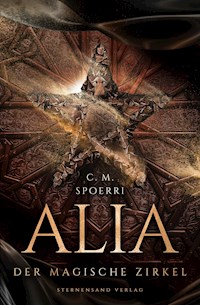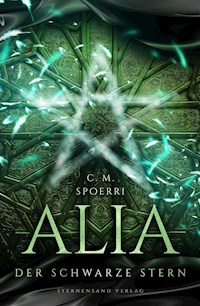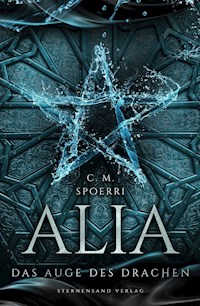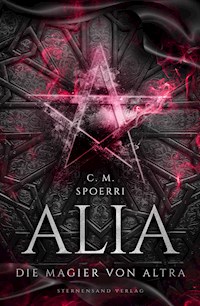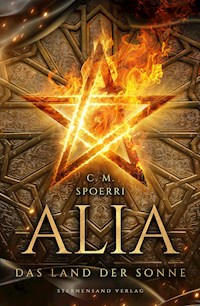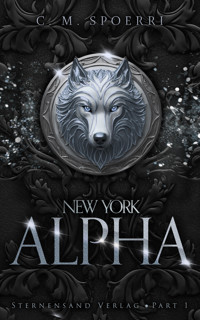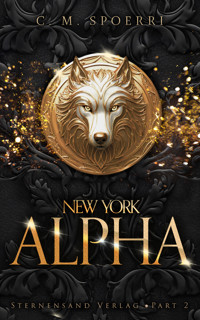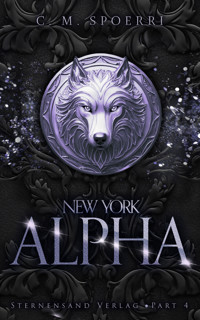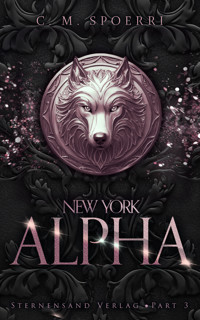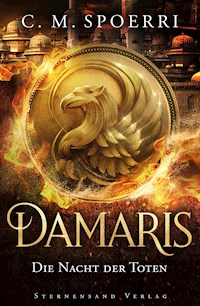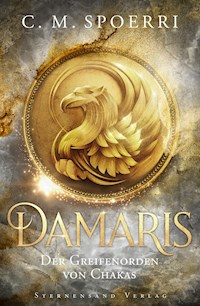Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Evan hat in seinem Leben schon viel Mist gebaut, doch seit fünf Jahren ist es ihm gelungen, nicht mehr auf die schiefe Bahn zu geraten. Er wohnt in New York, hat einen Job, eine Wohnung, keine nervigen Freunde ... alles wäre eigentlich so weit in Ordnung - abgesehen von der bescheuerten Weihnachtszeit, die gerade in vollem Gange ist. Und ausgerechnet jetzt mischt sich auch noch der schwule Nachbar in sein Leben ein. Dieser kann nicht mehr mit ansehen, wie Evan sich abkapselt, und plant deswegen über eine Single-Plattform ein Date für ihn. Sara, eine Londoner Studentin, wird für eine ganze Woche anreisen. Allerdings in der falschen Annahme, dass sie mit Evan gechattet hat und er sich auf ihren Besuch ebenso freut wie sie. Als wäre das nicht schon verheerend genug, ist Sara auch noch das komplette Gegenteil von ihm. Sie liebt Weihnachten und kommt einzig und allein nach New York, um hier den romantischsten Urlaub ihres Lebens zu verbringen - zusammen mit Evan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1 – Evan
Kapitel 2 – Sara
Kapitel 3 – Evan
Kapitel 4 – Sara
Kapitel 5 – Evan
Kapitel 6 – Sara
Kapitel 7 – Evan
Kapitel 8 – Sara
Kapitel 9 – Evan
Kapitel 10 – Sara
Kapitel 11 – Evan
Kapitel 12 – Sara
Stadtplan New York
Kapitel 13 – Evan
Kapitel 14 – Sara
Kapitel 15 – Evan
Kapitel 16 – Sara
Kapitel 17 – Evan
Kapitel 18 – Sara
Kapitel 19 – Evan
Kapitel 20 – Sara
Kapitel 21 – Evan
Kapitel 22 – Sara
Kapitel 23 – Evan
Kapitel 24 – Sara
Kapitel 25 – Evan
Kapitel 26 – Sara
Kapitel 27 – Evan
Kapitel 28 – Sara
Kapitel 29 – Evan
Kapitel 30 – Sara
Kapitel 31 – Evan
Epilog – Sara
Dank
Über die Autorin
C. M. SPOERRI
Unlike
Von Goldfischen und anderen
Weihnachtskeksen
Liebesroman
http://cmspoerri.ch
1. Auflage, Dezember 2016
© Sternensand-Verlag GmbH, Zürich 2016
Umschlaggestaltung: Rica Aitzetmüller | Cover&Books
Lektorat / Korrektorat: Martina König | Sternensand Verlag GmbH
Illustration: Mirjam H. Hüberli
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-28-9
ISBN (epub): 3-906829-28-9
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Gegensätze ziehen sich an.
Goldfische und Weihnachtskekse manchmal auch.
Kapitel 1 – Evan
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way …
Ich konnte es nicht mehr hören! Überall, wo ich hinging, erklang dieses dämliche Lied aus den Musikboxen – und wenn es keine Lautsprecher gab, die zur Lärmbelästigung auf den Straßen beitrugen, ertönte es aus den begeistert aufgerissenen Mündern der Weihnachtssänger, die gefühlt an jeder Ecke standen. Hatten die nichts Besseres zu tun?!
Und sowieso: Wer auch immer dieses Lied – oder jedes andere Weihnachtslied – erfunden hatte, gehörte gehängt, gevierteilt und ertränkt. In dieser Reihenfolge, bevor er verbrannt wurde!
Missmutig kickte ich einen Pappbecher vom schneebedeckten Bürgersteig und zog den Kopf zwischen die Schultern, während ich versuchte, dem lästigen Wind zu entkommen, der mir die Schneeflocken in die Nase trieb. Ich hasste Wind. Ich hasste Winter. Ich hasste diese beschissene Weihnachtszeit hier in New York!
Alle lächelten aufgesetzt, waren gespielt fröhlich, schleppten Einkaufstüten oder wahnwitzig hohe Tannen nach Hause und tranken heißen Kakao, in den sie Weihnachtskekse tunkten – alle außer mir.
Ich war auf dem Heimweg von ihr. Sie, die keinen Namen besaß, weil ich ihn bisher schlicht und ergreifend nicht hatte erfahren wollen. Sie, die mich von meinem beschissenen Leben, meiner Vergangenheit und der nicht vorhandenen Zukunft abzulenken verstand – wenigstens für ein, zwei Stunden. Denn länger dauerte unsere gemeinsame Zeit selten. Wenn wir nicht zugedröhnt waren, waren wir berauscht von unserer Zweisamkeit. Zugegeben, keine gute Kombination – weder in die eine noch in die andere Richtung.
Aber sie war der einzige Mensch, den ich kannte, der außer mir den Weihnachtsmist nicht mitmachte. Und gerade in dieser Jahreszeit stellte sie die beste Ablenkung dar.
Noch eine Woche, dann wäre der Scheiß endlich vorbei, die Geschenke im Müll, die Familienfeiern überstanden und New York endlich wieder so, wie ich es mochte: laut und dreckig.
Dann könnte ich in meinen Alltagstrott zurückfallen … zumindest so lange, bis meine Schwester sich bei mir meldete und versuchte, mich zu Plänen zu überreden, die mich von hier wegbrächten.
Aber ich wollte nicht weg. Das hier war mein Zuhause – auch wenn ich die Stadt in diesem Lichterketten-Glitzerkleid abgrundtief hasste.
Doch alles war besser, als in London bei meiner Schwester zu sein. Um sie herum gab es keine Entspannung – im Gegenteil. Sie hätte jedem Drill-Instructor die Tränen in die Augen getrieben und dafür gesorgt, dass er nach seiner Mutter schrie. So war sie nun mal, meine liebe große Schwester: verkappter Marine in einem Frauenkörper.
Kein Wunder, dass das weibliche Geschlecht bei ihr Schlange stand. Jedes Mal, wenn sie mich hier in New York besuchte, stellte sie mir eine andere Eroberung vor. Bei unserem letzten Aufeinandertreffen war es Erina gewesen. Oder Edana? Irgendetwas mit ›E‹, das konnte ich mir immerhin merken, da mein Name mit demselben Buchstaben begann: Evan. Aber die wenigsten nannten mich so. Wenn ich den Namen zu hören bekam, dann von meiner Schwester, bevor sie mir irgendeinen Gegenstand hinterherwarf. Blumenvasen, Kissen, Teller … alles war mir schon hinterher geflogen. Ein schlechter Scherz von Gott: Ihr flogen die Weiber hinterher, mir die Gegenstände – haha, wirklich witzig, da oben!
Ich warf einen verärgerten Blick zum wolkenverhangenen Himmel und verfluchte wieder einmal aufs Derbste den Engel (dessen Name mir gerade nicht einfiel), der die bescheuerte Idee gehabt hatte, dieser Maria vor zweitausend Jahren einen Sohn aufzuschwatzen. Hätte der Flattermann sich damals unterwegs verirrt oder wäre beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglüht, gäbe es diesen dämlichen Brauch jetzt nicht. Dann müssten sich nicht alle Leute Geschenke schenken, die man sich selbst niemals im Leben gekauft hätte.
Gut, wahrscheinlich war das etwas zu ketzerisch und auch zu pragmatisch gedacht. Ich war nicht ungläubig, nein. Aber ich durfte mich ja wohl über meinen biblischen Namen aufregen, der ausgerechnet ›Jahwe ist gnädig‹ bedeutete. Was auch immer meine Eltern an dem Tag meiner Taufe geraucht hatten (und sie hatten viel geraucht!), es musste ihnen das Gehirn komplett vernebelt haben.
Jetzt war ich dazu verdammt, mit einem Namen zu leben, den ich hasste, weil er weder zu mir noch zu meinem Leben passte. ›Gnade‹ … Scheiß auf Gnade! Es gab sie nicht. Sonst wäre ich nicht auf die schiefe Bahn geraten, nicht im Gefängnis gelandet … und Diana …
Himmelherrgott! Das war einer der Gründe, warum ich Weihnachten hasste: Ich dachte an Dinge, an die ich nicht denken wollte, sah Bilder, die ich nicht sehen wollte! Es war schon schlimm genug, dass ich mit einem Namen herumlaufen musste, den ich verabscheute – Glitzerketten und gebrannte Mandeln machten das absolut nicht besser!
Allen, die meinen Namen wissen wollten, sagte ich daher, ich hieße Sam. Auch ein biblischer Name, okay, aber auf Polnisch bedeutete Sam ›allein‹, und ich war gern allein. Also passte dieser Name eindeutig besser zu mir als etwas, das mit der Gnade Gottes in Zusammenhang stand.
Ich hatte kein Problem damit, dass es einen Gott geben sollte. Wenn es ihn gab, so rechnete ich ihm immerhin hoch an, dass er ein vollkommen gechillter Typ sein musste. Denn er hatte sich seit zweitausend Jahren nicht mehr hier unten blicken lassen und kümmerte sich um seinen eigenen Kram. Ich mochte Leute, die andere in Ruhe ließen. Aber mit seinem Bodenpersonal stand ich umso mehr auf Kriegsfuß.
Doch von meinem Namen mal abgesehen: Diese gekünstelten Bräuche gingen mir einfach auf den Geist. Sie leerten die Geldbörsen und waren sowieso nur dazu da, der Werbeindustrie in die Tasche zu spielen. Noch ehe man es sich versah, musste man sich für Dinge bedanken, die man das ganze Jahr über nicht gebraucht hatte, und an Weihnachtsessen teilnehmen, die die Bezeichnung ›Mästung‹ vollkommen verdient hätten.
DAS ersparte ich mir alles.
»Pass doch auf!«, herrschte ich einen Jungen an, der mir vor die Füße gelaufen war.
Er hob erschrocken den Kopf und geweitete blaue Augen blinzelten unter einer Wollmütze hervor, ehe er laut »Mom!« schrie und zu einer Frau mit dickem Wintermantel lief, die mir böse Blicke zuwarf.
»Junger Mann, hat man Ihnen keine Manieren beigebracht?«, tönte sie und legte eine Hand auf den Kopf des Jungen, der sich hinter ihr versteckte und mich ansah, als wäre ich ein Troll oder so.
Ich ging wortlos an ihr vorbei und überhörte das »Weißt du, das sind GENAU SOLCHE Leute, die an Weihnachten einsam sein werden« mit einem Zähneknirschen.
Na und? Dann gehörte ich eben zu diesen ›Leuten‹. Das war immer noch besser, als zu den Leuten zu gehören, die mit einem Haufen lärmender Kinder um sich herum krampfhaft versuchten, in Weihnachtsstimmung zu kommen. ›Leuchtende Kinderaugen‹, ›fröhliches Lachen‹, ›glückliche Gesichter‹ – pah! Das waren alles Gründe, die sich die Erwachsenen einredeten, um ihren Kaufwahn zu rechtfertigen.
Ich wich einer älteren Dame mit drei riesigen Einkaufstüten aus und erhaschte im Vorbeigehen einen Blick auf ihr Gesicht. Sie sah nicht glücklich oder zufrieden und schon gar nicht fröhlich aus. Nein, ihre Miene war verbissen, die Lippen zusammengekniffen, die Wangen ebenso gerötet wie die Augen. Auf ihrer Oberlippe konnte ich sogar einen Schweißfilm entdecken.
DAS war der wahre Weihnachtsgeist: Abgekämpfte alte Frauen, die versuchten, ihre Enkel zufriedenzustellen. Großmütter, die ihre letzten Cents zusammenkratzten und massenweise Geschenke für die ›lieben Kleinen‹ anschleppten. Nur um dann in zehn Jahren allein an Heiligabend vor einem kümmerlichen elektrischen Tannenbaum zu sitzen und zu ›den Leuten‹ zu gehören, weil ihre Enkel sich irgendwo in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen ließen.
Diesen Schritt übersprang ich liebend gern – vor allem blieb mir dadurch viel mehr Geld für die wirklich wichtigen Dinge im Leben: eine Flasche Alkohol, eine Tüte Gras und eine weitere (größere) Tüte von McDonald's.
Ja, ich hörte mich wie ein Junkie an, der Junkfood aß. Aber das war nun mal mein alljährlicher stiller Protest in der stillen Nacht: stoned vor dem Fernseher zu sitzen, mich zu betrinken und ungesundes Zeug in mich reinzustopfen, während ich mir irgendeinen Schrott aus der Glotze reinzog, den ich am nächsten Tag sowieso wieder vergessen hatte. Aber KEINE Weihnachtsfilme, das war meine heilige Regel.
Ich zuckte zusammen, als mein Handy in der Hosentasche vibrierte. Widerwillig schob ich eine Hand aus dem Jackenärmel, wo ich erfolglos versucht hatte, meine Finger aufzuwärmen (es war aber auch arschkalt!), und holte das Telefon hervor.
Auf dem Display leuchtete eine neue Nachricht:
Ruf mich an, wenn du das siehst!!!
Ich musste erst gar nicht auf den Namen des Absenders schauen, um zu wissen, von wem die Mitteilung kam, da es nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt gab, der mir Befehle mit drei Ausrufezeichen als SMS-Nachricht schickte: Carol, meine Schwester.
Wenn man von Gott und dem Teufel spricht …
Ohne darauf zu reagieren, steckte ich das Handy in die Tasche zurück und ging weiter. Das fehlte noch, dass ich ihr antwortete. Das würde nur ein stundenlanges Gespräch mit horrenden Kosten zur Folge haben, weil mich meine Schwester wieder zulaberte, wie toll es doch in England sei und wie schön es wäre, wenn ich bei ihr wohnen würde.
Einen Scheiß würde ich tun! Nein, ich würde nicht nach England ziehen! Obwohl es mir rein formal keine Probleme bereitet hätte, denn ich besaß genau wie Carol zwei Pässe: einen amerikanischen und einen britischen. Was wir unserer Mutter zu verdanken hatten – das Einzige, was uns von ihr geblieben war, nachdem sie sich das Hirn weggekokst hatte.
Carol lebte schon seit einigen Jahren in London und war der felsenfesten Überzeugung, dass mir ein Tapetenwechsel guttun würde – endlich raus aus den alten Mustern … zugegeben, bis zu einem gewissen Grad hatte sie schon recht damit, dass ich in Mustern festgefahren war. Aber ich brauchte nun mal Strukturen, um auf dem richtigen Pfad zu bleiben und nicht wieder in die Kleinkriminalität abzudriften (wow, meine Psychiater wären stolz auf so viel Einsicht!). Und sowieso … ob ich mir Carols Muster antun wollte, war eine ganz andere Frage.
Ich blickte über die Straße, die mir in den letzten fünf Jahren so vertraut geworden war. Hier war ich jetzt zu Hause. In einem Wohnblock in der Bronx. Hier wusste ich, dass mich alle in Ruhe ließen. Nun ja, von der alten Miss Walker im Erdgeschoss des Hochhauses mal abgesehen. Die schien den lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als mir aufzulauern – und just in dem Moment vor der Tür zu stehen, wenn ich den Müll rausbrachte, Zigaretten kaufen ging oder mich mit meinen Kumpels traf.
Da ich sehr wenige Kumpels hatte und Müll mich nicht sonderlich störte, waren es vor allem die Zigaretten, die mich aus der Wohnung trieben. Oder meine Anstellung als Pizzakurier, der ich seit fünf Jahren nachging.
Ich mochte meinen Job. Ich mochte es, unterwegs zu sein und meinem Voyeurismus zu frönen, wenn ich eine Zustellung machte und in fremde Wohnungen kam. Was ich in den fünf Jahren schon alles gesehen hatte, würde wahrscheinlich die gesamten Klatschblätter von Amerika ein Jahr lang füllen.
Die Arbeit in der Pizzeria brachte nicht viel Geld ein und, da ich nicht der gesprächigste Kurier war, auch nicht viel Trinkgeld. Aber es reichte, um die Monatsmiete zu bezahlen. Zudem war es das Einzige gewesen, was ich ohne richtige Ausbildung und mit einer Strafakte, die für mein Alter schon viel zu dick war, hatte bekommen können. Ich war froh, dass Antonio mich damals bei sich eingestellte, und hatte auch nicht vor, den alten Italiener zu enttäuschen.
Diese Zeiten lagen hinter mir.
So ein Mist, ich dachte schon wieder an die Frau, die ich erfolglos seit fast acht Jahren zu vergessen versuchte. Vergebens. Meine Vergangenheit holte mich immer wieder ein, wenn ich nicht aufpasste und aktiv etwas gegen die Bilder in meinem Kopf unternahm. Wie Alkohol zu trinken, zu kiffen, mit meiner namenlosen Geliebten Sex zu haben … oder eben zu arbeiten. Vor allem arbeiten. Denn mein Job lenkte mich am zuverlässigsten von all dem Scheiß ab, der hinter mir lag und mir diese elenden Schuldgefühle bereitete … diese Scham … diesen Schmerz …
Falsche Gedanken. Falsche Gefühle.
Ich musste mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren! Schließlich war ich lange genug bei Psychiatern ein und aus gegangen, um dies zu kapieren.
Also: Hier und jetzt stand ich vor der Fassade des alten Wohnblocks, in dem sich meine Wohnung befand.
Ich zögerte einen Moment. Drinnen erwarteten mich nichts als Melancholie, Bier – und Toni. Nein, so hieß nicht meine aufblasbare Sexpuppe, sondern mein Goldfisch. Da ich nicht wusste, ob es ein Weibchen oder ein Männchen war, hieß der Fisch einfach Toni, denn diesen Namen konnte man für beide Geschlechter verwenden. Genauer gesagt war es Toni Nummer 3. Seine Vorgänger hatten beide nicht lange in dem runden Glas durchgehalten.
Ich kramte in meiner Jackentasche nach dem Hausschlüssel. Gerade als ich ihn endlich in der Hand hatte, ging die Tür auf – und der viel zu weiblich aussehende Nachbar namens Hannes trat heraus. Er hatte deutsche Wurzeln, was auch seinen dämlichen Namen erklärte. Hannes Schmidt. Wie zum Teufel konnte man nur so heißen? Ich hätte mir sofort ein Pseudonym zugelegt. Allein das Buchstabieren jedes Mal, wenn jemand den Namen wissen wollte, wäre mir zu sehr auf die Eier gegangen. Denn Hannes bestand darauf, ›Hannes‹ genannt zu werden (dämlicher Typ!).
Seit ich meinen Hannes-Nachbarn einmal beim Rumknutschen mit einem Mann vor der Haustür erwischt hatte (ja, ›erwischt‹, denn er war so peinlich berührt gewesen, als hätte ich ihn bei einem Pornodreh überrascht), war meine Vermutung bestätigt, dass er schwul war. Das wiederum erklärte, warum er sich in meiner Gegenwart etwa so verhielt wie ein kleines Mädchen vor dem Eisverkäufer.
Auch jetzt sah er mich mit großen Augen an und seine Wangen röteten sich auf ungesunde Weise. Vielleicht war er aber auch einfach nur erkältet. Diese Chance ließ ich ihm.
»Evan, hi!«
Gut, es gab noch jemanden, der mich ›Evan‹ und nicht ›Sam‹ nannte: Hannes.
»Hi«, antwortete ich kurz angebunden und versuchte mich an ihm vorbeizudrücken, um ins Haus zu gelangen.
»Was läuft?« Hannes trat leider nicht zur Seite, sondern strich sich eine seiner blonden Haarsträhnen zurück und sah mich erwartungsvoll an. Er war ein bisschen kleiner als ich, was aber nichts Außergewöhnliches darstellte. Ich überragte die meisten Leute und hatte mich daran gewöhnt, dass sie zu mir aufsahen – obwohl es meiner Meinung nach hier oben nicht viel zu sehen gab.
Diese Meinung schien Hannes allerdings nicht mit mir zu teilen. Er sah mich so gespannt an, als hätte er mir die Quizfrage des Jahrhunderts gestellt. Ich konnte förmlich die Jeopardy-Musik in meinen Ohren hören.
Wollte er das jetzt wirklich durchziehen? Smalltalk mit mir führen? Er müsste mittlerweile wissen, dass ich quasi der Smalltalk-Grinch war. Schließlich wohnten wir seit fünf Jahren Tür an Tür.
»Läuft«, brummte ich. »Gehst du mal zur Seite?«
Hannes sah mich mit dunklen Kulleraugen an, die wahrscheinlich das Herz einer Tierschützerin an ein Robbenbaby erinnert hätten – bei mir verfehlte sein Blick allerdings diese Wirkung. Ich mochte keine Robben, die stanken zu sehr.
»Ich wollte dich fragen, ob du morgen Abend Lust hast, bei mir zu essen?«, sagte er in derart bedürftigem Tonfall, dass mir fast übel wurde.
»Essen?«, wiederholte ich. »Danke. Mein Kühlschrank ist voll.«
»Aber …«
»Was?!« Ich sah ihn entnervt an. »Ich habe keine Lust auf Gesellschaft, okay?«
Hannes zuckte kurz zusammen, aber dann streckte er den Rücken durch und straffte die Schultern. »Ich habe Gäste«, wagte er einen weiteren Versuch. »Und ich dachte, sie könnten sich vielleicht mit dir anfreunden.«
Ach du heilige Schweinekacke! Jemand musste sein Gehirn zu heiß gewaschen haben, anders war dieser plötzliche Kuschelmodus nicht zu erklären. Ich brauchte keine Freunde und ich hatte keine Lust auf seine Gäste! Was war bloß mit ihm los, dass er plötzlich glaubte, ich würde mich als Anstandsdame eignen?! Wenn er Leute zu sich einlud, war das ganz allein sein Problem. Nicht meins. Ich hatte genug eigene Probleme.
»Nein.« Ich sah ihn mit schmalen Augen an. »Und jetzt geh zur Seite.«
Auch wenn Hannes aufdringlicher als eine Stechmücke sein konnte, so schien er immerhin zu merken, dass er mich heute weder zu einem romantischen Dinner noch zu einem Kaffeekränzchen mit irgendwelchen Freaks überreden konnte. Ja, Freaks – denn niemand sonst verbrachte freiwillig Zeit mit diesem Spinner. Definitiv nicht.
Er trat zur Seite und gab den Weg frei.
»Schade …«, murmelte er noch, als ich an ihm vorbeiging.
Nein, hier war gar nichts schade! Ich wollte einfach nur in mein kleines Apartment, mich aufs Sofa setzen und mir bis spät in die Nacht irgendwelche Talkshows reinziehen, während ich meinen Biervorrat killte – oder Situps und Liegestütze machte, was wahrscheinlich die gesündere Alternative wäre.
Dass Hannes plötzlich solche Anwandlungen zeigte, musste eindeutig daran liegen, dass dieses beschissene Weihnachtsfest näher rückte.
Ach, ich HASSTE diese Weihnachtszeit!
Kapitel 2 – Sara
Ach, ich LIEBTE diese Weihnachtszeit!
Ich saß in meinem Londoner Einzimmerapartment vor dem Computer und surfte mit verträumtem Blick durch diverse Webseiten. Sah mir Bilder und Reiseberichte über New York an und kam mit jeder einzelnen Beschreibung mehr in Weihnachtsstimmung.
Kutschenfahrt im verschneiten Central Park, das berühmte Kaufhaus Macy's dekoriert zur zauberhaften Winterlandschaft, festlich geschmückte Straßen, an jeder Ecke Weihnachtssänger und … der Grund, warum ich es kaum noch erwarten konnte, dorthin zu reisen: der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center.
Ein mindestens fünfundsechzig Fuß hoher, meist aber noch viel höherer Baum, der mit einer fünf Meilen langen Lichterkette geschmückt wurde. Seit ich als kleines Mädchen in einer Zeitschrift den Baum zum ersten Mal gesehen hatte, war es mein größter Traum, ihn einmal in Realität zu bewundern.
In diesem Jahr sollte mein Traum endlich Wirklichkeit werden. Vor einer Woche war ich einundzwanzig geworden und hatte von meinem Dad einen Flug nach New York spendiert bekommen. Für mich und meine beste Freundin Mary. Ich war noch nie in Amerika gewesen, und jetzt gleich für eine ganze Woche! Wahnsinn! Christmas-Shopping mit Mary. Das würde großartig werden!
Zudem würde ich endlich Sam treffen. Den heißen, dunkelhaarigen Kerl, mit dem ich seit einigen Wochen chattete. Er hatte uns angeboten, während unseres Aufenthalts bei ihm zu wohnen. Nach kurzem Zögern hatte ich mir einen Ruck gegeben und sein Angebot angenommen. Es war endlich an der Zeit, dass ich meine Übervorsichtigkeit und den Kontrollwahn etwas ablegte. Leider musste ich Mary recht geben, die immer behauptete, dass in mir ein Kontrollmonster hause. Es hatte den größten Teil meines bisherigen Lebens bestimmt, sodass alles in geordneten Bahnen verlief. Kontrolliert und geplant. Doch jetzt wollte ich einmal etwas tun, das ganz und gar nicht zu mir passte. Meinen Horizont erweitern, Grenzen testen, über mich hinauswachsen. Mein Gott, ich war einundzwanzig Jahre alt und die Welt stand mir offen!
Umso mehr hatte es mich erstaunt, dass es dieses Mal Mary war, die die Alarmglocken geläutet hatte.
»Du kennst ihn doch noch gar nicht richtig. Ist das eine gute Idee? Was, wenn er ein Serienkiller ist? Wir können doch nicht bei einem wildfremden Menschen übernachten. Vielleicht hat er eine Frau und Kinder …«
… das wären normalerweise meine Worte gewesen.
Ich hatte sie bloß angestarrt und versucht, nicht auf die Stimme meines Kontrollmonsters zu hören, das mit dem Zeigefinger herumwedelte und Mary in allen Punkten recht gab. Nein, ich wollte das nicht hören – ich wollte ein Mal in meinem Leben unkontrolliert und spontan sein! Aber Mary hatte so lange auf mich eingeredet, bis ich ihr versichert hatte, dass ich Nachforschungen anstellen würde, ehe wir losflogen.
Deswegen riss ich mich jetzt von den New Yorker Weihnachtsbildern los und begann mit der Suche nach Sam in der Stadt, die niemals schlief. Ich hatte es so lange vor mir hergeschoben – aus Angst, dass ich beim kleinsten Zweifel auf das Kontrollmonster in mir hören und die Reise nicht antreten würde. Aber es war schon später Nachmittag und morgen Früh ging unser Flug, also musste ich jetzt endlich mein Versprechen Mary gegenüber einlösen und mit der Recherche beginnen.
Als Erstes fand ich über Google Earth Sams Wohnhaus. Es lag in einem heruntergekommenen Quartier in der Bronx – das für seine Kriminalität bekannt war, wie mir ein Blick auf die New Yorker Reiseseite verriet. Großartig. Vielleicht hatte Mary doch recht und Sam war ein Triebtäter … Aber ich würde das schönreden. Irgendwie ...
Mein Kontrollmonster holte tief Luft, um mir vor Augen zu führen, wie strohdumm ich mich verhielt, wie unvernünftig und leichtgläubig. In solchen Moralpredigten war es Weltklasse! Aber ich blendete die Stimme aus, indem ich an die Worte dachte, die Sam mir geschrieben hatte: ›Mach keine Listen, und schon gar keine Wunschlisten. Wünschen sollte man folgen und sie erleben. Es ist zu schade, sie bloß auf Papier festzuhalten.‹
Hach … er war ja so romantisch …
Ich warf einen verträumten Blick auf das Bild, das ich mir von der Dating-Plattform heruntergeladen und ausgedruckt hatte. Es stand nun eingerahmt neben meinem Laptop. Darauf war Sam zu sehen – wie er über die Straße ging. Irgendwo in New York.
Seine blauen Augen waren aufmerksam auf den Verkehr gerichtet, das dunkle, halblange Haar verwuschelt. Der Bartschatten stand ihm ebenso gut wie sein grauer Kapuzenpulli. Sein Kinn war markant, seine Nase gerade. Es war ein Schnappschuss aus seinem Leben, wie er mir im Chat berichtet hatte. Ein Freund hatte das Foto geschossen und seither verwendete er es als Profilbild. Er hatte mir noch weitere Bilder geschickt, aber dieses hier mochte ich am liebsten.
Nein, der Kerl war kein Triebtäter. Zudem passten so viele unserer Interessen zusammen, dass es beinahe unheimlich erschien. Aber Dating-Plattformen logen nicht, daran glaubte ich fest. Einige meiner Freundinnen hatten sich sogar in Chatforen verliebt und lebten glücklich mit ihrem Freund oder gar Ehemann zusammen.
Der Plattform zufolge war Sam ein fünfundzwanzigjähriger Student, der in New York als Schauspieler durchstarten wollte und im Moment als Pizzakurier sein Geld verdiente. Mit seinem Aussehen hätte er auch eine Modelkarriere anstreben können – er war wirklich heiß … zumindest in meinen Augen. Wahrscheinlich hätten ihn viele als zu schmächtig oder zu drahtig empfunden, aber ich stand nun mal auf solche Typen.
Aber … vielleicht war der Sam, mit dem ich gechattet hatte, gar nicht der Kerl da auf dem Bild … womöglich hatte er einen Bierbauch und war fünfzig Jahre alt. Vielleicht war das der Grund, warum er nicht mit mir hatte skypen wollen – und seine Entschuldigung, er hätte keine Webcam, bloß eine Ausrede?
Mist!
Mary hatte mich angsteckt und das Kontrollmonster in mir wieder lauter werden lassen, obwohl ich es einfach nur ein Mal in meinem Leben zum Schweigen bringen wollte!
Ich atmete tief durch und gab die Wohnadresse, die Sam mir angegeben hatte, in ein Online-Telefonbuch ein. Vielleicht fand ich seinen Namen ja und konnte mich vergewissern, dass er auch wirklich dort wohnte.
Leider musste ich wenige Sekunden später feststellen, dass kein Sam in der angegebenen Straße zu Hause war. Dafür gab es vier andere Einträge zu dieser Hausnummer.
Mist!
Der würde mir einiges zu erklären haben, wenn ich das nächste Mal mit ihm chattete – was in ein paar Minuten sein würde, denn morgen früh ging unser Flug. Ich hatte ihm noch meine Handynummer geben wollen. Nun war ich mir nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war …
Gut, wahrscheinlich war ich wirklich zu blauäugig an das Ganze herangegangen und hatte einfach so dringend etwas Spontanes, Unberechenbares machen wollen, dass ich auf die kleinsten Anzeichen nicht geachtet hatte.
Das Kontrollmonster in mir nickte bei diesem Gedankengang zustimmend und begann sich aufzuplustern, aber ich schubste es in die hinterste Ecke meines Gehirns.
Ruhig jetzt. Nachdenken.
Ich strich mir meine braunen Haare hinter die Ohren und fuhr mir dann mit beiden Händen über das Gesicht.
Okay. Vielleicht hatte Sam seine Telefonnummer einfach nicht ins Adressbuch eintragen lassen. Diese Chance ließ ich ihm. Nicht jeder wollte für jedermann im Internet auffindbar sein. Eine logische Erklärung, oder?
Das Kontrollmonster grummelte in seiner Ecke vor sich hin.
Ich ließ meinen Blick über den Bildschirm vor mir wandern, bis er an einer Telefonnummer hängen blieb, die zu einer Frau gehörte: Margaret Walker. Den Daten zufolge wohnte sie im selben Haus wie mein vermeintlicher Sam.
Sollte ich sie anrufen?
Vielleicht konnte sie mir sagen, ob es überhaupt einen Sam in ihrem Haus gab – und ob der annähernd so aussah wie auf dem Foto.
Erneut betrachtete ich sein Bild. Er sah so gut aus … und gleichzeitig irgendwie verletzlich. Eine Kombination, die in mir regelrechte Hormonschübe auslöste und mein angeborenes Helfersyndrom ins Unermessliche steigerte.
Hilf ihm, umarme ihn, küss ihn … gut, erwischt: Ich hatte mir heimlich bereits ausgemalt, dass wir uns beim Rockefeller Center vor dem Weihnachtsbaum zum ersten Mal küssen würden. So richtig kitschig, mit Weihnachtsmusik in den Ohren, während Schneeflocken auf uns herunterrieselten. Vielleicht würden wir eine Runde Eislaufen. Es gab dort schließlich eine Eisbahn. Okay, womöglich hatte ich zu viele Weihnachtsfilme geschaut. Aber in mir hausten eben nicht nur ein Kontrollmonster und ein Helfersyndrom, sondern auch eine hoffnungslose Romantikerin, die jetzt das Zepter an sich riss.
Ich war so was von in Weihnachtsstimmung. So was von!
Das Kontrollmonster schüttelte resigniert den Kopf. Die Romantikerin und ich straften es mit bösen Blicken.
Mary und ich mussten bei Sam übernachten, wenn wir die ganze Reise nicht abblasen wollten. Denn für einen Hotelaufenthalt und die geplanten Weihnachtseinkäufe reichte unser Geld nicht. Wir arbeiteten zwar nebenher in einem Café als Bedienung, aber viel brachte uns der Job nicht ein. Immerhin hatte diese Arbeit Mary und mich zusammengeführt, denn in der Uni wären wir uns niemals über den Weg gelaufen. Sie studierte Germanistik im fünften Semester, ich Sozialpsychologie. Mein Vater hatte mich immer in der Politik sehen wollen, aber mir widerstrebte es, in seine Fußstapfen zu treten. Daher war ich auch von zu Hause ausgezogen, als ich mein Studium begonnen hatte, denn die ewigen Diskussionen waren mit der Zeit unerträglich geworden.
Ich hätte auch meinen Dad fragen können, ob er uns ein Hotel in New York bezahlen würde. Da er ein dauerschlechtes Gewissen hatte, weil er sich als alleinerziehender Vater viel zu wenig um mich kümmerte, bezahlte er mir so gut wie alles.
Meine Mutter hatte uns wegen einem anderen Mann sitzen lassen, als ich noch recht gewesen klein war. Seither hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr – und wollte ihn auch nicht haben. Schon früh hatte ich auf eigenen Beinen stehen müssen und war stolz darauf, dass mir das so gut gelang. Gut, das Kontrollmonster war dadurch geboren worden, weil ich Angst hatte, Fehler zu machen. Aber selbständig zu sein war mir nun mal wichtig.
Nein … es war schon genug, dass mein Vater den Flug bezahlte. Ich wollte ihn nicht auch noch um das Geld für das Hotel bitten müssen. Und ich wollte bei Sam übernachten …
Seufzend warf ich einen Blick auf Sams Foto, ehe ich mein Handy in die Hand nahm und die Nummer von Miss Walker wählte.
Es dauerte etwas, bis die Verbindung hergestellt war. Dann klingelte es einige Sekunden lang und endlich hob jemand den Hörer ab.
»Hallo?«
Sofort hatte ich das Bild einer alten, vereinsamten Frau vor Augen. Ihre Stimme klang griesgrämig, als ob sie keine Lust auf ein Gespräch hätte.
Dennoch räusperte ich mich und suchte meine einschmeichelndste Stimmlage hervor. »Hallo, Miss Walker? Hier ist Sara Miles.«
»Wer?«
»Wir kennen uns nicht«, fuhr ich hastig fort. »Aber ich kenne jemanden, der bei Ihnen im selben Haus wohnt … denke ich. Ich rufe aus London an.«
Oh Gott. Ich hätte mir vielleicht zurechtlegen sollen, wie ich das Gespräch beginnen wollte. Aber jetzt war es sowieso zu spät. Ich spürte, wie meine Handflächen feucht wurden, weil ich zu schwitzen begann. Ich hasste es, keinen Plan zu haben. Keine Kontrolle …
»Und wen?«, fragte die alte Frau am anderen Ende.
Anscheinend war Miss Walker kein Mensch der großen Worte.
»Sam. Sam Wayne.«
Am anderen Ende herrschte einen Moment lang Stille.
»Ja, der wohnt hier«, sagte die Frau schließlich. »Warum? Hat er etwas ausgefressen?«
Ich schüttelte vehement den Kopf, obwohl sie das nicht sehen konnte. »Nein. Nein, hat er nicht. Ich wollte nur wissen, ob er tatsächlich da wohnt.«
»Soll ich ihm etwas ausrichten?« Sie klang gelangweilt. Offenbar würde ich sie nicht mehr lange in der Leitung halten können.
»Nein, schon gut«, erwiderte ich hastig. »Ich wollte nur wissen, ob er … hat er dunkle Haare und blaue Augen?«
Gut, ich hörte mich wie eine Psychopathin an und ich hätte es Miss Walker nicht übel genommen, wenn sie jetzt kommentarlos auflegte. Aber offenbar schien sie Psychopathen gewohnt zu sein, die nach ihren Hausbewohnern fragten.
»Ja, hat er«, antwortete sie. »Ist das dann alles?«
»Ähm …«
»Spucken Sie's aus.« Jetzt klang sie wie eine Marktschreierin, die zu viel Whiskey getrunken hatte.
»Ist er … ich meine … er ist … sauber, oder? Also nicht im Sinne von ordentlich, sondern … ähm …«
Mist! Ich hatte keine Ahnung, wie ich es formulieren sollte, ohne dass es noch komischer klang, als es das ohnehin schon tat.
»Sie wollen wissen, ob er ein Verbrecher ist?« Ich konnte in Miss Walkers Stimme eine Spur von Neugier erkennen.
»Nun … ja … ich …«
»In den letzten fünf Jahren hat er sich benommen«, war die ernüchternde Antwort. »Wenn Sie dann mit Ihrem Verhör fertig sind, lege ich auf. Ich habe noch zu tun.«
»Ist gut, danke für die Auskunft.«
Ehe ich den Satz beendet hatte, hatte Miss Walker aufgelegt.
›In den letzten fünf Jahren hat er sich benommen.‹
Was bitte schön hieß das? Dass er davor ein Gewaltverbrecher gewesen war? Dass er auf Bewährung war?
Mann, ich hätte mich nicht so leicht abwimmeln lassen dürfen. Aber mir fehlte der Mut, nochmals anzurufen.
Also sah ich erneut auf das Bild auf meinem Schreibtisch und runzelte die Stirn.
Sam hatte in unseren Chats immer sehr freundlich geklungen. Vielleicht manchmal etwas zu gestelzt … aber das sprach ja eher dafür, dass er eben KEIN Verbrecher war. Oder?
Ich hatte keine Ahnung, wie sich Verbrecher ausdrückten …
Ach, er würde uns schon nicht töten. Hoffte ich.
Das Kontrollmonster in mir schlug den Kopf gegen eine imaginäre Wand.
Ich wählte die Nummer meiner Freundin, um ihr das Ergebnis meiner Recherche mitzuteilen. Es dauerte eine Weile, bis sie ranging.
»Sara!«
Ich konnte ihrer Stimme direkt anhören, dass etwas nicht stimmte.
»Mary, was ist los?«, fragte ich, ohne sie zu begrüßen.
»Ich … ach, es tut mir so leid.«
Oje, das klang nicht gut. Ganz und gar nicht.
»Was ist los?«, wiederholte ich meine Frage.
»Ich bin … Mann … ich bin so blöd!«, rief sie in den Hörer.
Ich schüttelte verständnislos den Kopf. »Was ist denn?«
»Du weißt doch, dass es bei mir um die Ecke diesen neuen Sushi-Laden gibt«, holte Mary aus. Ich nickte, aber sie fuhr bereits fort: »Nun, da war ich gestern Abend. Mit Alex.«
Alex war ihre neue Bekanntschaft und sie erhoffte sich, dass bald mehr daraus entstehen würde.
»Und?« Ich konnte immer noch nicht nachvollziehen, warum Sushi und Alex sie blöd machen sollten.
»Ich war da gestern essen. Ein Date. Und … ach, ich sag's einfach, wie es ist: Ich habe mir eine Fischvergiftung zugezogen.«
Ich riss die Augen auf. »Oh …«
»Ja … es tut mir so leid. Der Arzt meinte, es wird mir in ein paar Tagen besser gehen. Aber ich werde morgen nicht mitfliegen können … ich sitze eigentlich nur auf dem Klo – wenn ich nicht gerade kotze.«
»Oh …«
Ich sah meinen ganzen Traum vor meinem inneren Auge platzen. Den Traum, in New York zu sein – mit Mary zusammen. Mit ihr diese Stadt zu entdecken, einzukaufen, Spaß zu haben …
»Geh trotzdem«, drängte Mary, ehe ich ihr sagen konnte, dass ich das Ganze abblasen würde. »Du hast dich so darauf gefreut.«
»Nein, wir wollten das zusammen machen«, antwortete ich energisch. »Ich werde das nicht ohne dich tun. Zumal ich nicht allein bei einem wildfremden Kerl übernachten werde.«
Jetzt hörte ich ein leises Schnauben am anderen Ende, das amüsiert klang. »Aber du sagtest doch selbst, dass Sam nicht irgendein wildfremder Kerl ist. Du kennst ihn seit zwei Monaten, chattest mehrmals pro Woche mit ihm. Ich war da vielleicht etwas zu skeptisch, aber er scheint doch ein netter Typ zu sein.«
Ja, in den letzten fünf Jahren hat er sich benommen …
»Ich habe Nachforschungen über ihn angestellt«, begann ich.
»Und?«
»Er scheint wirklich dort zu wohnen – und er ist auch kein Verbrecher … seiner Nachbarin zufolge.«
»Du hast mit seiner Nachbarin telefoniert?« Ich hörte förmlich, wie Marys Augenbrauen nach oben schnellten.
»Nun ja, du hast doch gesagt, dass ich nachforschen soll«, verteidigte ich mich.
»Ja, aber … ach, egal. Also er ist kein Gewaltverbrecher, Serienmörder, Triebtäter oder Dealer. Das heißt, du kannst guten Gewissens dorthin reisen. Melde dich bitte regelmäßig bei mir, ja? Vielleicht kannst du auch mal mit mir skypen. Dann sehe ich, dass alles in Ordnung ist, und muss mir keine Sorgen machen.«
Ich atmete tief durch. Die Vorstellung, ohne Mary nach New York zu fliegen, behagte mir immer noch nicht. Es wäre nicht das Gleiche …
Aber der Flug war bereits gebucht. Es wäre schade, ihn einfach in der Weihnachtsluft verpuffen zu lassen …
»Sara?«, fragte meine Freundin, da ich nichts mehr gesagt hatte.
Ich seufzte traurig mein Handy an. »Ja, bin noch da … ich … ach Mensch, ich wäre so gern mit dir zusammen dorthin geflogen.«
»Ich weiß … es tut mir echt total leid. Aber mir geht es wirklich mies. Außerdem habe ich Fieber und fühle mich, als sei ein Schnellzug über mich drübergefahren.« Meine Freundin klang ehrlich zerknirscht.
Ich wollte ihr kein noch schlechteres Gewissen machen …
»Gut«, sagte ich mit fester Stimme. »Ich fliege. Und ich werde alles für dich auf Videos und Fotos festhalten. Dann schauen wir uns das zusammen an, wenn ich zurück bin, abgemacht?«
»Abgemacht! Ich freue mich, dass du trotzdem dorthin fliegst. Ich hätte sonst ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt …«
»Ich weiß.« Ich lächelte. »Aber mach dir keine Sorgen. Ich melde mich, sobald ich am Flughafen bin.«
»Schlaf dann gut.« Ich hörte, wie meine Freundin ebenfalls lächelte. »Und träum schön von New York … und Sam.«
»Werde ich, danke.«
Ich legte auf. Bevor ich von irgendetwas träumen würde, würde ich mir erst noch Sam vorknöpfen. Na warte, der würde was zu hören kriegen!
Kapitel 3 – Evan
Na warte, der würde was zu hören kriegen!
Ich starrte meinen Nachbarn entgeistert an und wusste nicht genau, wie ich auf seine Offenbarung reagieren sollte.
»Du hast … WAS?«, rief ich und fuhr mir mit beiden Händen durch die Haare, um meine Finger darin zu verkrallen. »Spinnst du?!«
Hannes warf mir solch schuldige Blicke zu, als hätte er mir soeben gestanden, dass er meinen Goldfisch gegrillt hatte. Aber auch jetzt hatten seine großen, braunen Kulleraugen eher eine gegenteilige Wirkung auf mich.
Ich wollte dieses Robbenbaby ertränken!
»Ach komm schon, so schlimm ist es doch nicht«, wagte er den schwachen Versuch, sich herauszureden.
»So schlimm ist es doch nicht?!« Ich war im Moment viel zu aufgebracht, um mir eigene Worte zum Schreien auszudenken. »So schlimm ist es doch nicht?!«
Ja, die Worte ließen sich hervorragend brüllen!
»Evan, jetzt hör doch zu … es war nur gut gemeint …«
»Gut gemeint?!« Ich schnaubte wütend. »Wenn ich mir eine Frau suchen will, tue ich das auf MEINE Art, kapiert?! Nicht auf DEINE! Du hast kein Recht, dich in mein Privatleben einzumischen! Für wen hältst du dich eigentlich?!«
Hannes wurde unter meinem flammenden Blick noch ein Stück kleiner. »Ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie du immer zur Weihnachtszeit in diesen Trott verfällst. Du solltest mal sehen, was für Blicke du den Menschen zuwirfst. Das ist nicht auszuhalten.«
»Ach?!« Etwas anderes kam mir gerade nicht in den Sinn. Ich war viel zu aufgebracht und vor allem viel zu wütend auf meinen Nachbarn.
Was glaubte er eigentlich, wer er war? Ein Heiratsvermittler?
Wenn er meine Blicke nicht aushalten konnte, sollte er wegsehen! So einfach war das! Ich brauchte kein Date – schon gar nicht in der Weihnachtszeit!
»Schau zu, wie du da rauskommst!«, blaffte ich ihn an. »Ich werde dieser Londoner Göre bestimmt nicht zur Verfügung stehen!«
Hannes wirkte jetzt so verloren wie ein Robbenbaby auf einer einsamen Eisscholle. Aber ich hätte eher die Eisscholle in tausend Stücke gehackt, als ihm da runterzuhelfen!
»Aber … Evan. Du kannst die Frau doch nicht enttäuschen. Sie kommt extra deinetwegen aus London hierher. Eine Woche lang.«
»Eine Woche lang?! Spinnst du eigentlich? Was hast du ihr erzählt? Dass wir eine Woche lang Sex haben werden?«
Gut, das wäre eine annehmbare Alternative zu dem Plan, den Hannes sich wahrscheinlich ausgedacht hatte und der mir bestimmt – ganz bestimmt! – NICHT gefallen würde.
Pass auf, Robbenbaby, was du gleich sagst …
»Nein, ich dachte, du könntest sie etwas in New York herumführen.«
Et voilà, da war er: Hannes' dämlicher Plan!
»Sehe ich aus wie ein Reiseleiter?!«, bellte ich. »Ich habe einen Job! Ich kann nicht einfach Urlaub nehmen!«
»Du … ich …«
Hannes begann herumzustottern und ich ahnte bereits Böses.
»Was?!« Ich ging einen bedrohlichen Schritt auf ihn zu, was ihn vor mir zurückweichen ließ.
»Du hast frei«, nuschelte Hannes, ohne mir dabei in die Augen sehen zu können.
Ich starrte ihn an, als hätte er mir gesagt, dass er mich heiraten wolle.
»Wie meinst du das?« Meine Stimme war gefährlich leise geworden. Ich wollte meine Stimmbänder etwas schonen, da ich sicher war, dass da noch mehr kam – und dafür wollte ich ihn gebührend laut anschreien können, ohne dass ich direkt heiser wurde.
»Ich habe es mit deinem Chef Antonio geklärt«, hauchte Hannes.
Er war nun so weit zurückgewichen, dass er fast bei der Tür angekommen war, die zu seinem eigenen Apartment führte. Es war nur zu seinem Besten, denn die Tür stellte seine einzige Rettung dar, ehe ich ihm den Kopf von den Schultern reißen würde.
»Du hast …« Mir blieben die Worte im Hals stecken und ich atmete tief ein und aus. »Du hast …« Auch beim zweiten Mal verschluckte mein Zorn die Worte, also ließ ich es und begann direkt wieder zu brüllen. »Welches Rentier hat dir denn bitte schön ins Hirn geschissen?!«
Hannes hob beide Hände in die Luft, um sie wie einen Schild zwischen mich und sich zu halten. »Beruhig dich, Mann!«, rief er. »Du hattest noch Urlaubstage übrig und dein Chef hat dir diesen Gefallen sehr gern getan. Du hast bis Weihnachten bezahlten Urlaub und damit ab morgen frei.«
Ich wusste nicht, ob ich noch weiter brüllen oder ihm einfach eine reinhauen sollte. Vielleicht eine Kombination davon: ihm brüllend eine reinhauen!
Mein Job war neben meiner namenlosen Geliebten das Einzige, was mich in dieser beschissenen Weihnachtszeit über Wasser hielt. Dass Hannes mir ausgerechnet das genommen hatte, war einfach … es war … ich fand keine Worte dafür.
Mein Chef Antonio hatte mir natürlich immer wieder ans Herz gelegt, ich solle endlich mal Urlaub machen. Ich hatte in den fünf Jahren, die ich bei ihm arbeitete, noch nie frei genommen, war auch noch nie krank gewesen. Mein Job machte mir Spaß und er lenkte mich davon ab, dumme Sachen zu tun. Sachen, die mich dahin zurückgebracht hätten, wo ich vor fünf Jahren gewesen war.
Eine Woche ohne Arbeit glich der Hölle!
»Geh mir aus den Augen!«, fauchte ich.