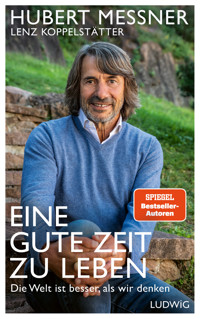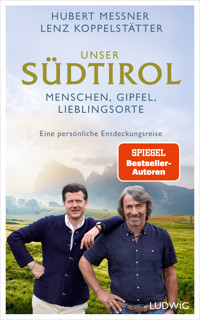
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Faszination Südtirol
Ob hoher Berggipfel, versteckte Dorfgasse oder Bauernwirtshausstube: Die gebürtigen Südtiroler Hubert Messner und Lenz Koppelstätter wandeln abseits der ausgetretenen Touristenpfade und geben Einblick in versteckte Paradiese. Sie berichten von atemberaubenden Geschichten, die sich hier und dort abgespielt haben, sie erzählen auch von spannenden Ereignissen, die sie selbst erlebten. Sie treffen typische Südtiroler Charaktere mit Rückgrat und tauchen ein in eine bezaubernde Welt aus Natur, Kultur und Kulinarik. Begleitet werden die Geschichten von fantastischen Aufnahmen des Südtiroler Fotografen Peter Unterthurner.
Ein bereicherndes Lesevergnügen für alle, die Südtirol neu entdecken wollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
HUBERT MESSNER
LENZ KOPPELSTÄTTER
Unser Südtirol
Menschen, Gipfel,Lieblingsorte
Eine persönliche Entdeckungsreise
Mit Fotografien von Peter Unterthurner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Caroline Kaum
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München
unter Verwendung der Motive von Peter Unterthurner; Getty Images (vorne) und Peter Unterthurner (hinten)
Layout: Eisele Grafik-Design, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-32301-1V001
www.Ludwig-Verlag.de
Zu den Autoren
Hubert Messner, geboren 1953, ist in einem Südtiroler Bergdorf im Villnößtal aufgewachsen. Er hat in Innsbruck Medizin studiert, in Modena Kinderheilkunde und wurde in Mailand, Graz, Toronto und London zum Neonatologen ausgebildet, bevor er in Bozen die Neonatologie-Abteilung übernahm und diese als Chefarzt zu einer Station mit internationalem Renommee ausbaute. Seinen Bruder, die Bergsteigerlegende Reinhold Messner, begleitete er als Expeditionsarzt mehrere Male in den Himalaja und in Eiswüsten. Seit 2018 engagiert er sich für soziale Projekte, unter anderem für Essen auf Rädern und freiwillige Arbeitseinsätze in den Sommermonaten auf Bergbauernhöfen in steilen Lagen. 2023 wurde er in den Südtiroler Landtag gewählt und zum Landesrat für Gesundheit ernannt. Messner lebt heute in Girlan bei Bozen, ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne.
Lenz Koppelstätter, geboren 1982, ist in Tramin an der Südtiroler Weinstraße aufgewachsen. Er studierte Politik und Sozialwissenschaften in Bologna und Berlin und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Über zehn Jahre war er für Geo Saison und Geo Special in der ganzen Welt unterwegs, nach wie vor schreibt er – vor allem Reise- und Genussgeschichten – für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sowie Salon und interviewt bzw. porträtiert zahlreiche Persönlichkeiten unserer Zeit. Viele seiner Bücher, insbesondere seine Kriminalromane, sind Spiegel-Bestseller. Nach Jahren in Bologna, München, Berlin und Istanbul lebt Koppelstätter mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern wieder im Südtiroler Unterland.
Peter Unterthurner, geboren 1986, ist in Lana, im Südtiroler Burggrafenamt, aufgewachsen. Er studierte Psychologie in Innsbruck und war in Berlin und Hamburg jahrelang als Bildredakteur für Zeit und Geo tätig. Nach seiner Rückkehr in die Heimat – er lebt nun mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Töchtern in Bozen – gründete Unterthurner die Agentur für visuelle Kommunikation UPstudio und arbeitet zudem als freier Fotokünstler.
Blick vom Ritten aus auf den Schlern. Schon Sigmund Freud spazierte bei seiner Sommerfrische diesen Weg entlang – und erfreute sich an der unerschöpflichen Lust zum Nichtstun. („Auf Sigmund Freuds Spazierweg“)
Immer wieder zog es Gustav Mahler wie magisch in die Dolomiten. Seiner Frau Alma, »Almschilitzili«, schwärmte er von den Drei Zinnen vor. („Beim Komponierhäusl“)
Inhalt
Am Ortler
In der Trostburg
In Bad Dreikirchen
Am Brenner
In Merans bester Eisdiele
Im Keller des Gewürztraminers
In der Kunstgärtnerei
Beim Komponierhäusl
Am Pillhof
Beim weißen Gold
Auf Sigmund Freuds Spazierweg
Bei den Stoanernen Mandln
Beim Totenkirchlein
Im kulinarischen Himmel
Im Montiggler Wald
Am Schneeberg
Auf dem Sass Rigais
Im stillen Tal
Am Kalterer See
Bei den vergessenen Waldbädern
In Prettau
Rund um den Little Canyon
Bei den Weltkriegsstellungen
Bei Wind und Wein
Im Künstlerdorf
Auf Ötzis Spuren
Epilog
Quellen und Literatur
Hubert und Lenz beim Klettern am Sass Rigais, dem Hausberg des Villnößtals. Die Messner-Brüder kletterten an diesen Felsen schon als sechsjährige Buben herum – Mutprobe! („Auf dem Sass Rigais“)
Hoch über der Schlucht des Eisacktals thront die Trostburg. Eines Tages machte Lenz sich auf, um nachzuschauen, ob denn dadrin noch jemand wohnt. („In der Trostburg“)
Schon als Schüler hing Hubert mit seinen Freunden am liebsten in der Meraner Traditionseisdiele »Costantin« ab. Auch heute schaut er noch gerne vorbei – genießt eine Kugel Stracciatella und eine Kugel Nuss. („In Merans bester Eisdiele“)
Im Mittelalter, so sagen die Leute aus dem Sarntal, hätten sich am Gipfel der Stoanernen Mandln bei Vollmond als Hexen verschriene Frauen zu ekstatischen Tänzen zusammengefunden. Kräuterweiber, Außenseiterinnen. („Bei den Stoanernen Mandln“)
Der Maler und Sänger Gotthard Bonell lebt in Truden – Südtirols Künstlerdorf. Es zog ihn nach Venedig, Mailand, Wien. Nun ist er wieder hier, lädt am liebsten Freunde ein, spricht mit ihnen über den Tod, das Leben, das Schöne, den Schrecken. („Im Künstlerdorf“)
Im »Atelier Moessmer Norbert Niederkofler« setzt der namensgebende Drei-Sterne-Koch alles auf Zutaten, die ihm die Natur und die Bauern der Südtiroler Berge bieten. »Ja, ich beschränke mich«, sagt er – und entdeckt so Altes neu. („Im kulinarischen Himmel“)
Hilde Van den Dries hatte einen Tumor im Hirn. Falls sie die OP überlebt, versprach sie sich, zieht sie in den Vinschgau, wird Winzerin. Und ja, zum Glück, sie überlebte … („Bei Wind und Wein“)
Als Gastgeberin bekommt man die Gäste, die man verdient! Das sagt Kathrin Oberhofer – und zeigt in ihrem »Pillhof«, was die zeitgenössische Südtiroler Gastfreundschaft ausmacht. („Am Pillhof“)
Die Blätterbachschlucht, der kleine, große Canyon Südtirols, ist UNESCO-Weltnaturerbe. Im Gestein lassen sich Schichten zwischen Erdaltertum und Erdmittelalter erkennen – außerdem treiben sich hier gerne ESA-Astronauten rum. („Rund um den Little Canyon“)
Es gibt keinen Sommer im Leben der Theresia Harm, zweifache Urgroßmutter, vierzehnfache Großmutter, den sie nicht auf der Tolder Alm verbracht hat. Wenn die ganze Familie in der Stube beisammen sitzt …
... gibt es natürlich Kaiserschmarrn. („Im stillen Tal“)
Hubert
Am Ortler
Wie er da ruht, der König! Der höchste. Er strahlt Behutsamkeit aus. Und Gefahr. Beides gleichzeitig – irrigerweise.
»Hättest du nicht Lust, mit mir eine Tour auf den Ortler zu machen?«, hatte mein Bruder Reinhold zu Beginn des Sommers vorgeschlagen.
Gemeinsam mit unserem sehr guten Freund, Wolfgang Thomaseth, ebenso ein Abenteurer wie wir: Bergsteiger, Eiswüstendurchquerer. Auf den Ortler? Warum schon wieder der Ortler?
Ich war schon ein paar Mal am Gipfel gewesen, auf 3953 Metern über dem Meer. Mit dem Blick über Hunderte andere Berge hinweg. Bislang war ich immer über die Normalroute hochgegangen – von der Julius-Payer-Hütte aus oder von der Hintergrathütte. Irgendwann mit Mitte zwanzig wohl zum ersten Mal. Über das Eis der steilen Nordwand bin ich bis dahin noch nie geklettert. Der Respekt davor war immer zu groß, auch die Angst. Ganz im Allgemeinen war dieser ferne, imposante Ortler für uns Buben im Villnößtal inmitten der Dolomiten schon von klein auf ein scheinbar unerreichbarer Sehnsuchtsort gewesen. Standen wir auf unseren schönen, jedoch eisfreien Gipfeln, dem Sass Rigais, den Fermedatürmen, dem Peitlerkofel, und schauten gen Westen, sahen wir die Riesen in der Ferne. Sahen ihn! Den letzten Berg, den wir am Horizont nach Westen blickend grad noch erspähen konnten. Das ewige Eis, von dem wir damals noch dachten, dass es tatsächlich nie schmelzen würde. Genau so stellten wir uns auch den Himalaja vor.
Lasst uns zu Ehren des Erstbesteigers, so hatte Reinhold präzisiert, dem Pseirer Josele, in diesem Sommer, dem Jubiläumssommer, genau zweihundert Jahre später, die gleiche, beinahe vergessene Route noch einmal gehen. Wir nickten, schlugen ein und ich freute mich auf ein neues, gemeinsames Abenteuer. Ein gewisser Josef Pichler aus dem Passeiertal, seines Zeichens Bergführer und Gamsjäger im Dienste der nahen Churburg, von allen nur liebevoll das Pseirer Josele genannt, stand als Erster da oben. Gemeinsam mit zwei von Erzherzog Johann auserwählten Begleitern aus dem Zillertal, die zuvor mehrere Male am Vorhaben gescheitert waren.
Am 27. September 1804 war es geschafft, so ist es dokumentiert. Zwischen zehn und elf Uhr vormittags. Bei heftigem Wind und großer Kälte. Die drei waren in Trafoi losgegangen, über die Hinteren Wandlen emporgeklettert, all das gab Pichler nach der Rückkehr ins Tal um acht Uhr abends bekannt. Schnellstens wurde dem Erzherzog in Wien Bericht erstattet, über »die Vollendung des großen Werks« am König Ortler. Ohne Seil und Eispickel. In einfachen Lederschuhen. Mit Nägeln untendran. Eine ganz hervorragende alpinistische Leistung – für die damalige Zeit.
Aufgeschrieben hatte der Pionier seine Route, da er Analphabet war, allerdings nie. Lange nach ihm schaffte kein anderer den Aufstieg – zu schwierig, beinahe unmöglich, wie hatte der das bloß gemacht? Und der schlaue Bursche machte sein Geschäft daraus. Bald sprach sich in den europäischen Bergsteigerkreisen herum, dass es da nur einen gab, ihn nämlich, den Josef Pichler, gebürtig aus dem Passeiertal, der die Leute zur hohen, schönen Ortlerspitze bringen könnte. Schnell gab es Anfragen, aus der Bergsteiger-Hautevolee Münchens und Londons, von betuchten Abenteuersuchenden, die er zum Gipfel führen sollte. Josef Pichler brachte einige davon hoch – und verdiente sich ein schönes Geld damit.
Wir entschieden uns für einen Tag Mitte Juli, übernachteten auf der Berglhütte über dem Trafoier Tal und brachen um vier Uhr morgens auf. In völliger Dunkelheit. Mit hell strahlenden Stirnlampen, Polyethylen-Seilen, wärmenden Hardshell-Jacken, federleichten Steigeisen. Mit dem besten Material, das man sich als moderner Bergsteiger nur vorstellen kann. Dazu je ein leichter Rucksack samt Biwak-Ausrüstung. Für alle Fälle.
Als Verpflegung? Schüttelbrot, Speck, Wasser, jeder einen Apfel. Mehr brauchten wir nicht, mehr brauchten wir nie. Zuerst wanderten wir nur leicht ansteigend über das Steingeröll, das der Berg über die Jahrtausende gen Tal geschoben hatte. Je näher wir den Hinteren Wandlen auf der Westseite des Ortlers kamen, desto höher und steiler erschien uns die Strecke. Da war der wirklich hinauf? Ehe wir’s uns versahen, steckten wir in einer vertikalen Fels- und Eiswand. Am frühen Vormittag, über uns ein gewaltiger Eisüberhang, hörten wir ein leises Rattern, immer lauter wurde das. Irgendwann sahen wir einen Hubschrauber über uns kreisen. Journalisten! Sie wollten die Jubiläumsbegehung filmen.
Wir blendeten das Rattern aus. Auch die schwarzen Wolken, die sich im Süden zusammenbrauten, über die dortigen Gipfel quollen. Der Hubschrauber drehte wieder ab. Nebel kroch plötzlich über die Wand, wurde immer dichter, die Suche nach der idealen Linie damit schwieriger. Der Eisüberhang nach wie vor drohend über uns. Das Gefühl der Ausgesetztheit war greifbar. Wir mussten schnell weg. Höher hinauf. So schnell ging das aber nicht.
Dem Wetter und den Gefahren des Ortlers ausgesetzt! Ich fragte mich, wie viele Menschen an diesen Flanken, in diesen Felsen, zwischen diesen Eisspalten schon umgekommen waren. Unzählige. Die meisten davon während des Ersten Weltkriegs, als sich hier österreichisch-ungarische und italienische Soldaten verschanzten.
Unsere Kletterei stellte sich schnell als noch herausfordernder dar, als wir es uns eh schon gedacht hatten. Es ging nur langsam voran, aufkommender Wind und undurchsichtiger Nebel machten alles noch schwieriger. Niemals, das wurde uns schnell bewusst, konnte das Josele vor zweihundert Jahren solche schwierigen Passagen geklettert sein. Und dann waren da noch diese verdammten Séracs in meinem Hinterkopf, die am oberen Ende der Wand über uns hingen. Eisgeschwülste, groß wie Bauernhäuser, die, je später es wurde, je wärmer es wurde, drohten abzubrechen. Gen Tal zu stürzen. Und uns mitreißen würden. Da hast du keine Chance, zu überleben. Ein mulmiges Gefühl kroch in mir hoch.
Nach Stunden, endlich und doch viel später, als wir berechnet hatten, erreichten wir den Ferner, das flache Eis über den steilen Wänden. Der Wind blies hier noch stärker, der Nebel wurde noch dichter. Orientierungslosigkeit.
Da kannst du ein noch so guter und erfahrener Bergsteiger sein, wenn der Nebel dich umhüllt, kennst du dich nicht mehr aus, selbst dort nicht, wo du schon oftmals gewesen bist. Du weißt nicht mehr, wo oben und wo unten, wo Norden und wo Süden ist. Wir setzten uns in den Schnee, warteten, konnten nichts tun, die Stunden vergingen. Später, viel später, erfuhren wir, dass der Hubschrauberpilot berichtet hatte, unsere Spur sei mitten in der Wand im Nichts verloren gegangen. Dass er sie noch gesehen habe, dann nicht mehr, dass er dann selbst dem Nebel entkommen musste. Dass wir spurlos verschwunden seien. Wir erfuhren, dass sie in den Dörfern unten, in Trafoi und in Sulden, vom Schlimmsten ausgingen. Die Messner-Brüder! Und der Thomaseth! Im Sturm verloren gegangen, wohl abgestürzt. Tot. Oder schwer verletzt. Besser tot, dann müssen sie nicht leiden. Alleine da oben. Unrettbar.
Wir begannen, zu unserem Schutz vor dem Wind und der einsetzenden Kälte eine Schneehöhle zu graben, da tat sich plötzlich doch noch, wie aus dem Nichts, ein blaues Loch zwischen den Nebelfetzen auf. Der Himmel! Und da, ja, ein Rattern. Es wurde lauter. Der Hubschrauber! Er landete kurz auf dem Eis, nur ein paar Sekunden, wir sprangen hinein. Gerettet.
Nein, sagten wir uns erneut, als wir erschöpft und erleichtert und glücklich im Hubschrauber saßen, der die Wand aus Eis und Fels hinuntereilte, die wir Stunden zuvor mit größter Mühe emporgeklettert waren. Nein, sagten wir uns immer wieder, diese ungemein schwierige Route im steilen Fels konnte das Pseirer Josele vor zweihundert Jahren unmöglich bewältigt haben. Ohne Seil. Ohne Pickel. Nur mit Lederschuhen. Und dann schauten wir uns an. Und schmunzelten. Dieser Gamsjäger, der weder lesen noch schreiben konnte, er war noch viel schlauer und gewiefter, als wir alle gedacht hatten. Der Fuchs! Er hatte wohl eine viel schwierigere Route angegeben als die, die er tatsächlich gefunden und genommen hatte. Sodass er – zumindest für eine Zeit lang – der einzige Bergführer war, der betuchte Gäste auf den Ortler führen konnte. Unten im Tal angekommen, wurden wir mit großer Erleichterung und noch größeren Augen empfangen. Als ob da drei Geister herumwandelten. Ja, wir lebten tatsächlich noch.
Lenz
In der Trostburg
Manchmal, sagte mir Terese Gröber, die von allen, die sie besser kennen, stets nur liebevoll Trostburg-Tresl genannt wird, schaue sie von einem der Burgfenster ins Eisacktal hinab. Nun stand sie gemeinsam mit mir da, im prunkvollen Renaissancesaal, und es war, als beobachteten wir aus der Vergangenheit das Heute. Die Stuckfiguren des Grafengeschlechts umgaben uns stumm, der Blick hinaus reichte bis zu den Dörfer Barbian, Lajen und Villanders, die sich zwischen Wiesen und Wald am steilen Hang festzukrallen schienen. Unten im Tal raste der Zivilisationswahnsinn der modernen Welt hin und her: Autos flitzten, Lichter blinkten. Hinter den dicken Gemäuern der Trostburg, hoch über Waidbruck, war es still. Wohlig ruhig.
Die zahlreichen Burgen Südtirols haben mich als Kind so sehr fasziniert, dass meinen Eltern nichts anderes übriggeblieben war, als Sonntag für Sonntag eine nach der anderen mit mir zu besuchen. Hochwandern zu den Gemäuern, gleichzeitig in der Zeit der Ritter zu schwelgen, nichts liebte ich mehr – und tue es heute noch. Über achthundert Burgen und Schlösser gibt es hierzulande, Südtirol ist damit die burgenreichste Region Europas.
Die meisten von ihnen entstanden zwischen dem 11. und dem 12. Jahrhundert, oftmals schwindelerregend auf steil abfallenden Felsen thronend. Viele dienten den Landesfürsten zur Sicherung der noch zersplitterten Herrschaftsgebiete und wichtiger Handelsrouten – manche auch als Wohnort. Ein paar sind nach wie vor bewohnt, andere nur noch Ruinen. Einige beherbergen Hotels und Gasthäuser, andere Museen oder Tagungsstätten, Bibliotheken und Bildsammlungen. Auf wieder anderen finden Theaterabende und Konzerte statt. Steinerne Zeugen der Geschichte sind sie allesamt. Das 1963 gegründete Burgeninstitut trägt zu ihrer Erhaltung bei, pflegt, erforscht, dokumentiert.
Die Trostburg, im Besitz des Instituts, fungiert heute als Südtiroler Burgenmuseum. Neben römischen Weihesteinen, einer gotischen Stube, dem Renaissancesaal, einer mit Wappen bemalten Loggia, den eisenbeschlagene Toren, dem hölzernen Fallgitter, Fensterschießscharten aus dem 17. Jahrhundert ist auch eine der größten historischen Weinpressen zu bewundern – mit einem elf Meter langen Pressbaum. Sicher war ich als Kind auch schon in der Trostburg, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nur eines weiß ich: Jedes Mal, wenn ich in meinem bisherigen Erwachsenenleben durch das Eisacktal gefahren bin, ging bei Klausen der Blick hinauf. Ich fragte mich: Wohnt da noch wer? Und die Gedanken wanderten zurück in meine Kindheit. Schwelgten in Ritterträumereien, in die ich mich so gerne verloren hatte.
Irgendwann, es war ein sonniger Herbsttag, die Blätter hatten sich bereits gelb und rot gefärbt, ich hatte es nicht eilig, fuhr ich von der Autobahn ab, obwohl mein Ziel, Bozen, noch nicht erreicht war. Ich parkte am Fuße des Hanges, ging über die alte Ritterstraße steil bergan, musste darauf achten, auf den glattgetretenen Steinen nicht auszurutschen.
Bis ich ehrfürchtig vor dem großen Tor aus dunklem Holz stand, das mir wie die Tür eines Riesen erschien. Wie der mystische Eingang in eine Märchenwelt. Auf einer Weide grasten Haflingerpferde, im Geäst eines Nussbaums glitzerten Sonnenstrahlen, Staub tanzte im Licht. Ich klopfte gegen das Holz, was mir sofort lächerlich vorkam. Als ob tatsächlich jemand in dieser Burg lebte. Und als ob dieser Jemand hinter all den dicken Mauern mein Klopfen überhaupt vernehmen würde.
Doch es dauerte überraschenderweise nur wenige Sekunden, dann hörte ich Schritte, Klimpern, eine kleine Tür im großen Tor öffnete sich, Terese trat heraus. Eine alte, kleine, zierliche, freundlich schauende Frau. Silbernes Haar, gletscherblaue Augen.
»Komm! Ich zeig dir meine Burg!« Sie sagte es so, als würden wir uns schon seit einer Weile kennen, als stünden wir uns nun eben nicht zum ersten Mal gegenüber. Ich schaute noch einmal zu den respekteinflößenden Pechnasen am oberen Ende der dicken Mauer empor, dann trat ich ein.
Wir wandelten durch den Innenhof, Rosen rankten sich an den Steinen empor. Zwei Katzen, eine getigert, eine schwarz-weiß gefleckt, beobachteten mich skeptisch. Die 77-jährige Burgherrin erzählte mir, sie lebe schon ihr ganzes Leben lang hier, in der Trostburg, auf 627 Metern Meereshöhe über der Schlucht, die der Eisack im Lauf der Jahrtausende in den Fels gefressen hat.
Die Geschichte des Gemäuers, so erfuhr ich von Terese weiter, reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück, als die Herren von Velthurns hier residierten. Als Straßenräuber gebrandmarkt, mussten diese die Burg um 1290 jedoch an den Grafen von Tirol abtreten. Der gab sie als Lehen an die Herren von Villanders weiter, diese an das Geschlecht derer von Wolkenstein, zu denen auch der allbekannte Minne Oswald von Wolkenstein gehörte. Zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert wurde die Burg erweitert, Engelhard Dietrich Graf von Wolkenstein ließ sie im 17. Jahrhundert im Renaissancestil umbauen. Von da an wurde die Trostburg von den Grafen nur noch als Sommerresidenz genutzt. Tereses Familie hält das Bauwerk nun schon seit Jahrzehnten in Schuss.
Unsere Schritte hallten gespenstisch im alten Gemäuer wider. Es zog und pfiff, draußen vor den Fenstern schien die Herbstsonne vom hellblauen, wolkenlosen Himmel, ich fröstelte ein klein wenig. Terese erklärte mir, der Name Trost habe im Mittelhochdeutschen, das damals gesprochen wurde, so viel wie Herr oder Herrscher, aber auch Zuversicht bedeutet. Ich berichtete ihr von der frühen Faszination, die Burgen und Ritter auf mich hatten, sie schmunzelte und erzählte mir von ihrer Kindheit. Davon, wie sie mit ihren Geschwistern im Wald spielte. Davon, wie sie mithalf bei der Arbeit im Stall. Die Haflinger striegelte, ihnen Heu gab.
»Vormittags«, so erinnerte sie sich, »mussten wir flüstern, weil das Kindergeschrei in der Burg so laut hallte. Und die Gräfin gerne lange schlief.«
Terese öffnete das Tor zur Kapelle, es quietschte und ächzte. Betbänke, ein schlichter Altar. Die Muttergottes beäugte uns von der Decke herab, das Gotteskind im Arm. Meine Begleiterin machte mich darauf aufmerksam, dass an den Wandgemälden immer wieder der heilige Antonius abgebildet ist. Ein ägyptischer Mönch, Asket, Einsiedler, der in der Wüste von Teufelsvisionen heimgesucht worden war. Der von den hiesigen Gläubigen Fockn-Toni genannt wird – was auf Südtirolerisch so viel wie Schweine-Toni bedeutet – ist er doch der Schutzpatron der Bauern, Metzger und Hirten. Noch heute, verriet mir Terese, würden manchmal die Bewohner einiger Höfe aus dem Eisacktal zu ihr in die Burg kommen, um für den Wurf ihrer Säue zu beten.
Irgendwann, Mitte des 20. Jahrhunderts, verließen die Grafen die Trostburg, Tereses Eltern verstarben, die Geschwister zogen hinunter ins Tal. Sie aber wollte bleiben. Und sie durfte. Weil sie sich um die Burg kümmern und Besucher herumführen sollte.
»Weil die Burg zu mir gehört und ich zur Burg«, sagte sie mir, nachdem sie mich in ihre kleine Stube gleich hinter dem großen Eingangstor gebeten hatte.
An den dicken Wänden hingen Heiligenbildchen, auch Familienfotos. In einem Kachelofen glühten Holzscheite, die beiden Katzen lagen schnurrend davor. Auf einem Regal ein altes Telefon mit Drehscheibe. Auf einem Couchtisch ein alter Fernseher.
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie das wohl sein würde: immer mittendrin in diesem Rittertraum. Es wollte mir nicht so recht gelingen. Ich überlegte, was mir alles fehlen würde, was dagegen nicht. Und geht das überhaupt, dieses Leben von gestern heute so ganz zu erfassen? Gäbe es auch Schwierigkeiten, die ich überhaupt nicht im Blick habe?
»Manchmal, wenn es gewittert«, erzählte mir Terese weiter und setzte einen Brennnesseltee auf, »fällt der Strom aus.«
Dann hole sie die Taschenlampe hervor. Und wenn die Batterien alle aus seien, entzünde sie Kerzen. Ob sie kein Internet habe? Ihre frechen Äuglein leuchteten, eine der Katzen schmiegte sich um ihre Beine.
»Internet«, sagte sie noch einmal belustigt, »wird’s schon brauchen heutzutage. Ich aber brauch’s nicht.«
Hubert
In Bad Dreikirchen
Als ich noch ein kleiner Junge war und zur Grundschule in Villnöß ging, da brachen ein paar von uns Brüdern – und oftmals auch meine Schwester – drei bis vier Mal im Jahr mit Vater auf. Zu Mutters Vetter, Luis, der im Dörfchen Lengstein am Ritten wohnte. Der alleine lebte, die Frau fürs Leben einfach nicht finden mochte. Bei dem im Sommer die älteren Geschwister Erich, besonders er, und einmal auch Reinhold als Gehilfen arbeiteten. Für Kost und Logis. So war es damals üblich. Kinder mussten versorgt werden. Irgendwie. Irgendwo.
Vetter Luis bewirtschaftete einen bescheidenen Bauernhof. Mit einem Stadel, in dem wir im Heu herumtobten. Er hatte ein paar Kühe, Schweine, Hühner. Ein paar Rebenzeilen. Süffiger St. Magdalener, typisch für die Gegend. Ein paar Zwetschgenbäume, die Schatten spendeten, deren Früchte wir in unseren Rucksäcken abends wieder nach Hause schleppten, wo wir stets erst im Dunkeln wieder ankamen.
Familienbesuche! Das klingt heute nach keinem großen Ereignis mehr. Irgendwann am späteren Vormittag ins Auto steigen oder in den Bus oder in den Zug, hinfahren zu den Verwandten. Schnell gemacht, schnell da, der Kuchen und der Kaffee warten schon. Früher? Damals? War das anders. Wir brachen in der Morgendämmerung auf. Mit klapprigen Fahrrädern ging es über die Schotterstraße ins Eisacktal hinaus. In Klausen warteten wir auf den Zug, fuhren bis zur Haltestelle von Kastelruth, die heute noch verfallen und windschief da steht, als sei sie einer Filmkulisse der Cinecittà in Rom entsprungen. Als würde Clint Eastwood gleich um die Ecke kommen, die Hand am Pistolenhalfter, der Mundharmonikamelodie von Charles Bronson lauschend. Kastelruth. Und dann?
Schaut man auf Google Maps nach, sieht das doch alles gar nicht so weit aus. Von Klausen im Eisacktal auf den Ritten. Doch was Google Maps nicht verrät: Es geht steil bergauf. Trotzdem freuten wir Buben und auch unsere Schwester Waltraud uns so sehr, wenn es wieder hieß: Auf nach Lengstein! Zum Vetter Luis!