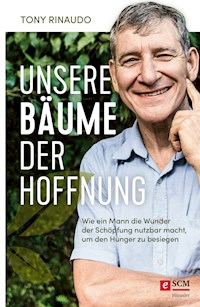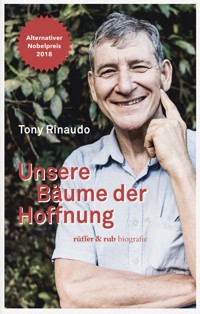
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dies ist die Geschichte einer zufälligen Entdeckung und wie sie nicht nur das Leben von Tony Rinaudo fundamental geändert, sondern auch das Klima und die Lebensverhältnisse von Millionen von Menschen verbessert hat. Der australische Agrarökonom Tony Rinaudo pflanzte bereits in den 1980er-Jahren im afrikanischen Niger Baumsetzlinge, um den Vormarsch der Wüste zu stoppen. Doch nur etwa 10 Prozent der Bäume überstanden die staubigen Stürme und die Hitze. Der Frust darüber hätte ihn beinahe dazu gebracht aufzugeben. Doch eines Tages, als Rinaudo gerade Luft an den Reifen seines Geländewagens herausließ, um besser durch die trostlose Sandlandschaft zu kommen, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Bei den grünen Trieben, die überall um ihn herum aus dem Sand sprossen, handelte es sich mitnichten um nutzloses Kraut; sie stellten sich bei genauerer Betrachtung vielmehr als Baumtriebe heraus. Unter dem Sand der Sahelzone befindet sich ein riesiges Wurzel-Netzwerk. Wenn die Triebe aus dem Wurzelwerk nicht von Tieren gefressen oder die Wurzeln als Brennholz verwendet werden, entstehen daraus in wenigen Jahren große Bäume. Tony Rinaudo hat damit die Grundlage für eine sichere Wiederaufforstung gefunden. In seiner Biografie erzählt Tony Rinaudo von seiner Entdeckung und der jahrelangen Überzeugungsarbeit, die er leisten musste, bis Farmer und Politiker seine sehr einfache und günstige Art der Wiederaufforstung ernst nahmen. Inzwischen wird seine Methode in mindestens 24 afrikanischen Ländern erfolgreich angewendet. Wo sich vor zwanzig Jahren noch die Wüste ausbreitete, forsten Farmer große Landstücke auf: Allein im Niger wurden auf diese Weise bereits sieben Millionen Hektar Land regeneriert. Tony Rinaudo erhielt für sein Engagement 2018 den Alternativen Nobelpreis, und seither geht die Erfolgsgeschichte weiter und weiter: Die aufgeforsteten Flächen in Afrika und Asien werden immer größer. Und der international erfolgreiche Filmregisseur Volker Schlöndorff hat sich die Filmrechte der Geschichte gesichert. Mit einem Vorwort von Filmregisseur Volker Schlöndorff
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der rüffer & rub Sachbuchverlag wird vom Bundesamtfür Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre2021–2024 unterstützt.
Erste Auflag Frühjahr 2021Alle Rechte vorbehaltenCopyright 2021 by rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zü[email protected] | www.ruefferundrub.ch
Das Buch enthält einige Passagen aus dem Buch»Tony Rinaudo – Der Waldmacher«, hrsg. von JohannesDieterich (rüffer & rub Sachbuchverlag, 2018).
Das E-Book enthält gegenüber der Printausgabe des Bucheseine stark erweiterte Version des Beitrags »FMNR – TonyRinaudos bleibendes Vermächtnis« von Dennis Garrity.
Design E-Book: Clara Cendrós
ISBN Book: 978-3-906304-66-3ISBN E-Book: 978-3-906304-78-6
Hoffnung – ausgerechnet in Afrika!
Volker Schlöndorff
Von kahlen Hügeln und Asthöhlen
Das Gebet eines Kindes
Wurzeln
Richard St. Barbe Baker – ein Mann der Bäume
Die Auswahl ist groß
Vorbereitungen auf das neue Leben
Das Bible College in Neuseeland
Bekehrung – eine Herzensangelegenheit
Elternglück und letzte Vorbereitungen für Niger
»Nach Hause« kommen
Hausa sprechen wie ein Esel aus Kano
Klänge aus Afrika
Maradi Farm School
Gesundheit, und nie mehr Pfannkuchen
Am richtigen Ort
Ein Besuch in Abalak
Die Entdeckung des unterirdischen Waldes
Wie man aus Feinden Freunde macht
Beschämend einfach
Bäume als ertragreiche Pflanzen erkennen
Verschwende nie eine gute Krise
Wenn Hunger den Alltag bestimmt
»Möge Ihr Gott Ihnen helfen«
Ein Jahr der Zäsur
Die Wiederbelebung der Hoffnung
Bäume drängen die Wüste zurück
Grüner Hunger
Eine Idee, deren Zeit gekommen war
Das Wiederaufforstungsprojekt von Humbo
FMNR-Hub als Beschleuniger der Verbreitung
Mit Liz zusammen unterwegs
Einige prägende Menschen der FMNR-Bewegung
Vom Projekt zur Bewegung
Vom Teufelskreis zum Gotteswerk
FMNR auf einer ganz neuen Stufe
Keine Zeit zu verlieren
Wie man die Welt wieder begrünt
Ein wunderbares Ergebnis
FMNR – Tony Rinaudos bleibendes Vermächtnis
Dennis Garrity
Anhang
Anmerkungen
Bibliografie
Bildnachweis
Hoffnung – ausgerechnetin Afrika!
Von Volker Schlöndorff
Tony Rinaudo begegnete ich zum ersten Mal im Dezember 2018, kurz nachdem er den Right Livelihood Award, auch bekannt als Alternativer Nobelpreis, erhalten hatte. Ich war so beeindruckt von seiner charismatischen Persönlichkeit, dass ich auf der Stelle beschloss, einen Film über ihn zu drehen. Nur einige Monate später nahm ich mit ihm an der »Beating Famine Conference« in Malis Hauptstadt Bamako teil und verbrachte zusammen mit meinem Kamerateam mehrere Wochen in Mali, Ghana und Niger. Wir begleiteten Rinaudo an die Orte, an denen er jahrzehntelang tätig war. Und ich konnte es mit eigenen Augen sehen: Seine Methode funktioniert. Hunderttausende glückliche Bauern und deren Familien wenden sie an. Allein in Niger hat sich auf sechs Millionen Hektar verödetem Farmland die Baumdichte seit 1980 von durchschnittlich 4 Bäumen pro Hektar auf heute 40 Bäume erhöht.
Bald wurden wir zu Verbündeten und sogar Freunden. Ich war beeindruckt von der Energie und Leidenschaft, die er bei der Konferenz an den Tag legte, von der hingebungsvollen Art, mit der auch seine Frau Liz die Gäste und Teilnehmer begrüßte. Agrarwissenschaftler und Unterstützer seiner Methode der Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) aus der ganzen Welt applaudierten, als er den Wert der Bäume nicht nur für die Wiederbelebung verkarsteter Böden, sondern vor allem für die Wiederbelebung der Hoffnung pries. Tatsächlich: Hoffnung liegt in der Luft. Wie ich bei jener Konferenz sehen konnte, schließen sich zahlreiche Projekte und Initiativen von Einzelpersonen, NGOs und sogar Regierungen zu einer echten sozialen Bewegung zusammen.
Tonys Methoden und die Bauern, die die Wüste wieder begrünen, sind für uns alle von Bedeutung. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist es an der Zeit, unsere westliche Arroganz abzulegen und von jenen zu lernen, die Tag für Tag »kleine Wunder« vollbringen. Es ist an der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Unsere Bauern, Agrargenossenschaften und Vertreter der industriellen Landwirtschaft müssen von diesen Bauern lernen.
Tony Rinaudo lebte während der Hungersnot der 1980er-Jahre bei den Ärmsten aller Bauern. Er erlebte die Not am eigenen Leib und kocht seitdem das Wasser, das er für den nächsten Tag benötigt, abends in seinem Hotelzimmer ab. Er kauft keine Plastikflaschen und industrialisiertes Wasser. Er verwendet auch keine Klimaanlage, sondern bindet sich einfach ein kühlendes Tuch um den Hals. Und um für den Tag fit zu sein, läuft er täglich eine Stunde vor Sonnenaufgang, ob auf den Straßen von Kalkutta, den ländlichen Pfaden in Bolgatanga in Ghana, ob entlang der schlammigen Hänge des Ganges oder des staubigen Nigers. Als Läufer, der ich selbst bin, begleitete ich ihn auf diesen morgendlichen Ausflügen – zur Belustigung der Einheimischen.
Am auffallendsten ist Tony Rinaudos Charisma. Es ist ein Grund des Erfolgs seiner Kampagnen für die Wiederaufforstung und die Agroforstwirtschaft in den Dörfern. Und so ist es überwältigend, bei Tonys Begegnungen mit wirklich dankbaren und glücklichen Bauern, Frauen und Kindern dabei zu sein. Ihre Hingabe, ihr Glaube und ihre Leidenschaft sind förmlich greifbar. Das Leben dieser Menschen veränderte sich komplett durch eine »neue« Art der Ackerbewirtschaftung, die eigentlich auf uralten Traditionen beruht. Die Methode vereint die Pflege der Felder mit dem Erhalt der Wälder; alle vier bis fünf Jahre wird zwischen der Nutzung der Felder für den Anbau von Getreide mit dem als Weideland gewechselt. Dies war auch in der europäischen Landwirtschaft vor Einführung der sogenannten Grünen Revolution Ende der 1950er-Jahre gang und gäbe. Ich wuchs in den 1940er-Jahren in Deutschland auf dem Land auf und begleitete meinen Vater, einen Arzt, oft bei seinen Patientenbesuchen in den sehr armen, ländlichen Regionen Hessens. Das Leben in den Dörfern war noch abgeschottet von der Außenwelt, mit Hochzeiten im Obstgarten, aber auch Frauen, die der einzigen Kuh halfen, den Pflug durch Erde zu ziehen, die mehr Steine als Brot hervorbrachte. Ich bedauere den Verlust des Dorfes, dieses ältesten Topos der menschlichen Gesellschaft.
Ähnliche Not und Entschlossenheit zur Veränderung wie die, von der mir Tony Rinaudo erzählte, erlebte ich, als unser Bundespräsident Horst Köhler mich 2009 einlud, ihn auf einer seiner Reisen nach Afrika zu begleiten. Seitdem engagiere ich mich an einer kleinen Filmschule in Ruanda und in einem landwirtschaftlichen Projekt in Burkina Faso. Ich habe einen Kontinent gesehen, der im Aufstieg begriffen ist, weit entfernt von dem »dunklen Kontinent«, als den man ihn in den Medien darstellt. Als Tony und ich eines Abends über den Niger blickten und er mir sagte, dass Afrika leicht seine gesamte Bevölkerung und sogar die Welt ernähren könnte, zweifelte ich zunächst wie der ungläubige Thomas. Aber auf unseren weiteren gemeinsamen Reisen begann ich die schier unbegrenzten Möglichkeiten für Landwirtschaft auf diesem riesigen, noch nicht überbevölkerten Kontinent zu begreifen.
Wer Afrika kennt, weiß, dass Frauen dort die treibende Kraft hinter Veränderungen sind. Dies trifft insbesondere auf die Landwirtschaft zu. Momentan ist weltweit die Situation für rund eine Milliarde Menschen, die noch als Kleinbauern ihren Unterhalt bestreiten, desolat. Ihre Erträge reduzieren sich dramatisch. Bis zu 700 Millionen Menschen könnten sich gezwungen sehen, in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der rapide fortschreitenden Wüstenbildung ihr angestammtes Land zu verlassen. Das ist kein vager Kassandraruf, sondern die Vorhersage von über 100 Wissenschaftlern, wie der in Bonn ansässige Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) berichtet.
Im November 2019 begleitete ich Tony mit meinem Team nach Indien. Zweck seiner Reise war die Verbreitung der FMNR-Methode durch Workshops und Schulungen vor Ort in Dörfern in der Provinz Jharkhand ganz im Osten des Landes sowie im Anschluss im riesigen Bundesstaat Maharashtra. Am Ende der Reise verbrachten Tony und ich drei Tage in Neu Delhi. Dort trafen wir indische Landwirtschaftsexperten und Beamte, um die Anwendbarkeit seiner Methode für eine Bevölkerung von mindestens 200 Millionen Kleinbauern zu prüfen. Ich merkte, dass diese Art der Lobby-Arbeit überhaupt nicht seine Sache war, und dennoch war sie nötig in einem Land, in dem allein in den letzten zehn Jahren über 100000 Bauern keinen Ausweg aus ihrer Misere mehr sahen und sich erhängten.
Mir wurde bewusst, dass wir alle zwar durch die Prognosen zum Klimawandel verängstigt, sprachlos und gelähmt sind, ein Agrarwissenschaftler, Missionar und einfacher Mann aus Australien jedoch eigenhändig die Lösung gefunden haben könnte. Seit er vor 30 Jahren seine bescheidene Arbeit aufnahm, sind allein in Niger 240 Millionen Bäume gewachsen. Sein Traum ist es, mithilfe seiner Methode und den Bauern vor Ort zwei Milliarden Hektar unseres Planeten wieder aufzuforsten. Es ist dies das ambitionierteste und zugleich kostengünstigste Projekt zur Eindämmung der steigenden Temperaturen. Es kommt genau zur rechten Zeit: Der Planet benötigt es dringend – und dank FMNR ist die Wiederaufforstung von so gut wie jedem verödeten Land zu sehr geringen Kosten möglich.
So ist es nicht übertrieben zu sagen, dass Tony Rinaudo den Planeten retten könnte. Zu Recht trägt er den Spitznamen »der Waldmacher«. Meiner Meinung nach benötigt und verdient Tony Rinaudo »Jünger« auf der ganzen Welt. Da er ein junges Publikum in vielen Ländern anspricht, scheint seine Botschaft der Hoffnung zur richtigen Zeit zu kommen: Da draußen ist eine Generation, die nur darauf wartet, sich aktiv einzubringen.
Von kahlen Hügeln undAsthöhlen
Unser Haus in Myrtleford, eine kleine australische Provinzstadt im Nordosten Victorias, befand sich am Fuß des Reform Hill. Vom Aussichtspunkt konnte ich fast die gesamte Gemeinde überblicken – Autos in Spielzeuggröße, Menschen, die ihren Geschäften nachgingen, das Ovens Valley aus der Vogelperspektive, die Mündung des Buffalo in den Ovens River und die zerfurchte Felswand des Mount Buffalo. Die stille Schönheit der blau-grünen Hügel und engen grünen Täler erfüllt mich mit einem starken Gefühl der Verbundenheit mit diesem Ort, das mich bis heute nicht verlassen hat, obwohl ich schon lange anderswo mein Zuhause eingerichtet habe.
Die Hügel waren der perfekte Spielplatz für einen aktiven Jungen wie mich. Die Bäume schienen mir stumme Zeugen vergangener Ereignisse; seit wie vielen Jahrhunderten hatten sie wohl dem Eingeborenenstamm der Ya-itma-thang Schutz und Nahrung geboten? Wie lange schon hatten Bäume im Frühling oder Sommer über deren jährliche Pilgerfahrt ins Hochland zur Ernte von Bogong-Motten gewacht? Millionen von Motten wandern bis zu 1000 km, um sich in den kühleren Felsspalten von Australiens südlichen Alpen zu sammeln. Auf heißer Asche geröstet, gelten sie wegen ihres süßen, nussigen Geschmacks und ihres hohen Fett- und Proteingehalts als Delikatesse. Der Yaitma-thang-Stamm besiedelte die Unterläufe der Flusstäler das ganze Jahr über; ihre Lagerstätten errichteten sie auf den weichbödigeren Ebenen des offenen flachen Lands, wo es Wasser und Nahrungsquellen im Überfluss gab – was ihnen im 19. Jahrhundert beim Aufeinanderprallen der Kulturen zum Verhängnis werden sollte.
In »Fire Country – How Indigenous Fire Management Could Help Save Australia« (2020) beschreibt der indigene Schriftsteller, Filmemacher und Berater Victor Steffensen die Landschaft vor der Kolonisierung als »wunderschön und reich an Nahrung, Medizin und Leben. Die Bäume, mit ihren Hunderten oder über tausend Jahren, waren riesig.«1 Der australische Bestsellerautor Don Watson entzaubert in seinem Buch »The Bush« (2014) die Mythen der frühen Siedler vom »Niemandsland« oder »leeren Land«. Sie waren offensichtlich dazu entworfen, um die Landnahme in kontinentalem Maßstab zu rechtfertigen. Watson zitiert zahlreiche Entdecker und frühe Siedler, die auf eine Landschaft hinweisen, die in ihrer offenen Regelmäßigkeit und Schönheit wie der »Park eines Landadligen« aussah, als »Englischer Garten«, als »Französischer Park«, eine »unermessliche Parkanlage« oder »ein überwältigender Park« bezeichnet wurde.2 Victor Steffensen seinerseits schreibt über die Landbewirtschaftung der indigenen Völker Australiens:
»Die Bäume wurden [von den indigenen Völkern] gepflegt, um sie dem Land zu erhalten, sodass sie alt und die Ältesten der Landschaft werden konnten, damit die Bäume weiterhin Leben schenken und alles, was in ihrer Umgebung lebte, gedeihen lassen konnten. Durch die Landbewirtschaftung der indigenen Völker wurde sichergestellt, dass die meisten der Bäume Hunderte, wenn nicht gar Tausende Jahre lebten. Sie besiedelten das Land in Hülle und Fülle, zogen Nährstoffe aus dem Boden und gaben ihm Nährstoffe zurück, sodass alles Notwendige für eine gesunde Landschaft gegeben war.«3
Beim Versuch, sich den »kranken« Zustand eines Großteils der heutigen australischen Landschaft zu erklären, weist Steffensen auf die den meisten Menschen fehlende Verbundenheit mit dem Land hin.
*
Unsere kleine Stadt weist eine interessante Geschichte auf: Ein Steinmonument erinnert an die Entdecker Hamilton Hume und William Hovell, die auf ihrer 700 km langen Entdeckungsreise durch Myrtleford zogen. Die Expedition führte in den Jahren 1824/25 durch Ost-Australien, von Sydney in New South Wales bis nach Port Phillip in Victoria. In der Folge nahmen erste Besetzer das Land an sich, um darauf Schafe und Rinder weiden zu lassen. Verlassene Goldminen und -schächte, Berghalden und ein enormer, inzwischen verstummter Gesteinsbrecher erzählen von der Zeit des Goldrauschs, der in den 1850er-Jahren begann. Reform Mine war mit einer Förderung bis 1880 von 21000 Unzen Gold (600 kg) die produktivste unterirdische Mine in North East Victoria. War es möglich, dass sogar die Kelly-Bande, die berüchtigten australischen Bushranger, wie man ursprünglich entlaufene Sträflinge in Australien bezeichnete, hier auf der Flucht vorbeikamen?
Im Land um Myrtleford gewannen über die Jahre verschiedene Wirtschaftstätigkeiten an Bedeutung und wurden wieder von anderen abgelöst. Dazu gehörten die Beweidung mit Rindern, Milchkühen und Schafen sowie während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Kultivierung von Flachs, Kiefernplantagen, der Anbau von Hopfen, Weintrauben, Heidelbeeren, Oliven, Walnüssen, Kastanien und Tabak. Tabak war der große Anziehungspunkt, der viele italienische Einwanderer, darunter auch meinen Großvater, Guiseppe »Joe« Rinaudo, ins Ovens Valley lockte, um ein neues Leben für seine Familie aufzubauen.
Ich gehörte einer kleinen Gruppe Kindern aus unserer Straße an, die am Ende der Sackgasse der Elgin Street wohnten. Wir spielten oft zusammen und hielten unsere Schutzengel auf Trab. Gelegentlich erfuhren unsere Mütter von einer Begegnung mit einer Schlange, Erkundungstouren in einem Minenschacht oder von der Besteigung eines Baums. Dann gab es ein Abenteuerverbot, bis wir ihren Widerstand brachen und wieder frei herumtollen durften. Am liebsten spielten wir Cowboys und Indianer. Wenn ich alleine war, rannte ich mit Karacho den Hügel hinunter und durchbrach dabei starke Seidenfäden, die zwischen den Bäumen von – so schien es mir damals – riesigen Spinnen gewebt waren. In meinen Träumen flog ich gar den größten Teil der Strecke den Hügel hinunter.
Wir sind eine kinderreiche Familie: Ich bin das dritte Kind und habe drei Brüder und zwei Schwestern. Peter, mein kleiner Bruder, und ich waren unzertrennlich, immer im Busch unterwegs, gingen angeln und Fahrrad fahren – allerdings glaube ich, dass er oft eher mitkam, um mir zu gefallen, als aus großer Begeisterung für meine Leidenschaften. Nach uns vier Jungs wollte Mum unbedingt ein Mädchen. Dads einzige Schwester war als junge Mutter zweier Jungs an Leukämie gestorben, und so wurden meine Schwestern Cathy und Josie mit besonderer Freude willkommen geheißen. Sie bedeuteten mir viel, und ich liebte es, auf sie aufzupassen.
So gut wie jeden Sonntagmorgen nach der Kirche holte Dad seine Boxkamera, eine Kodak Brownie, hervor. Während Mum zum Mittagessen Spaghetti kochte, arrangierte Dad eine schnelle Aufnahme von uns Kindern noch im Sonntagsstaat vor dem Kamelienbusch. Die ersten paar Jahre waren wir noch größer als der Busch, doch irgendwann überragte er uns. Nach dem Essen stopften unsere Eltern alle sechs Kinder in unseren Ford-Kombi, und es folgte die 40-minütige Fahrt von Myrtleford nach Wangaratta, wo wir Nanna und Nanu besuchten, wie wir unsere italienischen Großeltern nannten. In jenen Tagen gab es noch keine Gurte, und wenn wir Jungs auf dem Rücksitz Ärger machten, drehte sich Dad kurz zu uns um und verpasste uns einen Hieb, wenn wir uns nicht schnell genug wegduckten – sehr zum Ärger meiner Mutter, die eine ausgesprochen nervöse Beifahrerin war und ständig Angst davor hatte, dass Vaters Aktionen einen Unfall verursachen könnten.
Einmal an der Abzweigung nach Beechworth vorbei, öffnet sich das Land, und die weitere Ebene wird eingerahmt von den sanft geschwungenen, fast baumlosen Murmungee Hills. Kann Land sprechen? Vielleicht nicht mit Worten, doch das Land »sprach« trotzdem zu mir. Bereits als kleiner Junge empfand ich eine gewisse Traurigkeit über das Verlorengegangene beim Anblick dieser abgeholzten Hügel. In ihrer ungeschützten Kahlheit schienen die Hügel selbst zu trauern und dabei um Hilfe und Wiederherstellung zu rufen. Auf der allsonntäglichen Fahrt nach Wangaratta sah ich mich im Geiste dort oben in Gummistiefeln stehen, mit der Schaufel in der Hand Bäume pflanzen und die tiefen Erosionsrinnen eindämmen, von denen diese Hügel verwundet waren.
*
Manchmal kehrten wir von Wangaratta erst in der Dunkelheit zurück. An einigen Stellen der Great Alpine Road berührten sich die Äste der riesigen, die Straße säumenden Gummibäume über uns. Beim Fahren erhellten die Scheinwerfer die Stämme und Äste. Der schwarze Hintergrund ließ das Bild einer verzauberten Höhle entstehen, die vor uns auftauchte und hinter uns in der Dunkelheit verschwand. Mir waren diese kurzen Abschnitte von »Asthöhlen« nicht genug, und so pflanzte ich im Geiste in die Lücken Bäume!
Natürlich wusste ich, dass Landwirtschaft notwendig ist, aber innerlich zweifelte ich daran, ob es so klug war, alle Bäume auf dem Land zu roden. Warum verlangte Landwirtschaft so viel Zerstörung? Ein paar Jahre später an der Universität schien die Weisheit hinter meinen Tagträumen bestätigt zu werden, aber nicht in den Vorlesungen, sondern beim Lesen des Buches »Forest Farming – Towards a Solution to Problems of World Hunger and Conservation« (1976) von James Sholto Douglas. Der Ökologe und Agronom beschrieb darin, wie die Mischung aus Bäumen, Getreide und Vieh zu einem gesünderen ökologischen Gleichgewicht führe sowie zu größeren Erträgen von Nahrungsmitteln und dem vermehrten Gewinn anderer Materialien für Kleidung, Brennstoff und Behausungen.
Für mich ergab das absolut Sinn, aber es kontrastierte stark mit der Vorgehensweise der ersten Siedler Ende 18./Anfang 19.Jahrhundert. Die Kolonialisten brachten zerstörerische landwirtschaftliche Methoden aus Europa mit und betrachteten es als ihre Pflicht, den wilden Busch zu zähmen und zu »zivilisieren«, um ihn »nützlich« zu machen. Häufig vertrieben sie die Ureinwohner, rodeten die Bäume und töteten die wilden Tiere. Siedler, denen Land zugesprochen wurde, wurden von der Regierung sogar dazu verpflichtet, es von Bäumen zu befreien. Es gibt ein altes Sprichwort aus dem australischen Busch, das die Haltung der frühen Siedler gut zusammenfasst: »Was sich bewegt, das erschieße, was stillsteht, das fälle.« Diesen Spruch hörte man zwar eher nicht in den heiligen Hallen der Universitäten, und doch bestand der einzige Unterschied zwischen den kolonialen Methoden und der modernen Landwirtschaft in der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Logik, die diese mit dem Nimbus der Seriosität umgab. Die moderne Landwirtschaft beruhte auf diesem fehlerhaften, von den europäischen Siedlern gelegten Fundament. Sie ist gekennzeichnet durch die Einförmigkeit von Getreideanbau und Viehhaltung zum Zweck der Erwirtschaftung hoher und immer höherer Erträge, und sie wird von der Gier nach höheren Profiten gesteuert, ohne Rücksicht auf die ökologischen Kosten dieser Verfahrensweise – dem Verlust intakter Ökosysteme, dem Verlust der Artenvielfalt sowie der Verschlechterung der Böden. Natürlich müssen Landwirte Gewinn machen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und überlebensfähig zu bleiben, aber wenn dies um den Preis der Entwertung des Landes geschieht, dann ist das zu ihrem eigenen Schaden und dem zukünftiger Generationen.
Das Gebet eines Kindes
Seit den späten 1920er-Jahren verdrängten exotische Kiefernplantagen auf vielen Hügeln der Gegend langsam die einheimische Vegetation. Das Buschland wurde mit Bulldozern bearbeitet, Tausende Bäume zu Stapeln aufeinandergehäuft und verbrannt. Das Holz wurde noch nicht einmal verwendet! Steile Hügel wurden jeglicher Vegetation beraubt, und lange Zeit blieb nichts zurück als kahler Boden. Dann wurden die Hügel mit einer Monokultur von Monterey-Kiefern bepflanzt, einem Baum, der an der zentralkalifornischen Küste beheimatet ist. Selbst mir als einem Kind erschien etwas an diesem Vorgang sehr kurzsichtig und destruktiv. Durch diese dunklen, stillen Wälder ohne Unterholz zu wandern war wie ein Spaziergang durch eine Wüste. Die einzigen Vögel, die ich dort sah, waren solche, die möglichst schnell wieder herauswollten. Ich glaube, es war weniger die Abneigung gegen exotische Bäume, sondern die enorme Verschwendung und fehlende Achtung dessen, was bereits vorhanden war, das mich so aufregte. Nicht einmal die Täler oder Bergkuppen hatte man für die Bewahrung der indigenen Artenvielfalt und als Rückzugsort für wilde Tiere und die heimische Pflanzenwelt verschont.
In den fruchtbaren Tälern, in denen Tabak angebaut wurde, fiel regelmäßig der Sprühnebel von Pestiziden über die kalten, kristallklaren Gebirgsbäche – Bäche, in denen ich mit meinen Geschwistern und Freunden gerne angelte und schwamm; Bäche, aus denen weiter unten Gemeinden ihr Trinkwasser bezogen. Nachdem eine Zeit lang Schädlingsbekämpfungsmittel aus Flugzeugen gesprüht wurde, setzte ein gewaltiges Fischsterben ein, und Schwimmern bot sich der widerwärtige Anblick und Gestank großer, mit dem Bauch nach oben vorbeitreibenden Forellen. Ebendiese Wasserläufe hatten bereits während der Ära des Goldrauschs beträchtlichen Schaden genommen, ein Niedergang, der im Jahre 1899 begann und sich bis 1955 fortsetzte. Das Goldwaschen und -schleusen wich dem Einsatz von gigantischen, schlachtschiffähnlichen Baggern, die die einst lebendigen Wasserläufe systematisch schändeten und die fruchtbaren Täler mit Kiesablagerungen erstickten. Als ich im Teenageralter war, wurde das bereits beschädigte Flusssystem weiter bearbeitet und das Flussbett von Bulldozern abgetragen, um die Fließgeschwindigkeit zu beschleunigen. Dies sollte die »Lösung« sein für das Problem zerstörerischer Überschwemmungen, die durch Rodung erst vermehrt auftraten! Dieser schwerwiegende Eingriff zerstörte den Lebensraum von Fischen und verwandelte die wilden und schönen Bergbäche, die ich so liebte, in breite, seichte Kanäle.
Im Jahr 1969, als ich zwölf Jahre alt war, las ich darüber, dass der Cuyahoga River4 in Ohio, USA, unter anderem von Chemikalien so verschmutzt war, dass er Feuer fing – eine Katastrophe, die das unbesonnene Streben der Weltenlenker nach Glück allein durch Reichtum und Entwicklung sofort hätte beenden müssen. Aber das geschah nicht. Das erschütterte zusätzlich mein ohnehin geringes Vertrauen in die Fähigkeit von Regierungen oder Industrie, moralisch vertretbare Entscheidungen hinsichtlich Umweltangelegenheiten zu treffen. Auf der Weltbühne waren Tropenabholzung, Ölkatastrophen in den Ozeanen und industrielle Umweltverschmutzung fast wöchentlich in den Nachrichten. Die regelmäßigen Reportagen zu negativen Umweltnachrichten hinterließen bei mir tiefe Spuren. Angesichts einer globalen Kulisse des totalen Kriegs gegen die Natur, des Kahlschlags von Hügeln und von vergifteten Flüssen in meiner eigenen Umgebung, malte ich mir eine apokalyptische Zukunft ohne Natur aus. Ich fragte mich, wie vernünftige Erwachsene, gute Menschen, die einfach ihr Leben lebten, so etwas dem Planeten antun konnten. Abgesehen von seiner erlesenen Schönheit: War dies nicht der Planet, auf dem wir lebten und von dem wir alle abhingen bezüglich Nahrung, Luft, Wasser und nicht zuletzt um unser inneren Wohlbefindens willen? Ähnliche Fragen sollten mir später in Afrika keine Ruhe lassen: Wie konnten kluge, fleißige Bauern die Bäume zerstören, die die Landwirtschaft erst ermöglichten und damit das Wohl ihrer Familie aufs Spiel setzten?
Im Nachhinein betrachtet, machte mich nicht nur die Zerstörung wütend. Was mich so heftig reagieren ließ, war die Tatsache, dass Gewalt gegen die Natur von den meisten Menschen als normal empfunden und akzeptiert wurde, und der blinde Glaube, dass der sogenannte Fortschritt Vorrang vor natürlichen Prozessen hatte.
*
In meiner Jugend berichteten die Abendnachrichten im Fernsehen allzu oft von Hungersnöten in irgendeinem weit entfernten, unter Krieg oder Dürre leidenden Land. Ich fand es ungerecht, dass Kinder, die einfach das Pech hatten, in einem anderen Land geboren worden zu sein, hungrig zu Bett gingen. Diese Last lag schwer auf mir, und ich wünschte sehnlichst, zur Lösung dieses Problems beitragen zu können.
Bis es so weit war, musste ich allerdings noch viel über das Verhalten der Menschen lernen. So erzählte mir ein alter italienischer Tabakfarmer aus Myrtleford, dass man während des Zweiten Weltkrieges in Italien Zigaretten verteilte, um die Nerven zu beruhigen. Tabak entwickelte sich im Nordosten Victorias vor allem ab den 1960er-Jahren zu einem blühenden Industriezweig, und der Tabak galt damals nicht als schädlich. Viele Migranten, darunter auch meine Großeltern, verließen Italien für ein besseres Leben – auf der Flucht vor Faschismus, Armut und mangelnden Chancen – und fanden Arbeit in der Tabakindustrie. Die Dinge sind wohl nie nur ganz schwarz oder weiß, und die Bauern verdienten damit einfach ihren Lebensunterhalt. Gleichzeitig fragte ich mich, auf der Grundlage welcher Werte man fruchtbares Land und wertvolles Wasser zum Anbau eines Krauts nutzte, das, wie sich herausstellte, die Menschen krank machte, während andernorts Menschen wegen Nahrungsmangel starben.
Ich war wütend über die Umweltzerstörung und die Ungerechtigkeit, verursacht von bitterer Armut, ich fühlte mich angesichts der Gleichgültigkeit vieler Erwachsener machtlos, aber mir fehlten noch die Reife und die sozialen Kompetenzen, um darüber zu sprechen. Im Alter von zwölf Jahren, als ich noch nicht wusste, was ich tun sollte, schickte ich ein aufrichtiges Kindergebet gegen den Himmel: »Lieber Gott, bitte mach mich zu Deinem Werkzeug, damit ich irgendwie irgendwo etwas verändern kann.« Bis zum heutigen Tag versuche ich, diesem Gebet gerecht zu werden.
In der Mitte meiner Teenagerzeit entwickelte sich meine Besorgnis um Menschen und Umwelt zu einem Entschluss. Das Leben von Albert Schweitzer sowie Geschichten von Missionaren und Menschen, die einem bequemen Leben den Rücken kehrten, um anderen zu helfen, erhellten plötzlich meinen Weg.
Wurzeln
Mein Dad Gaetano (Tom) Rinaudo wurde in Ramacca, im Landesinnern von Sizilien geboren, meine Mum Carolina Rando in Scari (heute ein Ortsteil von Stromboli), im Nordosten der aktiven Vulkaninsel Stromboli. Papa erzählte uns später scherzhaft, dass Stromboli so klein war, dass die Bewohner bei Flut nach Sizilien schwimmen mussten, um ins Trockene zu gelangen. Mein Urgroßvater mütterlicherseits, Gaetano Russo, kommt in mehreren Szenen in Roberto Rossellinis Film »Stromboli« von 1950 vor, in dem die dreifache schwedische Oscar-Preisträgerin Ingrid Bergman die Hauptrolle spielt. Die Monotonie und Beschaulichkeit des Dorflebens werden im Film durch die jährliche Thunfischjagd unterbrochen. Das verschlafene Dorf entpuppt sich als Bienenstock, und die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen wird klar ersichtlich. Als die Ruderboote den Fang einkreisen und die Fischer Schulter an Schulter im Boot stehend die Netze fest um die gefangenen Thunfische ziehen, bringt ihr rhythmisches Zerren und ihr gemeinsamer Gesang die ruhige See zum Schäumen, und die Männer ziehen einen riesigen Thunfisch nach dem anderen auf ihre Boote.
Das Leben auf Stromboli und Sizilien war hart, und die meisten Jungen, die das Alter von 12 bis 14 Jahren erreichten, wurden nach Amerika, Kanada, Australien oder Neuseeland geschickt, um dort für Verwandte oder ehemalige Nachbarn zu arbeiten, die ihnen vorausgegangen waren. Mein Großvater mütterlicherseits, Salvatore (Sam) Rando, bildete da keine Ausnahme. Im Jahr 1904, im Alter von zehn Jahren, wurde er nach Wellington im Süden Neuseelands geschickt, um seinen Vater, den Fischhändler Giacomo Rando, zu unterstützen. Sechs Jahre später machte er sich auf den Weg nach New York, um im Obstladen eines Onkels zu arbeiten. Da ihm dieser keinen Lohn zahlte, kündigte er, fand eine Anstellung als Milchmann und schaffte es gar zum Manager der Reid Ice Cream Company in Brooklyn. Er erzählte mir, dass es auf den Milchfahrten oft so kalt war, dass er seine Jacke mit Zeitungen auskleidete.
Mein Großvater liebte das Meer und die Marine, und so heuerte er von 1917 bis 1919 als Matrose in der Küstenschutzreserve der US-Marine auf der USS Arizona an. Jahre später weinte er bitter, als er vom Untergang der USS Arizona und von dem Tod von 1177 Mann am 7. Dezember 1941 durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbour las. Aus einer zufälligen Begegnung mit einem Mitglied der Vanderbilt-Dynastie, deren Gründer »Eisenbahnkönig« Cornelius Vanderbilt einer der reichsten Unternehmer der US-amerikanischen Geschichte war, entwickelte sich eine Freundschaft und die Gründung seines Traums – ein »ConeyIsland-Mischgeschäft«, wie es meine Mum immer nannte –, das es ihm ermöglichte, während der Hauptsaison des Vergnügungsparks im Sommer sechs Monate in den USA und sechs Monate in Stromboli zu verbringen. Während dieser Besuche in Stromboli heiratete er und bekam drei Kinder, darunter meine Mutter, Carolina Rando. Mein Großvater war fest entschlossen, seine Frau und die drei Kinder mit nach New York zu nehmen, aber sein Vater, der sich inzwischen mit dem Rest der Familie in Melbourne, Australien, niedergelassen hatte, flehte ihn an, sich ihnen anzuschließen. Mum war sieben Jahre alt, als sie 1932 in Melbourne ankam.
Meine Mutter war eine ruhige, nachdenkliche Person und von frühester Kindheit an streng katholisch. Die Chiesa di San Vincenzo in Scari spielte nicht nur in ihrem Leben – sie wurde dort getauft und gefirmt –, sondern auch im Leben der Inselbewohner eine herausragende Rolle: Sie bot ihnen geistige Nahrung und physischen Schutz vor den vulkanischen Trümmern, die von Zeit zu Zeit auf ihre Seite der Insel niederregneten. Der Berg Stromboli befand sich in den letzten 5000 Jahren in fast ständiger Eruption. Meine Mutter erinnert sich noch gut daran, wie sie in die Kirche flüchtete, als der Vulkan am 11. September 1930 ausbrach. Es gilt als das heftigste und zerstörerischste Ereignis in den historischen Aufzeichnungen des Strombolis; der Ausbruch verursachte erhebliche Schäden und kostete drei Einwohnern das Leben.
*
Mein anderer Großvater Giuseppe Rinaudo wanderte 1926 mit einem One-Way-Ticket nach Australien aus. Seine Frau Catarina, sein Sohn Gaetano (Tom) und seine Tochter Domenica sollten innerhalb eines Jahres nachkommen. Aber die Weltwirtschaftskrise führte zu einem Mangel an Arbeitsplätzen, und es sollte sieben Jahre dauern, bis er sie wiedersehen konnte. Er musste genug Geld aufbringen, um seine Passage nach Australien zurückzuzahlen, und dann genug sparen, um seine Familie herüberzubringen. »Nanu«, wie ich ihn nannte, nahm Jobs an, wo immer er Arbeit finden konnte – unter anderem beim Bau des Hume-Wehrs (heute Hume Dam) im Murray River und als Farmarbeiter. Wenn ich als Junge bei Nanu und Nanna wohnte, zündete sich Nanu nach dem Abendessen eine Zigarette an und redete. Ich mochte es nicht, wenn er rauchte, aber er erzählte mir, dass er in meinem Alter Wein in Fässern auf einem Eselskarren für die Taverne der Familie in Ramacca transportierte. Eines Tages schlief er ein und wurde plötzlich von einem Räuber geweckt. Zu seinem Glück brach er in Tränen aus, der Räuber hatte Mitleid mit ihm und ließ ihn unbehelligt weiterziehen. Von diesem Tag an begann er zu rauchen, um wach zu bleiben.
Eines Tages, ich machte wohl einen unglücklichen Eindruck, meinte Nanu, dass er die jungen Leute von heute nicht verstehe: »Ihr müsst nicht arbeiten, um eure Familie zu unterstützen, ihr habt alles bekommen, was man sich vorstellen kann, und trotzdem ist eure Generation unglücklich – zu viele nehmen Drogen und einige nehmen sich das Leben. Warum?« Er erzählte mir von seiner Erfahrung als Swagman – die australische Version eines Wanderarbeiters, der von Stadt zu Stadt auf der Suche nach Arbeit unterwegs ist.
»Nachdem ich den ganzen Tag gelaufen war, machte ich ein Feuer unter einer Brücke und schlief dort. Andere Swagmen, die mir völlig fremd waren, schlossen sich mir an, und wir teilten, was wir hatten, und genossen die Gesellschaft der anderen. Bis spät in die Nacht hinein gaben wir uns gegenseitig Hinweise, welche Orte wir meiden sollten und wo wir Arbeit oder Essen finden konnten. Wir erzählten uns Lügengeschichten und machten Witze, um uns die Zeit zu vertreiben. Wir hatten nichts, das Leben war hart, aber wir waren glücklich.« In den Jahren, in denen er auf der Straße lebte, so erzählte er mir, habe er nur einen einzigen Fall von Selbstmord gesehen. Ein Mann hatte sich unter einer Brücke erhängt, unter der er schlief.
Als Nanna 1933 in Australien ankam, bauten Nanu und sein Bruder Antonio als Pächter Tabak in Whorouly East im Ovens Valley an und verarbeiteten die Ernte. Sie hatten mit dem Farmbesitzer einen Vertrag abgeschlossen, der ihnen das Land und die Geräte für den Anbau der Ernte sowie die Unterkunft zur Verfügung stellte; dafür erhielt er die Hälfte des Gewinns. Tabakanbau ist arbeitsintensiv, aber sie schienen erfolgreich zu sein. Ich bekam eine Ahnung von dem Leben, das meine Großeltern in Italien zurückließen, als Nanna beschrieb, wie schockiert sie über die Menge an Essen war, die Nanu für die Empfangsparty für sie und die Kinder vorbereitet hatte, darunter große Platten mit verschiedenen Fleischsorten – Schwein, Rind und Huhn. Da Nanna es gewohnt war, sparsam zu leben und in Sizilien nur zweimal im Jahr Fleisch zu essen – zu Weihnachten und Ostern –, schimpfte sie über seine Extravaganz!
Nanna konnte stricken und häkeln, sie verstand es zudem, komplizierte Spitzenarbeiten herzustellen, und fertigte wunderschöne Strickjacken, Tischsets, Schals und Deckchen. Aber ihre Fähigkeiten hatten ihren Preis, denn ihre Stiefmutter war eine strenge Lehrmeisterin, die ihr bei jedem Fehler in die Finger zwickte. Während der einsamen Jahre des Wartens darauf, ihrem Mann nach Australien zu folgen, häkelte meine Großmutter vier Spitzendecken in Doppelbettgröße und musste den Spott ihres Vaters ertragen, dass Giuseppe sie verlassen hatte.
Vermutlich hatte Nanna nur die Grundschule besucht, denn sie konnte nur schlecht lesen, und sie war sich ihres niedrigen Bildungsniveaus bewusst. Trotzdem verletzte sie die Diskriminierung tief, die sie nach ihrer Ankunft in Australien erlebte. Wegen seines Akzents ausgelacht zu werden und Geschichten darüber zu hören, wie ihrem Mann oft die Arbeit verweigert wurde, weil er ein »wog«, ein Kanake, sei, erscheint gering im Vergleich zu der körperlichen Gewalt, die andere damals erlebt hatten, aber es brannte sich trotzdem tief ins Herz. Nanna sagte mir so oft »An-do-ny (Anthony), gettajoba-widda-suit-na-tie-a«. Ich konnte verstehen, warum sie das für mich wollte, aber ein Bürojob war das Letzte, was ich im Sinn hatte. Ich habe oft über die Weisheit und die Werte meiner Großeltern nachgedacht und über die Lebenslektionen, die sie mir durch ihre Geschichten vermittelt haben. Dazu gehört die Erkenntnis, dass arm zu sein die Menschen nicht davon abhält, stolz zu sein oder nach einem besseren Leben zu streben.
Wenn wir Enkelkinder schon Nannas Druck auf uns spürten, wie viel mehr wohl unser Vater? Wie es bei Migranten der ersten Generation oft üblich ist, drängte Nanna ihren einzigen Sohn dazu, »ein Mann zu sein und etwas aus seinem Leben zu machen«. Natürlich wollten sie etwas Besseres für ihren Sohn. Mein Vater wiederum war seinen Eltern treu ergeben, er liebte und umsorgte seine Familie. Als Inhaber von Buffalo Farm Equipment vertrieb er erfolgreich landwirtschaftliche Maschinen, bot einen Reparaturservice an und widmete sich mit Hingabe seinen Kunden.
Dad war acht Jahre alt, als er in Australien ankam. Begierig darauf, seinen Vater kennenzulernen, folgte er ihm in die Tabakfelder und musste mit einem Sonnenstich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Tag für Tag lief er fünf Meilen (8 km) zur örtlichen Schule, nachdem er acht Kühe gemolken, den Rahm abgetrennt und die Kälber auf der Farm gefüttert hatte. Die Mithilfe auf der Tabakfarm und die langen Stunden harter körperlicher Arbeit machten ihm klar, dass er kein Tabakbauer werden wollte. Seine Eltern waren zudem erpicht darauf, dass er eine Ausbildung absolvierte. Dad erzählte mir, wie Nanu ihm ein Weideland voller Bäume zeigte und sagte: »Ich werde alle kleineren Bäume auf dieser Koppel fällen, aber dieser sehr große Rote Eukalyptus in der Mitte ist für dich reserviert, wenn du deine Ausbildung nicht fortsetzt.« Nanu wollte seinem Sohn damit zu verstehen geben, dass Bildung ein Weg aus der Armut ist und um sich Respekt zu verschaffen. Der Rote Eukalyptus hat extrem hartes Holz, und der Baum kann einen Umfang von 4 m und mehr erreichen.
Mein Vater verstand etwas von Mechanik, er war erfinderisch, wissbegierig und ausgesprochen fleißig. Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und dem Abschluss seiner Lehre machte er sich mit einem Partner in Wangaratta, der Stadt an der Mündung des King River in den Ovens River, selbstständig. Sie warteten Autos und verkauften Modelle von Vanguard und Massey-Ferguson-Traktoren. 1952 gründete er Buffalo Farm Equipment in Myrtleford, 50 km südöstlich von Wangaretta und verkaufte dort International Harvester-Lastwagen und -Traktoren, Maschinen und Zubehör, die hauptsächlich auf die boomende Tabakindustrie ausgerichtet waren. Mein Dad bediente viele Landwirte in den umliegenden Tälern und im weiteren Umkreis; er war häufig auf Abruf unterwegs und reparierte kaputte Maschinen. Viele seiner Kunden waren gute Freunde, er half ihnen in der Not, wo und wann er konnte, und er war weit herum für seine Fairness und Ehrlichkeit bekannt.
Zwei meiner Brüder, Sam und Peter, übernahmen den Betrieb, als Vater 1990 in den Ruhestand ging. Peter verließ die Firma 2003 und gründete sein eigenes Ingenieurbüro »Mechanism«. Sam führt das Geschäft heute noch, aber es gibt keine Familienmitglieder, die übernehmen wollen. Seit der Tabakanbau im Bezirk eingestellt wurde, ist das Geschäft stark zurückgegangen. Im Gegensatz zu meinen drei Brüdern habe ich keinerlei technische Begabung, aber Dad nahm mich oft auf seine Fahrten mit, und ich liebte diese Ausflüge zu den Farmen. Während er damit beschäftigt war, Maschinen zu reparieren, ging ich angeln, plünderte Obstbäume, oder genoss es einfach, auf dem Land zu sein. Obwohl mein Vater es gerne gesehen hätte, wenn ich irgendwann in den Familienbetrieb eingestiegen wäre, lag meine Leidenschaft woanders.
Bei diesen Kundenbesuchen war Dad ein anderer Mensch – befreit von der Führung der rund 20 Mitarbeitenden, den vielen administrativen Aufgaben, komplizierten Kunden und den Sorgen, sein Geschäft am Laufen zu halten. Immer wenn er über Land fuhr, pfiff er beliebte italienische Canzoni: »O sole mio«, »Arrivederci Roma«, »That’s Amore«. Er war gern mit Menschen zusammen, und im Laufe der Jahre half er vielen bei ihren Problemen. Obwohl er immer versuchte, zeitlich viel unterzubringen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass er nach getaner Arbeit auch nur einmal einen Espresso und ein Schwätzchen ausgeschlagen hätte. Selbst wenn ich der Unterhaltung nicht folgen konnte, sobald sie auf Italienisch stattfand, konnte ich sehen, dass Dad in seinem Element war und die Leute ihn respektierten. Für gewöhnlich kamen wir beladen mit Obst und Gemüse nach Hause, das uns dankbare Farmer aus ihrem Anbau geschenkt hatten. Jahre später war ich einerseits überrascht, aber nicht verwundert, als ein Handelsvertreter im Ruhestand, der meinen Vater kannte, zu mir sagte: »Sie kommen ganz nach Ihrem Vater.« Ich liebe es ebenfalls, Bauern kennenzulernen und mich mit ihnen zu unterhalten. Diese Erfahrung kam mir zugute, als ich in der westafrikanischen Republik Niger lebte und eng mit vielen tausend Bauernfamilien zusammenarbeitete. Die Fähigkeit zu Freundschaft und Empathie, dazu, Vertrauen zu gewinnen, zuzuhören und zu versuchen, die Bedürfnisse anderer und den Grund für ihre Entscheidungen zu verstehen, sind mehr wert als alle Entwicklungstheorien der Welt zusammen.
Mein Vater war ein sehr guter, aber leider immer anderweitig zu beschäftigter Hobbygärtner. Viele Stunden verbrachte ich mit ihm in unserem großen Gemüsebeet, wo ich half, zusah und lernte. Genau wie er fand ich eine tiefe Zufriedenheit im Setzen von Pflanzen. Samstagabends verfolgte die Familie »Sow What« mit Kevin Heinze auf ABC Television. Als mein sehr praktisch veranlagter Dad die Sendung über Gewächshäuser sah, baute er aus dem Nichts sein Eigenes. Dafür verwendete er das Holz von Lattenkisten, in denen Maschinen verpackt gewesen waren.
Ich besaß nicht die emotionale Intelligenz, um die Stärke von Mums sanftem Wesen zu schätzen, und meine Sturheit machte ihr bisweilen sehr zu schaffen. Sie war der ausgleichende Pol zu Dad, dessen katholischer Glaube seinen prinzipienfesten, aber vielleicht auch pragmatischeren Ansatz zum Leben leitete.
Mums Gelassenheit – obwohl sie mit vier ungebärdigen Jungs und zwei Mädchen fertigwerden musste – sprach Bände über ihr Verständnis von Gottes Wesen. Mir gab ihre Haltung eine innere Struktur, die es mir ermöglichte, den Sinn des Lebens zu erfassen. Dass es einen Gott gibt, der uns liebt und für uns sorgt, und dass wir aus einem Grund auf dieser Erde sind, stand immer außer Frage. Ich wuchs mit dem Gefühl auf, dass wir für das Wohlergehen derer, denen es nicht so gut geht wie uns, Verantwortung tragen und dass wir dazu verpflichtet sind, uns um die Schöpfung – die Erde und alles, was auf ihr lebt – zu kümmern. Die ersten zwei Bücher, die Mum mir schenkte, waren eine Bilderbibel, die die in der Kirche und in der Schule gehörten Bibelgeschichten verstärkten, und ein Buch, das ich mir besonders gewünscht hatte, nachdem ich es in einer Buchhandlung gesehen hatte: ein Bilderbuch über Afrika. Mehr als jeder andere Kontinent zog mich schon früh die Wildheit, die Vielfalt und das Geheimnis Afrikas an.
*
Meine Leidenschaft für Geografie und Bücher über fremde Länder entdeckte ich in der St. Mary’s Grundschule in Myrtleford. Mrs Weston, meine Klassenlehrerin, schien dies zu bemerken und ermutigte mich zu lesen. Auch Dad sah meine Begeisterung, und da er die Interessen seiner Kinder immer nach bestem Vermögen förderte, brachte er an der Wand meines Zimmers Sperrholzplatten an, auf denen ich Landkarten aufhängen konnte. Schwang man eine der Platten zur Seite, kam darunter die nächste zum Vorschein und zeigte einen anderen Kontinent – Afrika, Europa und so weiter. Von meinem Bett aus konnte ich die Welt betrachten und träumen.
Nach der sechsten Grundschulklasse wurde ich auf das Champagnat College in Wangaratta geschickt; es ist ein Internat der Maristenbrüder, einer Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche. Das war keine einfache Zeit für mich, mir fehlten meine Familie und das Herumstreifen in der Natur. Ich war sehr still, gewann aber gute Freunde; zwar besaß ich kein Talent für Ballsportarten, aber ich war ein ganz guter Läufer und schaffte es immer in die Leichtathletikmannschaft, die jedes Jahr gegen andere Schulen auf der gummierten Olympia-Laufbahn in Melbourne, der Hauptstadt von Victoria, antrat.
Doch bald traf ich auf Bruder Gordon, ein sanfter Riese, der auf dem Schulgelände eine Herde MurrayGrey-Rinder hielt. Zusammen mit ein paar anderen Jungs half ich gerne auf seiner Farm, und dabei lernte ich, wie man Traktor fährt, Zäune errichtet, sich um kalbende Kühe kümmert und Bäume pflanzt. Es gelang mir sogar, Dad dazu zu überreden, mir eine Kuh zu kaufen, die er bei einem Freund auf dessen Farm gegen Geld weiden ließ! Diese Kuh sollte der Anfang meiner zukünftigen Herde sein, das Tier erwies sich jedoch als wild und stur und mein Potenzial als zukünftiger Rinderfarmer als äußerst gering!
Wenn nicht gerade Fußballsaison war, schienen die langweiligen Wochenenden kein Ende zu nehmen, und so bat ich beim College um Erlaubnis, einen Angel-Club zu gründen, wobei mich Bruder Gordon unterstützte. Nach einem Angel-Nachmittag mit einem halben Dutzend anderer Internatsschüler eine Tasse von Bruder Gordons Version von »Billy Tea« zu trinken war der Abschluss eines perfekten Tages. Dazu nehme man eine Petroleumdose (den »Billy«), fülle sie mit Wasser und hänge sie über loderndes offenes Feuer, bis das Wasser wild sprudelt. Man werfe zwei Handvoll Tee hinein (Teebeutel waren bei uns noch nicht üblich), und fünf Handvoll Zucker – Bruder Gordons tief zerfurchten Hände hatten die Größe von Esstellern! Dann gebe man Milch hinzu. Man breche einen kleinen Ast vom nächstgelegenen Eukalyptusbaum, schlage ihn gegen den nächstgelegenen Pfosten, um ihn von Staub und Insekten zu befreien, dann rühre man damit den Tee kräftig um. Ich weiß nicht, ob es die Kameradschaft war, das Gefühl, mit der Welt im Einklang zu sein, wenn man mit seinen Freunden im Busch war, oder Bruder Gordons Rezept – aber es war der beste Tee, den ich jemals getrunken habe. An heißen Tagen, wenn wir alleine waren und die Fische nicht anbeißen wollten, ergriffen wir Jungs die Gelegenheit, uns unserer Klamotten zu entledigen und nackt zu baden – glücklicherweise fanden das die Brüder niemals heraus!
Während ein paar der Ordensbrüder als soziale Außenseiter beschrieben werden können, liebte der größte Teil die Jungs, die sie unterrichteten, und sie liebten Gott. Ihr beispielhaftes, von Selbstaufopferung geprägtes Leben beeindruckte mich, und zumindest für eine kurze Zeit trug ich mich ernsthaft mit dem Gedanken, ihrem Orden beizutreten. Doch das war nicht der Weg, den Gott für mich vorgesehen hatte.