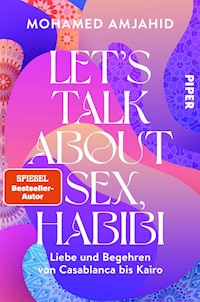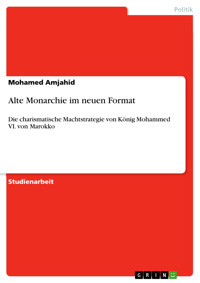Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie erlebt jemand Deutschland, der dazugehört, aber für viele anders aussieht? Mohamed Amjahid, Sohn marokkanischer Gastarbeiter und als Journalist bei einer deutschen Zeitung unfreiwillig "Integrationsvorbild", wird täglich mit der Tatsache konfrontiert, dass er nicht-weiß ist. Er hält der weißen Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vor und zeigt, dass sich diskriminierendes Verhalten und rassistische Vorurteile keineswegs bloß bei unverbesserlichen Rechten finden, sondern auch bei denen, die sich für aufgeklärt und tolerant halten. Pointiert und selbstironisch macht er deutlich, dass Rassismus viel mit Privilegien zu tun hat – gerade wenn man sich ihrer nicht bewusst ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wenn er sich in der U-Bahn neben eine Frau setzt, umklammert diese plötzlich ihre Handtasche. Am Flughafen wird er regelmäßig von Polizisten zur Routinekontrolle herausgepickt. Und eine Flüchtlingshelferin am Münchner Hauptbahnhof erklärt ihm, wie man Seife benutzt. Mohamed Amjahid, Sohn marokkanischer Gastarbeiter und als Journalist bei einer deutschen Zeitung unfreiwillig »Integrationsvorbild«, kann von vielen solcher Situationen berichten, die Nichtweiße wie er in der biodeutschen Mehrheitsgesellschaft täglich erleben. Ob skurril, empörend, peinlich oder ungewollt paternalistisch – diskriminierendes Verhalten und rassistische Vorurteile finden sich keineswegs bloß bei unverbesserlichen Rechten, sondern auch bei denen, die sich für aufgeklärt und tolerant halten. Pointiert und selbstironisch zeigt Amjahid, dass Rassismus viel mit Privilegien zu tun hat – gerade wenn man sich ihrer nicht bewusst ist.
Hanser Berlin
Mohamed Amjahid
Unter Weißen
Was es heißt, privilegiert zu sein
Hanser Berlin
ISBN 978-3-446-25632-3
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2017
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München © Götz Schleser
Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de .
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für alle Anderen
Inhalt
1 Worum es (mir) geht
2 Die Erfindung des Anderen
3 Ausgesprochen rassistisch
4 Aber Roberto Blanco hat gesagt …
5 Auch die Passfarbe zählt
6 Hilfe! Weiße wollen mein Leben retten!
7 Wer regiert die Welt?
8 Wenn zwei sich streiten, freut sich der Weiße
9 Welches ist das weißeste Land Europas?
10 Enkelkind mit blauen Augen
11 Von »white trash« und »weißer Überlegenheit«
12 Der ultimative Selbsttest: Wie weiß sind Sie?
Dank
Anmerkungen
1 Worum es (mir) geht
Es fällt mir schwer, dieses Buch zu schreiben, und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass ich es schreiben muss. Fast jeder Tag in Deutschland, fast jede Reise in Europa liefert mir Gründe dafür. Wenn ich mich zum Beispiel in der U-Bahn neben eine Frau setze und sie plötzlich ihre Tasche fest umklammert. Wenn mich schon wieder ein Polizist am Bahnhof zur Routinekontrolle herauspickt. Oder wenn ich bei einer Wohnungsbesichtigung gegen eine Bafög-Empfängerin aus Schwaben den Kürzeren ziehe und mir die Maklerin danach am Telefon erklärt: »Ich habe Ihren Namen gesehen und dachte, Sie seien arbeitslos.«
Solche Erfahrungen mache ich derart häufig, dass ich nicht mehr an Zufall glaube. Immer wieder habe ich mich gefragt, woran es wohl liegen mag: Hat es etwas mit meinem Aussehen zu tun? Mit meinem Namen? Mit meiner Herkunft? Mache ich etwas falsch? Oder bin womöglich gar nicht ich das »Problem«, sondern es sind andere, weil sie ein Problem mit mir haben?
Meine Eltern kamen in den sechziger Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Mein Vater schuftete im Schichtbetrieb am Fließband, meine Mutter in Teilzeit als Reinigungskraft. Wir lebten dennoch in ärmlichen Verhältnissen in einer engen Dachgeschosswohnung im Frankfurter Arbeiterviertel Hoechst. Meine Eltern entschieden sich 1995, als ich sieben Jahre alt war, mit meinen zwei älteren Schwestern und mir in ihre Heimat Marokko zurückzukehren.
»Sie haben in Deutschland andauernd auf uns herabgeschaut«, erklärte uns unsere Mutter damals immer wieder. »Wir waren Ausländer, egal, was wir gemacht haben«, sagt sie heute noch. Ich selbst habe dann zwölf Jahre in der mittelmarokkanischen Stadt Meknès die Schule besucht und bin nach dem Abitur wieder nach Deutschland zurückgekommen, um hier zu studieren. Wenn ich mich mit migrationspolitischen Termini beschreiben müsste, so bin ich zweite und erste Einwanderergeneration in einer Person.
Gleichzeitig kann ich mich nicht mit den Gastarbeitern vergleichen, die einst unter ganz anderen Bedingungen nach Deutschland migrierten. Von vornherein war damals klar, welche Position sie in der deutschen Gesellschaft einnehmen sollten – nämlich die ganz unten. Als Jugendlicher war ich wütend auf meine Eltern und den radikalen Bruch mit unserem Umzug nach Marokko. Inzwischen habe ich mehr Verständnis für ihre Entscheidung, die meine Welt von einem Tag auf den anderen aus den Angeln hob, auch wenn ich heute sicher weitaus weniger bürokratische Kämpfe austragen müsste, wenn wir Deutschland damals nicht verlassen hätten. Die Wut meiner Pubertät wich mit meiner Volljährigkeit einer Neugierde, diese segregierte Welt zu verstehen. Ich wollte wissen, wie es zu der Art von gesellschaftlicher Ausgrenzung kommt, wie sie etwa meine Eltern erfahren haben, und herausfinden, was oder wer darüber (mit-)entscheidet, ob eine Person oben oder unten landet. Die Ergebnisse meiner Recherche und der Überlegungen, die in dieses Buch einfließen, bedürfen an vielen Stellen sicher einer weiterführenden Auseinandersetzung; trotzdem helfen sie mir zu verstehen, warum meine Eltern damals gegangen sind. Ich bewege mich heute überwiegend in anderen gesellschaftlichen Kreisen als sie damals, aber viele Diskriminierungen, denen sie seinerzeit ausgesetzt waren, erlebe ich auch heute noch in Deutschland auf ähnliche Weise. Und ich bin nicht allein mit meinen Erfahrungen. Vielen ergeht es so wie mir, und genau deswegen schreibe ich dieses Buch.
Rassismus ist eine Ideologie, die besagt, dass bestimmte Menschen mit bestimmten äußerlichen Merkmalen weniger wert sind als andere Menschen. Rassismus geschieht zugleich ganz konkret, nebenbei, unbewusst, gedankenlos. Ohne nachzudenken, beurteilen wir Menschen nach Kategorien wie Name, Muttersprache, Herkunft, sichtbarer Religionszugehörigkeit oder Hautfarbe. Das ist eine anthropologische Konstante. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich mit der Erforschung von Vorurteilen, etwa die Soziologie, die Psychologie, die Geschichts- und Kulturwissenschaften. Dabei werden jeweils unterschiedliche Ansätze verfolgt. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass Menschen Rassismus evolutionär erlernt haben.1 Andere, dass Menschen Rassismus quasi in ihrer DNA tragen.2 Wieder andere Forscher wollen bewiesen haben, dass Vorurteile ein rein psychologisches Problem sind und dass stereotypes Denken über Minderheiten mit den eigenen Minderwertigkeitskomplexen, dem eigenen Drang nach Abgrenzung und der Suche nach gesellschaftlicher Bestätigung zu tun hat.3 Sosehr sich diese und andere Erklärungen unterscheiden, eines bleibt unumstritten: Wir alle hegen rassistische Vorurteile. Auch ich. Niemand ist frei von Rassismus.4
Schon im Kindergarten sollen wir Angst vor dem »schwarzen Mann« haben und wegrennen. Bis wir irgendwann wirklich Angst vor schwarzen Menschen empfinden. Wir lernen Rassismus über Fernsehserien, in denen Araber stets Terroristen spielen, Frauen mit Kopftüchern immer bildungsfern sind, Asiaten meistens kichern. Irgendwann sagen wir uns dann: »Die sind so.«
Mich erreichen regelmäßig Leseempfehlungen mit dem Hinweis auf die Rückständigkeit dessen, was einige meiner Leser für meine Kultur halten. Ich werde in Kommentaren in sozialen Medien darüber belehrt, dass die europäische Aufklärung mit ihren bekannten Vordenkern ausschließlich für Toleranz, Rationalität und Weltoffenheit steht. Dabei habe ich mich schon für mein marokkanisches Abitur beispielsweise mit dem Werk Voltaires beschäftigt, um dort unter anderem auf folgende Aussage zu stoßen: »Die Weißen sind den Negern überlegen. So wie die Neger den Affen, und die Affen wiederum Austern überlegen sind.«5
Doch es sind nicht allein solche nach wie vor hartnäckig gepflegte Phantasien »weißer Überlegenheit«, die Menschen wie mir das Leben schwermachen. Ein anderer wichtiger Aspekt, auf den ich bei meiner Suche gestoßen bin, sind Privilegien. Damit meine ich Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen, die einen Menschen überhaupt erst in die Lage versetzen, über sich, aber eben auch über andere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, ob ein Kind auf ein Gymnasium oder auf eine Hauptschule gehen soll. Ob ein Mensch eine Wohnung bekommt. Oder ob ein Migrant mit Respekt behandelt wird. Privilegien können subtil, unsichtbar, selbstverständlich sein. In diesem Buch will ich sie sichtbar machen und in ihrer Selbstverständlichkeit hinterfragen. Denn eines ist klar: Nur wer relativ zu anderen privilegiert ist, kann überhaupt rassistisch handeln. Oder anders gesagt: Rassismus muss man sich erst mal leisten können.
Ich bin selbst relativ zu anderen Menschen deutlich besser gestellt, gegenüber Geflüchteten zum Beispiel. Dass ich mir dessen bewusst bin, hilft mir sehr bei meiner Arbeit als Reporter, der sich unter anderem mit den Themen Flucht und Migration beschäftigt. Ehrlichkeit gegenüber sich selbst ist eine Voraussetzung, um nach außen glaubhaft seine Standpunkte zu vertreten und ernsthaft Veränderungen einzufordern. Es geht also nicht um den Verzicht auf Privilegien, sondern darum, sich zu positionieren und die Missstände zu benennen. Es geht darum, die Diskriminierungen der »Anderen« überhaupt zu sehen und dann abzubauen.
Ich kenne ein Spiel6, mit dem man herausfindet, ob man mehr oder weniger privilegiert ist. Eine Gruppe von zehn bis fünfzehn Leuten stellt sich in einer Reihe in der Mitte eines Raumes oder irgendwo im Freien auf. Hauptsache, es gibt genügend Platz nach vorne und nach hinten. Der Moderator liest dann sogenannte Privilegien-Fragen vor. Wer mit JA antworten kann, darf einen Schritt nach vorne machen. Bei einem NEIN muss man einen Schritt zurück gehen. Ein paar exemplarische Fragen wären etwa:
Haben Sie einen festen Wohnsitz?
Sind Sie bislang von sexueller Belästigung verschont geblieben?
Gehen Sie einer geregelten Erwerbstätigkeit nach?
Können Sie problemlos und legal Ihren Wunschpartner heiraten und gemeinsam ein Kind adoptieren?
Es können beliebig viele Fragen gestellt werden, die alle relevanten Bereiche von Diskriminierung und Privilegierung in unserer Gesellschaft abdecken: Geschlecht, sexuelle Identität, Bildungsstand, Wohnsituation, Gesundheitsstatus und so weiter. Viele Fragen betreffen die Diskriminierung oder Privilegierung aufgrund der Hautfarbe oder einer Migrationserfahrung:
Werden Sie von der Polizei ignoriert, wenn Sie an Bahnhöfen und Flughäfen unterwegs sind?
Behandeln andere Sie wie jemanden, der selbstverständlich zu Deutschland gehört?
Können Sie problemlos ins Ausland reisen?
Haben Sie uneingeschränkten Zugang zu Sozialsystemen? Zum Beispiel zur Arbeitslosenhilfe?
Am Ende stehen die Teilnehmenden meist verteilt und weit auseinander: ganz vorne die Privilegierten, ganz hinten die Benachteiligten. Ich habe das Spiel unter anderem einmal bei einem Bildungstag im Roten Rathaus in Berlin mit Schülern durchgespielt, darunter etliche mit Migrationshintergrund. Am Anfang verteilte ich Kärtchen mit fiktiven Personenbeschreibungen: Einzelkind mit zwei Akademikereltern, Kind einer Gastarbeiterfamilie, Tochter einer Kassiererin und eines Lastkraftfahrers, Sohn einer afghanischen Flüchtlingsfamilie, Halbwaise, deren Mutter Hartz-IV-Empfängerin ist. Die Schüler sollten sich in die jeweiligen Rollen versetzen und die Fragen entsprechend beantworten. Auf diese Weise sollte kein Kind denken, es sei ein Verlierer, wenn es ganz hinten landet. Der große Abstand zwischen denen, die am Ende ganz weit vorne standen, und denen ganz hinten hat alle erstaunt und zum Nachdenken gebracht – was ja der Sinn der Übung ist.
Mir selbst ist das Privilegien-Spiel zum ersten Mal vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung mit Studierenden begegnet. Unsere Antworten – also auch die Schritte vor und zurück – bezogen sich allerdings auf unsere wahren Identitäten. Ich landete auf dem vorletzten Platz in der Privilegien-Skala, vor einer pakistanischen Studentin aus einer Familie mit Fluchtgeschichte. Sie trug ein Kopftuch und stand am Ende buchstäblich mit dem Rücken zur kalten Betonwand und brach in Tränen aus. Interessanterweise wirkten aber auch diejenigen, die nach all den Fragen zu Herkunft, Akzeptanz, Reisefreiheit oder Racial Profiling (also der Praxis vieler Sicherheitsbehörden, Menschen nach ethnischer Zugehörigkeit zu kontrollieren) weit vorne landeten, mit dem Ergebnis etwas überfordert. Fast alle von ihnen waren in Deutschland geboren und hatten deutsche Eltern. Plötzlich als Gruppe definiert zu werden war für sie ungewohnt.
Ebenfalls vor wenigen Jahren schnappte ich zum ersten Mal das Wort »biodeutsch« auf. Ich weiß nicht mehr genau, wo, sondern nur, dass ich es auf Anhieb äußerst nützlich fand. Während es für Menschen wie mich, die in Deutschland leben, deren Eltern aber keine Deutschen sind, alle möglichen Begriffe gibt – Deutscher mit Migrationshintergrund, Ausländer, Zuwanderer, Migrant, Deutschmarokkaner, Deutscher mit marokkanischen Wurzeln, marokkanischstämmiger Deutscher usw. –, fehlt ein griffiges Wort für die große Gruppe all der in Deutschland lebenden Menschen, die übrig bleiben, wenn man die Zahl derer mit Migrationshintergrund von der Gesamtbevölkerung abzieht. Der Begriff »biodeutsch« benennt endlich etwas, das in all den Diskussionen um Zuwanderung und Integration meist unsichtbar im Hintergrund bleibt: jene Mehrheit, die die »selbstverständliche« Norm vorgibt und die definiert, wer oder was »anders« ist. Von Migranten und ihren Kindern ist in den Medien hingegen ständig die Rede, unzählige Publikationen und Forschungsprojekte in der seit Jahrzehnten andauernden Integrationsdebatte beschäftigen sich mit denjenigen, die hier als Nichtdeutsche leben. In Deutschland gibt es rund 16,4 Millionen Bewohner mit Migrationshintergrund.7 Es bleiben also rund 65 Millionen Biodeutsche übrig – und vor allem um sie soll es in diesem Buch gehen.
Würden wir das Privilegien-Spiel in Frankreich, in den USA oder gar auf globaler Ebene durchführen, stünden die meisten Menschen mit weißer Hautfarbe eher vorne, der Rest würde verteilt im Raum landen. Wäre es bei uns in Deutschland wirklich anders? Ich fürchte, nein. Die Aufteilung in Weiße und Nichtweiße ist hier nach meiner Erfahrung, von der ich in diesem Buch berichten will, genauso virulent und prägend. Das Kriterium Hautfarbe im Zusammenhang mit Diskriminierung und Rassismus zu thematisieren ist hierzulande aber zumindest ungewöhnlich und dürfte von manchem als Provokation verstanden werden. Rassismus und Kolonialismus sind aber europäische Traditionen, und wir in Deutschland können uns da nicht als immun bezeichnen.
Die Frau in der U-Bahn sieht in mir einen nordafrikanisch aussehenden und daher gefährlichen Mann. Der Polizist assoziiert mit meinen schwarzen Haaren und dichten Augenbrauen eine Terrorgefahr oder zumindest kriminelle Energie und illegale Migration. Die Immobilienmaklerin wiederum denkt, dass alle Mohameds in Berlin arbeitslos sind. Tatsache ist: Alle drei waren Weiße. Ihr Verhalten mir gegenüber deutet darauf hin, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie selbst die Erfahrung gemacht haben, grundlos als kriminell, gefährlich oder faul dargestellt zu werden. Überhaupt müssen sie kaum je befürchten, dass ihnen wegen ihres Aussehens – noch konkreter: wegen ihrer Hautfarbe – irgendwelche Nachteile entstehen. Sie und die biodeutsche Mehrheit sind sich ihrer Privilegien allzu oft gar nicht bewusst – und somit auch nicht der Tatsache, dass und wie schnell sie zur Diskriminierung der vielen »Anderen« beitragen. Insofern soll es in diesem Buch auch nicht so sehr um mich oder andere »Andere« gehen, sondern vielmehr darum, dieser biodeutschen Mehrheit – zu der vielleicht ja auch Sie gehören – den Spiegel vorzuhalten und ihr zu zeigen, wie sich ihre Geschichte des Rassismus, ihre Haltung und ihre Handlungen gegenüber denen auswirken, die nicht so sind wie sie und nicht so aussehen wie sie.
Die sogenannte Mitte-Studie erfasst seit dem Jahr 2000 regelmäßig »gruppenbezogene menschenfeindliche Tendenzen in der Mitte der deutschen Gesellschaft«8. Die repräsentative Langzeitstudie zielt damit auch auf das gutverdienende, gebildete, biodeutsche Milieu. Das Fazit mehr als 15 Jahre nach Beginn der Erhebung: »Rechtsextremes Denken ist in allen Teilen der Gesellschaft in erheblichem Maße verbreitet.« Zur konkreteren Anschauung einige Ergebnisse der Studie aus dem Jahr 20169: 21,9 Prozent der befragten Deutschen stimmen zu, dass »Deutschland eine einzige starke Partei braucht, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert«; 10,9 Prozent sehen weiterhin einen »zu großen Einfluss der Juden«; 33,8 Prozent der Befragten stimmen zu, dass »Ausländer die Bundesrepublik in einem gefährlichen Maße überfremden«; 41,4 Prozent wollen »die Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland untersagen«; 40,1 Prozent finden es »ekelhaft, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen«; und 58,5 Prozent sind sich sicher, dass »Sinti und Roma zur Kriminalität neigen«. Wie der Name der Studie schon verrät: Diese Auffassungen finden sich in der Mitte und nicht an den Rändern der Mehrheitsgesellschaft.
Es geht mir also explizit nicht um Nazis, NPD-Funktionäre oder Rechtspopulisten und längst nicht bloß um AfD-Wähler. Es ist kinderleicht, über Rechtsextreme zu schimpfen, und Rassisten sind sowieso immer nur die anderen. Wer so denkt und redet, ignoriert bewusst oder unbewusst den eigenen Rassismus.
Die meisten Biodeutschen setzen sich mit der eigenen Position und den damit verbundenen Privilegien kaum je auseinander und zementieren so den Status quo. Bei dem Privilegien-Spiel landen sie schließlich immer auf den vorderen Plätzen – häufig genug allein deshalb, weil sie Weiße sind. Die »Anderen« landen dagegen ganz hinten, vor allem weil sie keine weiße Hautfarbe besitzen.
Nun, wie schon erwähnt, es fällt mir nicht leicht, aber ich glaube, ich habe bzw. wir da auf den hinteren Plätzen haben ihnen – Ihnen – etwas zu sagen.
2 Die Erfindung des Anderen
Youssef war seit gut drei Monaten in Deutschland. An seiner ersten Silvesterfeier in Europa wollte er nur noch vergessen, woher er kam und was hinter ihm lag – vor allem die Erinnerungen an seine Reise von Casablanca nach Köln: Wie sein alkoholabhängiger Vater ihn, seine Schwester und seine Mutter am Tag seiner Abreise verprügelt hatte, wie er in der Meerenge von Gibraltar kilometerweit nach Norden geschwommen war, sich schließlich auf halbem Weg an eine Passagierfähre geklammert hatte und dabei fast von der Schiffsschraube erfasst worden wäre, wie er dann in Spanien von einer Mafiabande beherbergt worden war, für sie harte Drogen verkauft hatte, um seine Weiterfahrt zu finanzieren, und wie er schließlich in Paris unter einer Brücke übernachtet hatte. Das alles und noch viel mehr sollte mit dem Jahreswechsel der Vergangenheit angehören. Youssef hatte sich viel für das Jahr 2016 vorgenommen: Deutsch lernen, seinen Aufenthalt in Deutschland irgendwie legalisieren, eine Arbeit finden.
Doch es kam anders. Schon am frühen Nachmittag des 31. Dezember 2015 hatte der hagere, junge Mann mehrere Liter Bier und dazu eine halbe Flasche Wodka getrunken. Um kurz vor 17 Uhr hatte er dann mit einem Kumpel, den er in einer Notunterkunft für Geflüchtete kennengelernt hatte, einen Joint geraucht und ein paar bunte Pillen eingeworfen. Welche Drogen er da genau genommen hatte, wusste er später nicht mehr.
Während um ihn herum die Menschen nicht bis Mitternacht warten wollten und anfingen, ihre Feuerwerkskörper auf der Kölner Domplatte in alle Richtungen abzufeuern, fühlte er sich im wahrsten Sinne des Wortes nur noch high. »Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, außer dass diese Flasche aus dem Rucksack ragte – und mich anlächelte«, sagt Youssef heute. Er griff nach dem Flaschenhals und wollte das 25-Cent-Pfandgut aus der Tasche einer bis heute unbekannten Person ziehen. Ein Zivilpolizist, der zufällig neben ihm stand, ertappte ihn dabei auf frischer Tat, Youssef versuchte abzuhauen, wurde aber schnell von dem Beamten und zwei seiner Kollegen überwältigt und festgenommen.
In jener Nacht wurden aber auch ungleich schwerere Straftaten begangen. Kurz nach Silvester war bekannt geworden, dass es in Köln zu zahlreichen sexuellen Übergriffen gekommen war. Der Aufschrei in Deutschland war groß, und so begann ich zusammen mit neun weiteren Reportern für das ZEITmagazin zu recherchieren, was in der Nacht zum 1. Januar 2016 rund um den Kölner Hauptbahnhof genau geschehen war. Im Rahmen unserer Nachforschungen kümmerte ich mich um das Milieu der mutmaßlichen Täter: eine spezifische Gruppe junger Marokkaner und Algerier mit krimineller Vorgeschichte, Suchtproblemen, teils überholten Vorstellungen von Männlichkeit und ohne gültigen Aufenthaltsgrund in Deutschland. Youssef, den ich in diesem Zusammenhang mehrere Monate lang intensiv begleitete, hatte ich über einen engagierten Kölner Pflichtverteidiger kennengelernt, der es begrüßte, dass wir die Geschichte seines Mandanten journalistisch aufarbeiten wollten.
Im Unterschied zu anderen Tätern, mit denen ich gesprochen habe, ist bei Youssef inzwischen juristisch bewiesen, dass er in der Kölner Silvesternacht keine Frauen belästigt hat. Schon als ich ihn zwischendurch im Gefängnis besucht hatte, stellte er schlüssig dar, was in jener Nacht aus seiner Perspektive passiert war: Er hatte versucht, die Pfandflasche zu klauen, und war danach vor den Polizisten, die er in ihrer Zivilkleidung nicht als Beamte erkannt hatte, weggerannt. Beide Vorwürfe gab er später vor Gericht reumütig zu. Die Beweise und Zeugenaussagen unterstützten Youssefs Geständnis.
Nach dreieinhalb Monaten Untersuchungshaft wurde Youssef schließlich im April 2016 wegen versuchten Diebstahls einer Pfandflasche und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. In seinem Schlusswort im trostlosen Saal Nummer 18 des Kölner Amtsgerichts wandte sich der Richter minutenlang direkt an den Angeklagten. Er sprach über »Menschen wie Sie« und benutzte auffallend viele Sätze mit dem Personalpronomen »wir«: »Wir tolerieren Menschen wie Sie nicht« oder »Menschen wie Sie werden bei uns nie auf einen grünen Zweig kommen«. Ich sitze nicht oft in deutschen Gerichtssälen, doch bei dieser Verhandlung war für jeden erkennbar, dass Youssef für den zur Neutralität verpflichteten Richter nicht als Individuum, sondern stellvertretend für eine ganze ethnische Gruppe auf der Anklagebank saß. Offenkundig schlug sich die aufgrund der Kölner Ereignisse aufgeheizte Stimmung in Deutschland und mit ihr ein vollkommen eindimensionales Täterbild in der Perspektive des Richters und in seinem harten Urteil nieder.
Als der Richter von »Nordafrikanern« sprach, pauschal über »die anderen« herzog, über »unsere Zivilisation« referierte, hielt ich kurz den Atem an. Aber nicht nur weil ich empört war, sondern weil mir in dem Moment etwas über mich selbst klarwurde: Der vorurteilsgeladene Diskurs in Deutschland war so mächtig, dass sich einige von seinen stereotypen Bildern für kurze Zeit sogar in meinem Kopf festgesetzt hatten. Da waren auf der einen Seite die gewalttätigen Marokkaner, Algerier und Tunesier, die ich fieberhaft in Nordrhein-Westfalen, Belgien und Frankreich gesucht habe, und auf der anderen Seite die biodeutsche Gesellschaft, die plötzlich über Gewalt gegen Frauen schockiert war, so als würde es ohne Nordafrikaner keine sexualisierte Gewalt in Deutschland geben. Eigentlich war ich nach unzähligen Interviews und Begegnungen der Meinung gewesen, ein immer klareres Bild der Täter und der Opfer zu erkennen. Nun, im Gerichtssaal, schien das alles aber irgendwie nicht mehr ganz zu stimmen. Die Welt ist eben nicht »schwarz und weiß« und lässt sich auch nicht immer eindeutig in Täter und Opfer einteilen, erst recht nicht gemäß der Hautfarbe.
Nach Prozessende holte ich Youssef am Hintereingang des Gerichts ab und ging mit ihm zum nächsten U-Bahnhof. Auf dem Weg fragte ich ihn, wie er den Prozess erlebt habe. Youssef zuckte mit den Schultern und fragte zurück, ob ich eine Zigarette für ihn hätte. Wir machten also kurz in einem Tabakladen halt, wo er mir erklärte, dass die Gerichtsverhandlung für ihn wie ein modernes Theaterstück gewesen sei: surreal, unverständlich, diffus. Trotz des Übersetzers, der ihm die ganze Zeit ins Ohr geflüstert habe, habe er nicht verstanden, warum der Richter ständig von Nordafrikanern im Plural sprach. Wie sich nun herausstellte, hatte im Gefängnis zwar ein anderer Insasse Youssef von den sexuellen Übergriffen erzählt, ihm war aber schlichtweg nicht klar gewesen, welche Diskussion dadurch in Deutschland ausgelöst worden war und dass er mit allen anderen in eine Schublade gesteckt wurde.
Das Kölner Aprilwetter spielte verrückt. Wind, Sonne und Regen wechselten sich im Minutentakt ab, und nachdem Youssef vor dem Eingang zum U-Bahnhof Neumarkt rasch fertiggeraucht hatte (»In Deutschland meinen sie es ernst mit dem Rauchverbot. Ich will nicht noch mal drei Monate ins Gefängnis wandern.«), stiegen wir in den Untergrund hinab und warteten auf den nächsten Zug. Nach und nach strömten immer mehr Fahrgäste auf den Bahnsteig. Auf einmal tauchten vier Securitymänner der Kölner Verkehrsbetriebe auf und postierten sich im Gedränge unmittelbar neben uns. Nachdem sie uns kurz gemustert hatten, meinte der Oberwachmann zu seinen Kollegen: »Ich wette, die fahren zum Hauptbahnhof: klauen oder grapschen.« Offensichtlich ging er davon aus, dass wir kein Deutsch verstanden. Für Youssef, der erst seit wenigen Monaten in Deutschland lebte, traf das zwar zu, doch sogar er merkte sofort, dass von uns die Rede war, denn er bat mich, für ihn zu übersetzen. »Die kommen jetzt alle hierher, um unsere Frauen zu vergewaltigen«, fuhr der Mann im Kölner Dialekt fort. »Maroks halt«, antwortete einer seiner Kollegen. Die Gruppe bestand augenscheinlich aus drei Biodeutschen und einem Deutschtürken, der mir besonders auffiel, weil er seinen Kollegen hektisch und etwas übertrieben zunickte.
Viele der umstehenden Fahrgäste bekamen die Konversation der Wachmänner über die grapschenden Nordafrikaner mit – doch niemand sagte etwas.
Irgendwann hatte ich genug davon, vor aller Augen und Ohren gedemütigt zu werden, und sprach die Wachmänner an. »Was soll Ihr rassistisches Gerede eigentlich?«, fragte ich. Sichtlich überrascht, fingen sie gleich an, sich zu rechtfertigen. »Es steht doch überall in den Medien, dass Nordafrikaner grapschen und klauen«, sagte ihr Anführer. »Leute erzählen so Geschichten«, fuhr er fort, und als würde er das ultimative Argument bringen, meinte er schließlich: »Wir beobachten das jeden Tag.« Seine zwei biodeutschen Kollegen meldeten sich nicht zu Wort, sondern ballten nur die Fäuste, wie um mir zu zeigen, dass sie zu allem bereit waren.
Ich warf dem türkischstämmigen Wachmann einen flehentlichen Blick zu und hoffte auf irgendein Zeichen von Reue oder Einsicht. Erstaunlicherweise distanzierte er sich dann tatsächlich von den Äußerungen der anderen – »Ich weiß nicht, was mich geritten hat« – und brachte seine Kollegen sogar dazu, auf eine weitere Eskalation zu verzichten. Gut möglich, dass er im Nachhinein noch Ärger dafür bekam. So unvermittelt, wie sie aufgetaucht waren, zogen die vier Männer plötzlich wieder ab. Während die Fahrgäste versuchten, sich in eine gerade eingefahrene Bahn zu drängeln, verschwanden sie Richtung Treppe und Ausgang. Man hätte fast meinen können, sie flüchteten.
Ausschließlich aufgrund unserer äußeren Erscheinung – als unverkennbar aus Nordafrika stammende Männer – hatten die Wachmänner Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit, unser Verhalten und unsere Intentionen gezogen. Aus dem, was sie sagten, und aus ihrem Tonfall sprach dann das, was ich »behauptete Realität« nenne. Sie entsteht, wenn Vorurteile lediglich auf Grundlage von Ressentiments formuliert und dann so oft wiederholt werden, dass eine kritische Masse an Menschen sie für bare Münze nimmt.
Zwar galten »Nafris«, wie Nordafrikaner im Polizeijargon schon lange genannt werden, in Deutschland noch nie wirklich als willkommene Mitbürger, nun aber wurden die Geschehnisse der Silvesternacht auf alle »Nafri«-Körper projiziert. Die behauptete Realität hieß nun: Nordafrikanisch aussehende Männer klauen, grapschen und vergewaltigen qua Kultur, qua Herkunft oder qua DNA unsere deutschen Frauen. Die Skizzierung des Nordafrikaners als idealtypischen, für die Allgemeinheit und die »deutschen Werte« gefährlichen Migranten zeigt anschaulich, wie ein Vorurteil auf eine ganze Bevölkerungsgruppe angewendet wird. Und ebendiese gesellschaftliche Verurteilung hatte auch ich nun zusammen mit Youssef im U-Bahnhof Neumarkt und anderswo am eigenen Leib zu spüren bekommen.