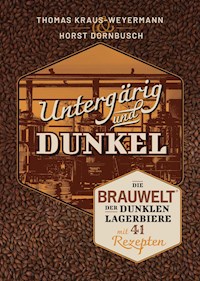
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fachverlag Hans Carl
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Untergärig und Dunkel ist ein einzigartiges Buch in der Bierliteratur. Es befasst sich ausschließlich mit einer der ältesten Biersorte der Welt, dem dunklen Lagerbier in all seinen Variationen. Diese Biergruppe verdankt ihren Ursprung einer einmaligen Kombination von klimatischen, biogeografischen, biogenetischen und politischen Zufällen, die sich in der Spätrenaissance im bayerischen Voralpenland abgespielt haben. Untergärig und Dunkel gehört in jede Bibliothek eines ernsthaften Bierliebhabers und Brauers. Die beiden Autoren, Thomas Kraus-Weyermann und Horst Dornbusch, sind weltbekannte Experten im Brau- und Mälzereiwesen. In ihrerer jahrzehntelangen Zusammenarbeit haben sie bereits fast jede Biersorte der Welt von der Antike bis zur Gegenwart gebraut und beschrieben. Thomas Kraus-Weyermann leitet zusammen mit seiner Frau Sabine die Weyermann®- Malzfabrik als weltweiter Marktführer in der Produktion von Spezialmalzen. Horst Dornbusch ist ein international gefragter Unternehmensberater in der Brauindustrie und ein Autor von fast 300 Artikeln in Fachzeitschriften und von acht Büchern über Bier auf Englisch und Deutsch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sabine und Elva
THOMAS KRAUS-WEYERMANN
HORST DORNBUSCH
Haftungsausschluss
Alle Angaben in diesem Buch wurden von den Autoren nach bestem Wissen erstellt und gemeinsam mit dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch lassen sich (im Sinne des Produkthaftungsrechts) inhaltliche Fehler nicht vollständig ausschließen. Die Angaben verstehen sich daher ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie seitens der Autoren oder des Verlages. Autoren und Verlag schließen jegliche Haftung für etwaige inhaltliche Unstimmigkeiten sowie für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar.
Verlag Hans Carl
© 2020 Fachverlag Hans Carl GmbH, Nürnberg
1. Auflage
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
Gestaltung: Wildner+Designer GmbH, Fürth
ISBN: 978-3-418-00928-5
eISBN: 978-3-418-00927-8
Inhalt
Ein Dankeschön
Geleitwort der Autoren: Unser erstes Treffen
Vorwort von Jim Koch, Samuel Adams Boston Brauerei
Vorwort von Dr. Martina Gastl, Technische Universität München
Vorwort von Dr. Josef Fontaine, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin
Vorwort von Garrett Oliver, Brooklyn Brewery
Vorab einige Begriffserklärungen
Ein Wort zum Reinheitsgebot
Definitionen
Umrechnungstabelle
Alphabetische Liste der Rezepte in den Kapiteln 7 bis 9
1.Als das Bier dunkel wurde
Die Geschichtlichkeit dunkler Biere
Blonde, obergärige Biere an der Wiege der Zivilisation
Die gesellschaftsbildenden Auswirkungen des Getreideüberschusses
Die sumerische Art des Brauens
Die Ausbreitung der sumerischen Braukunst
Das Ende des Bieres im Nahen Osten — und dessen Neugeburt in Mitteleuropa
Wie Dunkelheit (und Rauchgeschmack) ins Bier kamen
Die Rückkehr von Malz ohne Rauch
Die Rückkehr von Malz ohne Dunkelheit
Die Weiterentwicklung der Malztechnologie
Bierfreiheit!
Die dunkle Brauweise heute
2.Als das Bier untergärig wurde
Die Zeit der skrupellosen Bierpanscher
Dunkel: Der erste „echte“ Bierstil der Welt
Die manifesten und latenten Konsequenzen eines Feudaledikts
Eiszeit in der Renaissance und der Anfang einer neuen Bierkultur
Weizenbier: Die merkwürdige Ausnahme zur bayerischen Lagerbier Revolution
Bayerische Bierkultur: Ein zeitloses Erbe
3.Als die Cerevisiae mit dem Eubayanus
Von der Alchemie zur Wissenschaft: Das Verständnis der Hefe im Wandel der Zeit
Je mehr wir lernen, desto weniger scheinen wir zu wissen
Was geschah in Patagonien?
Das Wunder einer Mikroben-Migration
Transatlantische Vektorreise?
Vom Winde verweht?
Der Triumpf von Saccharomyces Pastorianus
Wissenschaftler holen die Brauer ein
4.Geschmacksprofile einiger klassischer, dunkler Lagerbiere
Bayerisches bzw. Münchner Dunkel
Schwarzbier
Böhmisches Dunkel
Dunkelbockbier und Dunkeldoppelbockbier
Rauchbier
Kellerbier
Kontinentaleuropäisches Porter
Mexikanisches Dunkel
5.Zutaten für dunkle Lagerbiere
Wasser
Hopfen
Hefe
Malz
Der moderne Keimkasten und die moderne Rösttrommel
Dunkle Malze für dunkle untergärige Biere
6.Sudhaus- und Gärkellerverfahren für dunkle Lagerbiere
Definitionen: Zwei idealtypische Maischeverfahren
Die Geschichte des Dekoktionsmaischens: Kaum Beweise, aber viele Vermutungen
Dekoktion: Die klassische Maischemethode
Dekoktion und die Maillard-Reaktion
Mehrstufen-Infusionsmaischen
Einstufen-Infusionsmaische
Die Gärung und Lagerung
Der Röstgeschmack: Die große Herausforderung beim Brauen dunkler Lagerbiere
Dunkle Farbmalzextrakte
7.Rezepte Teil 1: Klassische dunkle Lagerbiere
Rezept 1: Bayerisches/Münchner Dunkel I
Rezept 2: Bayerisches/Münchner Dunkel II
Rezept 3: Bayerisches/Fränkisches Dunkles Landbier
Rezept 4: Tmavý Ležák (Böhmisches Dunkel)
Rezept 5: Bayerisches Schwarzbier I
Rezept 6: Bayerisches Schwarzbier II
Rezept 7: Bamberger Hofbräu Schwarzbier
Rezept 8: Thüringer Schwarzbier
Rezept 9: Bayerisches Dunkelbockbier
Rezept 10: Bayerisches Dunkeldoppelbockbier I
Rezept 11: Bayerisches Dunkeldoppelbockbier II
Rezept 12: Bamberger Hofbräu Exquisator Dunkeldoppelbockbier
Rezept 13: Bamberger Rauchbier
Rezept 14: Bayerisches Dunkelkellerbier
Rezept 15: Deutsches Porter
Rezept 16: Baltic Porter (Baltisches Porter)
8.Rezepte Teil 2: Innovative Dunkle Lagerbiere
Rezept 17: Bayerisch-fränkisches trockenes Dunkel
Rezept 18: Bayerisch-fränkisches Dessert Dunkel
Rezept 19: Dunkles „Negra“ Wiener Lager
Rezept 20: Barke® Dunkles Wiener Lager
Rezept 21: Dunkelmärzen
Rezept 22: Dunkles Bauernlagerbier (Dark Farmhouse Lager)
Rezept 23: Birra Rossa
Rezept 24: Süffiges Dunkel („Session“ Dunkel)
Rezept 25: Barke® Sinamar® Dunkel
Rezept 26: Schlotfegerla® Bamberger Rauchbier
Rezept 27: Estländisches Baltisches Porter (Estonian Baltic Porter)
Rezept 28: Dunkelrauchdoppelbock
9.Rezepte Teil 3: Experimentelle Dunkle Lagerbiere
Rezept 29: „Schwarz-ator“-Triplebock
Rezept 30: „Imperial“ Fünf-Korn „Dinkel-Dunkel“
Rezept 31: Dunkles Lagerbier mit gerösteter Gerste, Kakao und Vanille
Rezept 32: Schwarzes Kaffee-Lagerbier
Rezept 33: Untergäriges Gersten-Weizen-Rauch-Starkbier
Rezept 34: „Imperial“ Barrique Rauchbock
Rezept 35: „Imperial“ Hafer-Schwarzbier
Rezept 36: Dunkles Sauergut-Lagerbier
Rezept 37: Dunkles Montmorency-Sauerkirschen-Lagerbier
Rezept 38: Dunkles California „Un-Common“ Lagerbier
Rezept 39: Spätrenaissance Bayerisches Dunkel
Rezept 40: „Hildegard-von-Bingen“-Bier aus dem Mittelalter
Rezept 41: American Imperial Hoppy Dunkel
10.Dunkle Lagerbiere in der Küche
Dunkle Lagerbiere als Zutat
Dunkle Lagerbiere als Speisebegleiter
Rezept I: Auberginen-Ziegenkäse-Terrine mit Kräuterbier-Dressing
Rezept II: Gemüse im Bierteig
Rezept III: Dunkle Kürbis-Lagerbier-Suppe
Rezept IV: Biersuppe
Rezept V: Biergulasch
Rezept VI: Carbonade à la Bavière
Rezept VII: Lamm (oder Schwein) in Rauchbier mariniert
Rezept VIII: Weihnachtsgans
Rezept IX: Thanksgiving Turkey (Truthahn) mit dunkler Lagerbiersoße
Rezept X: Spanferkel
Rezept XI: Roastbeef in dunkler Lagerbier-Senfsoße
Rezept XII: Braumeister-Steak
Rezept XIII: Dunkelbiersoße
Rezept XIV: Demi-Glace de bière selon Escoffier
Rezept XV: Garum nigrae cerevisiae:Eine Dunkeldoppelbock-Reduktion à la Apicius
Rezept XVI: Dunkle Lagerbier-Steaksoße
Rezept XVII: Gegrillte Champignons und Zucchini mit dunkler Lagerbierfüllung
Rezept XVIII: Birnen im dunklen Lagerbier pochiert
Quellen (nach Kapitel geordnet)
Register
Bildnachweis
Über die Autoren
Thomas Kraus-Weyermann
Horst Dornbusch
Ein Dankeschön
Dieses Buchprojekt wäre nicht ohne die enthusiastische Unterstützung vieler Freunde auf der ganzen Welt zustande gekommen, besonders da etwa die Hälfte der in den Kapiteln 7 bis 9 aufgeführten 41 klassischen, innovativen und experimentellen Bierrezepte, die speziell für dieses Buch konzipiert wurden, in 12 großen und kleinen Brauereien in den Vereinigten Staaten und in Kanada getestet und sensorisch bewertet wurden. Alle restlichen Rezepte wurden in der Braumanufaktur der Weyermann® Malzfabrik in Bamberg getestet. Unser Dank geht an diese Kollaborations-Brauereien, die ihre Tore großzügig für uns öffneten, in ihren Braukalendern für uns Platz machten und uns erlaubten, in Zusammenarbeit mit ihren Brauern und unter Benutzung ihrer Anlagen Biere nach unserem Entwurf zu brauen, selbst wenn diese Biere nicht unbedingt in ihre Sortimente oder Brauprogramme passten. Diese 12 Brauereien sind (in alphabetischer Reihenfolge):
1.Samuel Adams, Boston, Massachusetts. Dank an David Grinnell, Jim Carleton, Shelley Smith und Eryn Bottens für das Brauen eines klassischen, baltischen Porters sowie eines sehr experimentellen, mittelalterlichen, dunklen „Hildegard-von-Bingen“-Bieres, welches mit einer Mischung aus Hopfen und Gruit gewürzt und mit einer Mischung aus unter- und obergäriger Hefe vergoren wurde.
2.Microbrasserie Archibald, Lac-Beauport, Québec. Dank an Braumeister Frederick Moreau und die Brauer Pascal Nadeau und Jean-Simon Rancourt für das Brauen eines fränkischen, trockenen Dunkels und eines fränkischen Dessert-Dunkels.
3.Brasserie Dieu Du Ciel, Montréal, Québec. Dank an Inhaber und Braumeister Jean-François Gravel für das Brauen eines untergärigen, dunklen Rauch-Starkbieres mit einer Mischmaische aus Gersten- und Weizenmalz.
4.Fanatic Brewing Company, Knoxville, Tennessee. Dank an Inhaber und Braumeister Marty Velas für das Brauen von zwei Dunkeldoppelbockbieren unterschiedlicher Stärke.
5.Microbrasserie Farnham Ale & Lager, Farnham, Québec. Dank an Braumeister Jean Gadoua für das Brauen eines dunklen Lagerbieres mit gerösteter Gerste, Kakaopulver und Vanilleextrakt.
6.Flying Goose Brew Pub & Grill, New London, New Hampshire. Dank an Braumeister Rik Marley und Brauer Kyle Welch für das Brauen eines Bamberger Rauchbiers, eines schwarzen Tripelbockbieres, und eines starken, „Imperial“ Mehrkorn-Dunkels mit Malzen aus Gerste, Weizen, Hafer, Roggen und Dinkel.
7.Jack‘s Abby, Framingham, Massachusetts. Dank an Inhaber und Braumeister Jack Hendler für das Brauen einer historischen Nachbildung des ursprünglichen, bayerischen Dunkels aus der Spätrenaissance, welches „Dawn of the Dunkel“ (Dämmerung des Dunkels) getauft wurde.
8.Mayflower Brewing Company, Plymouth, Massachusetts. Dank an Inhaber und Geschäftsführer Drew Brosseau sowie die Brauer Ryan Gwozdz und Jay Southwood für das Brauen eines mit Montmorency-Kirschen-Konzentrat angesäuerten Dunkelmärzens sowie eines süffigen „Session“ Dunkels.
9.Schilling Beer Company, Littleton, New Hampshire. Dank an Inhaber und Braumeister John Lenzini für das Brauen eines mexikanisch inspirierten, dunklen „Negra“ Wiener Lagerbieres und eines untergärigen, dunklen California “Un-Common“.
10.Tributary Brewing Company, Kittery, Maine. Dank an Inhaber und Braumeister Tod Mott und Brauer Ian Göring für das Brauen eines dunklen, untergärigen Bauernbieres („Farmhouse Lager“) und eines amerikanischen, experimentellen, super-gehopften „American Imperial Hoppy Dunkels“.
11.Wormtown Brewing Company, Worcester, Massachusetts. Dank an Inhaber und Braumeister Ben Roesch und Brauer Scott Drake für das Brauen eines Barke® Dunkel Wiener Lagers.
12.Zero Gravity Craft Brewery, Burlington, Vermont. Dank an Inhaber und Braumeister Paul Sayler und Brauer Destiny Saxon für das Brauen eines dunklen Lagerbieres mit Weyermann® Sour Wort.
Dank gebührt auch der Brewers Supply Group, einem nordamerikanischen Großhändler im Brauwesen, für die großzügige Unterstützung bei der Beschaffung von Rohstoffen für die in den Vereinigten Staaten und in Kanada gebrauten Biere.
Darüber hinaus möchten wir uns bei einigen besonderen Freunden für ihre enthusiastische Unterstützung bedanken:
Judy Nadeau, die damalige Vertriebsleiterin der Brewers Supply Group für New England, hat sich mit unermüdlichem Einsatz und gutem Mut um die komplexe Logistik der Rohstoffe bemüht, so dass alles zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Mengen im richtigen Sudhaus vorhanden war.
Ebenso danken wir Deborah Wood, der Rohstoff-Spezialistin der Brewers Supply Group Canada, für die Organisation der Testsude in den drei Brauereien in Québec.
Denise Jones, die damalige Braumeisterin und Brennerin bei Weyermann®, hat viele unserer Rezepte in der Braumanufaktur auf dem Weyermann® Firmengelände verwirklicht und anschließend als fertige Biere verkostet.
Ein Dankeschön geht auch an Ulrich Ferstl, dem Kundenservice-Teamleiter bei Weyermann®, für seine Beiträge zu den Malzbeschreibungen in Kapitel 5.
Wir danken den vier Vorwort-Autoren, zwei in Europa und zwei in Nordamerika: Dr. Martina Gastl (TUM-Weihenstephan), Jim Koch (Boston Beer Company), Dr. Josef Fontaine (VLB) und Garrett Oliver (Brooklyn Brewery).
Schließlich kann kein Dankeschön vollständig sein, ohne unsere Ehefrauen Sabine Weyermann und Elva Ellen Kowald zu erwähnen, die von Anfang an unsere größten Fans waren. Ihre Ermutigungen haben zu unserem Durchhaltevermögen während der Arbeit an diesem Werk beigetragen!
Danke, thank you, merci beaucoup!Thomas und Horst
Geleitwort der Autoren: Unser erstes Treffen
Es war das Jahr 1999; der Ort war die Craft Brewers Conference® und Brew Expo America® (CBC) in Phoenix, Arizona, USA. Zu jener Zeit, kurz vor der Jahrtausendwende, war die amerikanische Craft-Brew-Revolution rasant im Schwung und es schien absolut nichts unmöglich zu sein. Besonders auf der Brew Expo-Messe war die ungebündelte Energie und der Enthusiasmus der anwesenden Brauer spürbar!
Die Veranstaltung in Phoenix war die vierte Messe im Rahmen der CBC, an der die Weyermann® Malzfabrik als Aussteller teilnahm. Das Unternehmen war damals 120 Jahre alt und der Export von Weyermann®- Produkten in die Vereinigten Staaten war gerade angelaufen. Für die Messebesucher hatten Sabine Weyermann und Thomas Kraus-Weyermann freundlicherweise zu Werbezwecken ein Fass frisches Schlenkerla Rauchbier zum Ausschank mit nach Phoenix gebracht. Das war damals eine echte Attraktion für die experimentierfreudigen und lernbegierigen Brauer der Neuen Welt.
Im gleichen Jahr hatte der Verlag Brewers Publications, eine Abteilung der Brewers Association (BA), gerade Horst Dornbuschs Buch, Altbier – History, Brewing Techniques, Recipes, als Nummer 12 in der Classic Beer Styles-Serie veröffentlicht. Es war das erste Buch überhaupt in englischer Sprache über dieses kupferfarbene, damals weltweit noch relativ unbekannte Obergärige aus dem Rheinland. Als gebürtiger Düsseldorfer kannte sich Horst mit diesem Bier jedoch sehr gut aus und es war eines der Hauptangebote seiner damaligen Microbrauerei in Massachusetts, der Dornbusch Brewing Company Inc. Ein Jahr nach Phoenix wurde sein Altbier sogar mit einer Bronzemedaille beim Great American Beer Festival® 2000 prämiert.
Es gab zwei Gründe, weshalb der Weyermann® Stand rein zufällig auf der Messe in Phoenix zum Ort der ersten Begegnung zwischen den Autoren dieses Buches wurde: das Schlenkerla Rauchbier und das Altbierbuch, denn Horst stellte sich am Stand auf Englisch vor, wechselte dann aber auf Deutsch, als er um eine Probe des Schlenkerlas bat. Eine Gruppe von Brauern hatte diesen kurzen, zweisprachigen Austausch gehört und einer davon bemerkte: „Bist du nicht der Typ, der das Buch über Altbier geschrieben hat?“ Es stellte sich heraus, dass die Familie Weyermann dieses Buch, welches auf der Messe erhältlich war, ebenfalls am gleichen Morgen erstanden hatte. Damit wurde das zufällige Treffen am Weyermann®-Stand schnell zu einer ungeplanten Signierstunde und zu einem Foto-Event. Für eine deutsche Mälzerfamilie aus Bamberg war es natürlich etwas ganz Unerwartetes, einem Brauer und Autor in die Quere zu laufen, der in den USA wohnt, fließend Deutsch spricht, aber ein Buch auf Englisch über einen selbst in Deutschland nur regional bekannten Bierstil schreibt. Umgekehrt war jener Exildeutsche ebenfalls überrascht, eine deutsche Spezialmalzfabrik aus Bamberg mit Ambitionen, im nordamerikanischen Craft-Brauwesen Fuß zu fassen, in Phoenix kennenzulernen.
Das nächste „Treffen“ war nicht persönlich, sondern per Brief (Email war damals noch nicht, was es heute ist). Horst arbeitete an seinem nächsten Buch, „Bavarian Helles“, als Nummer 17 in der Classic Beer Styles-Serie für englischsprachige Leser. Es behandelte die Geschichte und das Brauverfahren dieses klassischen, bayerischen Bierstils komplett mit Rezepten, für welche Weyermann®-Malze natürlich perfekt geeignet sind. So fragte Horst, ob Sabine und Thomas daran interessiert wären, das Vorwort zu schreiben … und die Familie Weyermann nahm diese Gelegenheit gleich beim Schopf. So konnte man im Sommer 2000 zwei deutsche Mälzer an einem italienischen Strand mit Blick auf die Adria beobachten, wie sie ein Vorwort auf Deutsch für ein Buch auf Englisch über Bayerns berühmten Biergarten-Gerstensaft verfassten. Das übersetzte Horst dann fürs Buch ins Englische.
Und das war der Beginn einer großen und dauerhaften Freundschaft. Es war auch der Beginn einer fruchtbaren professionellen Zusammenarbeit zwischen der Weyermann® Malzfabrik und Cerevisia Communications LLC, einem Beratungsunternehmen in der Brauindustrie, welches Horst im Jahr 2000 gründete. In den folgenden Jahren haben sie an vielen Projekten zusammengearbeitet. Unter anderem hat man gemeinsame Artikel in Fachzeitschriften verfasst. In der Weyermann® Braumanufaktur in Bamberg wurden diverse mittelalterliche Klosterbiere, klassische Biere aus der Renaissance und sogar germanische Brotbiere aus der Römerzeit rekonstruiert. Zusätzlich wurde gemeinsam in Bamberg und bei gastfreundlichen Brauereien in vielen Ländern der Welt mit innovativen Kombinationen von Weyermann®-Malzen und auch mit ungewöhnlichen Hopfenmischungen experimentiert. Währenddessen entwickelte sich die Marke Weyermann® zu einem bedeutenden Player im Craft Brew-Bereich der Neuen Welt, wo Weyermann®-Malze nach den Anfängen in den 1990er Jahren bald zum vielseitigsten und gefragtesten Spezialmalz-Sortiment im nordamerikanischen Markt avancierten.
Das hier vorgestellte Buch ist ein weiteres Ergebnis dieser langjährigen Zusammenarbeit. Es basiert auf gemeinsamem, über Jahre gesammelten Brauwissen und auf vielfältigen, praktischen Erfahrungen in der Mälzerei und im Sudhaus. Es ist ein vielseitiges und ungewöhnliches Buch, welches sowohl historische als auch brautechnische Fragen mit einem wissenschaftlichen Ansatz und der gebührlichen Reverenz, aber – so hoffen die Autoren – auch mit ein wenig Humor behandelt. Möge dieses Buch das Verständnis der Leser für das Wunder, welches die dunklen Lagerbiere darstellen, erweitern und möge es auch zum Nachbrauen bzw. zum innovativen Experimentieren mit unseren Rezepten anspornen.
Thomas Kraus-Weyermann, BambergHorst Dornbusch, West Newbury, Massachusetts, USAJuli 2020
Vorwort von Jim Koch, Samuel Adams Boston Brauerei
Es macht Spaß, Brauer zu sein. Ein Teil des Spaßes besteht darin, ein unbekanntes Bier zu trinken und sich zu fragen, wohin es einen führen kann. Als ich 1985 Samuel Adams Boston Lager zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellte, waren alle großen amerikanischen Brauereien bestrebt, ihre Biere so leicht wie möglich zu machen. Es war damals ein Kalorien-Zähl-Wettbewerb auf niedrigstem Niveau. Der Geschmack war irrelevant, solange das Bier weniger als 100 Kalorien hatte! Das war eine schwierige Herausforderung, mit der auch wir damals gespielt hatten. Am Ende sahen wir jedoch darin keine Mission, die uns wirklich faszinierte. Meine Neugier zielte eher auf das andere Ende des Bierspektrums ab, auf die mysteriöse, dunkle Seite des Bieres. Und das bedeutete dunkle Lagerbiere (und Ales).
Es war ein aufregender Moment, als ich meinen ersten Samuel Adams Doppelbock braute. Als ich ihn jedoch zum zweiten Mal braute, kam mir der Gedanke: „Nun, wenn wir einen Doppelbock brauen können, warum nicht auch einen Tripelbock. Also haben wir es gemacht, und das war der Anfang einer Reise in die untersten Regionen des Brauens – zu den extremen Bieren. Erst kam der Tripelbock, dann das Millennium und schließlich Utopias! (Technisch ist Utopias ein Ale, also ein Obergäriges. Jedoch bedeutet „Lager“ auch ein gut gereiftes Bier; und Utopias ist ein Verschnitt aus verschiedenen extremen Bieren, wobei einige mehr als 20 Jahre alt sind.)
Dunkle Biere, insbesondere Lagerbiere, sind gerade deshalb verführerisch, weil es dort drinnen so dunkel ist und man oft nicht genau sehen kann, wohin man geht oder wo man endet. Extreme Biere sind für mich als Brauer immer ein spannender Pfad der Liebe.
Aufgrund der international explodierenden Craft-Brewing-Bewegung ist es unmöglich den Überblick zu behalten, wer was braut. Wir verdanken es Horst Dornbusch und Thomas Kraus-Weyermann, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auf der ganzen Welt über dunkle Lagerbiere zu lernen und, was noch wichtiger ist, Einblicke in und ein Verständnis für die Zusammenhänge dieser dunklen Juwelen des Brauens zu gewinnen.
Was sie geschaffen haben, wird meines Erachtens die Bibel der dunklen Lagerbierherstellung werden. Ich denke, die wahre Genialität dieses Buches liegt in seiner Fähigkeit, die Informationen sowohl für professionelle Brauer als auch für neue Biertrinker klar und überzeugend darzustellen. Es liefert die Grundlagen: die Wurzeln dunkler Lagerbiere, die grundlegende Biochemie, die Zutaten und Rezepte … aber dann hebt es wie eine Rakete ins Unbekannte ab und erforscht das weltweite Spektrum klassischer und experimenteller dunkler Lagerbiere.
Wir bei Samuel Adams fühlen uns geehrt, dass wir eingeladen wurden, Rezepte für dieses Buch beizusteuern. Es hat uns großen Spaß gemacht und ich denke, dass es eine großartige Möglichkeit für unsere Brauer war, neue dunkle Lagerbierrezepte zu kreieren und damit das Thema des Buches in den richtigen Rahmen zu rücken.
Es ist heute fast gang und gäbe geworden, ein umfassendes Buch über ein Thema mit dem Wort „Bibel“ zu belegen. Damit ist das Wort fast zu einem Klischee geworden. Im Falle dieses Buches haben wir es jedoch wirklich mit einer Bibel über dunkle Lagerbiere zu tun, denn es befasst sich mit dem Ursprung dieser Biere und den Brauanleitungen; und erzählt dann die Geschichten der Entwicklung dieser Biere in verschiedenen Regionen. Damit entfacht es Leidenschaft und gibt uns Hoffnung und Vertrauen für die Zukunft.
Also, liebe Leser, zapfen Sie sich ein feines, dunkles Lagerbier, nehmen Sie sich einen Stuhl und schließen Sie sich unserer Reise an, die in der Spätrenaissance beginnt und noch kein absehbares Ende hat. Lesen Sie weiter! Brauen Sie weiter!
Jim KochGründer und GeschäftsführerSamuel Adams Boston Brauerei
Vorwort von Dr. Martina Gastl, Technische Universität München
Der überwiegende Teil des Biermarkts im 20. Jahrhundert schien vom Einheitsbier der großen Konzerne dominiert. Demzufolge basierten die klassischen am Markt befindlichen Biersorten auf nur wenigen Malzsorten wie Pilsener Malz, Dunkles Gerstenmalz, Helles Karamellmalz, Helles Weizenmalz und ggf. Röstmalz. Auch das Potenzial des Hopfens wurde zumeist auf seine rein bitternde Wirkung reduziert. Demzufolge wurden die Biere immer einheitlicher und büßten an Geschmacksvielfalt und individuellem Charakter ein.
Als Mitte der 80er Jahre die Craft-Bier-Bewegung aufkam und die Brauer die enorme Aroma- und Geschmacksvielfalt der Rohstoffe Hopfen, Malz und Hefe wiederentdeckten und auch die vielfältigen Technologien im Heiß- und Kaltbereich aktiv einsetzten, erlebte die Aroma- und Geschmacksvielfalt des Bieres ein spektakuläres Comeback. So vielfältig die Welt der Zutaten ist, so vielfältig sind auch die kreierten Sorten.
Den Aufbruch in eine neue Ära der kreativen Biervielfalt spiegelt auch die Brauliteratur der letzten Jahre wieder. Obwohl inzwischen zahlreiche Rezeptesammlungen bestehen, ist es doch eine Seltenheit auf ein Buch zu stoßen, dass sich explizit mit dunklen Lagerbieren und dunklen Malzen beschäftigt. Aufgrund der facettenreichen Darstellung dieses Bierstiles sticht dieses Buch in einzigartiger Weise aus der bestehenden Literatur hervor!
Mit der aufgezeigten beeindruckenden Vielfalt, der dahinterstehenden Historie sowie den möglichen Herstellungsprozessen sind mit Sicherheit auch wahre Bierkenner und Liebhaber dieser Biersorte nur auszugsweise vertraut.
Doch der Reichtum dieser Thematik wird dem Leser schnell bewusst. Kurzweilig dokumentieren die Autoren die faszinierende und weitgehend unbekannte Geschichte der dunklen Lagerbiere und beschäftigen sich intensiv und mit Liebe fürs Detail mit den abwechslungsreichen Rohstoffen und Brauverfahren dieses Bierstils, ausgeschmückt mit ansprechenden Illustrationen.
Einzigartig ist auch die Rezeptesammlung, die dem Brauer mehr als 40 einzigartige, ideenreiche und erprobte Rezepte für die Herstellung eigener Variationen zur Hand gibt. Das Buch lebt von der praktischen Expertise und jahrzehntelangen Erfahrung der beiden Autoren Thomas Kraus-Weyermann und Horst Dornbusch in Mälzerei und Brauerei.
Sicher wird dieses Buch die klassische Brauliteratur wertvoll und ergänzen und in zahlreichen Bibliotheken Einzug finden – auch an der TUM-Weihenstephan.
Dr.-Ing. Martina GastlTechnische Universität München (TUM)Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie – AG RohstofforientierteBrau- und Getränketechnologie (Arbeitsgruppenleitung)
Vorwort von Dr. Josef Fontaine, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin
Dunkle Biere haben eine große Tradition. Sie sind die „Hidden Champions“ in der Welt der Biere. Mit ihrem kräftigen, malzbetonten Aroma und den dunklen Farbnuancen waren sie lange Zeit weit verbreitet. Heute wird der Biermarkt in Deutschland aber mehr von Pilsner, Export, Hellen und Weizenbieren bestimmt. Die dunklen Biere dagegen sind ein wenig ins Hintertreffen geraten und werden meist als Spezialität von kleinen regionalen Brauereien angeboten. Zwar gibt es bei uns einige wenige überregional erfolgreiche Biere dieses Typs, wie beispielsweise das Schwarzbier. Generell fristen die dunklen Lager aber eher ein Nischendasein. Völlig zu Unrecht, wie auch ich finde!
Die Craft-Brewer weltweit haben in den vergangenen Jahren die Biervielfalt wiederentdeckt. Allerdings stehen bei vielen modernen Craft-Bieren die Hopfenaromen im Vordergrund. Bei den dunklen Lagerbieren kommt es aber eher auf die Malzkomposition und das Sudverfahren an. Es handelt sich bei dunklen Lagerbieren also um einen Biertyp, bei dem es noch viel zu entdecken bzw. wiederzuentdecken gibt. In den zahlreichen internationalen Brauerkursen, die die VLB Berlin anbietet, sind dunkle Lagerbiere auch immer wieder ein Thema. So gehört das „VLB Dunkel“ oder der „Dunkle Winterbock“ zu den Standardbieren unserer Studienbrauerei. Rezeptentwicklung ist natürlich auch ein Schwerpunkt in unseren Brauerkursen. Dabei müssen die angehenden Braumeister und Braumeisterinnen ein Rezept in allen Details planen. Das heißt, der Biertyp mit Aromaprofil wird festgelegt, dazu die passende Malzkomposition, die Hopfengabe und der Hefestamm ausgewählt. Anschließend werden die erforderlichen Prozessparameter für Sudhaus und Gärung/Reifung definiert. Dann muss das Ganze in unserer Studienbrauerei in die Praxis umgesetzt werden. In die abschließende Bewertung der Arbeit fließt auch ein, ob das gebraute Bier den Vorgaben des Rezepts entspricht und nicht ein Ergebnis von zufälligen Faktoren ist. Bei diesen Brauversuchen entscheiden sich immer wieder einzelne Gruppen für ein dunkles Lagerbier. Neben dem Verständnis über den Einsatz von Spezialmalzen bietet dieser Biertyp auch eine gute Gelegenheit, das heutzutage nur noch selten benutzte Dekoktionsverfahren einzusetzen. Das gibt den angehenden Braumeistern ein gutes Gefühl für die Bandbreite des Bierbrauens, die über Rohstoffauswahl, Brauverfahren und Gärführung beeinflusst werden kann. Die Resultate dieser Brauversuche sind immer wieder erfreulich und wohlschmeckend!
Wir sehen an diesem Beispiel, dass die dunklen Lagerbiere nach wie vor sowohl für Brauer als auch für Biergenießer attraktiv sind. Ich freue mich daher sehr, dass die beiden ausgewiesenen Bierexperten Horst Dornbusch und Thomas Kraus-Weyermann mit diesem besonderen Buch den Fokus auf diesen unterschätzten Biertyp richten, der zweifellos ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als ihm in der jüngeren Vergangenheit entgegengebracht worden ist.
Ich drücke die Daumen, dass dieses Buch viele Brauer weltweit zu mehr „Mut zur natürlichen Farbe“ im Bier inspiriert!
Dr. Josef FontaineGeschäftsführer Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) [email protected]
Vorwort von Garrett Oliver, Brooklyn Brewery
Selbst im dunklen Zeitalter des amerikanischen Bieres wussten wir immer, wonach wir suchten und wo wir es finden konnten. In den frühen 1980er Jahren, während der rauen Punkrock-Ära von New Yorks East Village, gab es ein verborgenes Biergeheimnis. East 6th Street, zwischen 1st und 2nd Avenue, wurde als „Little India“ oder „Curry Row“ bekannt, denn der gesamte Block bestand aus einer nahezu monokulturellen, indischen Gastronomie. Eigentlich gab es zwei Geheimnisse. Das erste war, dass viele der Restaurants überhaupt nicht „indisch“, sondern pakistanisch waren und daher von muslimischen Familien geführt wurden. Infolgedessen waren fast alle diese Restaurants BYOB-Betriebe (Bring Your Own Beer bzw. Bringe dein eigenes Bier), denn die Inhaber schenkten keinen Alkohol aus.
Das Problem war … was sollte man bringen? Sicherlich nicht die nichtssagenden, langweiligen amerikanischen Pilsner-Lagerbiere von gestern. Wir reden hier von einer Zeit lange vor der Craft-Beer-Revolution. Aber schon damals wussten wir, was „dunkel“ bedeutet. Und wir wussten, was hinter einem Etikett mit dem Suffix „-ator“ steckte. Denn an beiden Enden der Curry Row befanden sich die ersten New Yorker Bierspezialitätengeschäfte, und deren bedeutendste Ware war dunkles Lagerbier. Unsere Favoriten von damals hallen immer noch in meiner Erinnerung wider: Aass Bock aus Norwegen mit seiner tiefen, rötlichen Farbe, seiner rassigen Bittere und seinem lebendigen Toffeegeschmack. Das Spaten-Logo des berühmten Optimators tauchte in denselben Regalen auf und wir nahmen die Flaschen mit in die Restaurants und an warmen Tagen saßen wir damit manchmal auch auf den Treppen fremder Häuser. Um die Ecke schenkte McSorley’s Old Ale House kleine Becher mit schaumigem McSorley’s Dark Lager aus, was angeblich ein Bier mit dem echten Namen „Prior's Double Dark“ war, also ein Bier, welches zumindest davon träumen ließ, dass es bayerische Wurzeln habe.
Als ich schließlich zum ersten Mal in München ankam, arbeitete ich mich durch jedes Dunkel und Bockbier, das ich finden konnte, und entschied mich schließlich für das wundersame Gleichgewicht der Biere, das unter dem Augustiner Dach serviert wurde. Von dort stürzte ich mich in die Wildnis der kommunistischen Tschechoslowakei und entdeckte, was auch immer der Kommunismus dort ruiniert hatte, dass er den dunklen Lagerbieren von Prag nichts anhaben konnte. Viele Jahre später, als mir Prinz Luitpold von Bayern, der selbst ein Braumeister war und der damals mehr dunkle Lagerbiere produzierte als jeder andere in Bayern, eine Audienz gewährte, hörte ich Geschichten von Fürsten, Adligen und Geistlichen. Ab dem 16. Jahrhundert, sagte der Prinz wehmütig, kamen sie alle zu Hunderten auf diese Burg und tranken den ganzen Tag lang dunkle Lagerbiere.
Im Laufe der Jahre habe ich viele solcher Biere selbst gebraut und Mälzer (von denen einer sehr intensiv mit diesem Buch verknüpft ist) dazu ermutigt, aromatische Gersten zu mälzen, die für die Herstellung dunkler Biere geeignet sind. Ich liebe die moderne Bierkultur – wir können jetzt mehr wundervolle Biere trinken als je zuvor. Trotzdem denke ich, dass einige der jüngeren Leute heutzutage etwas verpassen. Hopfen ist natürlich wunderbar, aber wenn ich mich erinnere, war Malz damals das Objekt meiner ersten Bierromanze; und dieses Malz war in üppige Rot- und Brauntöne gehüllt. Sie hatten nicht nur Aromen von Karamell, sondern auch von Kaffee, Melasse, Honig, dunklem Brot, Schokolade und getrockneten Früchten, die selten übermäßig süß waren und die am besten von einem blumigen Hauch aus den Hopfengärten gekrönt wurden.
Gibt es einen feineren Bierstil? Darüber könnten wir durchaus diskutieren. Aber sollten Sie mich an einem kühlen Herbsttag in einer Brauerei oder Bierhalle mit einem Glas Dunkelbier in der Hand antreffen, werden Sie mich nie von einem anderen Bier überzeugen. Gehen Sie am besten gleich zur Bar und holen Sie sich eins für sich selbst. Ob Sie nun nur das Beste dieser Biere finden möchten, ob Sie über deren Geschichte lernen möchten oder ob Sie selbst eine würdige Version brauen möchten, dies ist das Buch, auf das Sie gewartet haben. Auf diesen gründlich recherchierten Seiten, die von meinen alten Freunden Horst und Thomas geschrieben wurden, finden Sie nur Dunkelheit auf dem Weg nach vorn. Seien Sie guten Mutes – denn alles geht aufwärts!
Garrett OliverBraumeister, Brooklyn BreweryAutor, The Brewmaster’s TableHerausgeber, The Oxford Companion to Beer (mit Horst Dornbusch als Mitherausgeber)
Vorab einige Begriffserklärungen
Die ursprüngliche Version dieses Buches wurde im Jahre 2018 auf Englisch von der Master Brewers Association of the Americas (MBAA) in Minneapolis, Minnesota, USA, unter dem Titel Dark Lagers – History, Mystery, Brewing Techniques, Recipes veröffentlicht. Bücher, die sich ausschließlich mit der Herstellung dunkler Lagerbiere befassen, sind nicht nur selten, sie gab es damals nicht, in keiner Sprache. Die Autoren hofften daher, diese gähnende Lücke in der internationalen Fachliteratur mit dem vorliegenden Werk zu stopfen.
Alle hier wiedergegebenen Rezepte wurden von den Autoren speziell für dieses Buch konzipiert und getestet. Die im Kapitel 7 aufgeführten Rezepte sind für dunkle Lagerbiere, die allgemein als Klassiker der Kategorie angesehen werden (siehe dazu auch Kapitel 4), gedacht. Zu diesen Archetypen der Bierstile gehören u.a. das bayerische Dunkel, das thüringische Schwarzbier, das böhmische Dunkel (Tmavý Ležák) sowie die bayerischen Starkbiere Dunkelbock und Dunkeldoppelbock. Diese Traditionsbiere haben den Test der Zeit überstanden. Die hier aufgeführten Rezepte sind Rekonstruktionen dieser historischen Modelle, aber mit leichten Abwandlungen, die es Brauern erlauben, diese Biere auch in zeitgenössischen Sudhäusern mit modernen Rohstoffen herzustellen.
Die Rezepte in Kapitel 8 sind dagegen eher „innovativ“. Sie wurden zwar auf der Basis klassischer Sude konzipiert, weichen aber dennoch wesentlich von diesen ab. Ein typisches Beispiel ist ein bayerisch-inspiriertes Dunkel mit einem Zusatz von ungemälzter Gerstenrohfrucht, also von Röstgerste, welche in Deutschland gegen das Reinheitsgebot verstößt, jedoch anderswo auf der Welt durchaus erlaubt ist. Schließlich sind die Rezepte in Kapitel 9 „experimentell“, da sie im Sinne des modernen Craft-Brau-Experimentierens das Konzept dunkler Lagerbiere in sehr kreative, vielleicht sogar abenteuerliche Richtungen weiterführt. Ein Beispiel ist ein dunkles Lagerbier, welches sowohl im Maischebottich als auch in der Sudpfanne mit einem Zusatz von entfettetem Bio-Kakaopulver, sowie in der Sudpfanne und im Gärtank mit etwas natürlichem Vanilleextrakt abgerundet wurde. Diese Zutaten lenken ein Dunkel in ganz neue geschmackliche Bahnen.
Natürlich sind die Trennlinien zwischen diesen drei Rezeptgruppen überwiegend subjektiv, weshalb jeder Leser diese Biere ganz legitim auch anders klassifizieren kann. Nur ein Ziel sollte dabei nicht aus den Augen verloren werden: Bei allen diesen Rezepten geht es weniger um deren Kategorisierung in der Bierstil-„Taxonomie“ als darum, interessante und leckere Biere zu brauen.
Ein Wort zum Reinheitsgebot
Während alle klassischen Rezepte in Kapitel 7 den Grundsätzen des Reinheitsgebots entsprechen, verstoßen selbstverständlich viele der „innovativen“ Rezepte in Kapitel 8 und besonders der „experimentellen“ Rezepte in Kapitel 9 gegen diese deutsche Zutatenverordnung für Bier. Nach deutschem Recht dürfen alle im Inland gebraute, untergärige Biere – also Lagerbiere – nur aus Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe bestehen. Das Bundesgesetz ist für obergärige Biere, also für „Ales“, etwas weniger restriktiv (mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg, wo nach den jeweiligen Landesgesetzen das deutsche Reinheitsgebot gleichermaßen für unter- und obergärige Biere gilt). Wenn es sich um ein Weizenbier handelt, gilt jedoch in allen Ländern, dass mindestens die Hälfte der Maische aus Weizenmalz bestehen muss. Der Rest muss Gerstenmalz sein. Andere in Deutschland (außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs) hergestellte obergärige Nicht-Weißbiere – wie zum Beispiel Altbier und Kölsch – dürfen ebenfalls eine nicht spezifizierte Menge an Weizenmalz sowie eine begrenzte Anzahl von klar definierten Zusatzstoffen wie zum Beispiel Invertzuckersirup enthalten. Darüber hinaus dürfen Biere mit Dinkel-, Hafer- oder Roggenmalz nur obergärig gebraut werden. Allerdings sind Zutaten wie Kaffee, Kakao, Vanille, Früchte, ungemälzte Getreiderohfrüchte für alle deutschen Biere, ob ober- oder untergärig, grundsätzlich verboten, obwohl viele dieser Zutaten bis zur Spätrenaissance auch in Deutschland in Bieren verwendet wurden. Selbst Gruit (ein Bouquet aus Kräutern und Gewürzen), welches von der Frühzeit bis ins Mittelalter eine Standardgeschmacksbeigabe zu Bier war, ist heute nicht mehr gestattet.
Daher dürfen vergorene Getränke auf Getreidebasis, die außerhalb der strengen Bestimmungen des Reinheitsgebots hergestellt werden, in Deutschland nicht als „Bier“ bezeichnet werden, es sei denn, sie werden dank eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs von 1987 für den Export gebraut oder sie werden aus dem EU-Ausland nach Deutschland eingeführt. Da dieses Buch sich international orientiert und da viele Craft-Brauer auch in Deutschland alkoholische Getränke auf Getreidebasis herstellen, die technisch in Deutschland nicht als „Biere“ gelten, wurden diese internationalen „Bier“-Sorten hier in die Kapitel 8 und 9 aufgenommen.
Definitionen
Da die erste Version dieses Buches auf Englisch primär für nordamerikanische Brauer verfasst wurde, wurden ursprünglich auch alle Mengen in den Rezepten in amerikanischen Maßeinheiten berechnet und ausgedrückt. Diese wurden für die deutsche Version ins Dezimalsystem übertragen. Auch beziehen sich einige Begriffe und Definitionen – wie zum Beispiel die Ermittlung der Extrakteffizienz eines Sudhauses oder die Berechnung der Bierfarbe – zum Teil auf die in Nordamerika geläufige Braupraxis. Auch diese Elemente wurden an das Vorverständnis der deutschen Brauer angepasst. Dazu folgende Erklärungen:
Definition: Extrakteffizienz
Alle Mengenangaben in den Rezepten in diesem Buch sind nominelle Proforma-Werte. Sie basieren auf einer hypothetischen Extraktausbeute von 75 Prozent. Die Gleichung zur Berechnung der Sudhauseffizienz ist:
Wobei:
Diese Formel bezieht sich nur auf die Ausbeute eines konkreten Sudhauses, nicht auf den potenziellen, im Labor erzielbaren Extraktwert einer Schüttung. Die mit dieser Formel definierte Ausbeute ist ein Nominalwert, dessen echte Größe auch von verschiedenen örtlichen Faktoren abhängt. Zu denen gehören u. a. die Sudhauskonfiguration, das Verhältnis von Durchmesser zu Höhe des Läuterbottiches, die Feinheit des Schrotes, die Tiefe der Maische und die Perforierung des Senkbodens. Deshalb sind manche Sudhäuser bei identischem Schüttungsgewicht wesentlich effizienter als andere. Anders ausgedrückt, um ein bestimmtes Würzevolumen mit einer bestimmten Stammwürze zu erzielen, brauchen manche Sudhäuser wesentlich größere Schüttungsmengen als andere. Dieser Tatbestand hat natürlich Auswirkungen auf die Bierfarbe, den Endvergärungsgrad und den Alkoholgehalt. Auch sollte berücksichtigt werden, dass die Malz- und Hopfenspezifikationen von einer Lieferung zur nächsten selbst vom gleichen Lieferanten variieren können.
Definitionen: Würzefarbe und Bierfarbe
Es gibt eine Vielzahl von Methoden und Formeln zur Berechnung der Würze- und Bierfarben. Die hier verwendete Formel für die Würzefarbe wurde von Daniel Morey in der Einheit SRM (Standard Reference Method) entwickelt und ausführlich in How To Brew: Everything You Need to Know to Brew Great Beer Every Time (John Palmer, 4. ergänzte Ausgabe, 2017) beschrieben.
SRM ist ein mit einem Spektralphotometer gemessener Nominalwert, der von der American Society of Brewing Chemists (ASBC) im Jahre 1950 entwickelt wurde. Er erfasst die Verringerung (Absorption) der Intensität eines tiefblauen Lichtstrahls mit einer Wellenlänge von 430 Nanometern, wenn er durch eine genormte Küvette durch 0,5 Zoll (1,27 cm) Bier oder Würze geschickt wird. Die für solche Messungen verwendete Bier- oder Würzeprobe wird normalerweise filtriert, um Verfälschungen durch Trübungen zu vermeiden. Je dunkler das Bier oder die Bierwürze, desto größer ist der numerische SRM-Wert. Die SRM Formel zur Bierfarbenstimmung lautet:
In dieser Formel ist 1,4922 eine Berechnungskonstante. Die Abkürzung MCU steht für Malt Color Unit und 0,6859 ist der konstante Exponent (Hochzahl) für den MCU-Wert. Die Malzfarbeinheit MCU ist die Summe der relativen Farbbeiträge (je nach Gewicht) der verschiedenen Malze in der Maische, wobei jeder einzelne Farbwert in Lovibond-Graden (°L) ausgedrückt wird.
Erklärung von °L: Diese Malzfarbeneinheit wurde im Jahre 1893 vom britischen Brauer Joseph William Lovibond entwickelt. Sie beruht auf einem Vergleich der zu messenden Bierfarbe mit einem Satz standardisierter farbiger Glasscheiben. Am unteren Ende der Lovibond-Skala sind die Werte in °L und SRM ziemlich ähnlich. Am oberen Ende weichen sie jedoch aufgrund des nichtlinearen Effekts, nach Gewicht, von Malzen unterschiedlicher Farbe auf die Gesamtbierfarbe erheblich voneinander ab. Mit anderen Worten, eine geringe Menge von tiefdunklem Malz hat einen proportional viel größeren Einfluss auf die Bierfarbe als eine gleiche Menge eines hellen oder bernsteinfarbenen Malzes.
Die Beziehung zwischen °L und SRM wird durch folgende Formeln ausgedrückt:
Eine andere Methode der Bierfarbmessung wurde von der European Brewery Convention entwickelt. Die Einheit dieser Farbmessung ist EBC. Sie wird praktisch auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Nordamerika, benutzt. Die EBC-Methode basiert auf einer Küvette mit einem Durchmesser von 1 cm. Jedoch ist das Testlicht das Gleiche wie in der SRM-Methode. Es hat ebenfalls eine Wellenlänge von 430 Nanometern. Da die SRM- und EBC-Methoden eng miteinander verwandt sind und sich nur im Küvettendurchmesser unterscheiden, können ihre Werte in beide Richtungen umgerechnet werden. Ein EBC-Farbwert beträgt ungefähr das 1,97-fache des SRM-Farbwerts. Daraus ergeben sich folgende Umrechnungsformeln:
In der deutschen Version dieses Buches werden alle Bierfarbwerte ausschließlich in EBC-Einheiten wiedergegeben.
Definition: Bittere
Die in diesem Buch verwendeten Hopfenmengen basieren auf den Alphasäureangaben der Hopfenverarbeiter in der Einheit IBU (International Bitter Unit) für den Gehalt an Iso-Alphasäure im fertigen Bier. Dabei entspricht 1 IBU 1 Milligramm Alphasäure pro Liter Bier (mg/l). Alle in den Testsuden für dieses Buch verwendeten Hopfengaben bestanden aus T90 (statt T45) Pellets und nicht aus Dolden. Daher sollten die angegebenen Hopfenmengen beim Gebrauch von Dolden um etwa 10 Prozent erhöht werden.
Für die Iso-Alpha-Ausbeute pro Kochlänge benutzen verschiedene Quellen unterschiedliche nominale Referenzwerte. In diesem Buch (siehe Tabelle) wird eine nominale Isomerisierungsrate von 30 Prozent des vom Hopfenhersteller angegebenen Alphasäurewertes bei einer Kochlänge von 60 Minuten angenommen. Bei einer Hopfengabe zum Kochende bzw. im Whirlpool wird eine Isomerisierungsrate von 6 Prozent angenommen.
Daraus ergibt sich für jede Hopfengabe folgende Formel:
Wobei:
Die Bitterwerte mehrerer Hopfengaben summieren sich zur Gesamtbittermenge in IBU, wobei in diesem Buch die relativ geringen Bitterwerte durch Hopfenstopfen (Dry-Hopping) im Kaltbereich ignoriert werden. Da die in der Brauerpraxis von Fall zu Fall erzielten Echtwerte der Bittere unterschiedlich ausfallen, gelten die in den Rezepten angegebenen Hopfenmengen pro Gabe nur als Leitfaden; und die Gaben sollten für jeden Sud, je nach den aktuellen Spezifikationen sowie auch nach dem Alter und den Lagerbedingungen des verwendeten Hopfens neu berechnet werden.
Kochlänge in Minuten
Alphasäuren-Ausbeute (%)
≥60
0,30
55
0,29
50
0,28
45
0,27
40
0,25
35
0,23
30
0,21
25
0,19
20
0,17
15
0,14
10
0,10
5
0,06
Umrechnungstabelle
Viele Rezepte, besonders im Craft-Bier-Bereich, werden heutzutage auf Englisch auf der Grundlage amerikanischer Maßeinheiten statt des international gebräuchlichen Dezimalsystems Système international d'unités (SI) veröffentlicht. Brauer, die es vorziehen, ausschließlich mit Einheiten im Dezimalsystem zu arbeiten (oder umgekehrt), können mit folgenden Umrechnungskonstanten die relevanten Mengen errechnen:
Alphabetische Liste der Rezepte in den Kapiteln 7 bis 9
1.American Imperial Hoppy Dunkel (Rezept 41)
2.Baltic Porter (Baltisches Porter: Rezept 16)
3.Bamberger Hofbräu Exquisator Dunkeldoppelbockbier (Rezept 12)
4.Bamberger Hofbräu Schwarzbier (Rezept 7)
5.Bamberger Rauchbier (Rezept 13)
6.Barke® Dunkles Wiener Lager (Rezept 20)
7.Barke® Sinamar® Dunkel (Rezept 25)
8.Bayerisch-fränkisches Dessert Dunkel (Rezept 18)
9.Bayerisch-fränkisches dunkles Landbier (Rezept 3)
10.Bayerisch-fränkisches trockenes Dunkel (Rezept 17)
11.Bayerischer Dunkeldoppelbock I (Rezept 10)
12.Bayerischer Dunkeldoppelbock II (Rezept 11)
13.Bayerisches Dunkelbockbier (Rezept 9)
14.Bayerisches Dunkelkellerbier (Rezept 14)
15.Bayerisches/Münchner Dunkel I (Rezept 1)
16.Bayerisches/Münchner Dunkel II (Rezept 2)
17.Bayerisches Schwarzbier I (Rezept 5)
18.Bayerisches Schwarzbier II (Rezept 6)
19.Birra Rossa (Rezept 23)
20.Deutsches Porter (Rezept 15)
21.Dunkelmärzen (Rezept 21)
22.Dunkelrauchdoppelbock (Rezept 28)
23.Dunkles California „Un-Common“ Lagerbier (Rezept 38)
24.Dunkles „Negra“ Wiener Lager (Rezept 19)
25.Dunkles Bauernlagerbier (Dark Farmhouse Lager; Rezept 22)
26.Dunkles Lagerbier mit gerösteter Gerste, Kakao und Vanille (Rezept 31)
27.Dunkles Montmorency-Sauerkirschen-Lagerbier (Rezept 37)
28.Dunkles Sauergut-Lagerbier (Rezept 36)
29.Estländisches Baltisches Porter (Estonian Baltic Porter; Rezept 27)
30.„Hildegard von Bingen“-Bier aus dem Mittelalter (Rezept 40)
31.„Imperial“ Barrique Rauchbock (Rezept 34)
32.„Imperial“ Fünf-Korn „Dinkel-Dunkel“ (Rezept 30)
33.„Imperial“ Hafer-Schwarzbier (Rezept 35)
34.Schlotfegerla® Bamberger Rauchbier (Rezept 26)
35.Spätrenaissance Bayerisches Dunkel (Rezept 39)
36.Süffiges Dunkel („Session“ Dunkel; Rezept 24)
37.„Schwarz-ator“-Triplebock (Rezept 29)
38.Schwarzes Kaffee-Lagerbier (Rezept 32)
39.Thüringer Schwarzbier (Rezept 8)
40.Tmavý Ležák (Böhmisches Dunkel; Rezept 4)
41.Untergäriges Gersten-Weizen-Rauch-Starkbier (Rezept 33)
Als das Bier dunkel wurde …
1
Heutzutage macht sich kaum ein Brauer oder Biertrinker darüber Gedanken, dass es nicht nur helle, sondern auch dunkle Biere gibt sowie Biere jeder Farbe dazwischen. Aber die Existenz dunkler Biere ist viel weniger „natürlich“ als deren weite Verbreitung heutzutage vermuten lässt. Man bedenke nur, dass die wichtigsten Bierrohstoffe, nämlich Gerste und Hopfen, im natürlichen Zustand eigentlich eher hell als dunkel sind, denn die reifen Gerstenähren wogen goldgelb und nicht dunkel auf den Feldern im Wind und die Hopfendolden sind alle gelblich bis hellgrün. Gleichsam ist ein Hefebrei grau-weiß bis elfenbein-gelb und reines Wasser ist natürlich farblos. Selbst Getreidearten, die seltener zum Brauen verwendet werden wie Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel und Einkorn verdienen kaum das Attribut „dunkel“. Trotzdem findet man heutzutage rabenschwarze, sepia-braune, rötliche und bernsteinfarbene Biere in fast allen bedeutenden Bierkulturen der Welt. Um nur einige Beispiele zu nennen: Es gibt das bayerische Dunkel; das fränkische Rotbier; das dunkelgoldene, kupferrote oder mahagonibraune Festbier; den Dunkelbock; das Dunkelweizen; das dunkelbraune, belgische Trappisten-Dubbel; und die mokkabraunen bis tiefschwarzen englischen Porters und Stouts. Mit anderen Worten, Dunkelheit im Bier ist nicht ein Produkt der Natur, sondern das Ergebnis von Herstellungsverfahren in der Mälzerei und der Brauerei … aber warum?
Die Geschichtlichkeit dunkler Biere
Um das Aufkommen dunkler Biere zu verstehen, ist es aufschlussreich, einen Blick auf die tiefe Vergangenheit des Brauens seit dem Beginn der Zivilisation, also auf eine Zeit vor etwa acht- bis zehntausend Jahren, zu werfen, als noch alle Biere hell oder bernsteinfarben waren. Damals waren sie höchstwahrscheinlich auch alle obergärig. Dieser Rückblick mag in einem Buch, welches sich ausschließlich mit dem Brauen dunkler, untergäriger Biere befasst, unorthodox erscheinen, jedoch basiert dieser scheinbare Widerspruch auf einer schlüssigen Logik: Aus der Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklung dieser alten Biere können wir – wenn nicht mit Sicherheit lernen – so doch erahnen, warum dunkle Biere, einschließlich dunkle untergärige Biere, überhaupt entstanden sind und auch heute noch einen festen Platz im Biersortiment der Welt einnehmen.
Die Biergeschichte lehrt uns, dass sowohl die Dunkelheit im Bier als auch die untergärige Brauweise historische Anfänge haben. Irgendwann und irgendwo wurde wohl zum ersten Mal dunkel gebraut; und irgendwann und irgendwo wurde auch zum erst Mal untergärig gebraut. Auch wissen wir heute, dass diese beiden Übergänge – von hell auf dunkel und von ober- auf untergärig – nicht zeitgleich stattfanden, sondern dass die Dunkelheit im Bier etwa ein Jahrtausend vor dem Wechsel von ober- auf untergärige Hefe kam. Damit gab es also auch irgendwann und irgendwo einen ersten Sud, der nicht nur dunkel war, sondern auch untergärig vergoren wurde. Folgerichtig schickt uns das erste Kapitel dieses Buches auf die Spuren der ersten, wahrscheinlich obergärigen, dunklen Biere, während wir im zweiten Kapitel versuchen, das Erscheinen der ersten, wohl ebenfalls dunklen Lagerbiere zu entschlüsseln. Dieser Forschungspfad führt dann automatisch im Kapitel 3 zu einer Analyse der – wie sich herausstellt – mysteriösen, mikrobiologischen Revolution, welche die Transformation obergäriger in untergärige Biere überhaupt erst ermöglichte. Schließlich verbleibt noch die Darlegung in den Kapiteln 4 bis 6 der historischen Entwicklung der Rohstoffe und Braumethoden vom ersten Erscheinen dunkler Lagerbiere bis zur heutigen Vielfalt dieser Biergattung. Danach enthalten Kapitel 7 bis 9 mehr als drei Dutzend speziell für dieses Buch entwickelte, weltweit getestete und sensorisch bewertete Rezepte für das Brauen klassischer, innovativer und experimenteller untergäriger Dunkelbiere. Letztlich bietet Kapitel 10 eine Exkursion in die Küche, wo 18 Gerichte vorgestellt werden, die man mit dunklen Lagerbieren kochen kann.
Bei den Recherchen für dieses Buch zeigte sich, dass die Fahndung nach den komplizierten historischen und brautechnischen Hintergründen der etappenmäßigen Transformation der blonden Obergärigen der Antike in die dunklen Untergärigen der Moderne eine überraschend breit gestreute und recht fantasievolle Detektivarbeit verlangte. Die Aufzeichnungen dieser Untersuchungen lesen sich daher fast wie ein echter Krimi!
Blonde, obergärige Biere an der Wiege der Zivilisation
Die meisten Archäologen und Anthropologen sind sich einig, dass die ersten Biere der Geschichte der Menschheit in der Jungsteinzeit in einer Region ungefähr zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat, also im Zweistromland des Fruchtbaren Halbmonds des Nahen Ostens (im Wesentlichen im heutigen Irak), gebraut wurden. Sie behaupten dies aufgrund von Ausgrabungen, in denen sie bis zu 9000 Jahre alte Körner aus gemälztem Getreide gefunden haben! Die Zivilisation, die diese Errungenschaft der Weltkultur vollbracht hat, nennen wir heute die Sumerer. Sie sind die ersten nachweisbaren Einwohner des Zweistromlandes. Ursprünglich waren die Sumerer nomadische Jäger und Sammler; und es ist unklar, wann genau oder von woher sie damals in ihre neue Heimat wanderten, aber viele Experten halten es für wahrscheinlich, dass sie aus Westasien oder gar aus dem heutigen Indien in die fruchtbare Ebene zwischen Tigris und Euphrat gezogen sind. Es waren die Griechen, die dem Land der Sumerer den Namen Mesopotamien gaben, was „zwischen den Flüssen“ – also Zweistromland – bedeutet. Das geschah im Jahre 331 v. Chr., als sie unter Alexander dem Großen Babylon, die damals bedeutendste Stadt im Nahen Osten, eroberten.
In diesem Zusammenhang sollte noch kurz erwähnt werden, dass einige Forscher auch die Chinesen als zeitgenössische Bierhersteller der Sumerer aufführen. Allerdings hat sich die frühe, meist auf Reis aufgebaute, chinesische Braukunst nicht in der weiten Welt verbreitet. Im Gegensatz dazu wurde die sumerische Braukunst in Abwandlungen zunächst von den alten Ägyptern übernommen und breitete sich dann spätestens im ersten Millennium v. Chr. (wahrscheinlich jedoch schon früher) entlang der Levante und quer durch den Balkan bis ins keltische und germanische Mitteleuropa aus, von wo sie sich schließlich ab dem Zeitalter der Entdeckungen in der Renaissance weltweit durchsetzte.




























