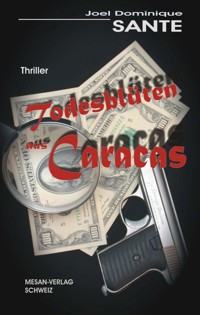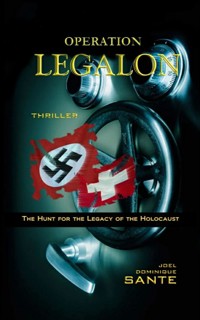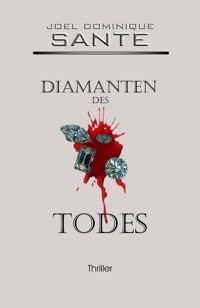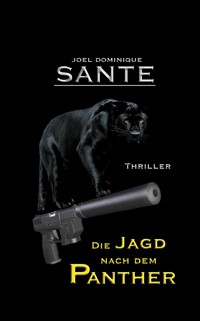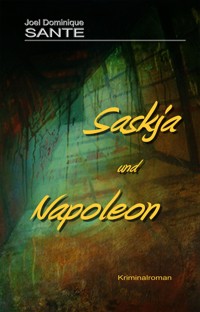Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mordfälle in London, Aufregung in der Schweizer Hochfinanz und Regierung sowie fieberhafte Aktivitäten internationaler Agenten. Es geht um ein Milliardenvermögen, das seit dem 2. Weltkrieg in Schweizer Banksafes lag - und plötzlich verschwunden ist. Superintendent Watchinson von Scotland Yard ermittelt in einem Mordfall, dem eine ganze Kette von Morden folgt. Die Verbindungen zwischen den Toten reichen weit in die Vergangenheit zurück. Aber was haben die Schweizer Banken, die Italienische Mafia und internationale Agenten mit seinen Mordfällen zu tun? Eine Dienstreise in die Schweiz bringt den britischen Kriminalisten der Lösung des Rätsels näher ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unternehmen
LEGALON
Die Jagd nach dem Erbedes Holocaust*
ThrillervonJoel Dominique Sante
1.Auflage 2000
Printed by: Books on Demand (D-Norderstedt)
ISBN 3-8311-1400-5
© 2000 J. D. Sante
Neuauflage 2008
Umschlaggestaltung: MESAN-VERLAG, Schweiz
Printed by: Bookstation GmbH (D-Sipplingen)
ISBN 978-3-9523196-1-1
1. Kapitel
Rastenburg, Deutschland, Sommer 1944
Der 20. Juli zählt zu den heissesten Nachmittagen des Jahres 1944, dessen Ereignisse die Geschichtsbücher noch füllen würden.
Eine drückende Schwüle liegt über der Landschaft von Ostpreussen und selbst den Vögeln ist es zu warm, ihre Flugkünste am Himmel vorzuführen, um damit zu zeigen, wie glücklich sie über ihr vogelfreies Dasein sind. Sie sitzen in den schattenspendenden Bäumen und flattern höchstens einmal wild umher, um von einem Ast auf den anderen Ast zu gelangen. Dann jedoch lässt sie ein rasch näher kommendes Motorengeräusch aufscheuchen.
Eine lange Staubwolke wirbelt hinter der schwarzen Nobelkarosse her, die in rasanter Fahrt aus westlicher Richtung soeben an diesen Bäumen vorbeigleitet. Die wenigen Leute am Strassenrand sehen dem Gefährt mit äusserst gemischten Gefühlen hinterher, denn sie kennen dieses Auto und auch dessen Besitzer.
Es gehört Oberstleutnant Max von Feldhof, Angehöriger der Waffen-SS und direkter Untergebener von Reichsinnenminister Himmler. Feldhof ist ebenso kaltblütig wie auch kaltschnäuzig. Jedermann fürchtet sich vor diesem Mann, dessen Kopfbedeckung auf der Stirnseite einen Totenkopf trägt.
Nach einigen Minuten verringert der Chauffeur des schwarzen Mercedes die Fahrt und er biegt in eine Einfahrt ab, die von Soldaten bewacht wird. Nur wenige Zentimeter vor dem Schlagbaum bremst der Fahrer das Fahrzeug ab. Die Wachsoldaten nehmen sofort eine Achtungsstellung ein, als sie den im Fond des Fahrzeuges sitzenden Passagier erkennen. Bevor der Schlagbaum in seiner komplett vertikalen Position einrastet, setzt sich der Mercedes bereits wieder in Bewegung und die Fahrt geht weiter.
Schon eine Minute später gelangt der Wagen auf einen riesigen bekiesten Platz. Dort stehen bereits Dutzende anderer, vorwiegend schwarzer Limousinen in Reih und Glied. Der Fahrer lenkt den schweren Mercedes vor die Einfahrt eines grossen Tores, das von zwei weiteren Soldaten bewacht wird.
Zackig grüssen sie die schwarze Uniform von Oberstleutnant Feldhof. Auch sie wollen in keiner Weise mit diesem Menschen etwas zu tun haben und kommen deshalb in diesem Moment ihren Pflichten doppelt bewusst nach.
Die Ankunft des SS-Mannes wurde offensichtlich erwartet, denn sogleich wird das grosse Portal zum Führerhauptquartier Wolfschanze bei Rastenburg von innen geöffnet. Ohne den Gruss der beiden Wachsoldaten zu erwidern, verschwindet der hohe Offizier in seinen schwarzglänzenden Stiefeln schnellen Schrittes im unterirdischen Bunker. Unmittelbar darauf schliesst sich das Tor wieder mit einem langanhaltenden Geräusch.
„Hast du eine Zigarette für mich, Hans?“
Karl tritt neben seinen Dienstkameraden, der wie er mit einem Gewehr auf dem Rücken vor dem Hauptquartier von Adolf Hitler auf Posten steht.
Hans nickt und grübelt eine zerdrückte Packung aus seiner Brusttasche. Er hält sie seinem Freund entgegen.
„Hast du Den gekannt?“, erkundigt sich Hans mit düsterer Mine bei seinem Kameraden, während dieser einen Glimmstängel herausfischt.
Er nickt.
„Mit dem möchte ich nichts zu tun haben.“
„Was glaubst du, wie lange die noch da drin sein werden?“, will Hans nun wissen und weist gleichzeitig mit seinem Kopf zum Eingang des Bunkers.
„Ich weiss es auch nicht. Aber, nach dem zu beurteilen, was hier so alles aufgefahren ist, glaube ich, dass es um eine wichtige Entscheidung geht.“
Karl zündet sich die Zigarette mit einem Streichholz an.
„Ich habe selten so viele hohe Offiziere hier versammelt gesehen.“
Auch Hans hat sich nun eine Zigarette angesteckt und jeder ist nun mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
Plötzlich lässt die beiden ein lautes Rasseln zusammenfahren, denn die Riegel der schweren Bunkertüre werden ein weiteres Mal zurückgezogen. Unverzüglich werfen die beiden Soldaten ihre Zigarette wieder weg, denn es ist ihnen nicht gestattet, während der Wache zu rauchen. Gleichzeitig springen sie auseinander und nehmen eiligst ihren angewiesenen Wachtposten, links und rechts der Bunkertüre, wieder ein.
Als sich die Türe zum unterirdischen Schutzraum öffnet, verlässt ein weiterer uniformierter Mann das Gewölbe. Er hat es auffallend eilig, das Hauptquartier von Adolf Hitler zu verlassen.
Hans und auch Karl nehmen beim Vorbeigehen eines Generalstabsoffiziers einmal mehr Haltung an und grüssen wieder vorbildlich. Aber auch dieser Mann geht wortlos und ohne Gruss an ihnen vorbei. Einen Augenblick später erreicht er seine schwarze Limousine, die auf der Kühlerhaube ebenfalls einen Mercedesstern trägt. Keine dreissig Sekunden später lenkt er selber das schwere Fahrzeug über den Kiesweg. Offensichtlich verfügt er über keinen eigenen Fahrer.
Die beiden Wachsoldaten entspannen sich wieder und wenden sich dem Gefreiten zu, welcher dem Mann mit dem steifen Hut das Tor geöffnet hat.
„Das war Stauffenberg, nicht war? Graf Claus von Stauffenberg?“, will Hans bestätigt wissen.
„Ja, das stimmt.“, antwortet ihm der Gefreite. „Ein toller Mann.“
„Na der hatte es mal eilig“, bemerkt Karl und sieht der kleinen Staubwolke hinterher, welche durch das Befahren vom Kies erzeugt wurde. Dann wendet er sich wieder zum Gefreiten um.
„Wie läufts denn da drinnen?“
Der Gefreite winkt ab.
„Dicke Luft.“
Dieser ist sich in diesem Moment nicht bewusst, wie Recht er mit seiner Äusserung hat. Denn kaum hat er geantwortet, werden die drei durch eine ungeheure Druckwelle zu Boden geworfen.
Noch während Karl, Hans und der Gefreite auf dem Boden liegen und immer noch nicht richtig begreifen, was eigentlich geschehen ist, quillt eine dichte Qualmwolke aus dem Gewölbe.
Die Bunkertüre wird wenige Sekunden später ganz aufgerissen und einfache Soldaten wie auch Offiziere stürzen laut hustend ins Freie.
Im Bunker des Führers hat eine Explosion stattgefunden!
Es herrscht ein heilloses Durcheinander und einige flüchtende Soldaten rennen offensichtlich um ihr Leben. Mehrere von ihnen bluten entweder am Kopf oder halten sich sonst irgendwelche Körperpartien schmerzhaft fest. Der Ruf nach Sanitätern verhallt jedoch zwischen den ehrwürdigen Eichen des nahe stehenden Waldes.
„Der Führer! Was ist mit dem Führer?!“, hört man plötzlich jemanden rufen. „Wir müssen nach dem Führer sehen!“
Alle Anwesenden vor dem rauchenden Bunkereingang blicken sich gegenseitig hilflos an. Endlich hat aber ein anscheinend getreuer Mitarbeiter von Adolf Hitler den Mut, wieder in den Bunker zurückzukehren. Er befiehlt zwei anderen Soldaten, sich ihm anzuschliessen.
Hans und Karl sind unterdessen wieder aufgestanden und schütteln immer noch benommen den Kopf. Ihre beiden Gewehre liegen herrenlos auf dem Boden.
„Das war eine Bombe! Ein Attentat auf den Führer! Mein Gott!“, wimmert Hans, der sich zu diesem Zeitpunkt immer noch zu den treuen Gefolgsleuten seines Führers zählt und deshalb um sein Leben bangt.
Es vergehen ungefähr zwei lange Minuten, bis ein Soldat im nur noch dürftig rauchenden Bunkereingang auftaucht.
„Der Führer lebt!“, hat diese Person zu melden. „Er lebt und ist unverletzt!“
Hans und Karl setzen sich nun entgegen aller militärischer Würden, aber auch entgegen aller Vorschriften, wie viele andere erleichtert einfach auf den Kiesboden.
Inzwischen ist auch ärztliche Hilfe eingetroffen. Die Sanität kümmert sich um einige verletzte Landser. Die Verletzungen derjenigen Soldaten, welche sich selber aus dem Bunker retten konnten, stellen sich jedoch als mehr oder weniger harmlos heraus.
„Hast du noch mal eine Zigarette, Hans?“
Abermals reicht ihm sein Freund die Glimmstängel und diesmal kümmert es niemanden, wenn ein Soldat auf der Wache raucht...
* * *
„Attentat auf den Führer!“
Diese Nachricht verbreitet sich im In-, wie auch im Ausland wie ein Lauffeuer. Viele Menschen machen sich ihre eigenen Gedanken über den Anschlag auf Adolf Hitler. Die einen sind bestürzt, die anderen freuen sich oder sind sogar ob des misslungenen Anschlages enttäuscht.
Eine bestimmte Gruppe von Leuten ist jedoch über die beiläufige zweite Nachricht, wonach Oberstleutnant Max von Feldhof bei genau diesem Attentat sein Leben verloren hat, äusserst betroffen und fassungslos.
So auch Otto Braunwald, der mit seinem Freund Hermann Stadler in der Gartenwirtschaft vom Hotel Adlon in Berlin sitzt. Das Hotel Adlon ist das erste Haus am Platz und steht in unmittelbarer Nähe des prächtigen Brandenburgertores. Das Haus gilt als ein Erstklassehotel, das von namhaften Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur aus allen Winkeln der Erde besucht wird. Aber auch die hohen Offiziere, die sich auch gerne in Luxus und vielen Annehmlichkeiten aufhalten. Braunwald und Stadler sind ebenfalls Angehörige der Waffen-SS und beide bekleiden den Rang eines Unteroffiziers.
„Feldhof ist tot? Mein Gott. Und nun? Ich habe ihm alles gegeben, was ich hatte!“
Braunwald weiss, wieso sein Gegenüber in der gut besuchten Gartenwirtschaft derart beunruhigt ist. Ihm selber geht es nämlich im Moment nicht anders.
„Ich weiss!“, antwortet er. „Ich ja auch. Verdammt noch mal. Legalon sollte für uns beide nach dem Krieg eine Altersvorsorge sein. Ich nehme an, dass auch du nicht weisst, wo sich dein Geld befindet?“
Hermann Stadler nimmt einen kräftigen Schluck Bier und wischt sich mit dem Handrücken den Schaum von seinen Lippen. Nervös sieht er sich in der Gartenwirtschaft um.
„Nein, natürlich nicht. Nur Feldhof wusste darüber Bescheid. Ich bin wie viele andere dem Unternehmen Legalon beigetreten und habe vor einem Monat beinahe mein gesamtes Barvermögen an Feldhof übergeben. Wie er mir versicherte, habe er verdammt gute Beziehungen in die Schweiz, wo das Geld sicher und gut angelegt sei. Und zwar auf einem geheimen Konto, zu dem man nur mit einer bestimmten Nummer und einem Codewort Zugang habe. Sozusagen eine todsichere Sache. Und jetzt lebt Feldhof nicht mehr.“
„Mein Gott“, wiederholt sich Braunwald.
„Weisst du, wie viele von uns ihm Geld zur Anlage in der Schweiz gegeben haben? Und jetzt ist vermutlich alles weg. Und die Quittung für das ihm überlassene Geld kannst du auch zerreissen. Feldhof hat unser Vermögen mit in sein Grab genommen.“
„Aber irgendwo müssen doch Aufzeichnungen über diese finanziellen Transaktionen vorhanden sein“, überlegt Stadler flüsternd.
Braunwald winkt ab.
„Das kannst du vergessen, Hermann. Feldhof war ein gewitztes Kerlchen. Und du weisst ganz genau, dass er nur dann seine Verbindungen in die Schweiz spielen liess, wenn man ihm freie Hand gewährte. Da kannst du nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Nein, mein Lieber, unser Vermögen ist weg. Da kommen wir nicht mehr dran.“
Hermann Stadler kann es immer noch nicht fassen, aber er muss seinem Freund Recht geben. Das Unternehmen Legalon ist zu einem Reinfall geworden...
* * *
Januar 1995, im Staatsarchiv von Moskau.
Die alten verrosteten Scharniere knattern jedes Mal lärmend, wenn der Schrank geöffnet wird, denn sie wurden seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, nicht mehr geölt.
„Na, dann auf ein Neues!“, murmelt Ludwig Kerschbaum zu sich selbst und nimmt gleichzeitig vom obersten Regal das oberste Aktenbündel herunter. Es gehört bereits zum Ritual, dass er zunächst einmal mit einem kräftigen Luftstoss allenfalls vorhandenen Staub vom Papierbündel entfernt. An-schliessend fährt er noch mit einem olivgrünen Lappen, den er in der Tasche seines grauen Arbeitsanzuges aufbewahrt, über das oberste Blatt. Dadurch wird die gebleichte Schrift der Tinte ab und zu noch etwas besser sichtbar.
Ludwig Kerschbaum arbeitet erst seit einigen Monaten als Archivar im Moskauer Staatsarchiv und wurde damit beauftragt, die vielen im Keller stehenden Schränke durchzusehen. Neben diversen Akten, Büchern und Zeitschriften sind die Behältnisse auch noch mit vielen deutschen Akten aus dem zweiten Weltkrieg gefüllt und es gilt, etwas Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen.
Während die Bücher und Zeitschriften in die Staatsbibliothek verbracht werden sollen, müssen die Kriegsakten registriert und schliesslich dem Staatsministerium zur Verfügung gestellt werden. Dort werden die Akten nochmals eingehend geprüft und entweder vernichtet oder in einer anderen Weise genutzt. Kerschbaum hat nun schon viele Akten und Dokumente aus dem zweiten Weltkrieg durchgesehen und wurde auf diese Weise über manchen, damals streng geheimen Befehl ebenfalls Mitwisser.
Damals, ja - im Krieg, wäre er mit diesem Wissen wohl zu Tode geschlagen worden. Dass er die, in deutscher Schrift verfassten Dokumente lesen kann, verdankt er seiner Jugendzeit. Denn er wurde in Berlin geboren und ist auch dort aufgewachsen. Auch heute noch beherrscht er die deutsche Sprache perfekt, obwohl er schon viele Jahre in Russland lebt.
Nun hält er wiederum ein verstaubtes, dickes Aktenbündel in seinen Händen. Nachdem er den Aktendeckel wie sonst ein wenig gesäubert hat, kann er den Namen des seinerzeit für das Dossier zuständigen Militärfunktionärs entziffern. Und während er den Namen liest, läuft ihm ein kalter Schauer über den Rücken.
„Reichsinnenministerium Berlin. Oberstleutnant Max von Feldhof“ liest er laut vor.
Der alte Archivar weiss nicht wieso, aber er verspürt plötzlich ein mulmiges Gefühl im Magen und er beginnt zu schwitzen. Das Bündel Akten ist ziemlich dick und an den offenen Seiten mit einer Schnur zugebunden. Eigentlich ist es klar, dass diese Akten sowieso dem Moskauer Staatsministerium zugestellt und somit gar nicht erst geöffnet werden müssten.
Kerschbaum wischt nun ganz unbewusst mit dem verstaubten Lumpen seine Schweissperlen auf der Stirne weg. Gleich darauf fährt er mit dem jetzt natürlich leicht feuchten Lappen nochmals über den Aktendeckel. Er denkt in diesem Moment nicht daran, dass die Feuchtigkeit des Lappens bereits genügt, um die Tintenschrift ein wenig zu verwischen.
Beinahe wäre ihm deshalb auch ein Fluch über die Lippen gehuscht. Aber er hat sich im letzten Moment noch in der Gewalt. Nervös sieht er sich im Keller um, denn die Neugier für dieses Dokument ist gross. Wie von einem inneren Zwang angetrieben, löst Kerschbaum nun die Schnur.
Er ist nicht etwa enttäuscht, sondern eher beruhigt, dass ihm der Inhalt des Dossiers lediglich eine Auflistung mit vielen Namen, erkennbar von damaligen Offizieren der Wehrmacht, offenbart. Hinter all den Namen stehen Nummern, die für Kerschbaum ein Rätsel sind. Und überall ist auch die Bezeichnung SNB aufgeführt. Auch mit diesem speziellen Ausdruck kann der alte Archivar überhaupt nichts anfangen.
„Wahrscheinlich eine Mannschaftsliste“, überlegt Kerschbaum. Er blättert das Dossier noch einmal durch. Aber er findet keinen weiteren Hinweis darauf, um was für eine Liste es sich tatsächlich handelt.
Mit einem leichten Seufzer legt er die vielen Blätter zwischen die beiden Kartondeckel zurück und beginnt damit, das Dossier wieder zuzubinden. Dabei fällt sein Blick auf den unteren Rand des hinteren Kartondeckels, wo eine kleine vergilbte Ecke eines Papiers heraushängt. Sogleich nimmt er nochmals alle Blätter heraus und hält die Kartondeckel ein wenig hoch. Genauestens inspiziert er nun die Verpackung des Dossiers. Tatsächlich - der hintere Kartondeckel ist dicker als der Vordere. Und offensichtlich wurden hier zwei Deckel absichtlich aufeinander geklebt.
Vorsichtig zieht Kerschbaum nun an der zum Vorschein gekommenen Papierecke. Es gelingt ihm, das verborgene Schriftstück beinahe unversehrt herauszuziehen.
Was er nun auf diesem Dokument als Überschrift liest, hätte er niemals erwartet: „Unternehmen Legalon“. Der alte Archivar beginnt augenblicklich zu zittern.
Automatisch wischt er mit seinem Lappen, diesmal jedoch mit einer trockenen Stelle, über die blaue Tintenschrift. Das wäre jedoch gar nicht nötig gewesen, da der Zettel in keiner Weise verstaubt ist.
Und noch einmal murmelt er, was auf dem Dokument steht. „Unternehmen Legalon. Mein Gott, Legalon.“
Er blickt nun von dem Schriftstück auf und starrt ins Leere. Er weiss ganz genau, was das Wort „Legalon“ während des zweiten Weltkrieges zu bedeuten hatte. „Legalon“ wurde damals in einem Zug mit Tod, Schrecken und Verderben genannt.
Der alte Archivar merkt, wie seine Knie langsam weich werden und er muss sich nun doch hinsetzen. Mit einem Mal kommen die Erinnerungen zurück, die er so lange verdrängt hat. Denn Ludwig Kerschbaum hat das Grauen des zweiten Weltkrieges in der ersten Reihe miterlebt und vor allem - mit viel Glück überlebt!
Denn Ludwig Kerschbaum ist Jude!
* * *
„Und Sie sind dessen ganz sicher?“, will der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende des Telefons wissen.
„Da besteht absolut kein Zweifel. Es geht um Legalon. Ich habe es rein zufällig gefunden und ich habe es zweimal überprüft. Die Akten sind ohne Zweifel echt. Und Legalon steht ja sogar auf dem ersten Blatt. Es stimmt alles, was ich ihnen gesagt habe."
„Mein Gott, Kerschbaum. Wenn es das ist, was ich mir erhoffe, so wird Sie das Jüdische Volk auf Händen tragen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Zu niemandem ein Wort! Haben Sie verstanden, Kerschbaum? Zu niemandem! Wir müssen zuerst ganz sicher sein.“
„Ja, natürlich. Von mir erfährt keiner etwas. Aber was soll ich damit nun tun?“, will der Archivar nun wissen.
„Ich werde die Akten bei Ihnen zu Hause abholen lassen. Das fällt weniger auf. Und Sie halten den Mund, haben Sie verstanden?"
"Ja, ja, natürlich. Aber, äh.., ich meine doch, dass diese Information sicher wieder etwas wert ist. Ich meine, dass ich Sie ja noch nie fälschlicherweise...“
Kerschbaum hat sich inzwischen wieder etwas gefangen. Er hat natürlich erkannt, welche Kostbarkeit er möglicherweise in den Händen hält. Dennoch drückt er sich vorsichtig aus, denn er hat vor dem Mann am anderen Ende des Telefons eine hohe Achtung.
Er spricht immerhin mit Chaim Idelsohn, der wie er Jude und damals im zweiten Weltkrieg trotz seinem Glauben so etwas wie ein Freiheitskämpfer war. Er kämpfte damals zwar nicht mit Waffen im üblichen Sinn, sondern meistens mit der Feder. Und ein altes Sprichwort sagt, dass die Feder manchmal mächtiger ist als das Schwert.
Jetzt lebt der 81-jährige Chaim Idelsohn zurückgezogen in einem Aussenbezirk von Moskau und kümmert sich immer noch um die Anliegen der in Russland lebenden Juden und Orthodoxen.
Aber gleichzeitig ist er, Kerschbaum, auch nur ein kleiner Archivar mit einem kleinen Gehalt und muss ebenfalls über die Runden kommen. Und für ein paar Rubel extra lässt seine Zuverlässigkeit dann und wann etwas zu wünschen übrig.
„Ja, natürlich. Keine Angst Kerschbaum. Zuerst muss ich selbst einmal nachsehen, was Sie da gefunden haben. Ich werde Sie dann schon nicht vergessen.“
Daraufhin wird die Leitung unterbrochen.
Dass nach dem Auflegen des Telefonhörers durch Chaim Idelsohn noch ein leichtes Knacken in der Leitung zu hören ist, fällt dem alten Archivar nicht auf.
Kerschbaum hat feuchte Hände. Vor ihm auf dem Schreibtisch liegt vermutlich etwas äusserst Kostbares. Vielleicht sogar die Hinterlassenschaft seines gebeutelten und ermordeten Volkes. Das Erbe des Holocaust!
Legalon, dieses Wort kursierte während des Zweiten Weltkrieges vor allem in den Konzentrationslagern. Und Legalon hatte einen derart bitteren Beigeschmack, wie damals der Totenkopf an den Mützen der Waffen-SS. Nachdem durchgesickert war, dass mit dem Tod von Oberstleutnant Max von Feldhof Legalon und damit die widerrechtlich angesammelten Reichtümer verschollen sind, war es zumindest ein kleiner Trost, wenn nicht sogar Schadenfreude für all die Menschen, die in den Kriegsjahren Hab und Gut Himmlers Schergen überlassen mussten. Ja, sie freuten sich darüber, dass viele ihrer Peiniger schliesslich nichts mehr mit dem eigentlichen Eigentum vieler ermordeter Juden anfangen konnten.
Kerschbaum wird plötzlich bewusst, dass er nicht alleine auf der Welt ist. Er sieht sich deshalb erschrocken im Keller um, doch ist natürlich ausser ihm niemand anwesend. Er nimmt das Aktenbündel und zieht die alten Schnüre wieder zusammen.
Nachdem er ein belegtes Brot und eine Thermoskanne aus seiner schwarzen Ledertasche genommen hat, steckt er das gesamte Dossier dorthinein.
Um 18 Uhr hat der alte Mann Feierabend. Schnell hängt er nun seinen grauen Arbeitsanzug in seinen Garderobenschrank und schliesst ihn ab. Dies wäre allerdings nicht nötig, denn einerseits ist er der einzige Arbeiter in diesem Kellergewölbe und zweitens befindet sich absolut nichts Wertvolles im Schrank.
Das riesige Staatsarchiv in Moskau kann er am Abend schliesslich ohne Zwischenfall und vor allem ohne Kontrolle der Effekten verlassen. Niemand will den Inhalt seiner schwarzen Aktentasche sehen, denn man kennt ihn ja.
Für Ludwig Kerschbaum wird nach der Übergabe des Dossiers, spätestens jedoch beim Empfang seines Lohnes, der Alltag wieder einziehen. Er ahnt jedoch nicht, dass er mit der Weitergabe des Dossiers Legalon ein riesiges Gangwerk in Bewegung setzt, das über fünfzig Jahre nach dem 2. Weltkrieg einigen Menschen wiederum den Tod bringen wird...
* * *
Sommer 1997, London
Prasselnd klatschen die kalten Regentropfen gegen die Windschutzscheibe des kleinen Ford Fiesta. Die abgenützten Scheibenwischerblätter bewegen sich wedelnd über das Glas und versuchen mit aller Kraft, die anströmenden Wassermassen zu verdrängen.
Was soll nur aus dem Wochenende werden?, denkt sich Henry McCloud, der sein Auto trotz miserabler Sicht mit sicherer Hand durch den Feierabendverkehr von London lenkt. Die ganze Woche über herrschte herrliches Sommerwetter und nun sollte laut Wetterbericht eine Kaltwetterfront von Nordwesten her aufziehen. Die stürmischen Winde, die den Regen begleiten, sind zusätzliche Vorboten der Wetterstörung.
Enttäuscht über die schlechte Laune von Petrus bringt Henry seinen Wagen vor einem Reiheneinfamilienhaus in der St. John Street zum Stillstand. Nachdem er sich den Kragen seines Jacketts hochgeschlagen hat, öffnet er in aller Eile die Wagentüre und verlässt hastig den fahrbaren Untersatz.
Als er die Autotüre verschliessen will, entfällt ihm der Schlüsselbund aus der Hand direkt in eine Pfütze.
„Shit!“, flucht er über sein Missgeschick. Mit spitzen Fingern angelt er die Schlüssel aus der Wasserlache und schüttelt, so weit es möglich ist, die mit Schmutz behafteten Wassertropfen ab. Gleich darauf verschliesst er dann die Autotüre endgültig.
Währenddessen nimmt er nicht wahr, dass auf der gegenüberliegenden Strassenseite ein blauer Rover abgestellt ist. Die beiden männlichen Insassen belustigen sich an dem, im Regen stehenden Mann.
Ein wenig ausser Atem und mit einigen Schimpfwörtern erreicht Henry schliesslich die Haustüre.
Erstaunt muss er feststellen, dass die Türe nicht wie üblich verriegelt, sondern lediglich eingeschnappt ist. Er gibt der Türe einen kleinen Schubs und betritt schnell den Korridor. Den nassen Schlüsselbund hängt er wie gewohnt neben der Türe in einen kleinen Schlüsselkasten.
„Mary!“, ruft er laut. „Mary, ich bin’s!“
Gleichzeitig schliesst er schnell die Türe hinter sich zu, denn Windböen wehen nun bis in den Korridor hinein.
Rasch entledigt er sich seiner nassen Jacke und Schuhe und deponiert die Kleidungsstücke bei der Garderobe.
Während Henry in seine Hausschuhe schlüpft, nimmt er im Haus eine eigenartige Stille wahr. Er fühlt im Unterbewusstsein, dass etwas nicht ist wie sonst. Er begibt sich aber zunächst einmal auf den Weg zum Wohnzimmer, das durch eine zweiteilige Schiebetüre zum Korridor abgegrenzt ist.
Als er die Türe öffnet, glaubt er seinen Augen nicht zu trauen. Es trifft ihn beinahe der Schlag, denn eine wüste Unordnung ist im Zimmer anzutreffen. Sämtliche Schubladen der Einbauschränke und des Schreibtisches wurden herausgerissen und der Inhalt der Behältnisse liegt verstreut und zerwühlt auf dem Boden herum. Der kostbare Lederbezug der Couchgruppe weist hässliche Schlitze auf und die weisse Füllung schaut an mehreren Stellen hämisch aus den Schlitzen hervor.
Nachdem er einen kurzen Blick in die Küche geworfen hat, wo er das gleiche Chaos antrifft, läuft er zur Treppe, die ihn ins Obergeschoss führt.
Auf den Stufen stolpert er beinahe über eine leere Kartonschachtel, die ihm den Weg ein wenig versperrt. Einmal mehr muss er fluchen. Als er im Obergeschoss ankommt, stellt er beim Vorbeigehen durch die geöffnete Schlafzimmertüre fest, dass auch dort ein heilloses Durcheinander herrscht. Aber hier ist seine Frau ebenfalls nicht anzutreffen. Sein Rundgang endet beim Badezimmer, dessen Türe er nun verschlossen vorfindet.
„Mary!“, ruft er laut und rüttelt gleichzeitig an der Türe. Aber er erhält keine Antwort.
„Mary!“, ruft er nochmals und poltert nun an das Türblatt. Aber auch diese Methode ruft keinerlei Reaktion hervor.
Der aufgeregte Ehemann kann mit einem kurzen Blick durch das Schlüsselloch feststellen, dass von innen kein Schlüssel steckt.
Er rüttelt weiter an der Türklinke.
„Mary, bist du da drin?! So mach doch auf! Was soll denn das!“
Er poltert weiter mit der Faust gegen die Türe. Aber, was der aufgeregte Mann auch anstellt, so ist keinerlei Laut aus dem Badezimmer zu vernehmen. Das Henrys Herz schlägt schon lange überdurchschnittlich schnell. Ja, es droht nun beinahe, aus der Brust zu springen. Kurz entschlossen tritt er schliesslich zwei Schritte zurück und nimmt Anlauf. Unter der Einwirkung seines Körpergewichtes, springt die Türe aber erst beim zweiten Versuch aus dem Schloss.
Das Bild, das sich Henry McCloud nun bietet, übersteigt im Moment beinahe sein Fassungsvermögen.
Überall an den Wänden kleben Blutspritzer und eine wüste Unordnung ist festzustellen. Der geschockte Mann tritt näher an die Badewanne heran, wo ein blutverschmierter Arm eines Menschen leblos heraushängt. Nur die Wasserperlen, die aus dem Wasserhahn in das Badewasser tropfen, sind zu hören und stören die gespenstische Ruhe.
Im rötlich gefärbten Wasser liegt seine Frau. Seine tote Frau! Stur blicken ihre toten Augen unbeweglich an die Decke.
Die schockartige Erkenntnis, dass seine Frau vermutlich ermordet wurde, lässt Henry rückwärts aus dem Badezimmer taumeln. Voller Benommenheit stürzt er beinahe die Treppe hinunter, denn er übersieht auf den Stufen nochmals die leere Kartonschachtel. Im letzten Moment kann er sich jedoch noch am Treppengeländer festhalten.
Verstört läuft er aus dem Haus. Auf dem Gehsteig prallt er mit seiner Nachbarin zusammen, die sich auf dem Heimweg befindet. Mrs. Robertson bekundet durch den Zusammenprall einige Mühe, dass ihr die soeben eingekauften Lebensmittel nicht aus den Händen fallen.
Stotternd erwähnt der geschockte Ehemann mehrmals den Namen seiner Frau und überraschend schnell realisiert sie, dass etwas passiert sein muss. Sie eilt, ohne sich weiter um den Mann zu kümmern, in das Reiheneinfamilienhaus der McClouds.
Henry indessen läuft weiterhin besinnungslos und doch automatisch zu seinem Wagen und langt nach dem Türgriff. Erst da begreift er, dass sich die Autoschlüssel noch immer im Haus befinden. Er zittert am ganzen Leib. Aus unerklärlichen Gründen geht er jedoch nicht zum Haus zurück, sondern wendet sich von seinem fahrbaren Untersatz ab. Er taumelt die St. John Street entlang, wo er im angrenzenden Park verschwindet.
Auch diesmal bemerkt er den unbekannten Mann nicht, der nun aus dem blauen Rover ausgestiegen ist und ihm folgt. Er hat seinen Hut tief ins Gesicht gezogen und der hohe Mantelkragen verdeckt zusätzlich die Gesichtskonturen. Auch er verschwindet schliesslich an der gleichen Stelle im dunklen Park, wie kurz vorher Henry McCloud...
* * *
Superintendent Watchinson und Inspektor Powell haben sich die Tote in ihrem vom Blut rot gefärbten nassen Grab für einen kurzen Augenblick angesehen. Sie liegt, wie sollte es auch anders sein, nackt in der Wanne. Auf der Brust und auch am Hals sind hässliche, rot unterlaufene Stichwunden zu erkennen.
Nachdem der Erkennungsdienst seine ersten Fotos geschossen hat, wird das Badewasser abgelassen, was die Arbeit des Gerichtsmediziners wesentlich erleichtern wird.
Die beiden Kriminalbeamten treten wieder etwas in den Hintergrund zurück und verfolgen zunächst wortlos das weitere Vorgehen der in weissen Plastikanzügen eingekleideten Beamten der Spurensicherung. Zusätzliche Fotos werden erstellt; Haarbüschel werden in Plastikbeutel gesteckt und diverse Blutspritzer fachgerecht gesichert. Auch die Rückstände unter den Fingernägeln der Toten werden mit einem zweckentsprechenden sterilen Gerät gelöst und ebenfalls für eine spätere Analyse gesichert.
Watchinson nimmt im Unterbewusstsein die Beobachtung auf, dass die Ermordete einige Ringe trägt. Dabei fällt ihm besonders ein Siegelring auf, worauf ein Pferd mit Flügeln abgebildet ist.
„Wer hat die Ermordete gefunden?“, erkundigt sich Watchinson nach einiger Zeit bei seinem zuverlässigen Mitarbeiter Jack Powell.
„Miss Phillis Robertson“, liest der Inspektor aus seinem kleinen, schwarzen Buch vor. „Sie wohnt im Haus nebenan. Sie wird soeben durch Constable Baecker befragt. So viel ich weiss, wurde sie vor dem Haus beinahe vom Ehemann der Ermordeten überrannt, als dieser sein Haus fluchtartig verlassen hat. Die Zeugin muss offensichtlich sofort bemerkt haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, weshalb sie Nachschau hielt. So fand sie dann die Tote hier im Badezimmer und hat daraufhin sofort die Polizei gerufen.“
„Ihr Ehemann also, aha. Ist die Fahndung nach ihm schon raus?“
„Ja Sir, die Fahndung wurde wie üblich sofort veranlasst.“
„Na ja, eigentlich hatte ich mich auf ein ruhiges Wochenende gefreut“, bemerkt Watchinson mit einem leichten Seufzer in der Stimme, als er das Badezimmer verlässt. „Doch bei dem Hundewetter verpassen wir ja auch nicht viel.“
Er steuert die Treppe an.
„Unterhalten wir uns zuerst einmal selber mit dieser Miss Robertson.“
Nachdem Watchinson und Powell das Tatobjekt verlassen haben, müssen sie sich zunächst einen Weg durch die zahlreich angelockten Schaulustigen bahnen. Auch die Journalisten der Tagespresse sind bereits wieder vor Ort. Weiss Gott, woher die immer so schnell Wind von einer Sache erhalten, die möglicherweise als Schlagzeile des nächsten Morgens gilt.
Beim Vorbeigehen gibt der Kriminalbeamte den Zeitungsleuten ein abwehrendes Handzeichen, womit er wortlos zu verstehen gibt, dass er der Presse keine Auskünfte erteilen möchte. Zumindest im Moment nicht.
„Ich könnte mir etwas Schöneres vorstellen, als hier im Regen herumzustehen“, bemerkt Watchinson, der Leiter des Morddezernates von Scotland Yard, sarkastisch.
Einen Augenblick später erreichen die beiden Polizeibeamten die Wohnungstüre von Mrs. Robertson. Auch dieser Eingang wird durch einen uniformierten Polizeibeamten bewacht. Nicht etwa, weil die Gefahr besteht, dass jemand das Haus verlassen könnte. Nein. Eher deshalb, damit keiner in das Haus gelangen kann - vor allem niemand von der Presse.
Ohne zu läuten, betreten die beiden Beamten das Haus. In der Küche treffen sie dann Constable Baecker an, der mit der Befragung von Mrs. Robertson begonnen hat.
„Sie kehrten also eben erst vom Einkaufen zurück, als Sie Mister McCloud auf dem Gehsteig antrafen?“
Phillis Robertson steht am Herd und ist damit beschäftigt, heisses Wasser für ein Getränk zuzubereiten.
„Ja, das stimmt“, gibt sie mit ihrer schrillen Stimme zur Antwort. „Das heisst, eigentlich von der Arbeit. Wissen Sie, ich arbeite jeden Tag als Aushilfe auf dem Gemüsemarkt. Mein Mann, Gott habe ihn selig, ist vor drei Jahren gestorben und so muss ich eben meinen Lebensunterhalt selber verdienen. Die Witwenrente reicht ja nirgends hin. All zuviel zahlt der alte Hopkins ja nicht gerade, aber...“
Ihr Redeschwall wird von Constable Baecker unterbrochen, der am Küchentisch sitzt und immer wieder wichtige Details in seinem Notizbuch festhält. Sein nasser Hut liegt auf einem Stuhl.
„Wie lange wohnen die McClouds denn schon im Haus nebenan?“
„Nun ja, da muss ich überlegen. Drei Jahre liegt Ben, Gott habe ihn selig, nun schon unter der Erde. Ja, dann dürften es jetzt ungefähr 2 Jahre her sein, seit sie eingezogen sind. Die McClouds sind nämlich ungefähr ein Jahr nach Bens Tod eingezogen. Ja das stimmt. Sie müssen wissen, dass ich immer darauf bedacht war, dass ich gute Nachbarn kriege. Die Häuser gehören ja alle Thompson, dem alten Halsabschneider und wir...“
Weiter kommt sie ein weiteres Mal nicht, denn nun greift Watchinson in das Verhör ein.
„Sie kannten Mrs. McCloud gut?“
Ein wenig misstrauisch mustert sie nun den Mann, der kurz vorher in die Küche getreten ist und sich nun in das Gespräch einmischt.
„Tja, was heisst hier gut. Wir kannten uns eben. Manchmal haben wir uns gegenseitig mit ein paar Lebensmitteln ausgeholfen.“
„Was war Mrs. McCloud für eine Frau?“
„Nun, wenn Sie mich so direkt fragen?“
Sie blickt in der Runde herum. Da alle übrigen Anwesenden stumm bleiben, führt sie weiter aus.
„Jetzt kann ich es ja sagen. Ich glaube mit der Treue hielt sie es nicht gerade so, wie eine liebende Ehefrau.“
„Wie kommen Sie denn darauf?“
„Nun ich weiss nicht. Na ja, der McCloud tut es ja sowieso nicht mehr weh. Also, Inspektor äh...“
„Watchinson, Superintendent Watchinson“, stellt er sich vor.
„Oh, also Superintendent. Hier, in dieser Strasse, erzählt man sich ja so viel. Man munkelt, dass Mrs. McCloud nicht nur Hausfrau gewesen ist. Wie soll ich es sagen – na ja, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, nicht wahr?“
Wiederum sieht die alte Frau nacheinander jeden der Polizisten an.
Watchinson stellt sich aber absichtlich dumm.
„Nein. Nicht im Geringsten.“
In diesem Augenblick beginnt der Teekessel mit dem heissen Wasser zu pfeifen. Sie dreht sich um und nimmt den Kessel mit einem Lappen, der zu früheren Zeiten wohl einmal strahlendweiss gewesen ist und nun sämtliche Farben eines Unwetters aufweist, vom Herd. Unmittelbar danach dreht sie den Elektroherd ab.
„Na, also man erzählt sich, dass sie regelmässig kleinere Ausflüge mit anderen Männern unternommen habe. Sie war ja wirklich ein hübsches Ding, und sie konnte sich zeigen lassen... Tee?“, erkundigt sie sich unvermittelt in der Runde.
Alle drei Beamten winken zur gleichen Zeit ab. Etwas enttäuscht wendet sich Mrs. Robertson ihrem Küchenschrank zu und nimmt mit der freien Hand eine Tasse heraus.
„Sie meinen also, dass Mrs. McCloud ihren Ehemann mit anderen Männern betrogen hat?“, will Watchinson geradeheraus wissen.
Man sieht der Witwe an, dass sie über die Direktheit des Polizisten erschrocken ist, denn sie stockt einen Augenblick in ihren Ausführungen.
Während sie das heisse Wasser in die Tasse giesst, beantwortet sie die Frage etwas umständlich:
„Ja, nun, also... Ich will ja nichts gesagt haben. Sie verstehen mich? Ich rede nicht gerne über andere Leute.“
Ein leichtes Schmunzeln huscht den Zuhörern über das Gesicht und ihre Blicke treffen sich.
Watchinson muss nun psychologisch vorgehen.
„Aber, sehr geehrte Mrs. Robertson. Es liegt mir fern zu denken, dass sie über andere Leute reden. Sie müssen sich jedoch klar darüber sein, dass es sich hier um einen Mordfall handelt, den wir aufzuklären bemüht sind. Ich wäre Ihnen also sehr verbunden, wenn Sie sich daran erinnern könnten, wann und mit wem Mrs. McCloud in letzter Zeit ausgegangen ist. Im Übrigen erfährt es die Verstorbene ja sowieso nicht mehr, wie sie selber schon bemerkten.“
Die Witwe muss sich selber eingestehen, dass der Kriminalbeamte sie durchschaut hat und es nun kein Zurück mehr gibt.
Inzwischen hat der Teebeutel ebenfalls seinen Weg in die Tasse gefunden.
„Ja, also es ist so. Ich habe Mrs. McCloud selber schon mehrmals gesehen, als sie an der Ecke in ein Auto gestiegen ist. Am Steuer sass immer derselbe junge Mann.“
„Können Sie mir den Namen des Mannes nennen oder wie sah er aus?“
„Den Namen kenne ich natürlich nicht“, antwortet sie entrüstet. „Aber er war meiner Meinung nach ungefähr gleich alt wie Mrs. McCloud. Er war recht schlank und schien mir gross zu sein. Er hatte blonde Haare…“, überlegt sie. „Ach ja, und einen Schnurrbart, so wie Sie Inspektor – äh.. ich meine natürlich Superintendent.“
Watchinson lässt sich dabei überraschen, wie er in diesem Moment eitel an seine behaarte Oberlippe greift. Verlegen sieht er deshalb einen Augenblick seine Mitarbeiter an.
„Ich bitte Sie, Mrs. Robertson, dem Polizeibeamten“, er weist gleichzeitig auf Constable Baecker „alles zu sagen, was Sie über das Ehepaar McCloud wissen. Jede Kleinigkeit könnte für uns von Bedeutung sein.“
Mit diesen Worten wendet sich Watchinson ab. Er verlässt zusammen mit Powell, der sich während der Befragung stets im Hintergrund gehalten und in sein schwarzes Notizbuch ebenfalls Eintragungen machte, das Haus.
„Was halten Sie von der Frau, Powell?“
Powell beginnt zu grinsen.
„Ich nehme an, dass ihr Hopkins beim Gemüsesortieren deshalb so wenig zahlt, weil sie vermutlich die Hälfte der Arbeitszeit mit Schwatzen verbringt.“
Watchinson muss zustimmend lachen.
„Aber im Ernst…“, fügt Powell hinzu, „Ihre Beobachtung hinsichtlich des Unbekannten mit dem Auto, mit dem sich die McCloud öfters getroffen haben soll, könnte für uns interessant sein. Ich werde veranlassen, dass in dieser Richtung ebenfalls in der Nachbarschaft nachgefragt wird.“
Während sich Powell auf den Weg macht, um einen weiteren Polizeibeamten in Uniform Anweisungen zu erteilen, kehrt Watchinson ins Tatobjekt zurück.
Inzwischen hat sich die Menschentraube vor dem Haus ein wenig aufgelöst. Nur einige Leute von der Zeitung stehen noch im Regen. Bevor die Journalisten den Kriminalbeamten im Regen entdecken können, gelingt es ihm jedoch wieder, das Tatobjekt unbehelligt zu betreten.
Als langjähriger Mitarbeiter im Morddezernat hat er sich daran gewöhnt, sich persönlich immer genauestens am Tatort umzusehen. Dies hat absolut nichts mit einem etwaigen Misstrauen gegenüber der Zuverlässigkeit des Erkennungsdienstes zu tun. Einerseits will er sich aber über die Lebensumstände und Gewohnheiten eines Opfers informieren. Andererseits bemerkt er manchmal doch noch Dinge, die für den Spezialisten des Erkennungsdienstes wohl uninteressant erscheinen - für den Kriminalisten jedoch äusserst wertvolle Hinweise geben könnten. Auch versucht er sich immer wieder in die Person des Opfers zu versetzen.
In diesem Fall ist es nun eine Frau.
In allen Zimmern ist eine grosse Unordnung anzutreffen. Die Kleiderschränke stehen offen und alle Schubladen liegen herausgerissen auf dem Fussboden. Der Inhalt der Schmuckschatulle liegt im Schlafzimmer auf dem Bett. Die angetroffene Situation hinterlässt jedoch nicht den Eindruck, wonach es die Täterschaft auf Kostbarkeiten abgesehen hatte. Sogar das Portemonnaie der Ermordeten befindet sich noch in ihrer Handtasche. Und das enthält immerhin ungefähr 250 Pfund.
Mehr und mehr kommt der Kriminalbeamte somit zum Schluss, dass es sich hier nicht um einen normalen Einbruch handelt. Entweder wurde die Täterschaft gestört oder sie hat nach etwas ganz Bestimmtem gesucht. Aber was könnte dieses Etwas wohl sein?
Nach seinem Rundgang durch Keller, Abstellraum, Wohn- und Schlafzimmer, betritt er die Küche.
Das Reich der Hausfrau, wie man so schön sagt. In der Küche, überlegt sich Watchinson, hegen so manche Hausfrauen Geheimnisse. Geheimnisse, welche sich manchmal zu lüften lohnen.
Selbstverständlich erst nach erfolgter Spurensicherung durch den Erkennungsdienst, öffnet er jede Schublade und jeden Schrank nochmals. Auch schaut er ab und zu in Dosen oder Büchsen, die in den Regalen stehen und als Vorratsbehälter zum Beispiel für Salz oder Zucker dienen. Sogar der Eisschrank bleibt vor den prüfenden Augen des erfahrenen Kriminalbeamten nicht verschont. Aber trotz intensiver Suche kann er nichts Verdächtiges feststellen.
So kehrt er wieder in das verwüstete Wohnzimmer zurück. Dort sind die Beamten des Erkennungsdienstes soeben damit beschäftigt, ihr Argentorat, Ninhydrin und wie die chemischen Mittel zur Erkennung von Fingerabdruckspuren sonst alle heissen, wieder in die Koffer zu packen.
Gleichzeitig tritt der Gerichtsmediziner in den Raum, der offensichtlich den zuständigen Ermittlungsbeamten sucht. Seine schwarze Tasche deponiert er bei der Schiebetüre zum Korridor.
„Nun Doc, wie sieht es aus?“, begrüsst Watchinson den Arzt. Er kennt ihn natürlich schon seit vielen Jahren und obwohl dieser bereits das 60. Altersjahr überschritten hat, hinterlässt er noch einen höchst vitalen Eindruck.
„Eintritt des Todes vor ungefähr 2 Stunden. Die genaue Zeit kann ich jedoch erst nach der Obduktion ermitteln. Das warme Badewasser beeinträchtigt natürlich die fortschreitende Leichenstarre. Das macht die Bestimmung der Todeszeit noch etwas schwieriger. Der Tod dürfte durch mehrere Stiche in die Herzgegend eingetreten sein. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein spitzes Messer oder sogar um ein Stilett gehandelt haben. Aber, wie ich schon sagte, genaueres nach der Obduktion.“
„Danke Doc, das genügt mir im Augenblick.“
Als der Arzt das Zimmer wieder verlässt, kann der Kriminalbeamte gerade noch beobachten, wie der Zinksarg die schmale Treppe hinauf getragen wird. Er schiebt deshalb die beiden Schiebetüren zusammen, damit er nun wieder ungestört sein kann.
Er unterzieht das Wohnzimmer, wie vorher die übrigen Räume, ebenfalls einer genauen Prüfung. Zuerst widmet er sich dem kleinen Schreibtisch, der neben dem Fenster steht. Auch dieses Möbelstück ist vom menschlichen Hurrikan, der hier gewütet hat, nicht verschont geblieben. Die meisten Schriftsachen liegen auf dem Boden herum. Obwohl der Erkennungsdienst bereits seine Arbeit getan hat, berührt der Kriminalbeamte die Schriftstücke nicht mit seinen Händen, sondern stochert mit einem stumpfen Kugelschreiber darin herum. Er kann jedoch keine aussergewöhnlichen Dokumente finden.
Er lässt seine Augen über das Bücherregal wandern. Sonderbar, hier stehen noch alle Bücher in Reih und Glied. Als wären sie erst gerade eingereiht worden. Wurde die Täterschaft vielleicht doch gestört? Er tritt näher und betrachtet die Buchtitel. Meist wissenschaftliche Bücher oder Buchtitel, deren Inhalt auf den Umgang mit Computern verweisen. Dann fällt ihm ein Buch auf, das gar nicht in die Reihenfolge passt.
Ein Kochbuch!
Kochbücher bewahren die Hausfrauen doch in der Küche auf, wo sie immer sofort zur Hand sind. Weitere Bücher, die darauf schliessen lassen könnten, dass sie allenfalls von der Hausherrin gelesen würden, sind keine vorhanden.
Watchinson hat in seiner langjährigen Laufbahn als Kriminalbeamter gelernt, dass es in der Regel das Beste ist, immer dem ersten Gedanken zu folgen. Deshalb nimmt er das Buch aus dem Regal, schlägt es auf und blättert darin herum.
Hoppla! Aus den Augenwinkeln heraus bemerkt Watchinson, wie irgendetwas zu Boden segelt. Sofort bückt er sich danach.
Es ist ein Zettel. Nein, eine Fotografie! Nanu, wie kommt eine Fotografie in ein Kochbuch?
Verblüfft nimmt er die Fotografie, die offensichtlich mit einer Polaroidkamera gemacht worden ist, in die Hände und studiert die abgebildeten Personen auf dem Bild.
Das Lichtbild zeigt zwei Männer und eine, nur mit einem Slip bekleidete Frau, die einen der Männer umarmt. Offensichtlich amüsieren sie sich an einem Fest. Im Hintergrund ist die Zahl 1992 zu lesen. Girlanden sind aufgehängt und eine der Personen trägt einen Hut aus Pappe.
Watchinson runzelt die Stirn und macht sich seine Gedanken. Wer sind wohl diese Leute? Mit einiger Phantasie kann man bei der Frau die Gesichtszüge der ermordeten Mary McCloud erkennen. Watchinson hat die Verstorbene ja nur wenige Minuten in ihrer Badewanne liegen sehen. Doch nach längerer Betrachtung des Bildes ist er fast sicher, dass es sich bei der abgebildeten Frau um die Ermordete handelt.
Und wer sind die beiden Männer?
Einer der Männer könnte eventuell ihr Ehemann sein. Watchinson kennt ihn nicht und er hat auch im ganzen Haus weder von ihr noch von ihm Fotografien gesehen. Gerade diesen Umstand registriert er nun im Unterbewusstsein wiederum als etwas merkwürdig.
Watchinson steckt die gefundene Fotografie in seine Manteltasche und steckt das Kochbuch, nachdem er dieses prüfend noch einmal geschüttelt hat, wieder in das Bücherregal zurück. Im gleichen Moment geht die Schiebetüre auf und Powell steckt seinen Kopf durch den entstandenen Spalt.
„Ah, hier sind Sie? Der Erkennungsdienst ist fertig und zieht ab. Ist noch etwas zu veranlassen?“.
„Ich nehme an, vom Ehemann fehlt noch immer jede Spur?“
Powell tritt nun ganz in den Raum.
„Ja Sir. Bis jetzt sind noch keine Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort eingegangen. Ich habe auch veranlasst, dass sämtliche Pressestellen von der Fahndung in Kenntnis gesetzt werden. Aber leider haben wir von ihm im Moment noch kein Bild. Wir sind jedoch bemüht, über die Fahrzeugzulassung vom Führerschein eine Kopie zu erhalten. Auch die Grenzen wurden verständigt“.
„In Ordnung“, erwidert der Superintendent. „Ich glaube, wir können hier auch nichts mehr tun. Lassen Sie das Haus versiegeln. Ausserdem wünsche ich, dass das Anwesen überwacht wird. Zumindest heute Nacht. Vielleicht kehrt McCloud hierher zurück. Übrigens, haben Sie seinen Wagen ebenfalls von der Spurensicherung untersuchen lassen?“
„Natürlich Sir, ich war selbst während der Durchsuchung dabei. Sein Auto steht vor der Haustüre und ist ordnungsgemäss verschlossen. Die Zündungsschlüssel sind im Schlüsselkasten hier im Haus deponiert. Anlässlich der Spurensicherung konnte jedoch nichts Aussergewöhnliches festgestellt werden, das uns im Moment vielleicht weiterhelfen könnte.“
„Gut, packen wir’s an“, bemerkt Watchinson, womit er sich eines alten Werbeslogans einer Ölfirma bedient.
* * *
Einen Tag später.....
„Cross Limited, In- und Auslandtransporte, hier ist das Vorzimmer von Mister Cross. Sie wünschen bitte?“
Die weibliche Stimme tönt etwas gelangweilt. Man vermutet indirekt hinter dem Telefon eine Frau, die gegenwärtig mit dem Bemalen ihrer Fingernägel beschäftigt ist.
„Mister Cross!“, antwortet eine barsche männliche Stimme.
„Mister Cross befindet sich derzeit in einer wichtigen Besprechung und kann leider nicht gestört werden. Geben Sie mir bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und Mister Cross wird Sie unverzüglich zurückrufen, sobald er frei ist.“ Offensichtlich eine Standardauskunft, welche die Sekretärin vermutlich jeden Tag mehrmals herunterleiern muss.
„Ich sagte, ich will Cross sprechen!“, wiederholt der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung seinen Wunsch. „Und zwar schnell! Sagen Sie ihm nur den Namen Heinrich Groll und er wird Zeit für mich haben!“
„Ich glaube zwar nicht, dass Mister Cross sich gerne stören lässt, aber ich versuche es. Einen Moment bitte, Sir.“
Die Vorzimmerdame mit Namen Lucy Travers hasst es, freundlich zu sein, wenn sie jemand so anschnauzt wie eben. Zähneknirschend meldet sie ihrem Arbeitgeber über die Gegensprechanlage den arroganten Anrufer.
„Verzeihung Mister Cross, aber es will Sie jemand am Telefon sprechen, der sich nicht abweisen lässt.“
Es hallt laut und unmissverständlich aus dem Lautsprecher.
„Ich sagte doch, dass ich nicht gestört werden will, Miss Travers!“
„Ich weiss, Sir. Aber ich glaube, es ist wirklich dringend. Der Anrufer lässt ausrichten, ich solle Ihnen den Namen Heinrich Groll nennen und Sie wüssten dann, worum es sich handelt.“ Gespannt lauscht nun Lucy auf die Reaktion ihres Chefs.
„Groll? Sagten Sie Heinrich Groll? Nun, einen Augenblick...“
Der Transportunternehmer nimmt den Finger von der Gegensprechanlage. Er wendet sich an seine beiden gut gekleideten Besucher, die vor seinem Schreibtisch sitzen.
„Meine Herren, es tut mir ausserordentlich Leid, aber sie hören ja selbst. Darf ich Sie bitten, einen Moment lang im Vorzimmer Platz zu nehmen? Es dauert wirklich nur eine Minute.“
Wortlos nickend kommen die beiden Männer dem Wunsch des Hausherrn nach.
Nachdem sie die Türe hinter sich geschlossen haben, teilt Allen Cross seiner Sekretärin mit, dass sie den Anruf nun durchstellen kann.
„Hier Allen Cross. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?“
„Hallo Cross! Was ich will, werde ich dir gleich sagen. Wer ich bin, wirst du nie erfahren. Ich will mit dir ins Geschäft kommen. Und zwar vergesse ich den Namen Heinrich Groll, wenn du mir eine halbe Million Pfund zahlst!“
Allen Cross schnappt nach Luft und er muss sich zusammennehmen, damit seine Stimme sicher klingt.
„Was sind Sie denn für ein Irrer? Ich kann mit dem Namen Heinrich Groll nichts anfangen und ich wüsste deshalb auch nicht, warum ich Ihnen eine halbe Million Pfund zahlen sollte.“
Ein lautes Lachen dringt nun an das Ohr des Transportunternehmers.
„Mach dich nicht lächerlich. Du weisst haargenau, was es mit dem Namen Heinrich Groll auf sich hat, sonst hättest du den Anruf gar nicht erst entgegengenommen. Doch als du diesen Namen vernahmst, wusstest du, dass du es dir nicht leisten kannst, den Anruf zu ignorieren!“
„Ich sage Ihnen nochmals, dass mir der Name nichts sagt, also lassen Sie mich gefälligst zufrieden.“
Cross meint nun doch, ein leichtes Beben in seiner Stimme zu bemerken und er würde am liebsten aufhängen. Eine innere Stimme rät ihm jedoch von seinem Vorhaben ab.
„Aber, aber Cross...“
„Für Sie immer noch Mister Cross!“
Der schwergewichtige Mann hinter seinem Schreibtisch versucht immer noch, seine Ruhe zu bewahren und in diesem Gespräch die Oberhand zu behalten.
Die Stimme des unbekannten Anrufers wird nun aber leiser und gleichzeitig bedrohlich.
„Höre mir nun gut zu, Cross! Entweder du zahlst mir die Kleinigkeit von einer halben Million Pfund oder du tauschst dein schönes Büro mit einer nicht ganz so schönen Zelle im Gefängnis. Übrigens kannst du dort nicht jeden Mittwochabend mit deiner Vorzimmeramsel ins Bett kriechen!“
Das hat gesessen. Der Kerl muss gut über mich Bescheid wissen, erkennt nun der Unternehmer.
„Ich habe deine schwarze Weste durchleuchtet, Cross. Ich weiss genug über dich und deine Machenschaften. Ich gebe dir einen Tag Zeit, das Geld zu beschaffen. So wie du lebst, dürfte das für dich nicht allzu schwierig sein. Vor der Polizei habe ich keine Angst. Die rufst du nicht an, denn dabei würdest du selbst zuviel riskieren. Ich rufe dich morgen zur gleichen Zeit wieder an. Wie gesagt, Groll ist das Stichwort!“
Bevor Allen Cross noch etwas erwidern kann, wird am andern Ende der Leitung der Hörer wieder aufgelegt. Auch er legt schliesslich den Hörer beinahe im Zeitlupentempo wieder auf die Gabel zurück.
Obwohl die Klimaanlage in seinem Büro auf Hochtouren läuft, zeichnen sich an seinen Wangen einige Schweissperlen ab.
Was dieser Anruf zu bedeuten hat, weiss Allen Cross nur zu gut. Doch wer ist der unbekannte Mann und woher kennt er den Namen Heinrich Groll?
Langsam weicht seine Angst der Wut. Er ist derart mit seinen Gedanken beschäftigt, dass er erst wieder in die Wirklichkeit zurückfindet, als der Bleistift, den er während des Telefonates krampfhaft gehalten hat, mit knirschendem Krachen zerbricht.
* * *
2. Kapitel
„Herein!“, ruft Superintendent Watchinson, als es an seine Bürotüre klopft.
Obwohl er beinahe die halbe Nacht in seinem Büro verbracht hat, sitzt er doch bereits einige Minuten nach 7 Uhr wieder hinter seinem Schreibtisch.
Bei der Person, die das Zimmer betritt, handelt es sich um Greg Norton. Er verdient in der Abteilung von Watchinson seine Sporen als Ermittler ab. Norton ist 21 Jahre jung und hat eben erst noch die Bank in der Polizeischule gedrückt.
Ein aufgeweckter, sportlich veranlagter junger Mann, dem Watchinson bis jetzt ein hervorragendes Zeugnis ausstellen kann. Er ist intelligent und hat jetzt schon einen gewissen Spürsinn entwickelt, der ihm in der kurzen Zeit, seitdem er bei der Kriminalpolizei arbeitet, schon einige Pluspunkte eingetragen hat.
„Nun Norton, was gibt es?“
„Ich bringe Ihnen die Protokolle und Berichte im Mordfall McCloud, Sir.“
Norton legt die sauber gehäuften Akten vorsichtig auf den Schreibtisch, als wäre es eine Packung Porzellan.
„Danke Norton. Ist der Bericht der Obduktion auch schon dabei?“
„Ja Sir, ich glaube, das rote Mäppchen hier dürfte es sein.“
Der junge Beamte fischt ein rotes Klarsichtmäppchen aus dem Stapel. Daraufhin verabschiedet er sich und verlässt das Büro seines Vorgesetzten.
Kaum eine Minute später tritt Jack Powell ins Chefbüro. Offenbar hat er eine gute Nachricht, denn der Inspektor grinst bereits zur frühen Morgenstunde über das ganze Gesicht. Watchinson ist gespannt und erwartet eigentlich eine Erfolgsmeldung, was die Fahndung nach Henry McCloud betrifft. Er wird jedoch in dieser Hinsicht enttäuscht.
„Ich glaube Sir, ich bin da auf etwas gestossen, das für uns von Interesse sein dürfte.“
„Na, dann spannen Sie mich mal nicht so auf die Folter“, fordert Watchinson seinen tüchtigen aber ebenso korrekten Mitarbeiter auf.
„Also, Sie erinnern sich doch, dass Mrs. Robertson, die Nachbarin von den McClouds, etwas von einem Mann erwähnte, der öfters mit der Ermordeten weggefahren sein soll?“
„Ja, natürlich. Was ist damit?“
„Nun, ich habe die Kollegen vom Fahndungsdienst damit beauftragt, in der Nachbarschaft diesbezüglich Erkundigungen einzuziehen. Dabei hatten wir Glück. Als Constable Greesbie im kleinen Laden schräg gegenüber des Tatortes die Sprache auf das Fahrzeug lenkte, konnte ihm der kleine Junge der Whrites, so heissen die Ladeninhaber, das Auto genauestens beschreiben. Thomas Whrite ist 11 Jahre alt und wie die meisten Jungen in dem Alter kennen sie manchmal die Automarken besser als unsere Kollegen vom Verkehrsdienst. Er hat den Unbekannten mit seinem Auto auch schon gesehen, wobei ihm natürlich vor allem das Fahrzeug in Erinnerung geblieben ist. Nach seinen Angaben muss es sich um ein amerikanisches Fabrikat handeln. Er meint, es sei ein Pontiac Firebird, Jahrgang 1986, Farbe blau mit auffallenden gelben Streifen an den Seiten.“
Powell liest die Angaben aus seinem Notizbuch heraus.
„Und was haben Sie daraufhin unternommen?“
„Ich habe alle Angaben in den Computer der nationalen Autozulassung eingegeben. Er spuckt im Moment die Liste der Eigentümer solcher Fahrzeuge aus.“
„Okay, das ist gut so“, lobt Watchinson das selbständige Handeln von Powell. „Vielleicht haben wir Glück und es sind nicht so viele. Kümmern Sie sich um die Liste und veranlassen Sie das Nötige. Ich würde vorschlagen, dass die Eigentümer der Autos auch noch in unserem Vorgangregister nachgeschlagen und überprüft werden. Vielleicht bringt uns das einen Schritt weiter.“
„Ja, Sir“, erwidert Powell und verlässt daraufhin ungestüm das Büro.
Watchinson widmet sich anschliessend den von Norton gebrachten Akten.
Wie aus den Protokollen hervorgeht, ist Henry McCloud seit ziemlich genau 6 Jahren als Computerfachmann in der Fa. Brown Electronic Ltd. in London tätig. McCloud verdient nicht schlecht und er hat auch, soweit offiziell nachweisbar ist, im Moment keine Schulden. Von seinen Vorgesetzten wird McCloud ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Auch in der Nachbarschaft gilt der Mann der Ermordeten als eine geachtete Person - eher zurückhaltend, meinen verschiedene Auskunftspersonen. Irgendwelche Aktenvorgänge sind im Yard über diesen Mann nicht verzeichnet.
Auch die Ermordete, Mary McCloud, hat den Akten nach nichts zu verbergen, wenn man von den angeblichen Ausflügen mit dem unbekannten Mann absieht. Das Eheleben der McClouds soll dem Vernehmen nach gut gewesen sein. Dem Vernehmen nach! Ihre Freizeit verbrachten sie angeblich oft auf ihrem Boot. Ein Segelboot, mit dem sie manchmal bis hinauf nach Irland gesegelt sind. Diese Aussage stammt von einem Arbeitskollegen von Henry McCloud.
Watchinson sieht von den Akten auf und lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Während er zum Fenster hinaussieht, tippt er gedankenverloren mit seinem Kugelschreiber an seine Lippen. Einen Augenblick später hat er plötzlich das Verlangen, mit seinem Assistenten zu sprechen.
„Powell!“, ruft er laut durch die geschlossene Türe. Er bekommt jedoch keine Antwort, weshalb er genötigt ist, aufzustehen und nach seinem Mitarbeiter zu sehen.
Als er die Türe öffnet, stürzt ihm der Gesuchte beinahe in die Arme. Nicht nur Watchinson, sondern auch Powell ist einen Moment lang erschrocken.
„Hier habe ich die Liste der Fahrzeugbesitzer, Sir. Ich bitte um Entschuldigung, Sir.“
„Schon gut, ich lebe ja noch.“
Mit dieser Antwort nimmt er die Liste an sich. Er ist jedoch überrascht, als er die Liste überfliegt.
„Was, so viele?“
„Ja“, bestätigt ihm Powell. „Es gibt Hunderte solcher Fahrzeuge auf der ganzen Insel. Dabei sind das jetzt nur diejenigen mit Baujahr 1986. Was, wenn sich der kleine Whrite im Baujahr geirrt hat?“
„Das ist bis jetzt der einzige Hinweis, den wir im Moment haben, Powell. Schicken Sie aber doch Greesbie nochmals zu dem Jungen. Vielleicht fällt ihm über das Fahrzeug doch noch etwas ein, womit wir den Kreis enger ziehen können. Er soll sich auch sonst noch ein wenig in der Umgebung umhören. Inzwischen müssen zumindest die Autos, welche im Grossraum London zugelassen sind, überprüft werden. Dabei genügt es vorderhand, die Fahrzeughalter in unserem Vorgangregister nachzuschlagen“.
„Ja, Sir.“
Powell will das Büro wieder verlassen.
„Übrigens, wurde das Boot der McClouds auch schon unter die Lupe genommen?“, erkundigt sich Watchinson, bevor sein Mitarbeiter die Türe schliessen kann.
Dieser hält inne und schaut seinen Vorgesetzten fragend an.
„Welches Boot, Sir?“
„In den Akten steht, dass die McClouds über ein Segelboot verfügen. Schauen Sie zu, dass Sie den Liegeplatz ausfindig machen und dann muss es überprüft werden.“
* * *
„Inspector Powell, Scotland Yard. Habe ich mit Ihnen telefoniert?“
„Ja, ich glaube schon. McIntosh ist mein Name, Joshua McIntosh. Aber nennen Sie mich nur Mac, das machen alle hier.“
Joshua McIntosh ist ein kleiner, aber drahtiger Mittfünfziger mit einem weissen Bart. Er trägt eine kleine, ölverschmierte Seemannsmütze, die vermutlich auch schon bessere Tage gesehen hat. Sein Gesicht ist von der salzigen See gezeichnet, wie es sich für einen richtigen Seebären gehört.
„Sie haben sich erkundigt, ob ein McCloud hier ein Boot hat? Hat er. Die Mary-Ann liegt dort hinten.“
Powell sieht McIntosh irritiert an.
„Die Mary-Ann?“
„Das Boot! Das Boot von McCloud heisst Mary-Ann. Es liegt dort hinten, das Zweitletzte am Laufsteg, auf der linken Seite.“
McIntosh weist dem Beamten mit einem Handzeichen die Richtung.
„Aha“, lacht Powell dem Seebären entgegen und bedankt sich.
Als er sich einige Meter entfernt hat und mit zwei anderen Mitarbeitern bereits den Laufsteg ansteuern will, ruft ihm der Hafenmeister hinterher.
„Ich habe übrigens McCloud nicht gesagt, dass Sie nach seinem Boot gefragt haben!“
Abrupt bleibt Powell stehen und wendet sich zu McIntosh um. Langsam geht er nochmals ein paar Schritte auf den Hafenmeister zu.
„Was? Wieso? Ist Henry McCloud denn auf dem Boot?“
„Ich glaube schon“, antwortet er. „Gestern Abend habe ich auf alle Fälle noch Licht in der Kajüte gesehen.“
Powell ist nun äusserst überrascht und blickt seine Kollegen an, welche ebenfalls mit hochgezogenen Augenbrauen dastehen. Wortlos starren sie nun zum genannten Steg hinüber.
Jack Powell ist nicht gerade motiviert zum Bootshafen gefahren. Nie im Traum hätte er daran gedacht, dass er hier vielleicht den Tatverdächtigen antreffen und vielleicht sogar festnehmen könnte. Anfangs wollte er deshalb auch nur eine stationierte Polizeipatrouille mit der Überprüfung beauftragen. Er hat es sich jedoch im letzten Augenblick anders überlegt.
Er erteilt nun den beiden Beamten des Fahndungsdienstes ein paar taktische Anweisungen, bevor sie alle in geduckter Haltung auf das Boot zugehen.
Als sie in die Nähe des Bootes gelangen, stellen sie fest, dass an Bord sämtliche Vorhänge zugezogen sind.
Powell gibt den beiden Beamten ein entsprechendes Handzeichen, wonach sie einen Moment in Deckung verharren sollen. Er selber zieht seine Schuhe aus, damit er möglichst keinen Lärm verursacht. Nun zieht er vorsichtshalber seine Waffe aus dem Gurtholster. Immer noch in geduckter Haltung schleicht sich Powell zum Heck des Bootes. Dort gelingt es ihm ohne Mühe, über die Reling zu klettern.
Die beiden anderen Beamten sind inzwischen ebenfalls in unmittelbare Nähe nachgerückt und versuchen, Jack Powell abzusichern. Dieser hat nun Stellung neben der Kajütentüre bezogen. Nach gegenseitigem Augenkontakt und Kopfnicken ruft der Inspektor laut nach dem Schiffseigner.
„McCloud! Hier ist die Polizei! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!“
Der Inspektor lauscht intensiv nach jedem Geräusch an Bord. Doch ausser dem Klatschen der Wellen an die Bordwand ist nichts zu hören. Er wiederholt seine Aufforderung, aber auch diesmal regt sich nichts im Innern des Bootes. Der Kriminalbeamte beschliesst deshalb, in die Höhle des Löwen zu gehen. Seine Absichten macht er seinen Begleitern wiederum wortlos mit einem Handzeichen klar.
Mit einem leichten Druck auf die Klinke lässt sich die Türe zur Kajüte öffnen...
* * *
„Hier habe ich noch ein wunderschönes Stück, das Ihnen sicherlich sehr gefallen wird, Madame.“
James Loundry legt den aus einer Erbmasse stammenden und mit Rubinen besetzten Armring behutsam auf ein blaues Samttuch, welches ausgebreitet auf dem Glastresen liegt. Er ist Inhaber eines Antiquitätengeschäftes in London, ganz in der Nähe des berühmten Trafalgar Squares. Nebenbei hat er sich auf Preziosen aller Art spezialisiert. Er ist 52 Jahre alt und hat eine geschiedene Ehe hinter sich. Er bedient sich bei seinen Kunden gerne mit französischen Begriffen. Er meint damit einen zusätzlich nobleren Eindruck hinterlassen zu können.
„Oh ja, der Armreif ist wirklich wunderschön“, antwortet ihm die junge, elegante Frau.
Sie sitzt dem Geschäftsinhaber auf einem ebenfalls mit blauem Samt überzogenen Hocker gegenüber. Ihre langen, braungebrannten Beine hat sie kunstvoll übereinander geschlagen und der kurze Rock enthüllt zur Freude des Verkäufers bald mehr, als er eigentlich verbergen sollte.
Offensichtlich verfügt die junge Dame über ausreichend finanzielle Mittel - oder besser gesagt ihr Mann, denn sie hat in der letzten Zeit schon mehrmals bei Loundry eingekauft. Sie bezahlt zwar immer mit einem Check, aber dieser konnte bis jetzt immer ohne Probleme eingelöst werden.
„Aber billig wird es ja wohl nicht sein, Mister Loundry?“
„Nun ja, was ist denn heute schon noch billig, Madame?“, entgegnet ihr James Loundry charmant.
Als Geschäftsmann in dieser Branche hat er gelernt, seine Kundschaft zu beobachten und gleichzeitig auch einzustufen. Er merkt deshalb sofort, dass die Lady von diesem rubinbesetzten Armband fasziniert ist und sie deshalb mit ihrem Gewissen ringt. Darum lässt er ihr auch gar nicht viel Zeit, um irgendwelche Überlegungen anzustellen und spricht weiter.
„Aber wie Sie gesehen haben, gibt es noch andere schöne Armbänder, die natürlich wesentlich günstiger sind.“
Er weist auf eine andere Schublade, worin sich ebenfalls schöne Schmuckstücke befinden.
„Doch, ich muss schon sagen, dass dieses Armband ein wahres Gedicht darstellt und seinen Preis wert ist. Ausserdem ist das Armband ja wie geschaffen für Sie“, doppelt er berechnend nach.
„Oh ja, das ist es“, erklärt die Frau und legt dabei das Schmuckstück nochmals vorsichtig um ihr rechtes Handgelenk.
„Nachdem Sie in letzter Zeit so manches Stück an mich verkaufen konnten Mister Loundry, kommen Sie mir diesmal im Preis doch sicherlich etwas entgegen?“
Die Kundin sagt dies nicht ohne einen gewissen Unterton, welchen man beinahe missverstehen könnte und sie sieht dabei den Antiquitätenhändler mit einem treuherzigen Augenaufschlag an.
„Nun, wenn ich so überlege, so kann ich vielleicht ausnahmsweise..., aber wirklich nur dieses Mal..., na sagen wir - 50 Pfund?“
Loundry hat insgeheim schon geahnt, dass das Schmuckstück gleich den Besitzer wechseln wird, weshalb er den eigentlichen Verkaufspreis von vornherein schon um 50 Pfund angehoben hatte.
Die Frau seufzt.
„Also, gut, ich nehme dieses Armband. Mein Mann wird mich zwar umbringen, aber...“
Sie langt in ihre Handtasche und nimmt ihr Scheckbuch hervor.
„Ein Check ist Ihnen doch sicherlich recht, Mister Loundry?“ Die Standardfrage der jungen Dame, wenn sie bei Loundry einkauft.
Loundry beruhigt das Gewissen seiner Kundin.
„Aber gewiss doch Madame und glauben Sie mir, Ihr Mann wird Sie nicht umbringen, sondern in die Arme schliessen, wenn er das Armband sieht.“
„Wollen Sie es gleich mitnehmen oder soll ich es Ihnen mit einem Boten vorbeischicken?“
„Aber Sie wissen doch, dass ich es immer gleich tragen will“, antwortet die Käuferin rasch und sie ist nun offensichtlich über ihren Entscheid erleichtert.
Während der Antiquitätenhändler damit beschäftigt ist, der jungen Frau das Armband vorsichtig um das Handgelenk zu legen, geht die Ladentüre auf. Ein stattlicher Mann betritt den Verkaufsraum. Seinem Aussehen nach zu beurteilen, hat auch er keine finanziellen Sorgen. Der Massanzug stammt vermutlich von einem der besten Schneider in London und war deshalb sicher auch nur für teures Geld zu haben.
Der Mann begibt sich sogleich zu einem Tresen, wo er scheinbar interessiert eine Auswahl alter Taschenuhren in der Auslage betrachtet.
„Vielen Dank, Madame und beehren Sie uns bald wieder“, sagt Loundry und begleitete die junge Dame wie sonst auch immer zur Türe. Mit einer leichten Verbeugung verabschiedet er seine Kundin, als sie das Geschäft verlässt.
Während der Ladeninhaber die Türe schliesst, geht eine merkwürdige Veränderung in seinem Gesicht vor. Aus einem freundlichen Lächeln wird unvermittelt ein harter und verärgerter Gesichtsausdruck.
„Was willst du denn hier, Cross? Wir hatten doch vereinbart, dass du nicht hierher kommst!“
* * *
Powell hat in seiner Karriere schon so manche heikle Situationen erlebt, weshalb er sich nun beinahe übervorsichtig verhält. Weiterhin in geduckter Haltung und mit vorgehaltener Pistole gelingt es ihm, die schmale Türe aufschwingen zu lassen.
Er muss davon ausgehen, dass McCloud an Bord ist. Und eine entsprechende Reaktion eines Mordverdächtigen ist nicht auszuschliessen.
Nochmals fordert er den Bootseigentümer auf, mit erhobenen Händen herauszutreten. Doch auch dieses Mal ist nur der Wellenschlag an die Bordwände und das Knarren der Holzdielen zu hören.