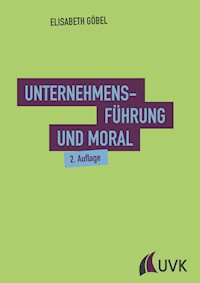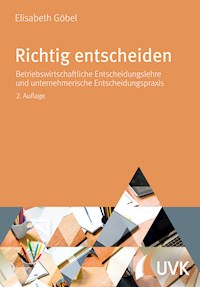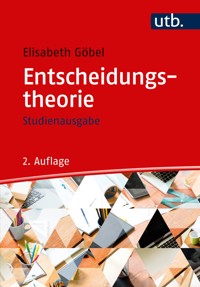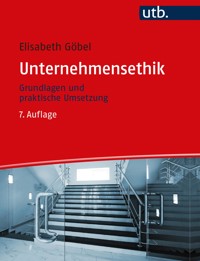
48,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie kann die Unternehmensethik als Management der Verantwortung praktisch umgesetzt werden? Eine stärkere Orientierung der Unternehmensführung am Leitbild einer lebensdienlichen Wirtschaft wird nicht nur von Politiker:innen und kritischen Bürger:innen, sondern ebenso von Wirtschaftspraktizierenden und -wissenschaftler:innen gefordert. Die Autorin erörtert zunächst die philosophischen Grundlagen der Ethik und klärt dann das Verhältnis von Ethik und Ökonomik. Im Vordergrund steht die Institutionalisierung der Ethik im einzelnen Unternehmen. Zugleich wird aber auch deutlich, welche Rolle die Individualmoral sowie die Rahmenordnung für die Unternehmensethik spielen. In der Neuauflage werden einige einschlägige neue Gesetze und Institutionen vorgestellt. Die Verrechtlichung ehemals nur moralischer Erwartungen an die Wirtschaft ist in den letzten Jahren stetig vorangeschritten. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie an alle, die mit Führungsaufgaben in Unternehmen betraut sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
utb 8515
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Unternehmensführung
Herausgegeben von
Franz Xaver Bea
Steffen Scheurer
Prof. Dr. Elisabeth Göbel lehrt an der Universität Trier und forscht zu den Themen Organisation, Neue Institutionenökonomik, Strategisches Management und Wirtschaftsethik. Sie studierte an der RWTH Aachen und an der Universität Tübingen. Dort war sie nach ihrem Studium Assistentin am Lehrstuhl für Planung und Organisation bei Prof. Dr. F. X. Bea.
Elisabeth Göbel
Unternehmensethik
Grundlagen und praktische Umsetzung
7., überarbeitete Auflage
Umschlagmotiv: © terex – Fotolia.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
7., überarbeitete Auflage 2024
6., überarbeitete Auflage 2020
5. Auflage 2017
4. Auflage 2016
3. Auflage 2013
2. Auflage 2010
1. Auflage 2006
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838588388
© UVK Verlag 2024
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG · Dischingerweg 5 D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
ut-Nr. 8515
ISBN 978-3-8252-8830-3 (Print)
ISBN 978-3-8385-8830-8 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-8830-3 (ePub)
Vorwort zur 7. Auflage
Die Neuauflage wurde genutzt, um die Beispiele und die Zahlen zu aktualisieren. Zugleich werden einige einschlägige neue Gesetze und Institutionen vorgestellt. Die „Verrechtlichung“ ehemals „nur“ moralischer Erwartungen an die Wirtschaft ist in den letzten Jahren stetig vorangeschritten. Vor allem die EU forciert neue Gesetze zur Umsetzung des umfassenden und ambitionierten „European Green Deal“, der eine sozial-ökologische Wende der Wirtschaft zum Ziel hat. Angesichts der zahlreichen neuen Gesetze stellt sich (erneut) die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Moral. Sind die Gesetze der einzige Weg, um die Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit zu zwingen? Oder führen die zahlreichen neuen Verordnungen nur zu einem Überdruss an der überbordenden Bürokratie und Gängelung durch staatliche und überstaatliche Institutionen? Das wird die Zukunft zeigen. Bestenfalls geben die Gesetze den Rahmen vor für eine freiwillige soziale Verantwortung der Unternehmen aus Überzeugung, die angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel meines Erachtens notwendiger ist denn je. Denn nur wenn sich die zentralen Marktakteure, sprich die Unternehmen, aber auch die Investoren und die Konsumenten, ihrer Verantwortung bewusst sind und entsprechend handeln, können die enormen dynamischen Kräfte der Marktwirtschaft genutzt werden, um die notwendige sozial-ökologische Wende unserer Wirtschaft zu schaffen.
Ein herzlicher Dank geht wieder an Herrn Dr. Jürgen Schechler für die stets freundliche und hilfreiche Zusammenarbeit.
Trier im Mai 2024
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 6. Auflage
Wer 2020 eine Neuauflage vorbereitet, kommt um das Thema „Corona-Krise“ nicht herum. Häufig wurde in Publikationen die Metapher vom „Brennglas“ Corona benutzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass sich Missstände in der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlicher gezeigt haben. Außerdem hat die Pandemie eine Wertediskussion beflügelt: Was ist wichtiger? Leben und Gesundheit oder Arbeitsplätze, Gewinn und Wohlstand? Wieviel staatliche Eingriffe lassen sich mit der Marktwirtschaft vereinbaren? Sollen die Billionen Euro an Staatshilfen die Rückkehr zum alten Wirtschaftsmodell ermöglichen oder ist jetzt die Gelegenheit, im Rahmen eines „Green Deal“ Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr Klimaschutz zu transformieren? Man gewinnt den Eindruck, dass das Thema „Ethik in der Wirtschaft“ noch einmal einen Schub bekommen hat. Zugleich macht sich eine gewisse Enttäuschung breit über die Ernsthaftigkeit und Reichweite freiwilliger Maßnahmen der Unternehmen. Als Reaktion darauf gibt es eine ganze Reihe von neuen Gesetzen und Gesetzentwürfen, um vormals „nur“ moralische Erwartungen gesetzlich verbindlich zu machen. Die Neuauflage geht an verschiedenen Stellen auf die Corona-Krise und auf neue Gesetze und Initiativen ein, stellt aktuelle Beispiele vor und nutzt aktualisierte Zahlen.
Herrn Dr. Jürgen Schechler möchte ich wieder meinen herzlichen Dank aussprechen für seine Unterstützung und seine Geduld.
Trier im August 2020
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 5. Auflage
Wie sehr das Thema Unternehmensethik bzw. Corporate Social Responsibility mittlerweile etabliert ist, zeigt sich nicht zuletzt an ersten Werken zur CSR-Geschichtsschreibung. In meinem Schlusswort werde ich unter der Überschrift „Rückblick“ darauf kurz eingehen. Die nunmehr langjährigen Erfahrungen mit CSR in der Praxis sind auch ein Anlass, im Kapitel V den kritischen Stimmen mehr Raum zu geben und zu fragen, wo das Konzept eines Managements der sozialen Verantwortung möglicherweise seine Schwächen hat. Die Neuauflage habe ich wieder genutzt, um Beispiele und Zahlen zu aktualisieren.
Herrn Dr. Jürgen Schechler möchte ich für die gute verlegerische Betreuung meinen herzlichen Dank aussprechen.
Trier im März 2017
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 4. Auflage
Seit der ersten Auflage sind zehn Jahre vergangen. Jahre, in denen in Wissenschaft und Praxis viel über die Verantwortung der Unternehmen geschrieben und gesprochen wurde. Wenn man auf das Jahr 2015 zurückblickt, dann lassen die Skandale bei den deutschen Vorzeigeunternehmen Volkswagen und Deutsche Bank auf der einen Seite daran zweifeln, dass „Corporate Social Responsibility“ (CSR) wirklich schon in der Praxis angekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Nachrichten. Im September 2015 beschlossen die Vereinten Nationen siebzehn „Sustainable Development Goals“. Eines der siebzehn Ziele lautet „Responsible Consumption and Production“, spricht also unmittelbar die Verantwortung der Wirtschaft an. Ebenfalls 2015 wurde in Paris das historische Klimaschutzabkommen getroffen. Das Ziel, die Erderwärmung deutlich unter 2° zu halten, kann ohne die massive Mithilfe der Industrie nicht erreicht werden. Auch auf der Ebene der EU werden die Forderungen nach mehr sozialer Verantwortung der Unternehmen lauter. Bis Ende 2016 muss die EU-Richtlinie 2014/95/EU (CSR-Richtlinie) in nationales Recht umgesetzt sein. Gemäß dieser Richtlinie wird eine CSR-Berichterstattung EU-weit für Unternehmen mit mehr 500 Mitarbeitern verpflichtend, wenn das Unternehmen von öffentlichem Interesse ist. Diese Unternehmen müssen dann Informationen offenlegen u.a. über ihre Umweltschutzmaßnahmen, die Einhaltung der Menschenrechte, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Anstrengungen für mehr Gleichberechtigung der Geschlechter. Schließlich wächst der Druck der Konsumenten und Investoren auf die Unternehmen. Fair gehandelte und biologisch erzeugte Produkte werden von Jahr zu Jahr deutlich mehr nachgefragt. Das ethische Investment hat hohe Zuwachsraten. Die Unternehmen reagieren auf diese Forderungen und stellen vermehrt Mitarbeiter mit CSR-Kompetenz ein. Studierende suchen und finden verstärkt Bildungsangebote zu Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement, CSR und Unternehmensethik. Bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklungen einen Kulturwandel anzeigen, der in langfristiger Perspektive zu einer verantwortungsvolleren und lebensdienlicheren Wirtschaft führt.
Die Neuauflage habe ich vor allem genutzt, um die Zahlen und Beispiele zu aktualisieren sowie neuere Gesetzesinitiativen vorzustellen. Da die CSR-Berichterstattung für immer mehr Unternehmen zur Selbstverständlichkeit wird – sei es freiwillig oder wegen gesetzlicher Verpflichtung – habe ich dieses Thema in einem eigenen Abschnitt ausführlicher behandelt.
Herrn Dr. Jürgen Schechler danke ich herzlich für die freundliche Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Mein Dank gilt weiterhin Herrn Christian Haller für wertvolle Hinweise.
Trier im Februar 2016
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 3. Auflage
Das Interesse an Unternehmensethik ist nach wie vor hoch. Zumindest bei den großen Unternehmen findet man mittlerweile nahezu durchgängig Bekenntnisse zu Corporate Social Responsibility oder Corporate Citizenship oder Nachhaltigkeit. Mit CR-Reports, Nachhaltigkeitsberichten oder Gemeinwohlbilanzen versuchen sie, die Ernsthaftigkeit und den Erfolg ihrer Bemühungen um mehr gesellschaftliche Verantwortung nachzuweisen. Mag auch vieles im Moment noch eher Lippenbekenntnis sein: Die Praxis hat längst gemerkt, dass die Wirtschaft ohne Moral ihre Legitimität verliert, und fragt zunehmend ethische Expertise nach. Die Institutionen wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung reagieren darauf mit einer Ausweitung des Angebotes zu Themen wie CSR, Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Unternehmensethik. Die Führungskräfte von morgen sollen ihre Tätigkeit auch ethisch reflektieren können. Dazu möchte das Buch beitragen.
Die Änderungen gegenüber der 2. Auflage bestehen vor allem in der Aktualisierung von Zahlen, Beispielen und Literatur. Ausführlicher behandelt wird das Prinzip des Gemeinwohls. Hinzu gekommen ist ein Glossar, welches den Lesern online zur Verfügung steht und die zentralen Begriffe des Buches kurz erläutert.
Mein herzlicher Dank gilt Herrn Dr. Jürgen Schechler für die unkomplizierte und freundliche Zusammenarbeit und die gute verlegerische Betreuung.
Trier im November 2012
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 2. Auflage
Das Thema Unternehmensethik „boomt“ in den letzten Jahren, wenn auch oft unter anderen Labeln wie „Corporate Social Responsibility“ (CSR), „Corporate Responsibility“ (CR) und „Corporate Citizenship“ (CC). Negativ ausgelegt kann der Boom damit begründet werden, dass die schädlichen Folgen wirtschaftlichen Handelns eher zuals abgenommen haben. Man kann es aber auch positiv interpretieren als wachsende Einsicht der Wirtschaftspraktiker in die Notwendigkeit, sich auch um die nachteiligen Folgen ihres Entscheidens und Handelns für Gesellschaft und Umwelt zu kümmern. Es mangelt jedenfalls nicht an Bekenntnissen zur Notwendigkeit von mehr Verantwortungsübernahme, vor allem seitens großer Unternehmen und wirtschaftsnaher Institutionen. Auch die Verankerung wirtschaftsethischer Themen in der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung macht Fortschritte. Das ist zu begrüßen.
Die zweite Auflage habe ich genutzt, um die aktuellen Entwicklungen der letzten Jahre aufzugreifen. Dazu waren an manchen Stellen Änderungen und Erweiterungen nötig. So wird die ISO-Norm 26000 „Guidance on social responsibility“ vorgestellt, die Messung der „Corporate Social Performance“ als Information für den Kapitalmarkt wird thematisiert, das Prinzip Gerechtigkeit wird stärker betont und die Lohngerechtigkeit eigens diskutiert. Eine Liste mit Internetadressen zu einschlägigen Institutionen und Initiativen trägt der Entwicklung Rechnung, dass man sich heute immer häufiger online informiert.
Einen zusätzlichen und besonderen Dank möchte ich Frau Sabine Hesselmann aussprechen, die den Text der Neuauflage mit viel Engagement lektoriert und noch leserfreundlicher gestaltet hat.
Trier im März 2010
Elisabeth Göbel
Vorwort zur 1. Auflage
Es gibt wohl kaum ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre (BWL), welches so umstritten ist wie die Unternehmensethik. Schon seit Jahrzehnten wird über Sinn und Notwendigkeit einer Unternehmensethik diskutiert. Ja, wir brauchen eine Unternehmensethik, denn eine an den Kriterien praktischer Vernunft orientierte Ethik stellt ein wichtiges, den Wettbewerb ergänzendes Steuerungsinstrument für die Unternehmen dar, postulierten Horst Steinmann und Bernd Oppenrieder vor rund 20 Jahren in einem programmatischen Aufsatz in der Zeitschrift „Die Betriebswirtschaft“ (vgl. [Unternehmensethik]). Nein, Unternehmensethik zu betreiben, ist „anmaßend“ und „unfruchtbar“, lautet dagegen das Verdikt von Dieter Schneider (vgl. [Gewinnprinzip]). Die BWL könne getrost auf „Moralprediger“ verzichten, heißt es auch in einem Beitrag (2005) von Horst Albach in der „Zeitschrift für Betriebswirtschaft“ (vgl. [Betriebswirtschaftslehre]).
Interessanterweise argumentieren die Gegner einer Unternehmensethik teilweise völlig konträr. Nach dem Motto „Schuster bleib bei deinem Leisten“ fordert Schneider die Betriebswirte auf, sich auf ihr ureigenes Terrain, nämlich die „Wissenschaft von der Profiterzielung“ (875), zu beschränken. In der Tradition von Wilhelm Riegers „Privatwirtschaftslehre“ bejaht er ausdrücklich das Gewinninteresse der privatwirtschaftlichen Unternehmung und fordert von der Betriebswirtschaft, auf dieser Grundlage unternehmerisches Handeln zu erklären und zu prognostizieren. Solche rein betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse könnten dann auch in eine ethische Folgenabwägung einfließen, welche aber keinesfalls Aufgabe einer ethisch-normativen Betriebswirtschaftslehre sei. Während Schneider also Unternehmensethik ablehnt, weil er Ethik und BWL klarer trennen will, behauptet Albach die Identität von BWL und Unternehmensethik. Eine eigene Unternehmensethik ist nach seiner Argumentation deshalb nicht nötig, weil die BWL die Ethik immer schon enthielte und es einen Konflikt zwischen der ökonomischen, erwerbswirtschaftlichen Rationalität des Unternehmers und moralischem Verantwortungsbewusstsein einfach „gar nicht gibt“ ([Betriebswirtschaftslehre] 811). Die erwerbswirtschaftliche Rationalität des Unternehmers wird schlicht mit der praktischen Vernunft im Sinne Immanuel Kants gleichgesetzt, so dass alles, was sich für den Unternehmer rechnet, zugleich als umfassend vernünftig ethisch gerechtfertigt erscheint.
Beide Argumentationen gegen die Unternehmensethik sind nicht stichhaltig. Dass mit dem Gewinnprinzip zugleich die umfassende Vernunft wirtschaftlicher Entscheidungen garantiert ist, wird ständig durch die Realität widerlegt. Schließlich gibt es die Probleme der Umweltverschmutzung, der Arbeitslosigkeit, des Hungers und der Armut, unmenschlicher bis lebensgefährlicher Arbeitsbedingungen, der Ausbeutung von Kindern, minderwertiger, gefährlicher und umstrittener Produkte, der Korruption, des Betruges, der Bilanzfälschung usw. auch in den Ländern, in denen gewinnorientierte private Unternehmen im Rahmen einer Wettbewerbsordnung produzieren. Es ist falsch und irreführend, diese Probleme zu verdrängen und so zu tun, als sei das Interesse des Unternehmers der „Dienst am Nächsten“ (vgl. Albach [Betriebswirtschaftslehre] 814).
Dass der Unternehmer eine gesellschaftlich sinnvolle Funktion erfüllt, ist eine von ihm in der Regel nicht primär intendierte und auch ungewisse Nebenfunktion des Gewinnstrebens, wie schon Wilhelm Rieger sehr klar erkannt hat (vgl. [Privatwirtschaftslehre] 46f.). In dieser Hinsicht kann man Dieter Schneider nur zustimmen, wenn er die Betriebswirtschaftler ermahnt, nicht aus Gründen der Selbstdarstellung die Beschränkung der ökonomischen Rationalität auf den Einkommenserwerb zu verleugnen. Nicht folgen kann ich ihm allerdings darin, dass man sich deshalb als Betriebswirt ganz aus den ethischen Fragen herauszuhalten habe. Gerade wer anerkennt, dass mit der ökonomischen Rationalität noch nicht die umfassende praktische Vernunft wirtschaftlichen Handelns garantiert ist, darf (und sollte) sich doch dafür interessieren, wie man die absehbaren schlechten Folgen einer entfesselten und unbeschränkten ökonomischen Rationalität bändigen könnte. Gesetzliche Verbote alleine reichen dazu nicht aus. In der Logik ökonomischer Rationalität liegt es nämlich, sich auch gegenüber der Gesetzgebung als rationaler Nutzenmaximierer zu verhalten, also zu kalkulieren, ob sich eine Gesetzesübertretung „rechnet“ (was angesichts von zahlreichen Kontrolldefiziten sowie einer hoffnungslos überlasteten Justiz häufig der Fall sein wird). Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen Gesetze fehlen und dass sie – soweit vorhanden – stets auslegungsbedürftig sind, insbesondere im internationalen Kontext. Moral wird so zum Desiderat einer menschendienlichen Wirtschaft.
Es gehört zum „Grundwissen der Ökonomik“, dass man als Entscheidungsträger in der Wirtschaft nicht in einem moralfreien Raum agiert. Das Buch wendet sich deshalb zum einen an diejenigen, die bereits heute Verantwortung in der Unternehmenspraxis haben, zum anderen an die Studierenden der Betriebswirtschaftslehre, welche die Entscheidungsträger von morgen sein werden. Die philosophischen Grundlagen der Ethik werden vergleichsweise ausführlich behandelt. Auch wenn das für Betriebswirte ungewohnte und vielleicht auch harte Kost ist, halte ich es für unabdingbar, sich damit auseinanderzusetzen, wenn Unternehmensethik wirklich „Ethik“ sein will und nicht nur eine Art strategisches Reputationsmanagement im rein ökonomischen Sinne. Zugleich soll das Buch aber auch praxisrelevant sein und so konkret wie möglich aufzeigen, wie die Ethik in den Alltag des Unternehmens eingebracht werden kann.
Herzlich danken möchte ich zum Schluss meinem Mann Prof. Dr. phil. Dr. theol. Wolfgang Göbel für zahlreiche anregende und klärende Gespräche. Mein Dank gilt weiterhin meinem geschätzten akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Franz Xaver Bea, der sich gegenüber dem Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik schon bei meiner Dissertation sehr aufgeschlossen gezeigt hat. Herrn Prof. Dr. von Lucius danke ich für die verlegerische Betreuung des Buches, dem Service-Büro Sibylle Egger für die gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Textes.
Juni 2006
Elisabeth Göbel
Inhaltsverzeichnis
Vorworte
Einführung
IGrundlagen der Ethik
1Zentrale Begriffe
1.1Freiheit und Verpflichtung
1.2Moral, Recht und Ethos
1.2.1Moral
1.2.2Recht
1.2.3Ethos
1.3Ethik
1.3.1Allgemeine Kennzeichnung
1.3.2Deskriptive Ethik
1.3.3Normative Ethik
1.3.4Methodenlehre
1.3.5Metaethik
2Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation
2.1Bewertungsgrundlage: Gesinnung, Handlung, Folgen
2.1.1Gesinnungsethik
2.1.1.1Allgemeine Kennzeichnung
2.1.1.2Vorteile und Probleme einer Gesinnungsethik
2.1.2Pflichtenethik
2.1.2.1Allgemeine Kennzeichnung
2.1.2.2Die Erkenntnis des Pflichtgemäßen auf der Grundlage von Imperativen
2.1.2.3Die Pflichten im Einzelnen
2.1.2.4Vorteile und Probleme einer Pflichtenethik
2.1.3Folgenethik
2.1.3.1Allgemeine Kennzeichnung
2.1.3.2Vorteile und Probleme einer Folgenethik
2.1.3.3Der Handlungsutilitarismus von Jeremy Bentham
2.1.3.4Die Weiterentwicklung des Utilitarismus durch John Stuart Mill
2.1.3.5Das Verhältnis von Pflichtenethik und Utilitarismus
2.1.4Synopse
2.2Der Ort der Moral: Individuum, Institution, Öffentlichkeit
2.2.1Individualethik
2.2.2Institutionenethik
2.2.3Die Öffentlichkeit als Ort der Moral
2.2.4Synopse
2.3Ethische Entscheidungsmethoden: Monologische Ethik und Diskursethik
2.3.1Formale und materiale Ethik
2.3.2Monologische Ethik
2.3.3Diskursethik
2.3.3.1Allgemeine Kennzeichnung
2.3.3.2Anwendungsbereiche der Diskursethik
2.3.3.3Probleme und Vorzüge der Diskursethik
2.3.4Synopse
IIDas Verhältnis von Ethik und Ökonomik
1Kennzeichnung der Ökonomik
1.1Begriff der Ökonomik
1.2Das Modell menschlichen Verhaltens in der Ökonomik
2Die Auseinanderentwicklung von Ethik und Ökonomik
2.1Ethik und Ökonomik als miteinander verbundene Teile der praktischen Philosophie
2.2Von der materialen zur formalen Auslegung des ökonomischen Prinzips
2.3Unterschiede zwischen der aristotelischen und der modernen Auffassung von Ökonomik
2.4Ethik und Ökonomik – zwei Welten?
3Das Verhältnis von Sittlichkeit und Selbstinteresse: unvereinbar oder vereinbar?
3.1Was heißt Selbstinteresse?
3.2Nähere inhaltliche Bestimmung des Selbstinteresses
3.3Berücksichtigung der Interessen anderer
3.4Gesinnung der Akteure
3.5Kanalisierung des Selbstinteresses durch Institutionen
3.6Synopse
IIIModelle der Beziehung von Ethik und Ökonomik
1Anwendung der Ethik auf die Wirtschaft (Modell 1)
1.1Ethik als Ausgangsdisziplin
1.2Kritik am Anwendungsmodell
1.3Konkretisierung ethischer Grundsätze für unterschiedliche Lebensbereiche
2Anwendung der Ökonomik auf die Moral (Modell 2)
2.1Ökonomik als universale Erklärungsgrammatik
2.2Ort der Moral ist die marktwirtschaftliche Rahmenordnung
2.2.1Moralisches Handeln muss sich auszahlen
2.2.2These: Die Marktwirtschaft transformiert Eigennutz in Gemeinwohl
2.2.3Ethische Probleme der Marktwirtschaft
2.3Individualmoral in der Moralökonomik
2.3.1Individualmoral der Politiker
2.3.2Individualmoral der Wirtschaftsakteure
2.3.3Die Unverzichtbarkeit der Individualmoral im Modell der Moralökonomik
2.4Primat der Ökonomik im Konfliktfall
2.5Relevanz der Ökonomik für die Implementation ethischer Zielsetzungen
3Integration von Ethik und Ökonomik (Modell 3)
3.1Das Konzept sozialökonomischer Rationalität
3.2Problematik der Integrationsidee
4Plädoyer für das Anwendungsmodell
IVBereiche einer angewandten Wirtschaftsethik
1Allgemeine Abgrenzung der Wirtschaftsethik
2Die Mikroebene der Wirtschaftsethik: Die Wirtschaftsakteure
2.1Konsumentenethik
2.1.1Ethische Forderungen an die Konsumenten
2.1.2Grenzen der Konsumentenverantwortung
2.2Produzentenethik
2.3Investorenethik
3Die Makroebene der Wirtschaftsethik: Die Rahmenordnung
3.1Ethische Bewertung wirtschaftlicher Institutionen
3.2Vorteile und Probleme der Marktwirtschaft
3.3Zwingt der Markt zur Unmoral?
3.4Staatliche Rahmenordnung
3.5Überstaatliche Rahmenordnung
4Die Mesoebene der Wirtschaftsethik: Unternehmensethik
4.1Das Unternehmen als moralischer Akteur?
4.2Bedingungen für die Moralfähigkeit von Unternehmen
4.3Unternehmen sind moralfähig
4.4Die Mitverantwortung der Individuen in der Unternehmung
5Zusammenwirken von Mikro-, Meso- und Makroebene der Wirtschaftsethik
VUnternehmensethik als Management der Verantwortung
1Verantwortung: Die ethische Grundkategorie der Unternehmensethik
1.1Subjekt der Verantwortung
1.2Objekt der Verantwortung
1.3Verantwortungsrelation
1.4Instanz der Verantwortung
2Verantwortung als Integrationsbegriff
2.1Integration von Gesinnungs-, Pflichten- und Folgenethik
2.2Integration von Individuen, Institutionen und Öffentlichkeit
2.3Integration von Diskursethik und monologischer Verantwortungsethik
3Die praktische Umsetzung der Unternehmensverantwortung im Management
3.1Warum „Management“?
3.2Kritik an der Idee eines Managements der Verantwortung
3.3Die Bausteine eines Managements der Verantwortung
VIDie analytische Komponente der Unternehmensethik: Stakeholderanalyse
1Begriff des Stakeholders
1.1Die Stakeholder als Adressaten der Unternehmensverantwortung
1.2Unterschiedliche Definitionen des Stakeholders
1.3Unterschiedliche Auffassungen von den Funktionen einer Stakeholderanalyse
2Ablauf der Stakeholderanalyse
2.1Stakeholder wahrnehmen
2.1.1Überblick über typische Stakeholder
2.1.2Die Öffentlichkeit als Stakeholder
2.1.3Die Medien als Stakeholder
2.1.4Die Führungskräfte und Mitarbeiter als Stakeholder
2.1.5Instrumente zur Unterstützung der Stakeholderwahrnehmung
2.1.5.1Social Issue Analysis
2.1.5.2Produktlebenszyklusanalyse
2.1.5.3Dialog mit den Stakeholdern
2.1.6Die unvermeidbare Selektivität der Stakeholderwahrnehmung
2.2Stakeholder und ihre Anliegen analysieren und prognostizieren
2.2.1Analyse der Stakeholderanliegen
2.2.2Prognose der Stakeholderanliegen
2.2.3Datenquellen für Analyse und Prognose von Stakeholderanliegen
2.3Stakeholderansprüche bewerten
2.3.1Ethische versus strategische Bewertung
2.3.2Bewertung der Legitimität der Stakeholderanliegen
2.3.2.1Die Legitimität des Anspruchs macht den normativ-relevanten Stakeholder
2.3.2.2Das Verständnis von Legitimität
2.3.2.3Legalität und Legitimität
3Ethische Grundlagen für die Legitimitätsbewertung
3.1Menschenwürde als ethisches Prinzip für die Bewertung von Stakeholderanliegen
3.2Gemeinwohl als ethisches Prinzip für die Bewertung
3.3Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip für die Bewertung
3.4Tierschutz als ethisches Prinzip für die Bewertung
3.5Gerechtigkeit als ethisches Prinzip für die Bewertung
4Die mögliche Kollision legitimer Stakeholderanliegen
4.1Die Kollision von Interessen
4.2Abwägung konfligierender Ansprüche
4.2.1Pflichten, Güter und Werte als Basis der Abwägung
4.2.2Vorzugsregeln für die Güter- und Übelabwägung
4.2.3Beispiele für eine Abwägung von legitimen Interessen
4.3Die Rolle des Gewinns bei der Abwägung konfligierender Ansprüche
4.3.1Die Rolle des Gewinns in einer Marktwirtschaft
4.3.2Gewinnerzielung steht unter einem Legitimitätsvorbehalt
4.3.3Gewinneinbußen können das kleinere Übel sein
5Die strategische Option einer Konfliktentschärfung
VIIDie strategische Komponente der Unternehmensethik
1Das Ziel einer Entschärfung von Stakeholderkonflikten durch die Harmonisierung von Moral und ökonomischen Interessen
2Wettbewerbsstrategien
2.1Arten von Strategien
2.1.1Unternehmensstrategie
2.1.2Geschäftsbereichsstrategie
2.1.3Funktionsbereichsstrategie
2.2Können Strategien „moralisch“ sein?
2.3Verantwortungsbewusste Strategiewahl am Beispiel Umweltschutz
2.3.1Umweltschutz als Unternehmensziel
2.3.2Umweltbewusste Unternehmensstrategien
2.3.3Umweltbewusste Geschäftsbereichsstrategien
2.3.4Umweltbewusste Funktionsbereichsstrategien
2.3.5Integration von Moralität in die strategische Unternehmensführung
2.4Probleme der Harmonisierung von Moral und Gewinn durch Wettbewerbsstrategien
2.4.1Die unterschiedliche Fristigkeit von Kosten und Nutzen
2.4.2Die unterschiedliche Bewertbarkeit von Kosten und Nutzen
2.4.3Die Unsicherheit hinsichtlich der Reaktion der anderen Marktteilnehmer
3Ordnungspolitische Strategien
3.1Die Notwendigkeit von Ordnungspolitik
3.2Staatliche Ordnungspolitik
3.3Ordnungspolitische Strategien der Unternehmen
3.3.1Unterstützung staatlicher Ordnungspolitik
3.3.2Ordnungspolitische Eigeninitiativen
4Marktaustrittsstrategien
VIIIDie personale Komponente der Unternehmensethik
1Die Unverzichtbarkeit der personalen Komponente
2Führungsethik
2.1Begriffsklärung
2.1.1Begriff „Führung“
2.1.2Begriff „Führungsethik“
2.2Personalführungsethik
2.2.1Voraussetzungen für ein legitimes Führungsverhältnis
2.2.2Die Begrenzung der Weisungsbefugnisse
2.2.3Die verantwortungsvolle Gestaltung der Führungsbeziehung
2.3Unternehmensführungsethik
2.3.1Die Unternehmensführung betrifft alle Stakeholder
2.3.2Typische Unternehmensführungsentscheidungen
2.3.3Ethik in der Unternehmensführung
2.3.4Die besondere Verantwortung der Führungskräfte
3Mitarbeiterethik
3.1Die innerbetriebliche Verantwortung
3.2Die Verantwortung gegenüber den Stakeholdern
3.3Whistle Blowing
3.3.1Kennzeichnung des Whistle Blowing
3.3.2Bewertung des Whistle Blowing
3.3.3Empfehlungen für das Whistle Blowing
4Führungs- und Mitarbeiterethik als Tugendethik
4.1Kennzeichnung von Tugend und Tugenden
4.2Grenzen der Tugendethik
IXDie innerbetrieblichen Institutionen
1Die Bedeutung strukturell-systemischer Führung
2Die institutionelle Unterstützung des Sollens
2.1Formale Werte und Normen: Das Unternehmensleitbild
2.1.1Das Unternehmensleitbild als Teil der Zielhierarchie
2.1.2Das Bekenntnis zur Verantwortung in Vision und Leitbild
2.1.3Einige typische Leitbildaussagen
2.1.4Empfehlungen für das Leitbild
2.1.5Die Präzisierung der Grundsätze in Zielen und Richtlinien
2.1.6Der Prozess der Leitbilderstellung
2.2Informale Werte und Normen: Die Unternehmenskultur
2.2.1Kennzeichnung der Unternehmenskultur
2.2.2Beziehung zwischen Unternehmenskultur und Unternehmensethik
2.2.3Ansatzpunkte für ein „Kulturmanagement“
3Die institutionelle Unterstützung des Wollens
3.1Personalauswahl
3.1.1Das Personalauswahlverfahren
3.1.2Personalauswahl und Unternehmensethik
3.1.3Ansatzpunkte für die Auswahl sittlich orientierter Unternehmensmitglieder
3.2Personalbeurteilung und -honorierung
3.2.1Motivation durch Anreize
3.2.2Der Zusammenhang mit der Unternehmensethik
3.2.2.1Prinzipien einer gerechten Personalbeurteilung und -honorierung
3.2.2.2Beispiele für Lohnungerechtigkeiten
3.2.2.3Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein
3.3Kontrollsysteme
3.3.1Anreizwirkungen der Kontrolle
3.3.2Die Bedeutung der Kontrolle in Compliance- und Integritätsprogrammen
4Die institutionelle Unterstützung des Könnens
4.1Personalentwicklung
4.1.1Funktion der Personalentwicklung
4.1.2Anlässe für Personalentwicklung
4.1.3Inhalte der Personalentwicklung
4.1.4Methoden und Träger der Personalentwicklung
4.1.5Personalentwicklung als Teil verantwortlichen Personalmanagements
4.1.6Personalentwicklung zur Unterstützung der Unternehmensethik
4.1.6.1Entwicklungsziel: Moralische Kompetenz
4.1.6.2Verbesserung der moralischen Sensibilität
4.1.6.3Verbesserung der moralischen Urteilskraft und Motivation
4.1.6.4Verbesserung der Verständigungskompetenz
4.1.6.5Adressaten der Entwicklung
4.1.7Entwicklungsmethoden
4.2Organisationsstruktur
4.2.1Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und Unternehmensethik
4.2.2Abbau von organisationalen Verantwortungsbarrieren
4.2.3Aufbau von organisationalen Unterstützungspotenzialen
4.2.3.1Stellen
4.2.3.2Gremien
4.2.3.3Situative Faktoren
4.2.3.4Vor- und Nachteile spezieller Stellen und Gremien für die Unternehmensethik
4.3Informationssysteme
4.3.1Die Einordnung der Informationsaufgabe in das Controlling
4.3.2Die Beziehung von Controlling und Unternehmensethik
4.3.2.1Barrierewirkung des herkömmlichen Controlling
4.3.2.2Unterstützung der Unternehmensethik durch Informations bereitstellung
4.3.3Beispiel: Öko-Controlling
4.3.4Corporate Social Performance als Information für den Kapitalmarkt
XDie überbetrieblichen Institutionen
1Die institutionelle Unterstützung des Sollens
1.1Gesetze und Verordnungen
1.1.1Schutzrechte für Anspruchsgruppen
1.1.2Ergänzungsbedürftigkeit der Gesetzgebung
1.2Kodizes und Konventionen
1.2.1Funktionen, Verbindlichkeit und Geltungsbereiche
1.2.2Regelsysteme in Bezug auf Branchen
1.2.3Regelsysteme in Bezug auf Produkte
1.2.4Berufs- und Standesregeln
1.2.5Themenspezifische Regelwerke
1.2.6Verhaltenskodizes für Organisationen
1.3Globale Regelsysteme und das Problem interkultureller Konflikte
1.3.1Vereinheitlichung der Normen als Ziel
1.3.2Gibt es universal gültige Werte und Normen?
1.3.3Plädoyer für die Anerkennung weltweit gültiger Normen und Werte
2Die institutionelle Unterstützung des Wollens
2.1Kontrollen
2.1.1Staatliche Kontrollen
2.1.2Kontrollen durch die Öffentlichkeit
2.1.3Kontrollen durch wirtschaftsnahe Organisationen und Peer-Kontrolle
2.1.4Kontrollen durch gemeinnützige Organisationen
2.1.5Kommerzielle Kontrollanbieter
2.2Anreize
2.2.1Bestrafung von Fehlverhalten
2.2.2Kompensation von Zusatzkosten
2.2.3Beseitigung von Fehlanreizen
2.2.4Generierung von Zusatznutzen
3Die institutionelle Unterstützung des Könnens
3.1Leitlinien für die CSR-Berichterstattung
3.2Wirtschaftsethik in der schulischen und universitären Ausbildung
3.3Verbraucheraufklärung und -bildung
3.3.1Das Idealbild vom souveränen Verbraucher
3.3.2Mitverantwortung der Verbraucher
3.3.3Hilfestellungen für den verantwortungsbewussten Verbraucher
Zusammenfassung, Rückblick und Ausblick
Zusammenfassung
Rückblick
Ausblick
Literaturverzeichnis
Initiativen / Institutionen und Internet-Adressen zum Thema
Namensregister
Sachregister mit Glossarhinweisen
Einführung
Seit Jahren stehen Unternehmen in der öffentlichen Kritik. Einige Themen sind „Dauerbrenner“, es kommen aber auch immer wieder neue Vorwürfe hinzu. Einige Beispiele:
Zu den Problemen, die jedes Jahr wieder beklagt werden, gehört der „gender-pay-gap“, die Lücke zwischen den Stundenlöhnen von Männern und Frauen. Große Teile dieser Lohnlücke sind durch die unterschiedlichen Erwerbsbiografien von Männern und Frauen erklärbar. Frauen arbeiten viel häufiger nur in Teilzeit und unterbrechen ihre Erwerbsarbeit auch häufiger und länger, bspw. um unentgeltliche Sorgearbeit für die Kinder oder pflegebedürftige Eltern zu leisten. Sie wählen überdies überdurchschnittlich oft Berufe und Branchen, in denen weniger gezahlt wird und erreichen weniger oft Führungspositionen. Aber auch wenn man diese Effekte herausrechnet, bleibt eine bereinigte Lohnlücke von 6%, das heißt auch bei gleicher Ausbildung und Erwerbsbiografie bekommen Frauen oft geringere Stundenlöhne als Männer.
Der massive Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung ist für das vermehrte Auftreten von resistenten Keimen verantwortlich, die sich nicht nur im Fleisch, sondern auch in der Gülle und in Badegewässern nachweisen lassen. Lebensrettende Medikamente werden durch die Resistenzen nutzlos, was zigtausende Menschen das Leben kostet. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, steigt der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung weltweit an.
Tausende Kinder und Jugendliche verfallen jedes Jahr in eine pathologische Sucht nach Computerspielen. Sie zeigen die gleichen Suchtsymptome wie Drogenabhängige, bspw. Kontrollverlust und unstillbares Verlangen. Die Betroffenen werden immer jünger. Die virtuelle Realität ersetzt mehr und mehr das echte Leben, die Schule wird vernachlässigt, soziale Kontakte finden nicht mehr statt, die Gesundheit leidet. Manipulative Designs und Spielverläufe (dark patterns) verstärken die Suchtgefahr. Die zunächst kostenlos angebotenen Spiele sollen sich für die Anbieter natürlich letztlich auszahlen. Zum größten Teil geschieht das durch sog. „In-Game-Käufe“. Die Nutzer können ab einem bestimmten Level nur noch weiterkommen, wenn sie Zusatzkäufe tätigen (pay to win). Nachdem am Anfang der Nutzer durch schnelle Erfolge „angetriggert“ wird, ist im weiteren Spielverlauf ein Erfolgserlebnis nur noch möglich, wenn der Spieler bspw. Bonuspunkte oder zusätzliche Leben erwirbt. Durch den Umtausch von echtem Geld in eine virtuelle Währung wird das Ausgabeverhalten zusätzlich manipuliert und weniger transparent.
Seit Jahren werden die Autos immer schwerer und länger, die SUVs beherrschen den Markt. Auch in Deutschland führen die SUVs die Statistik der Neuzulassungen an. Unter dem Aspekt des Umweltschutzes ist das eine eklatante Fehlentwicklung. Für diese Autos werden nicht nur viel mehr knappe Ressourcen zur Herstellung verbraucht, sie haben auch im Gebrauch einen deutlich höheren Energiebedarf. Zudem beanspruchen sie mehr knappen öffentlichen Raum und schaden so dem Gemeinwohl, selbst wenn sie gar nicht gefahren werden.
Der chinesische Modegigant Shein hat Ultra-Fast-Fashion zu seinem Markenzeichen gemacht. Jeden Tag kommen mehrere tausend Produkte neu in das Sortiment. Zielgruppe sind vor allem Jugendliche, die über TikTok und Instagram von Influencerinnen angesprochen werden. So wird die unter jungen Leuten verbreitete Bewegung „Outfit-of-the-day“ gepusht. Weil nach Möglichkeit jeden Tag ein anderes Outfit auf den sozialen Medien präsentiert werden soll, müssen die Kleidungsstücke vor allem billig sein. Die Haltbarkeit spielt eine untergeordnete Rolle, weil viele Kleidungsstücke nur ein einziges Mal getragen werden. Kleidung wird auf diese Weise zum Wegwerfartikel degradiert, was extrem klimaschädlich ist und zu Bergen von zusätzlichem Müll führt.
Obwohl die Deutsche Bahn die zentralen Ziele bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit nicht annähernd erreicht hat, bekamen die Vorstandsmitglieder 2023 rückwirkend für 2022 rund fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen zusätzlich zum Gehalt. Als Begründung diente die Übererfüllung anderer Ziele. Insbesondere diese Berechnungsweise der Boni wurde stark kritisiert. So führten eine 1%ige Überschreitung der Zielmarke für Frauen in Führungspositionen sowie eine geringfügig verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit schon zu 1,6 Millionen Euro an Boni.
Die Emotionserkennung mittels künstlicher Intelligenz (KI) hat sich zu einem neuen Markt entwickelt. Mittels der Analyse von Mimik, Gestik und Sprache durch eine Software kann bspw. auf der Basis eines Videointerviews eine Vorauswahl von Bewerbern im Rahmen von Personalauswahlverfahren getroffen werden. Kritiker weisen darauf hin, dass es an einer wissenschaftlichen Grundlage dafür fehlt, aus bestimmten Gesichtsbewegungen zuverlässig auf bestimmte Gefühle zu schließen, geschweige denn auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Weiterhin wurde nachgewiesen, dass die KI Gesichter von Männern und von Menschen mit heller Hautfarbe zuverlässiger „liest“ als die Gesichter von Frauen und von Menschen mit dunkler Hautfarbe. Das Versprechen der Softwareanbieter, die Personalauswahl neutral und fair zu machen, wird durch diese subtilen Diskriminierungseffekte konterkariert. Versuche zeigten außerdem, dass Änderungen des Settings wie bspw. Bildhintergründe oder Kleidung und Frisur der Probanden zu Veränderungen in deren Bewertung durch die KI führten. Selbst für die Systemanbieter ist die Art und Weise, wie die KI aus den komplexen visuellen und auditiven Informationen zu ihren Einschätzungen der Person kommt, eine Blackbox (vgl. Peters [Emotionserkennung].
Die Liste ließe sich mühelos noch um einige Punkte erweitern. Gemeinsam ist den Beispielen, dass die beschriebenen Handlungsweisen kaum justiziabel sind: Die Vertragsfreiheit ist ein Kernprinzip des deutschen Rechts, und es steht den Frauen frei, ob sie sich für typische Frauenberufe entscheiden, für Teilzeitarbeit, für die längere Babypause und ob sie ein höheres Gehalt einfordern. Die in der Tiermast eingesetzten Antibiotika werden von Tierärzten verschrieben und dienen offiziell der Tiergesundheit. Die Konsumenten könnten der verdeckten Preiserhöhung und der Qualitätsminderung auf die Spur kommen, wenn sie genau hinsehen, Grundpreise vergleichen und Zutatenlisten studieren. Dass Kinder und Jugendliche nicht in eine Spielsucht abrutschen und sich nicht zu hohen Ausgaben verleiten lassen, ist nach Ansicht der Spieleanbieter Sache der Eltern. Außerdem überprüfe die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), ob Spiele für bestimmte Altersgruppen geeignet sind. Der Boom der SUVs wird von den Anbietern damit begründet, dass die Nachfrager solche Autos wollen und sie in einer Marktwirtschaft die Kundenwünsche bedienen müssen, um wirtschaftlich zu überleben. Auch Anbieter von Ultra-Fast-Fashion können sich auf die Nachfrage berufen. Sie rühmen sich sogar, durch ihre niedrigen Preise zu einer „Demokratisierung der Mode“ beizutragen, weil sich jeder diese Billigmode leisten kann. Die Boni für die Bahnvorstände waren vertraglich zugesichert und absolut gesetzeskonform. Systemanbieter von KI zur Bewerberauswahl berufen sich darauf, dass sie die Personalverantwortlichen nur technisch dabei unterstützen, objektivere Entscheidungen zu fällen.
Die Unternehmen tun nichts Illegales. Und dennoch empfinden die meisten Menschen das Verhalten der Unternehmen als falsch. Die Bewertungen in den Medien lauten „ungerecht“ und „diskriminierend“ (gender-pay-gap), „rücksichtslos“ und „gefährlich“ (Antibiotika in der Tierhaltung), „Täuschung“ und „Mogelei“ (verdeckte Preiserhöhungen), „unlauter“, „manipulativ“ und „schädlich“ (dark patterns, In-Game-Käufe), „absurd“ und „klimaschädlich“ (Boom der SUVs), Verstärkung der Wegwerfmentalität und Erzeugen von Müllbergen (Ultra-Fast-Fashion), „frech“ und „skandalös“ (Boni für Bahnvorstand), „unkontrollierbar“ und „beängstigend“ (Emotionserkennung durch KI). Es werden zwar keine gesetzlichen, aber moralische Grenzen verletzt.
Die Coronavirus-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels haben in den letzten Jahren eine umfassende Diskussion um die Grundwerte unserer Gesellschaft angestoßen und dabei insbesondere auch die Frage aufgeworfen, was wir für den wirtschaftlichen Wohlstand zu opfern bereit sind. War der Shutdown mit seinen immensen wirtschaftlichen Folgen angemessen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung? Müssen wir aus moralischen Gründen auf das billige Gas aus Russland verzichten, um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins zu bestrafen? Ist es richtig, in die unternehmerischen Entscheidungen mit hohen Klimaschutzauflagen einzugreifen? Es sei „zynisch“, darüber zu diskutieren, ob das Leben von Menschen wichtiger sei als die wirtschaftliche Prosperität, meinte Bundeskanzler Olaf Scholz am 29.03.2020 im „Bericht aus Berlin“ in der ARD in Bezug auf die Coronamaßnahmen. Dem werden die meisten zustimmen, doch ist das so selbstverständlich, wie es sich anhört? Eindeutig gesundheitsschädliche, ja potenziell tödliche Produkte wie Zigaretten dürfen nicht nur verkauft, es darf sogar für sie geworben werden. Laut ADAC sind 2019 3.059 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen und 384.000 wurden verletzt. Der Individualverkehr gehört überdies zu den großen Verursachern von klimaschädlichen Emissionen, doch nicht einmal ein flächendeckendes Tempolimit von 130 km/h lässt sich gegen die starke Lobby der Automobilindustrie durchsetzen. Alltagsprodukte wie Mobiltelefone enthalten Rohstoffe, deren Gewinnung in den Lieferländern mit immensen Schäden für Menschen und Umwelt einhergehen.
Die Handlungen von Wirtschaftsakteuren, insbesondere der Entscheidungsträger in den Unternehmen, haben eben nicht nur eine ökonomische Dimension. Da wirtschaftliche Entscheidungen die legitimen Interessen anderer betreffen, darf und muss immer auch gefragt werden, ob sie umfassend vernünftig und moralisch richtig sind. Die Forderung nach mehr Moral in der Wirtschaft wirft aber auch eine ganze Reihe von Fragen auf. Was empfinden wir eigentlich als unmoralisch an den Marktergebnissen? Wer von den Wirtschaftsakteuren trägt die Hauptverantwortung für die unerwünschten Folgen wirtschaftlichen Handelns? Sind in einer Marktwirtschaft nicht letztlich die Käufer für die Zustände in der Fleischindustrie verantwortlich, weil sie das Billigfleisch vom Discounter kaufen? Sind nicht die Kunden schuld an der Wegwerfmentalität, weil sie immer mehr online bestellen und bedenkenlos zurücksenden? Oder müssen sich die Politiker den Schwarzen Peter zuschieben lassen, weil es an Gesetzen und Kontrollen fehlt? Oder sind vielleicht die Wettbewerber schuld, die mit niedrigen Preisen die Konkurrenten quasi zwingen, ihre Kosten ebenfalls immer weiter zu senken? Und wenn man den Unternehmen eine wesentliche Verantwortung für die Marktergebnisse zuordnet, sind es dann die Führungskräfte als Einzelpersonen, die falsch oder richtig gehandelt haben, oder kann das Unternehmen als Institution verantwortlich sein? Kann die Marktwirtschaft überhaupt mit Moral vereinbar sein, wo sie doch systematisch auf das Selbstinteresse der Menschen setzt?
Die folgenden Ausführungen wollen versuchen, auf einen Teil dieser Fragen Antworten zu geben. Dieses Buch besteht aus zehn Kapiteln:
(1)Zunächst wird in den Grundlagen der Ethik (Kapitel I) eine integrative Perspektive der Ethik erarbeitet, die aufzeigen soll, dass es erstens bei der moralischen Bewertung von Entscheidungen und Handlungen gleichermaßen auf die Motive der Akteure, ihre konkreten Handlungen und deren Folgen ankommt, dass zweitens eine Beziehung wechselseitiger Beeinflussung zwischen den Individuen und den sie umgebenden Institutionen besteht und dass drittens die monologische Verantwortungsethik und der Diskurs mit den Betroffenen sich gegenseitig ergänzen.
(2)Im zweiten Kapitel wird dann die Ethik mit der Ökonomik konfrontiert. Fundamentale Unterschiede in der Denkweise der beiden Disziplinen haben zu der weit verbreiteten Ansicht geführt, Wirtschafts- und Unternehmensethik sei so etwas wie ein „hölzernes Eisen“, also ein Widerspruch in sich.
(3)Wie die beiden Disziplinen dennoch sinnvoll in Beziehung gebracht werden können, wird im dritten Kapitel vorgeführt. Erstens kann die Ethik als Ausgangsdisziplin verstanden und auf die Wirtschaftspraxis bezogen werden. Zweitens ist eine Moralökonomik denkbar, bei welcher die Disziplin „Ökonomik“ auf die moralische Praxis angewendet wird. Schließlich kann man anstreben, die beiden Disziplinen ineinander zu überführen und ihre faktische Auseinanderentwicklung rückgängig zu machen. Im weiteren Verlauf der Argumentation wird das erste Modell einer angewandten Wirtschaftsethik weiterverfolgt. Das Spannungsfeld zwischen den Disziplinen Ethik und Ökonomik wird grundsätzlich akzeptiert, zugleich werden aber auch Schnittmengen zwischen Moralität und Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielen.
(4)Die Anwendung von ethischen Kategorien auf die Wirtschaft findet auf verschiedenen Handlungsebenen statt (Kapitel IV). Selbstverständlich erscheint zunächst die Einforderung von Moralität bei den einzelnen Wirtschaftsakteuren, z.B. von Konsumenten, Managern, Mitarbeitern, Investoren. Da Rollenmodelle und Handlungsweisen der Wirtschaftsakteure maßgeblich durch die wirtschaftliche Rahmenordnung geprägt werden, ist eine moralische Verantwortung zugleich den Gestaltern dieser Rahmenordnung zuzuordnen. Doch können auch Institutionen selbst Verantwortung haben? Können insbesondere Unternehmen als moralische Akteure verstanden werden?
(5)Diese Frage wird positiv beantwortet und eine Verantwortung der Unternehmen eingefordert (Kapitel V). Die ethische Kategorie der Verantwortung harmoniert mit der in Kapitel I entwickelten integrativen Perspektive der Ethik und erfasst das Anliegen der Unternehmensethik besonders gut. Die Unternehmung bzw. die in ihr arbeitenden Personen sollen auf die Folgen ihrer wirtschaftlichen Entscheidungen achten und diese gegenüber den Betroffenen verantworten. Sehr häufig wird dieses Anliegen auch mit den Begriffen Corporate Social Responsibility (CSR) oder Corporate Responsibility (CR) zum Ausdruck gebracht. Die Idee der Verantwortung wird aber nur dann Eingang in die Unternehmenspraxis finden, wenn sie systematisch in den Planungs- und Entscheidungsprozessen, den Strategien und Institutionen berücksichtigt wird. Es muss ein Management der Verantwortung stattfinden.
(6)In den Kapiteln VI bis IX werden die Bausteine eines solchen ethischen Managements vorgestellt, wobei die individuelle und die institutionelle Seite der Ethik verknüpft werden. Kapitel VI befasst sich mit der analytischen Komponente der Unternehmensethik: Der Stakeholderanalyse. Hier werden alle, die gegenüber dem Unternehmen legitime Ansprüche haben, mit Hilfe eines systematischen Prozesses wahrgenommen, ihre Anliegen werden analysiert und zukünftige Anliegen prognostiziert. Die Ansprüche werden als Grundlage für ein Stakeholdermanagement aus Verantwortung bewertet.
(7)In Kapitel VII steht dann die strategische Komponente der Unternehmensethik im Mittelpunkt der Betrachtung: Wie können Stakeholderkonflikte durch die Harmonisierung von Moral und ökonomischen Interessen entschärft werden?
(8)Kapitel VIII ist der personalen Komponente der Unternehmensethik gewidmet: Was bedeutet ein Management der Verantwortung für die Führungskräfte und die Mitarbeiter?
(9)Kapitel IX befasst sich mit der Frage, wie die innerbetrieblichen Institutionen gestaltet werden sollten, damit sie ein Management der Verantwortung unterstützen.
(10)Schließlich sind auch die Einflüsse zu berücksichtigen, welche von den überbetrieblichen Institutionen auf das einzelne Unternehmen ausgehen (Kapitel X). Denn das Unternehmen bildet nicht nur das institutionelle Umfeld für die Entscheidungen der Unternehmensmitglieder, es ist zugleich selbst in ein Umfeld eingebettet und dessen Einflüssen ausgesetzt. Nachhaltigen Erfolg bei der Umsetzung der Idee der Verantwortung verspricht nur das Zusammenwirken der drei Ebenen der Wirtschaftsethik: Die Individualethik der Wirtschaftsakteure muss zusammen treffen mit unterstützenden institutionellen Rahmenbedingungen auf der Ebene des Unternehmens und der (globalen) Rahmenordnung.
Die folgende Abbildung verdeutlicht den Aufbau des Buches:
Ein Online-Glossar finden Sie unterhttps://files.narr.digital/9783825288303/Zusatzmaterial.zip
IGrundlagen der Ethik
[1]Zentrale Begriffe
[2]Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation
1Zentrale Begriffe
Dieses Kapitel dient der Klärung der wichtigsten Begriffe, die in der Ethik eine Rolle spielen:
Freiheit und Verpflichtung
Moral, Recht und Ethos
Verschiedene Bereiche der Ethik: Deskriptive Ethik, Normative Ethik, Methodenlehre und Metaethik
1.1Freiheit und Verpflichtung
„Wie soll ich handeln?“ lautet die Grundfrage der Ethik (vgl. Quante [Einführung] 11). In dieser Frage kommt zweierlei zum Ausdruck, nämlich Freiheit und Verpflichtung.
Erstens haben die Menschen die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Sie können wirklich handeln im Sinne eines bewussten und gewollten Tätigwerdens und sind nicht durch Instinkte auf ein bestimmtes Verhalten festgelegt. Sie haben Handlungsalternativen und sind in der Lage, vernünftig dazwischen zu wählen. Ohne Freiheit sind moralische Überlegungen müßig, denn der Begriff der Moral oder Sittlichkeit gehört zur Tätigkeit „vernünftiger und mit einem Willen begabter, freier Wesen“ (Kant [Grundlegung] BA100).
Zweitens bringt der deontische Begriff des „Sollens“ die Wahrnehmung einer Einschränkung dieser Freiheit durch eine Verpflichtung zum Ausdruck (griech. to déon: die Pflicht). Gerade aus der Freiheit des Menschen und der daraus erwachsenden Unsicherheit ergibt sich die Notwendigkeit zur Reglementierung des Handelns, zur Etablierung einer Ordnung.
Ordnung meint zum einen, dass das Handeln des jeweils anderen für uns mit einiger Sicherheit erwartbar und vorhersehbar sein muss. Ohne diese Konstanz und Verlässlichkeit im Handeln, die Korrespondenz der Erwartungen, könnte kein Glied der Gesellschaft seine Ziele wirksam verfolgen. Zum anderen wird über die reine Verhaltenssicherheit hinaus ein bestimmtes Handeln erwartet, damit im Ergebnis eine „gute“, „wohltätige“ und „vernünftige“ Ordnung entsteht (vgl. Hayek [Regeln] 19).
Das moralische Sollen bezieht sich somit nicht nur darauf, was getan werden sollte, sondern auch auf Situationen oder Zustände, die der Fall sein sollten (vgl. Broad [Types] 141f.). Der „Naturzustand“ eines Krieges aller gegen alle ist bspw. schlecht, weil die Existenz des Einzelnen in einem solchen Zustand von ständiger Furcht bestimmt, „armselig, widerwärtig, vertiert und kurz“ ist (Hobbes [Leviathan] 105). Er sollte nicht sein. Umgekehrt impliziert dieses Urteil, dass Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, ein „humanes“ und langes Leben erwünschte, gute Zustände sind, die sein sollen. Solche „Strebensziele“ werden auch als Werte oder „Güter“ bezeichnet (vgl. Forschner [Güter] 120).
Das ethische Sollen trifft den Menschen aber noch in einer dritten Form, nämlich als Verpflichtung zu einer bestimmten inneren Grundhaltung. Der Mensch soll nicht nur gut handeln und gute Zustände anstreben, sondern gut (edel, wertvoll, sittlich tüchtig) sein (vgl. Aristoteles [NE] 1099b, 1103b). In allgemeinster Form betrifft dieses Sollen die innere Verpflichtung, überhaupt moralisch handeln zu wollen (Moralität, Ethos). Ohne diese innere Verpflichtung würden die Menschen gar nicht erst den Anspruch ihres Gewissens spüren, ihre Handlung moralisch zu prüfen. Das Sollen kann darüber hinaus in Form bestimmter erwünschter „Tugenden“ präzisiert sein (wie Besonnenheit, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit; vgl. Aristoteles [NE] 1107b-1108b).
Aus dem, was der Fall sein soll (erwünschte Zustände, Strebensziele, Werte oder Güter), lassen sich Rückschlüsse ziehen auf das, was die Menschen tun sollten (erwünschte Handlungen, Normen oder Pflichten) und wie sie sein sollten (erwünschte Haltung, Gesinnung oder Tugenden). Und aus der Vorstellung, dass die Menschen eine bestimmte innere Haltung haben und in einer bestimmten Art und Weise handeln, lassen sich Rückschlüsse ziehen auf den daraus erwachsenden Zustand. Insofern stehen die hier unterschiedenen Bedeutungen des Sollens eng miteinander in Verbindung. (vgl. Abb. I/1).
Abb. I/1: Formen des Sollens
Verschiedene Typen ethischen Argumentierens betonen aber oft einseitig die eine oder die andere Form des Sollens. Auf die innere Haltung stellt die Gesinnungs- oder Tugendethik ab, die Handlungen stehen im Mittelpunkt der Pflichtenethik und die Güter- oder Folgenethik verweist besonders auf die erstrebenswerten Zustände. Die unterschiedlichen Typen werden später genauer erläutert.
Die freiheitsbeschränkende Verpflichtung gibt sich der Mensch selbst. Gerade „weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben“ müssen wir uns selbst Gesetze geben, heißt es bei Kant in seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ (BA105). Der Mensch ist zugleich „gesetzgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unterworfen“ (ebenda BA75). Freiheit bedeutet also nicht Willkür, sondern Autonomie als die Freiheit, selbst an einer guten Ordnung mitzuwirken und diese freiwillig zu befolgen.
1.2Moral, Recht und Ethos
1.2.1Moral
Was zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft im Allgemeinen als Handlung, Zustand oder Haltung für gut und wünschenswert bzw. für böse und verboten gehalten wird, bezeichnet man zusammenfassend als die jeweils herrschende Moral.
Die Moral stellt den „für die Daseinsweise der Menschen konstitutiven … normativen Grundrahmen für das Verhalten vor allem zu den Mitmenschen, aber auch zur Natur und zu sich selbst dar“ (Höffe [Moral] 204). Erkennbar wird die Moral vor allem in den Handlungsnormen (Regeln, Vorschriften, leitenden Grundsätzen). Normative Vorstellungen zeigen sich aber auch in Wertmaßstäben, Sinnvorstellungen, Vorbildern sowie der Verfasstheit öffentlicher Institutionen. Die Moral wird gegen die Etikette (Tischsitten, Anredeformen usw.) und das Brauchtum (bspw. Feiertagsbräuche) abgesetzt. Im Vergleich zu Etikette und Brauchtum geht es bei der Moral um wichtigere, grundsätzlichere Aspekte des Verhaltens, die mit einem größeren Maß an Verbindlichkeit geregelt werden müssen und deren Vorschriften deshalb auch einer stärkeren Begründung bedürfen. Die Grenzen sind allerdings nicht immer eindeutig, denn wie sehr eine Gesellschaft darauf vertraut, dass die überkommenen Bräuche und Sitten gültig, wichtig und verbindlich sind, ist wiederum eine Frage der herrschenden Moral. In einer modernen Gesellschaft, in der Toleranz und Kritikfähigkeit hoch geschätzt werden, gelten immer mehr Verhaltensnormen als relativ unverbindliche Konventionen, Sitten und Bräuche. Als geschichtlich gewordene konkrete Lebensform ist die Moral immer nur mehr oder weniger angemessen und muss offen bleiben für Kritik und Wandel.
1.2.2Recht
In modernen Gesellschaften wird ein großer Teil der Handlungsnormen zu Gesetzen formalisiert und damit zum geltenden Recht. Das Recht stellt als öffentliches Regelsystem eine zentrale Institution dar.
Das Recht kann verstanden werden als ein System von positiven, an Menschen adressierten Zwangsnormen, einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Sanktionen.
Den Kern der Rechtsordnung bilden die Gesetze. Unter Gesetzen verstehen wir
verbindliche Muss-Normen,
die von dazu legitimierten staatlichen Autoritäten (dem Gesetzgeber)
in verbindlich vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren
schriftlich erlassen und öffentlich bekannt gemacht werden,
die zu einem bestimmten Termin in Kraft treten oder außer Kraft gesetzt werden,
deren Einhaltung systematisch von dazu befugten Stellen kontrolliert
und deren Nichteinhaltung grundsätzlich bestraft wird.
Viele Gesetze bringen Moral zum Ausdruck, indem sie Handlungen formal als geboten oder verboten kennzeichnen, die gleichzeitig auch als sittlich gut bzw. sittlich schlecht angesehen werden. In den Bereichen, die für das Miteinander der Menschen, für ihr Verhältnis zu sich und zur Natur als sehr wichtig gelten, wird das Handeln besonders genau, planvoll und verbindlich vorgeschrieben. Dass Gesetze Ausdruck der Moral sein können, zeigt sich zunächst in der großen Übereinstimmung zwischen philosophisch oder religiös begründeten moralischen Normen und den Gesetzen.
Dafür einige Beispiele: Die zentrale moralische Norm der Achtung vor der Würde der Person ist bei uns in Artikel 1 des Grundgesetzes gesetzlich verankert worden. Die biblischen Verbote des Betruges, des Diebstahls und des Mordes finden ihren Niederschlag in umfangreichen Strafgesetzen. Die moralische Idee der Gerechtigkeit steht hinter dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG. Die moralische Verurteilung der Wegwerfmentalität im Handel mündete 2020 in einer Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Demnach haben die Unternehmen eine „Obhutspflicht“, d. h. sie müssen die Gebrauchstauglichkeit der vertriebenen Waren nach Möglichkeit erhalten und dürfen bspw. retournierte neuwertige Waren nicht einfach vernichten. Den Unternehmen wird eine „Produktverantwortung“ auferlegt.
Weiterhin kann der moralische Gehalt vieler Gesetze auch daran abgelesen werden, dass immer öfter Ethik-Kommissionen explizit in das Gesetzgebungsverfahren einbezogen werden (etwa beim Embryonenschutzgesetz, Organspendegesetz, Gentechnikgesetz). Das heißt nicht, dass nur solche heftig diskutierten Gesetze einen moralischen Inhalt haben. Man ist in manchen Fällen nur besonders unsicher, was man als sittlich gut und wünschenswert gesetzlich vorschreiben bzw. als sittlich schlecht und unerwünscht gesetzlich verbieten soll.
Schließlich nimmt auch das Recht immer wieder ethische Kategorien in Anspruch und verweist bspw. in §138 BGB auf die „guten Sitten“ und in §157 BGB auf „Treu und Glauben“. Der BGH hat am 25.5.2020 entschieden, dass von VW getäuschte Dieselfahrer Schadenersatz bekommen können, weil das Verhalten von VW „objektiv als sittenwidrig“ und „besonders verwerflich“ zu qualifizieren sei. Es sei mit grundlegenden Wertungen der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren.
Moral und Recht sind aber nicht deckungsgleich. Vielmehr handelt es sich um zwei Sphären, die sich teilweise überschneiden, die teilweise aber auch nur moralischen bzw. nur rechtlichen Charakter haben (vgl. Kaufmann [Recht]). Einige Gesetze bringen keine sittlichen Wertungen zum Ausdruck, sondern stellen lediglich praktische Übereinkünfte dar, um Verhalten erwartbar zu machen (z.B. das Rechtsfahrgebot oder die Vorfahrtsregeln im Straßenverkehrsrecht). Die Erfahrung lehrt außerdem, dass Gesetze unsittlich sein können. Man denke etwa an die Gesetze zur Enteignung der Juden im Dritten Reich.
Weiterhin gehören zur Moral auch noch die zahlreichen informalen Normen, die sich in mehrfacher Hinsicht von Gesetzen unterscheiden können. Sie sind
weniger verbindliche Soll- und Kann-Normen (bspw. Gebote der Nachbarschaftshilfe oder der Unterstützung der Armen),
entstehen „von selbst“ als gewachsene Lebensform
oder werden von nicht-staatlichen Autoritäten (bspw. Kirchen) vorgeschrieben,
liegen oft nicht explizit ausformuliert vor,
treten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft
und werden anders kontrolliert und sanktioniert. Die Kontrolle erfolgt nicht durch staatliche Stellen, sondern in Form sozialer Kontrolle durch die Mitmenschen oder durch die Selbstkontrolle des Gewissens. Die Sanktionen bestehen nicht in Freiheits- oder Geldstrafen, sondern in sozialen Strafen wie Tadel, Missachtung, Vermeiden von Kontakten oder in Gewissensbissen.
Abbildung I/2 verdeutlicht die Unterschiede und die Schnittmenge zwischen der Moral und dem Recht.
Abb. I/2: Unterschiede zwischen und Schnittmenge von Moral und Recht
Für die USA stellt Bird (vgl. [History] 18f.) eine Entwicklung hin zur Verrechtlichung von „Business Ethics“ fest, d. h. vormals „nur“ moralische Erwartungen an Unternehmen werden immer stärker in die Form von Gesetzen gegossen. Das scheint auch in Deutschland so zu sein. So sind die in der Corona-Krise in Verruf gekommenen Konstrukte mit Werkverträgen und Leiharbeit in der fleischverarbeitenden Industrie seit Anfang 2021 verboten (Arbeitsschutzkontrollgesetz). Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom Juli 2021 (kurz: Lieferkettengesetz) verpflichtet große Unternehmen, bei ihren Zulieferern auf die Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Vorgaben zu achten. Mögliche Verletzungen der Vorgaben sollen erkannt, gegebenenfalls beendet oder zumindest abgemildert werden und künftigen Verstößen soll vorgebeugt werden. Konkret sollen bspw. Kinderarbeit und Zwangsarbeit verhindert werden, angemessene Löhne und Arbeitsschutz sind zu gewährleisten, die Kontaminierung von Gewässern durch die Produktion soll vermieden werden. Das Gesetz bezog sich zunächst auf Unternehmen mit mindestens 3000 in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern, seit 2024 auf Unternehmen mit mindestens 1000 in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern. Eine freiwillige Verpflichtung durch einen Kodex hatte offensichtlich nicht zu den erhofften Besserungen geführt.
Es macht sich eine gewisse Ernüchterung breit, was die Wirksamkeit freiwilliger Selbstverpflichtungen der Unternehmen betrifft. Da nicht jede Form erwünschten Verhaltens gesetzlich geregelt werden kann und auch die Einhaltung der geltenden Gesetze durch die staatlichen Kontrollen und Sanktionen alleine niemals gewährleistet werden kann, haben die nicht-formalen Regeln, Kontroll- und Sanktionsmechanismen aber eine sehr wichtige ergänzende Funktion für die Gesellschaftsordnung.
1.2.3Ethos
Als Rahmen für das Verhalten erscheint die herrschende Moral zunächst als etwas den Subjekten Äußerliches und Vorgegebenes. Die Moral erschöpft sich aber nicht in ihren äußeren Manifestationen, sondern umfasst auch die persönlichen Haltungen, Wertmaßstäbe, Überzeugungen, Sinnvorstellungen und Tugenden der Subjekte. Als sittliche Subjekte haben sie eine innere Moral, die man auch als Ethos bezeichnen kann.
Anerkennt ein Subjekt eine bestimmte Moral als verpflichtend für sein Handeln und ist das Handeln dauerhaft durch die Anerkennung geprägt, so spricht man von Ethos.
Der Begriff „Ethos“ wird teilweise auch anders verwendet, bspw. als Sammlung von Regeln für bestimmte Berufsgruppen wie Ethos des Mediziners, Ethos des Kaufmanns, oder auch als Synonym für Moral. Im Folgenden ist mit Ethos eine innere Verpflichtung zum Guten gemeint. Durch sein Ethos fühlt sich das Subjekt an bestimmte Handlungsweisen gebunden, die es als gut und wünschenswert erkannt hat (bspw. Gesetzestreue, Mildtätigkeit, Ehrlichkeit). In gleicher Bedeutung wird auch der Begriff der „Moralität“ verwendet (vgl. Höffe [Sittlichkeit] 272) oder – altmodisch – von Tugend gesprochen.
Mit der Moralität wird ein weiterer Unterschied zwischen Recht und Moral angesprochen. Denn während die von Recht und Moral ausgesprochenen Pflichten die gleichen sein können (bspw. Verträge einzuhalten, sie nach Treu und Glauben auszulegen) ist die Art der Verpflichtung eine andere. Dem Gesetz kann man rein äußerlich Folge leisten ohne innere Überzeugung, nur aus Angst vor Strafe, während zum moralischen Handeln die innere Triebfeder gehört, gut handeln zu wollen, und zwar insbesondere auch dann, wenn man nicht dazu gezwungen ist (vgl. Kant [Rechtslehre] AB16,17).
Weil auch die Moralität Gegenstand der Ethik ist, kann man nicht sagen, dass die Ethik erst da anfängt, wo das Gesetz endet und sozusagen nur den (kleinen) Rest an Normen betrifft, die bisher noch nicht gesetzlich geregelt sind (zu dieser These vgl. Crane/Matten [ethics] 9). Vielmehr ist es eine Frage des Ethos, als gut und vernünftig akzeptierte Gesetze prinzipiell zu befolgen, einfach weil das Handeln als richtig erkannt wurde und nicht aus Angst vor Strafe. Zur Selbstverpflichtung kommt die Selbstkontrolle durch das Gewissen, als Sanktion wirkt das „schlechte Gewissen“. Das heißt, man fühlt sich unwohl und schuldig, wenn man etwas getan hat, was nach eigener Überzeugung schlecht war. In diesem Urphänomen menschlicher Erfahrung erlebt vermutlich jeder Mensch den Anspruch des Moralischen.
Das Ethos bildet sich zum Teil durch die Verinnerlichung der herrschenden Moral im Rahmen der Sozialisation in Familie und Gesellschaft. Das aus dem Griechischen stammende Wort Ethos wird mit „Charakter, sittliche Gesinnung“, aber auch mit „gewohnter Lebensort“ und „Gewöhnung“ übersetzt. Aristoteles war der Überzeugung, dass man Ethos erlernt und einübt wie eine Handwerkskunst, indem man sich an Vorbildern orientiert und die als richtig geltenden Handlungen vollzieht (vgl. [NE] 1103b).
Das Ethos muss aber mehr sein als das schlichte Abbild der geltenden Moral im Inneren des Menschen, denn sonst wären Kritik an der herrschenden Moral und ihre Weiterentwicklung nicht denkbar. Der Mensch kann sich aufgrund seines persönlichen Ethos geradezu verpflichtet fühlen, den geltenden Gesetzen, der geltenden Moral nicht Folge zu leisten. Das sittliche Subjekt schöpft offenbar bei seinen moralischen Urteilen noch aus anderen Quellen als den äußeren Vorgaben, vor allem aus der „Vernunft als praktisches Vermögen“ (Kant [Grundlegung] BA7). Diese ermöglicht sowohl eine kritische Distanz gegenüber den geltenden Normen (weshalb bspw. u. U. ein nicht legales Handeln als moralisch empfunden werden kann) als auch die Neuschöpfung von Normen, wenn dies aufgrund veränderter Lebensbedingungen oder neuer empirischer Erkenntnisse (bspw. Gentechnik) nötig wird.
Die Moral kann sich zu keinem Zeitpunkt auf den gerade gültigen Komplex von Normen, Wertmaßstäben usw. beschränken, sondern braucht das sittliche Subjekt mit seinem Ethos, das die geltende Moral bewertet, durch sein Handeln zur Geltung bringt oder sie auch abändert und ergänzt. Äußere und innere Moral (Ethos) sind in einer Art von Zirkel miteinander verbunden, denn das sittliche Subjekt ist zugleich Schöpfer und Adressat der Moral, ihr passives Vollzugsorgan und ihr aktiver Gestalter (vgl. Abbildung I/3).
Abb. I/3: Zusammenhang von Moral und Ethos
1.3Ethik
1.3.1Allgemeine Kennzeichnung
Die Ethik kann ganz allgemein gekennzeichnet werden als die Lehre oder auch die Wissenschaft von Moral und Ethos, also vom menschlichen Handeln, welches sich von der Differenz zwischen gut/sittlich richtig und böse/sittlich falsch leiten lässt.
Nach Aristoteles beschäftigt sich die theoretische Philosophie mit Theologie, Mathematik und Naturwissenschaften. Diese werden auch als betrachtende Wissenschaften bezeichnet. Dagegen gehören zur praktischen Philosophie die handelnden Wissenschaften, deren Prinzip die Entscheidungen von Handelnden sind (vgl. Aristoteles [Metaphysik] 1025b-1026a; 1064a).
Praktische Philosophie ist zu charakterisieren
durch ihren Erkenntnisgegenstand, nämlich die menschliche Praxis, das menschliche Handeln
sowie durch ihre praktische Intention der Orientierung und Verbesserung dieser Praxis im Hinblick auf die Erreichung eines Endzieles oder obersten Gutes.
1.3.2Deskriptive Ethik
Die deskriptive Ethik beschreibt als empirische Disziplin, wie es in bestimmten Gesellschaften oder bei bestimmten Gruppen um Moral und Ethos bestellt ist.
Das Ethische soll in seinen verschiedenen zeit- und kulturabhängigen Ausprägungen möglichst genau erfasst werden.
Beispiel: Während es bis 1969 nicht nur als unsittlich galt, sondern sogar strafbar war, wenn Menschen ihre Homosexualität lebten, ist die gleichgeschlechtliche Partnerschaft heute eine allgemein akzeptierte Lebensform, die in Form der eingetragenen Lebenspartnerschaft sogar eheähnlichen Status genießt.
Man könnte sagen, deskriptive Ethik sei im Grunde mehr Ethnologie oder Geschichtswissenschaft als Ethik, weil man nur beschreibend feststellt, was bei bestimmten Völkern, Stämmen, Gruppen, Schichten, Klassen usw. als „moralisch“ galt bzw. gilt. Es geht der deskriptiven Ethik aber nicht darum, die Neugier zu stillen durch die Beschreibung möglicherweise exotisch anmutender Sitten und Bräuche. Vielmehr nimmt sie zu den Befunden wiederum wertend Stellung. Wenn festgestellt wird, dass immer weniger Menschen in einer Gesellschaft bereit sind, sich entsprechend der herrschenden Moral richtig zu verhalten, wird das bspw. als ein Werteverfall problematisiert, der Handlungsbedarf auslöst. Die Beschreibung der Unterschiede zwischen den Moralvorstellungen verschiedener Kulturen (etwa islamische und christliche Kultur) oder verschiedener Zeiten gibt Anlass, die eigenen Vorstellungen zu prüfen und zu relativieren. Und die Entdeckung weit verbreiteter, von fast allen Menschen anerkannter Grundnormen macht Hoffnung auf die Möglichkeit eines Weltethos (bspw. in der Form der Anerkennung zentraler Menschenrechte).
1.3.3Normative Ethik
Die deskriptive Ethik liefert mit ihrer Beschreibung der herrschenden moralischen Praxis einen wichtigen Input für die normative Ethik, die als eigentlicher Kern der Ethik gilt.
Die normative Ethik sucht nach den richtigen sittlichen Sollensaussagen. Sie will begründete und verbindliche Aussagen dazu machen, wie der Mensch handeln soll (Handlungsnormen oder Pflichten), was er anstreben soll (Strebensziele oder Werte/Güter) und wie er sein soll (Haltungsnormen oder Tugenden).
Man sucht nach dem festen, verbindlichen Maßstab für das Gute, mit dem man die geltende Praxis bewerten, orientieren und verbessern kann.
1.3.4Methodenlehre
Häufig vernachlässigt wird ein Bereich der Ethik, der von Kant als „Methodenlehre“ bezeichnet wird.
Die Methodenlehre sucht nach der Art, „wie man den Gesetzen der reinen praktischen Vernunft Eingang in das menschliche Gemüt, Einfluß auf die Maximen desselben, d.i. die objektiv-praktische Vernunft auch subjektiv praktisch machen könne.“ (vgl. [Kritik] A269).
In moderner Diktion würde man sagen, es geht um die Motivation zum Guten oder die Implementation von Moral.
Diese Implementation kann zum einen an der Gesinnung, am Ethos des Individuums ansetzen. Ihm soll die „Triebfeder zum Guten“ eingepflanzt werden, so dass es zur selbstverständlichen Gewohnheit wird, die Handlungen nach moralischen Kriterien zu prüfen und sich für das Gute zu entscheiden (vgl. Kant [Kritik] A273, A285). Ähnlich wie auch Aristoteles sieht Kant die Erziehung der Jugend als wichtigste Methode, um sittliche Subjekte (Aristoteles spricht von „wertvollen Menschen“) herauszubilden (vgl. Kant [Kritik] A275ff.; Aristoteles [NE] 1103b).
Zum anderen wird, vor allem im ökonomischen Diskurs, die Möglichkeit erwogen, das Ethos des Individuums sozusagen zu umgehen und durch geschickt gestaltete Anreize auf der Ebene der äußeren Moral dafür zu sorgen, dass auch der unmoralische Mensch zuverlässig in erwünschter Weise handelt. Für Kant wäre dies „lauter Gleisnerei, das Gesetz würde gehaßt, oder wohl gar verachtet, indessen doch um des eigenen Vorteils willen befolgt werden“ ([Kritik] A271). Für andere, in erster Linie Wirtschaftsethiker, erscheint es als einzig realistische Möglichkeit, Moral – vor allem in der Wirtschaft – zu implementieren (vgl. bspw. Homann [Unternehmensethik] 42). Diese Kontroverse wird uns später noch beschäftigen.
1.3.5Metaethik
Schließlich ist als vierter Bereich noch die Metaethik zu nennen.
Die Metaethik will keine inhaltlichen Aussagen über das sittlich Gute machen, sondern ethische Aussagen untersuchen. Ihr Forschungsgegenstand ist die Ethik an sich, nicht Moral und Ethos.
Ihre wichtigste Methode ist die Sprachanalyse. Sittliche Prädikate wie „gut“, „richtig“, „Sollen“, „Pflicht“ werden auf ihre Bedeutung hin untersucht und die sittliche von der nicht-sittlichen Verwendung unterschieden. Weitergehend versucht man die Frage zu klären, ob ethische Aussagen die Form von Behauptungen haben und damit wahrheitsfähig sind.
Die unterschiedliche Beantwortung dieser Frage trennt die Lager der Nonkognitivisten und der Kognitivisten. Der Kognitivismus hält an der prinzipiellen Erkennbarkeit des Sittlichen fest, der Nonkognitivismus meint dagegen, ethische Aussagen könnten nicht im wissenschaftlichen Sinne wahr oder falsch sein. Obwohl die Metaethik sich selbst als ethisch neutrale Sprachwissenschaft versteht, haben ihre Urteile große Relevanz auch für die normative Ethik. Denn wenn die sittlichen Aussagen nicht wahrheitsfähig sind, ist es sehr schwer, ihre Gültigkeit zu begründen.
Abbildung I/4 vermittelt nochmals einen kurzen Überblick über diese Ethikbereiche und ihre jeweils zentrale Fragestellung.
deskriptive Ethik
normative Ethik
Methodenlehre
Metaethik
Was wird für das Gute gehalten?
Was ist das Gute?
Wie kann man Menschen bewegen, das Gute zu verwirklichen?
Sind Aussagen über das Gute wahrheitsfähig?
Abb. I/4: Bereiche der Ethik
Im Folgenden steht die normative Ethik im Vordergrund.
2Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation
Schon seit Jahrtausenden wird von Philosophen und Theologen systematisch über das Gute nachgedacht, ohne dass bis heute ein definitiver Abschluss dieses Prozesses zu verzeichnen wäre. Im Verlaufe der Diskussion haben sich teils recht kontroverse Meinungen herausgebildet, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Um der Übersichtlichkeit willen werden die Aussagen zu „Typen“ verdichtet, auch wenn damit notgedrungen eine gewisse Verkürzung und Vereinfachung verbunden ist.
Wir unterscheiden
nach der Bewertungsgrundlage die Gesinnungs-, Pflichten- und Folgenethik,
nach dem Ort der Moral die Individual-, Institutionen- und „Öffentlichkeitsethik“ und
nach verschiedenen Methoden, zu ethisch vertretbaren Entscheidungen zu kommen, die monologische Ethik und die Diskursethik.
2.1Bewertungsgrundlage: Gesinnung, Handlung, Folgen
Zur Illustration der Problematik werden zunächst drei fiktive Beispiele für das Verhalten verschiedener Personen vorgestellt.
Szene 1
Frau A. sieht, wie eine Frau von einem Mann verfolgt wird, und denkt: „Der Kerl will ihr sicher Böses tun, ich will sie retten“. Als der Mann zu ihr kommt und sie fragt, wohin die Frau gelaufen sei, zeigt sie in die falsche Richtung und sagt: „Da entlang!“ Nachher stellt sich heraus, dass die Frau eine Diebin war und der Verfolger der Bestohlene. Die entkommene Diebin stiehlt weiterhin.
Szene 2
Frau B. sieht, wie eine Frau von einem Mann verfolgt wird, und denkt: „Der Kerl will ihr sicher Böses tun, das kann ja spannend werden“. Als der Mann zu ihr kommt und sie fragt, wohin die Frau gelaufen sei, zeigt sie eifrig in die richtige Richtung. Nachher stellt sich heraus, dass die Frau eine Diebin war und der Verfolger der Bestohlene. Der Verfolger erwischt die Diebin und sie wird bestraft.
Szene 3