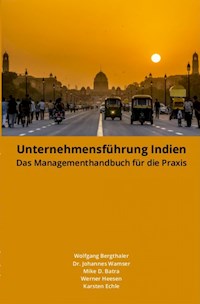
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch geht auf die heute wichtigsten Aspekte und brennendsten Probleme im Indiengeschäft ein und zeigt für Mittelständler praktische Handlungsanweisungen zur Bewältigung des geschäftlichen Alltags auf dem Subkontinent. Die Inhalte beschäftigen sich insbesondere mit dem Thema Vertrieb, dem Umgang mit Geschäfts- und Joint Venture-Partnern sowie dem Thema Personal inklusive Führung und Steuerung des Indien-Geschäfts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unternehmensführung Indien
Das Managementhandbuch für die Praxis
1.Auflage
Wolfgang Bergthaler
Dr. Johannes Wamser
Mike D. Batra
Werner Heesen
Karsten Echle
Mit einem Vorwort von Bernd Mützelburg, Botschafter a.D.
2018 Dr. Wamser + Batra GmbH, Bochum ISBN: 978-3-746737-35-5
Vorwort
Die Dr. Wamser + Batra GmbH sieht es als seine Aufgabe als zuverlässiges und vertrauenswürdiges Projektmanagement- und Beratungsunternehmen für Indien an, den eigenen Kunden nur solche Informationen zur Verfügung zu stellen, die für ausländische (mittelständische) Unternehmen tatsächlich bedeutsam sind und die über Erfolg oder Misserfolg in Indien auch wirklich entscheiden.
Zu häufig werden Aspekte diskutiert, die kaum praxisrelevant sind, oder es werden wichtige Herausforderungen verschwiegen oder in Ihrer Bedeutsamkeit kleiner gemacht als sie sind. Wir glauben, dass wir diesem Anspruch am besten gerecht werden können, indem wir aus unserer eigenen persönlichen Erfahrung berichten, die wir allesamt als Manager in Indien an eigener Haut erlebt haben, sowie von den Erfahrungen, die wir inzwischen mittels mehr als 250 Projekten für knapp 150 europäische Unternehmen in Indien sammeln durften. Lesen Sie unsere ganz persönlichen Einschätzungen und lernen Sie die Situationen kennen, mit denen unsere Kunden in Indien konfrontiert sind.
Diese Themen haben wir in den letzten Jahren in Form unseres Blogs http://www.wamser-batra.de/blog/ gesammelt und wollen sie nun einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Grußwort
Das vorliegende kleine Handbuch über Unternehmensführung in Indien hat das Zeug dazu, ein Klassiker für jeden zu werden, der überlegt, sich in Indien unternehmerisch zu betätigen.
Es zeichnet sich durch eine sehr konzise und gleichzeitig anschauliche Analyse der typischen Risiken aus, die deutschen, aber auch europäischen Unternehmen in jeder Phase der in Frage kommenden Aktivitäten und Kooperationen in Indien begegnen und es leitet daraus praktische Handlungsanleitungen ab. Damit wird der Band zu einem „Vademecum“ von Praktikern für Praktiker, das in jeder Phase unternehmerischer Tätigkeit - von der Markterschließung über die Personalrekrutierung und -Führung bis hin zum Umgang mit der Korruptionsproblematik - Rat und Hilfe bietet; nicht zuletzt auch dadurch, dass es zu einer ständigen Überprüfung und Hinterfragung der eigenen Annahmen, Erwartungen und Verhaltensmuster anregt.
Wie ein Leitmotiv durchziehen die Belege für die tiefgreifenden, letztlich auf unterschiedlichen Weltanschauungen beruhenden Unterschiede in der Unternehmenskultur das Handbuch. Sein großes Verdienst ist, diese in den unterschiedlichen Zusammenhängen wieder und wieder bewusst zu machen. Damit trägt es nicht nur dazu bei, den keineswegs nur auf die Inder beschränkten Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, den „weiten Raum zwischen Realität und Wahrheit“ zu überbrücken. Vor allem hilft es Unternehmern, Konfliktpotentiale rechtzeitig zu erkennen und so kapitale Fehler zu vermeiden.
Insofern gehört das Büchlein in die Präsenzbibliothek jedes deutschen Unternehmens, das in Indien nachhaltig und langfristig Erfolg haben will. Es wird auch Unternehmern, die schon längere Zeit in Indien aktiv sind, manch neue Einsicht, zumindest das eine oder andere Aha-Erlebnis vermitteln. Ich wünsche dem Handbuch daher weite Verbreitung. Da, wo das Büchlein keine konkrete Antwort mehr weiß, empfehle ich, die Autoren um Rat zu fragen.
Bernd Mützelburg Botschafter a.D. der Bundesrepublik Deutschland in Indien
Indiengeschäft zwischen Wunsch und Wirklichkeit
In den letzten fünfzehn Jahren verschlug es hunderte von mittelständischen Unternehmen nach Indien – sei es mit Hilfe indischer Handelsvertreter, Joint Ventures der sogar mit einer eigenen Tochtergesellschaft. Doch die anfängliche Euphorie hat sich offenbar gelegt, denn eine steigende Zahl von Unternehmen berichtet von erheblichen Anlaufschwierigkeiten, die teilweise über viele Jahre andauern. Im Rahmen einer repräsentativen Studie, demWB Geschäftsklimaindex Indien,wurde erhoben, dass 70 Prozent der deutschen Unternehmen ihre Vertriebsziele in Indien (deutlich) verfehlen. Aber auch abseits der Verkaufszahlen beklagen viele Manager ausbleibende Gewinne. Es gäbe vielfältige Probleme mit den indischen Partnern, Managern und Mitarbeitern.
70 Prozent der deutschen Unternehmen verfehlen ihre Vertriebsziele in Indien
Viele deutsche Unternehmer wähnen die Ursache für ihre Probleme ganz einfach in den indischen Verhaltensweisen und sprechen mitunter auch von indischen „Schlitzohrigkeiten“ oder gar „Betrügereien“, von „fehlender Zuverlässigkeit“ oder einfach von „mangelnder Loyalität“. In der Mehrzahl der Fälle liegt aber überhaupt kein „unmoralisches“ oder gar „böswilliges“ Verhalten der indischen Mitarbeiter und Manager vor. Die „Schuld“ für die erlebte Misere liegt ganz woanders – nämlich im sogenannten Culture Clash – dem Zusammenstoß von zwei grundverschiedenen Kulturen und zweier sehr unterschiedlicher Auffassungen von Management und Unternehmensführung. Westliche Unternehmen unterschätzen leider nach wie vor die sehr hohen interkulturellen Anforderungen, die ein Engagement in Indien an das europäische Stammhaus und seine Führungskräfte stellt. Denn Indien aus der Distanz vom fernen Deutschland aus zu führen, ist eine tägliche Herausforderung. Daher stellen wir das Thema Unternehmensführung ins Zentrum dieses Management-Handbuchs für Indien.
Denn viel wurde in den letzten Jahren zum Thema „Markteintritt Indien“ geschrieben: Investitionsratgeber, Business-Guides, Markt- und Branchenreports und vieles mehr. Auch wir veröffentlichten zu diesem Thema unter anderem das kompakte Büchlein„Indien: Ein Reiseführer für die Business-Class“. Für Indien-Einsteiger und Manager, die zum ersten Mal nach Indien dürfen, ist diese Lektüre nach wie vor tagesaktuell und nützlich.
Doch im Grunde ist für die meisten Unternehmen das Thema Markteintritt durch und Indien kein unbekanntes Land mehr. Daher geht dieses Buch auf die heute wichtigsten Aspekte und brennendsten Probleme im Indiengeschäft ein und zeigt für Mittelständler praktische Handlungsanweisungen zur Bewältigung des geschäftlichen Alltags auf dem Subkontinent. Die Inhalte beschäftigen sich insbesondere mit dem Thema Vertrieb, dem Umgang mit Geschäfts- und Joint Venture-Partnern sowie dem Thema Personal inklusive Führung und Steuerung des Indien-Geschäfts.
Markteintritt und erste Erfolge
Aber lassen Sie uns zuerst nochmals–für all jene, die die ersten Schritte erst vor sich haben und diese gerade gehen–einen kurzen Blick auf das Thema Markteintritt werfen. Denn wenn man ein attraktives Produkt oder eine Technologie hat, welche sich sichtbar vom indischen Wettbewerb unterscheiden, kann ein Markteintritt in Indien noch immer – auch für ein kleineres Unternehmen – Sinn machen.
„Kommissar Zufall“ spielt bei der Vertriebspartnersuche in Indien oft Regie
Auf Grund der oft limitierten finanziellen Möglichkeiten ist eine Kooperation mit einem indischen Händler oder Distributor oft der pragmatischste Weg zum Ziel-(Markt).Dieses Modell hat zahlreiche Vorteile gegenüber der Gründung einer eigenen Firma in Indien. Für viele Nischenplayer ist der zu Beginn erreichbare Teil des indischen Marktes einfach zu klein, um den Aufbau einer eigenen Struktur vor Ort zu rechtfertigen.
So gibt es heute wahrscheinlich etliche tausend indische Handelsvertreter, die für europäische Unternehmen in Indien tätig sind. Typischerweise beginnen solche Kooperationen auf einer Messe oder anderen Indien-Veranstaltung mit den Worten eines indischen Agenten:„I want to make business with you.“Nachdem das Risiko überschaubar scheint, zögern die wenigsten Produzenten, hier direkt einzuschlagen und zwar oft genug, ohne die tatsächliche Leistungsfähigkeit des zukünftigen Geschäftspartners weiter zu untersuchen. Aber auch Handelsvertreter, die von einem Verband oder der Handelskammer „per offizieller Liste“ empfohlen werden, entgehen einer sorgfältigen Bewertung hinsichtlich ihrer wahren Tauglichkeit.
Das Betriebsstätten-Risiko
Ungeachtet einer notwendigen, aber meist unzureichenden Due Diligence des zukünftigen Vertriebspartners, lauert beim ersten Kontakt mit einem indischen Agenten für viele Unternehmen auch bereits das erste große Risikopotential. Denn die Zusammenarbeit mit einem indischen Handelsvertreter–das Spektrum reicht hier von Einzelpersonen, welche als Repräsentanten eine Reihe von Marketing-Aufgaben übernehmen, bis hin zu gewerblichen Händlern, Distributoren oder Importeuren mit umfangreichen Aufgaben und Vollmachten – führt unter gewissen Umständen zu einer steuerlichen Betriebstätte.Betriebstätte.
Viele Vertriebs-Modelle führen zur ungewollten Gründung einer steuerpflichtigen Betriebsstätte
Die „Betriebsstätte“ wird in den Abkommen zwischen Deutschland (respektive Österreich und der Schweiz) und der Regierung der Republik Indien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (kurz Doppelbesteuerungsabkommen oder DBA) aus dem Jahr 1996 klar und umfassend definiert:„Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck Betriebstätte eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.“
Im deutsch-indischen Doppelbesteuerungsabkommen werden folgende Einrichtungen als Betriebsstätte bezeichnet: Ort der Leitung, Zweigniederlassung, Geschäftsstelle, Fabrikationsstätte, Werkstätte, Bergwerk, Öl- oder Gasvorkommen oder ein Steinbruch. Aber auch eine Verkaufseinrichtung, das Lagerhaus einer Person, die Dritten Lager-Einrichtungen zur Verfügung stellt, eine Bauausführung oder Montage oder eine damit im Zusammenhang stehende Aufsichtstätigkeit von über sechs Monaten Dauer verursacht eine Betriebsstätte in Indien. Typische Beispiele für ungewollt gegründete Betriebsstätten in der vertrieblichen Praxis:
Exklusive Vertreter und indische Berater
Arbeitet ein lokaler Agent (Unternehmen oder Einzelperson) ausschließlich oder fast ausschließlich für nur einen ausländischen Auftraggeber, gilt er in Indien als „abhängiger Vertreter“, was unmittelbar eine so genannte Vertreterbetriebsstätte zur Folge hat. Dazu muss dieser Vertreter noch nicht einmal Abschlussvollmachten haben oder ein Auslieferungslager betreiben. Es reicht bereits, wenn er „regelmäßig“ und nicht nur gelegentlich für die ausländische Firma „tätig“ wird.
Viele Unternehmen beschäftigen eine indische Einzelperson, die als Ansprechpartner oder Repräsentant vor Ort fungiert, ohne dass weitere Strukturen wie eine Tochtergesellschaft oder irgendein anderes eingetragenes Unternehmen bestehen. Dieser Berater ist entweder beim europäischen Stammhaus angestellt oder er wird durch eine Art „Beratervertrag“ direkt bezahlt. In der Regel handelt es sich dabei um jemanden, der in Vollzeit direkt im Auftrag des europäischen Unternehmens handelt und dabei sogar oft der Weisungsbefugnis eines Mitarbeiters im Stammhaus untersteht. In dieser Konstellation ist der indische Mitarbeiter ebenfalls ein „abhängiger Vertreter“ (siehe oben: Vertreterbetriebsstätte). Wenn der indische Mitarbeiter am Ende des Jahres seine fällige Einkommenssteuer nicht oder nicht in adäquater Höhe abführt, ergibt sich ein weiteres Risiko für den Auftraggeber. Dann erkennen die indischen Steuerbehörden nämlich eine Art „Scheinselbstständigkeit“ und können das europäische Unternehmen für die entgangenen Steuern haftbar machen.
Montagebetriebsstätte
Wird beispielsweise eine Anlage nach Indien verkauft und das europäische Unternehmen erbringt für einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten direkt oder indirekt Montageleistungen beim Käufer, führt das zu einer so genannten Montagebetriebsstätte, ganz gleich ob
das Unternehmen die Montageleistungen in Indien selbst mit eigenen Mitarbeitern erbringt,
das Unternehmen ein indisches Subunternehmen mit der Montage beauftragt (ein indisches Unternehmen wird also im Auftrag des europäischen Unternehmens vor Ort tätig), oder
ein europäischer Mitarbeiter die Aufsichtsfunktion für die Montagearbeiten in Indien übernimmt.
Entsendungen nach Indien
Bei der Einordnung von Entsendungen durch die indische Steuerbehörde besteht besonders große Unsicherheit. Auch wenn der Entsandte Angestellter bei der indischen Firma ist, kann die Frage gestellt werden, wer denn nun der endgültige oder „principal“ Arbeitgeber ist. Außerdem gibt es Gerichte, die in einer klassischen Entsendung (meist ja Führungspersonal) einen versteckten Knowhow- Transfer an die indische Gesellschaft annehmen und die Gehaltskosten des Entsandten als „fees for technical service“ interpretieren. Dieser Argumentation zu Folge, besteht nach sechs Monaten eine Betriebsstätte, da der Mitarbeiter in Indien technische Dienstleistungen erbringen würde.
Steuerrechtliches Risiko & Gerichtsbarkeit
Die steuerlichen und rechtlichen Folgen einer Betriebsstätte in Indien sind vielen Unternehmen oft nicht ausreichend bewusst.
Das primäre und unmittelbarste Problem ist ein steuerrechtliches Risiko: Die europäische Mutterfirma wird in Indien Körperschaftssteuerpflichtig (Corporate Income Tax). Die Betriebsstätte verursacht also eine indische Steuerpflicht – ohne, dass man von ihr Kenntnis besitzt. Möglicherweise entsteht sogar eine Steuerpflicht für Einkommen, welches bereits vor Jahren im Ausland versteuert wurde. Das bedeutet nicht nur einen ungeplanten zusätzlichen Verwaltungsaufwand, sondern durch die Steuerforderungen (inklusive Zinsen und Zuschläge) einen nicht zu unterschätzenden finanziellen Aufwand.
Das zweite, nicht zu unterschätzende Risiko ist, dass das europäische Unternehmen über seine indische Betriebsstätte auch gleichzeitig der indischen Gerichtsbarkeit unterworfen ist. Es liegt natürlich im Interesse der Mutterfirma, die Haftung in Indien auf die indische Entität zu beschränken. Eine Vertretung der europäischen Gesellschaft vor den indischen Behörden kann sehr schnell enorme Kosten verursachen.
Vermeidung einer Betriebsstätte
Auf Grund dieser Risiken ist es umso wichtiger, jedes für Indien ins Auge gefasste Vertriebsmodell hinsichtlich des (steuerlichen) Betriebsstätten-Risikos genauestens zu prüfen. Ein paar „Best Practices“ und Anhaltspunkte seien hier exemplarisch genannt. In der Realität ist aber jeder Fall individuell zu prüfen.
Zur Vermeidung einer Vertreterbetriebsstätte ist zum Beispiel die Gründung eines „Liaison Office“ der sicherste Weg. Es gibt aber auch Fälle, wo selbst das nicht nötig ist, weil die Unabhängigkeit des Repräsentanten auch anders sichergestellt werden kann.
Bei Montageprojekten und Entsendungen ist auf eine äußerst präzise Vertragsgestaltung zu achten, um jede Angriffsfläche zu vermeiden.
Anlagenbauern raten wir zu einer vorausschauenden und entsprechend sorgfältigen Vertragsgestaltung bei ihren Indien-Geschäften. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist dabei ein sogenanntes „Contract Splitting“ (Vertragssplitting). Die Warenlieferungen zwischen dem europäischen Lieferanten und dem indischen Kunden („Offshore“) müssen vertraglich separat von den Montageleistungen geregelt werden. Dies führt dazu, dass jeder Leistungsbestandteil des Projektes eindeutig und für sich mit der korrekten Steuer versehen werden kann.
Bei Entsendungen sind ganz klar strukturierte Angestelltenverhältnisse zurzeit sicherlich die beste Wahl zur Risikominimierung. Zur Not müssen Unterbrechungen in der Sozial- und Pensionsversicherung in Europa privat abgedeckt werden.
Am besten vermeidet man das Betriebsstätten-Risiko natürlich gleich von Anfang an. Aber selbst, wenn solche Risiken erst seit kurzem bestehen, sind sie doch im Allgemeinen noch „gut kontrollierbar“ und können ohne erheblichen Aufwand bereinigt werden. Außerdem ist im Anfangsstadium die Wahrscheinlichkeit für (hohe) Strafen eher gering.
Die Behörden reagieren empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, dass dem Staat Steuern vorenthalten werden.
Wenn eine Konstellation jedoch bereits mehrere Jahre besteht, ohne dass sie entdeckt und angezeigt wurde, ist die denkbar schlechteste Strategie, hier einfach in gewohnter Form weiter zu machen. Durch die zunehmende Digitalisierung hat sich das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht. Der indische Staat hat großes Interesse an Auslandsinvestitionen und ist ein durchaus konstruktiver Gesprächspartner, wenn es darum geht Lösungen für internationale Unternehmen zu finden.
Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern
Hat man sich entschieden, in Indien tätig zu werden, erfolgt der erste Schritt häufig auf Basis der Zusammenarbeit mit einem indischen Handelsvertreter, der die Waren entweder für eigene Rechnung ein- und verkauft, oder – im Falle von Direktgeschäften – eine Provision kassiert. Man erhofft sich einen leichteren Marktzugang, den ja der Handelsvertreter bereits mitbringen soll, sowie einen geringeren Zeit- und Finanzaufwand während der Markteintrittsphase. Doch den Vorteilen dieser mit einem relativ geringen Aufwand verbundenen Form des Markteintritts stehen in der Praxis aber deutliche Nachteile gegenüber, die langfristig einem Geschäftserfolg in Indien hinderlich sein könnten:
Keine systematische Marktbearbeitung
„Inder“ zeichnen sich in der Regel durch ein überdurchschnittliches Maß an Talent und Begeisterung fürs Verkaufen aus. Die Händlermentalität ist Teil der indischen Kultur und gleichermaßen berühmt wie berüchtigt.
Was dem klassischen indischen Verkäufer aber meist nicht in die Wiege gelegt wurde, ist „systematisches Vorgehen“. Viele indische Händler bzw. Vertriebsmitarbeiter verhalten sich so, wie man es bei uns von den Vorurteilen über Versicherungsagenten kennt. Jemand steigt in das Geschäft neu ein, weil er sich dort gute Provisionen erwartet. Erst klappert er die eigene Verwandtschaft ab, dann seinen Freundeskreis bzw. seine „Community“ (persönliches Netzwerk) bis schließlich jeder Verwandte, Freund und Bekannte zu einem Kauf überredet werden konnte. Dann ist allerdings Schluss.
Marktdurchdringung und Ertragsentwicklung liegen bei Unternehmen mit eigenem Vertrieb in Indien deutlich höher.
So oder so ähnlich wird Vertrieb in Indien häufig gehandhabt und das zieht sich quer durch alle Branchen. Man verkauft nämlich in der Regel dorthin, wo es am einfachsten ist und auch am schnellsten geht. Aber man schaut leider nicht dorthin, wo tatsächlich das größte Potential besteht.
Es fehlt den indischen Vertrieblern tatsächlich oft an Methodik, wie zum Beispiel an einer Priorisierung von Marktsegmenten. Vielmehr wird der einfachere Weg bevorzugt. Und bevor man die Bereitschaft mitbringt, einen weiteren, aber gleichzeitig systematischen Weg zu gehen, wendet man sich lieber neuen Produkten zu und lässt das bestehende Geschäft nur noch nebenbei weiterlaufen.
Wenig/keinen Einfluss auf Vermarktungs-Strategie
Der Handelsvertreter ist derjenige, der den indischen Markt bearbeitet – und nicht das deutsche Unternehmen! Ob die Kommunikations- & Vertriebspolitik des Vertreters letztendlich auch der gewünschten Strategie des eigenen Unternehmens entspricht, ist meistens mehr als fraglich. Und dann fehlt auch noch jegliche Transparenz. Ob der Markt wirklich so ist, wie der Vertreter behauptet oder ob man tatsächlich zu teuer ist und übermäßige Rabatte oder Sonderkonditionen anbieten muss, sind nur einige der Fragen, die das europäische Unternehmen aus der Ferne kaum beantworten werden kann und schnell in die Abhängigkeit des Vertreters gerät.
Kein direkter Zugang zum Kunden
Langfristige Kunden-Beziehungen sind die Basis für nachhaltigen Geschäftserfolg. Beim Markteintritt über Handelsvertreter bleibt der deutsche Lieferant aber meist „außen vor“. Das heißt die eigentlich gewünschte Beziehung zum Markt kommt nicht direkt zustande und ist von der Kooperationsbereitschaft des indischen Vertreters abhängig.





























