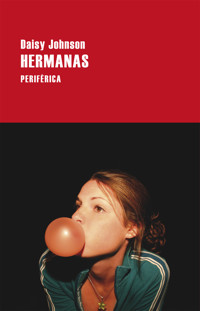9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die literarische Sensation aus England - jetzt erstmals auf Deutsch!
Sechzehn Jahre ist es her, dass sie ihre Mutter zuletzt gesehen hat. Die Hälfte ihres Lebens hat sie versucht, ihre Kindheit zu vergessen - die Zeit auf dem Fluss, auf einem Hausboot, frei und ungebunden. Die Jahre danach, als ihre Mutter plötzlich weg war und sie bei Pflegeeltern unterkam. Gretel hat nicht aufgegeben, bei Kliniken, Leichenhäusern und Polizeistationen nachgefragt. Dann bringt ein Anruf die beiden wieder zusammen. Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Während das Erinnerungsvermögen der Mutter zusehends schwindet, will die Tochter endlich verstehen. Warum wurde sie im Stich gelassen? Was ist damals geschehen, in jenem letzten Winter auf dem Fluss?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Die literarische Sensation aus England.
Sechzehn Jahre ist es her, dass sie ihre Mutter zuletzt gesehen hat. Die Hälfte ihres Lebens hat sie versucht, ihre Kindheit zu vergessen – die Zeit auf dem Fluss, auf einem Hausboot, frei und ungebunden. Die Jahre danach, als ihre Mutter plötzlich weg war und sie in Heimen unterkam. Gretel hat nicht aufgegeben, bei Kliniken, Leichenhäusern und Polizeistationen nachgefragt. Dann bringt ein Anruf die beiden wieder zusammen. Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Während das Erinnerungsvermögen der Mutter zusehends schwindet, will die Tochter endlich verstehen. Warum wurde sie im Stich gelassen? Was ist damals geschehen, in jenem letzten Winter auf dem Fluss?
»Dieses Buch berührt und verzaubert.« Celeste Ng
»Daisy Johnson ist eine Wahnsinnserzählerin!« Lauren Groff
»Eines jener Bücher, die einem noch lange in Erinnerung bleiben.« Observer
Zur Autorin
DAISY JOHNSON, 1990 geboren, war mit 27 Jahren die jüngste Finalistin des renommierten Man Booker Prize. Bereits für ihr Debüt »Fen« wurde sie mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Johnson gilt als eine der »faszinierendsten Stimmen ihrer Generation« (Entertainment Weekly). Der New Yorker nannte den Roman »bezaubernd schön«, die New York Times feierte seine »erzählerische Wucht«. Daisy Johnson lebt in Oxford am Ufer der Themse.
DAISY JOHNSON
UNTERTAUCHEN
Roman
Aus dem Englischen von Birgit Maria Pfaffinger
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Everything Under« bei Jonathan Cape, London.Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Oktober 2020Copyright © 2018 Daisy Johnson
Copyright © der deutschen Ausgabe 2020 btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Frauke Brodd
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Designs von © Suzanne Dean und einer Illustration von © Kustaa Saksi
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Klü · Herstellung: scAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-23523-9V002www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für meine Großmütter, Christine und Cedar
EINS Mitten im Nichts
DER ORT UNSERER GEBURT lässt uns nicht los. Er tarnt sich als Migräne, Bauchweh, Schlaflosigkeit. Er sorgt dafür, dass wir manchmal aus dem Schlaf schrecken, nach der Bettlampe tasten, in dem festen Glauben, dass alles, was wir erschaffen haben, über Nacht verloren gegangen ist. Wir werden zu Fremden für den Ort, an dem wir geboren sind. Er würde uns nicht wiedererkennen, aber wir ihn immer. Er steckt uns in den Knochen, ist tief in uns verankert. Und würde unser Innerstes nach außen gekehrt, wären Karten in unsere Haut geritzt. Damit wir den Weg zurück finden. Nur dass bei mir keine Kanäle, keine Gleise und kein Boot eingeritzt sind, sondern von jeher nur: du.
DAS COTTAGE Selbst jetzt weiß ich kaum, wo ich anfangen soll. Für dich ist Erinnerung nichts Lineares, sondern eine Abfolge wirbelnder Kreise, die näher kommen und sich entfernen. Manchmal bin ich kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Wärst du noch dieselbe Frau wie vor sechzehn Jahren, dann brächte ich es wahrscheinlich fertig, die Wahrheit aus dir herauszuprügeln. Jetzt geht das nicht mehr. Du bist zu alt. Die Erinnerungen blitzen auf wie zerbrochene Weingläser im Dunklen und verschwinden wieder.
Du baust immer weiter ab. Du vergisst, wo du deine Schuhe gelassen hast, obwohl du sie an den Füßen trägst. Fünf-, sechsmal am Tag schaust du mich an und fragst, wer ich bin, oder du willst, dass ich verschwinde. Du möchtest wissen, wie du hierhergekommen bist, zu mir nach Hause. Ich erzähle es dir immer wieder. Du vergisst, wie du heißt oder wo die Toilette ist. Also fange ich an, deine saubere Unterwäsche in der Schublade mit dem Besteck aufzubewahren. Mache ich den Kühlschrank auf, entdecke ich meinen Laptop, das Telefon, die Fernbedienung. Mitten in der Nacht rufst du nach mir, und wenn ich angerannt komme, fragst du, was ich hier verloren hätte. Du bist nicht Gretel, sagst du. Meine Tochter Gretel war wild und wunderschön. Du bist nicht sie.
An manchen Tagen weißt du morgens ganz genau, wer wir beide sind. Du kramst so viele Küchengeräte hervor, wie auf der Arbeitsplatte Platz finden, und bereitest ein Festtagsfrühstück zu, mit vier Knoblauchzehen in jedem Gericht und so viel Käse wie möglich. Du kommandierst mich in meiner eigenen Küche herum, sagst, ich soll abwaschen oder, Herrgott noch mal, die Fenster putzen. An diesen Tagen kommt der Verfall langsam. Du vergisst die Pfanne auf dem Herd oder lässt die Pfannkuchen anbrennen, das Spülbecken läuft über, ein Wort verfängt sich in deinem Mund, du zerhackst es in Einzelteile und versuchst vergeblich, es auszuspucken. Ich lasse dir ein Bad einlaufen, und wir gehen Hand in Hand nach oben. Das sind kleine Momente des Friedens, nahezu unerträglich.
Hätte ich dich wirklich gerne, dann würde ich dich zu deinem eigenen Besten in ein Heim bringen. Geblümte Vorhänge, täglich geregelte Essenszeiten, mehr von deiner Sorte. Alte Menschen sind eine Spezies für sich. Würde ich dich wirklich noch lieben, dann hätte ich dich gelassen, wo du warst, anstatt dich hierher zu verfrachten, wo die Tage so ereignislos sind, dass jedes Wort, das man über sie verliert, eigentlich eins zu viel ist, und wo wir unaufhörlich zutage fördern, freischaufeln, was besser begraben bliebe.
Gelegentlich schleichen sich bei uns die alten Wörter wieder ein, und sie machen alles ungeschehen. Es ist, als hätte sich nichts verändert, als wäre Zeit ohne Bedeutung. Wir sind wieder da, wo wir waren, ich bin dreizehn Jahre alt, und du bist meine furchtbare, wunderbare, entsetzliche Mutter. Wir leben in einem Hausboot auf dem Fluss und benutzen Wörter, die außer uns niemand kennt. Wir haben eine eigene Sprache. Du sagst, du kannst das Wasser dahinpimpern hören, ich erwidere, dass hier zwar kein Fluss in der Nähe ist, ich es aber manchmal auch höre. Du sagst, ich soll dich allein lassen, du brauchst etwas Uffzeit. Ich nenne dich eine Harpiedudel, und du wirst wütend oder lachst so sehr, dass dir die Tränen kommen.
Eines Nachts wache ich auf, und du schreist und schreist. Ich schlittere durch den Flur, stoße deine Zimmertür auf, schalte das Licht ein. Du sitzt mit offenem Mund auf dem schmalen Gästebett, die Decke bis ans Kinn gezogen, und weinst.
Was ist los? Was hast du?
Du schaust mich an. Der Bonak ist hier, sagst du, und einen Moment lang – weil es mitten in der Nacht ist und ich gerade erst aufgewacht bin – spüre ich, wie Panik in mir aufsteigt. Mir wird ganz schlecht vor Angst. Ich schüttele sie ab. Mache den Kleiderschrank auf und zeige dir, dass er leer ist; helfe dir aus dem Bett, damit wir gemeinsam in die Hocke gehen und darunter nachsehen können. Dann stehen wir am Fenster und blicken ins Schwarze hinaus.
Hier ist nichts. Schlaf jetzt.
Er ist hier, sagst du. Der Bonak ist hier.
Die meiste Zeit sitzt du mit versteinerter Miene im Sessel und siehst mich an. Du hast einen schlimmen Ausschlag an den Händen, der früher nicht da war, und kratzt dich mit gebleckten Zähnen. Ich versuche, es dir gemütlich zu machen, aber du – und das fällt mir jetzt wieder ein – magst nicht, dass man dir hilft. Du willst den Tee nicht, den ich dir bringe, weigerst dich zu essen, trinkst kaum. Wenn ich mit Kissen komme, scheuchst du mich weg. Hör auf, du gehst mir auf die Nerven, lass mich in Ruhe. Und das tue ich dann auch. Ich setze mich an den kleinen Holztisch gegenüber von deinem Sessel und höre dir zu. Du besitzt eine aggressive Ausdauer, die uns fast ohne Unterbrechung durch ganze Nächte trägt. Manchmal sagst du, ich gehe aufs Klo, erhebst dich aus deinem Sessel wie eine Trauernde von einem Grab und streichst dir unsichtbaren Staub von der Hose, die ich dir geliehen habe. Ich gehe jetzt, sagst du, und schreitest würdevoll zur Treppe, dann drehst du dich um und funkelst mich an, wie um mir zu sagen, dass ich nicht ohne dich weitermachen soll, dass es nicht meine Geschichte ist und dass ich warten muss, bis du wieder da bist. Auf halbem Weg nach oben erklärst du mir, dass man zu seinen Fehlern stehen, mit ihnen leben muss. Ich schlage eins der Notizbücher auf, die ich gekauft habe, und schreibe alles nieder, woran ich mich erinnere. Auf dem Papier sind deine Worte beinahe friedlich, irgendwie entschärft.
Ich habe über die Spur unserer Erinnerungen nachgedacht, darüber, ob sie gleich bleibt oder sich verändert, wenn wir sie im Lauf der Zeit überschreiben. Ob Erinnerungen robust sind wie Häuser und Klippen oder ob sie schnell verfallen, ersetzt und überlagert werden. Alles, woran wir uns erinnern, ist überliefert, überarbeitet, es ist nie so, wie es sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Das belastet und beunruhigt mich. Ich werde nie wissen, was wirklich passiert ist.
Wenn es dir gut genug geht, nehme ich dich mit hinaus auf die Felder. Früher gab es hier Schafe, jetzt wächst da nur noch Gras, das so dünn ist, dass der Kalkboden durchscheint, klumpige Hügel, die sich aus den Vertiefungen erheben, ein schmaler Bach, der aus dem Dreck herausquillt und sich den Hang hinabschlängelt. Alle paar Tage erkläre ich Spazierengehen zum Allheilmittel, und wir marschieren auf den Hügel, bleiben oben schwitzend und schnaufend stehen und gehen dann schräg hinunter zum Bach. Erst dann hörst du auf, dich zu beschweren. Du hockst dich neben das Wasser und streckst die Hände in die kalte Strömung, bis du den steinigen Grund berührst. Menschen, die am Wasser aufwachsen, erklärst du mir eines Tages, sind anders als andere Menschen.
Wie meinst du das?, frage ich. Doch du antwortest nicht oder hast längst vergessen, dass du überhaupt etwas gesagt hast. Dennoch begleitet mich der Gedanke durch die stille Nacht. Dass unsere Umgebung uns definiert, dass Hügel und Flüsse und Bäume unser Leben bestimmen.
Deine Laune schlägt um. Du spielst die Beleidigte, und als es dunkel wird, rumpelst du auf der Suche nach etwas Stärkerem als Wasser durchs Haus. Wo ist sie?, schreist du. Wo ist die Flasche? Ich sage dir nicht, dass ich alle Schränke geleert habe, als ich dich am Fluss fand und hierherbrachte, und du nun ohne Alkohol auskommen musst. Du lässt dich in den Sessel fallen und starrst finster vor dich hin. Ich mache dir einen Toast, den du vom Teller fegst. In einer Schublade finde ich ein Kartenspiel, und du schaust mich an, als sei ich verrückt.
Ich weiß es doch auch nicht, sage ich. Was willst du?
Du stehst auf und deutest auf den Sessel. Ich kann erkennen, dass deine Arme vor Erschöpfung oder Wut zittern. Es kann ja wohl verdammt noch mal nicht sein, dass immer nur ich dran bin, sagst du. Ich habe dir genug erzählt. Genug von dem Zeug. Den ganzen Mist über mich. Du bohrst deine abgespreizten Finger in den Sessel. Jetzt bist du an der Reihe.
Na gut. Was willst du wissen? Ich setze mich. Der Sessel ist immer noch warm von dir. Du drückst dich an der Wand herum und nestelst an den Ärmeln der Wachsjacke, die du neuerdings immer im Haus trägst.
Erzähl mir, wie du mich gefunden hast.
Ich lege den Kopf zurück und presse meine Hände so fest gegeneinander, dass ich das Blut in meinen Adern pulsieren spüre. Es ist beinahe eine Erleichterung, dass du fragst.
Das hier ist deine Geschichte – mit ein paar Lügen, ein paar Ausschmückungen –, und die Geschichte des Mannes, der nicht mein Vater war. Und es ist die Geschichte von Marcus, der eigentlich Margot war – auch das Berichte aus zweiter Hand, Vermutungen. Und letztendlich ist diese Geschichte auch – und das ist das Allerschlimmste – meine Geschichte.
Zumindest auf den Anfang erhebe ich Anspruch, also darauf, wie ich dich vor einem Monat gefunden habe.
DIE JAGD Es war sechzehn Jahre her, dass ich dich das letzte Mal gesehen hatte, damals, beim Einsteigen in diesen Bus. Zu Beginn des Sommers füllten sich die Mulden in dem Weg, der zum Cottage hinaufführte, mit Froschlaich, doch mittlerweile war der August schon halb vorbei, und in den Löchern wuchs nicht mehr viel heran. In einem anderen Leben war dieser Ort ein Hausboot.
Im August waren die Wände immer feucht, und die plötzlichen Böen, die von den Hügeln fegten, brachten Vogelnester, Eierschalenscherben und Eulengewölle im Kamin zum Vorschein. Der Boden der winzigen Küche war so schief, dass ein Ball glatt von einer Seite zur anderen rollen würde. Keine Tür schloss richtig. Ich war zweiunddreißig und wohnte seit sieben Jahren dort. In Australien sagten die Leute, sie lebten mitten im Nichts. In Amerika war man dann ab vom Schuss oder wohnte in der Einöde. Die Botschaft dahinter war immer dieselbe: Ihr sollt mich nicht finden. Mir war klar, dass ich diesen Zug von dir geerbt habe. Mir war klar, dass du dich so tief einbuddeln wolltest, damit nicht einmal ich dich ans Tageslicht befördern könnte. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mit dem Bus brauchte ich eineinhalb Stunden nach Oxford, wo ich arbeitete. Bis auf den Postboten wusste niemand, dass ich hier war. Ich schützte meine Einsamkeit. Ich räumte ihr Platz ein, so wie andere Leute das für Religion oder Politik tun, denen ich aber nun mal nichts zu verdanken hatte.
Meinen Lebensunterhalt verdiente ich damit, Wörterbucheinträge zu überarbeiten. Die ganze Woche hatte ich an dem Verb break gearbeitet. Verteilt über den ganzen Tisch, und sogar auf dem Boden, lagen Karteikarten herum. Brechen war ein schwieriges Wort und wehrte sich gegen eine einfache Definition. Solche Wörter mochte ich am liebsten. Sie waren wie Ohrwürmer, Lieder, die einem nicht mehr aus dem Kopf gingen. Oft ertappte ich mich dabei, dass ich sie in Sätze einbaute, in denen sie nichts zu suchen hatten. Einen Code knacken. Einen neuen Rekord aufstellen. Jemandem das Wort abschneiden. Ich arbeitete mich durch das Alphabet vor, und wenn ich am Ende angekommen war, hatte es sich verändert und sogar ein Stück weit verschoben. Mit den Erinnerungen an dich verhielt es sich genauso. Als ich noch jünger war, ging ich sie immer wieder durch, weil ich ihnen unbedingt winzige Details, bestimmte Farben oder Klänge entreißen wollte. Aber jedes Mal, wenn ich zu einer zurückkehrte, hatte sie sich schon wieder ein bisschen verändert, und mir wurde klar, dass ich nicht mehr zwischen dem unterscheiden konnte, was ich mir ausgedacht hatte, und dem, was wirklich vorgefallen war. Von da an hörte ich auf, mich zu erinnern und versuchte stattdessen zu vergessen. Das hatte ich schon immer besser gekonnt.
Alle paar Monate rief ich Kliniken, Leichenhäuser und Polizeistationen an und fragte, ob irgendwer dich gesehen hätte. Im Lauf der letzten sechzehn Jahre war zweimal die Möglichkeit aufgeflackert: eine Razzia bei einer Hausbootgemeinschaft, der eine Frau angehörte, auf die meine Beschreibung zutraf; ein paar Kinder, die behaupteten, sie hätten im Wald eine Leiche entdeckt, was sich allerdings als Lüge erwies. Ich sah dich nicht mehr in den Gesichtern fremder Frauen auf der Straße, doch die Anrufe bei den Leichenhäusern waren mir zur Gewohnheit geworden. Manchmal kam mir der Gedanke, ich machte nur weiter, weil ich sicherstellen wollte, dass du nicht zurückkommst.
An jenem Morgen war ich im Büro. Die Klimaanlage war so kalt eingestellt, dass alle Pullover, Schals und fingerlose Handschuhe trugen. Wir Lexikografen sind ein eigener Menschenschlag. Beherrscht, bedächtig, wählerisch in dem, was wir sagen. Als ich am Schreibtisch saß und Karteikarten mischte, fiel mir auf, dass ich seit beinahe fünf Monaten nicht nach dir gesucht hatte. Die längste Pause seit geraumer Zeit. Ich ging mit dem Handy auf die Toilette und rief die altbekannten Orte an. Ich hatte deine Beschreibung angepasst, um der vergangenen Zeit Rechnung zu tragen. Eine weiße Frau, Mitte sechzig, dunkles bis graues Haar, eins fünfundfünfzig groß, fünfundsiebzig Kilo, ein Muttermal auf der linken Schulter, eine Tätowierung am Knöchel.
Ich habe mich schon gefragt, sagte jemand im letzten Leichenhaus auf meiner Liste, ob dieser Anruf kommen würde.
Du hattest immer stark, ewig, unvergänglich gewirkt. Ich machte früher Feierabend. Weil an den Verkehrskreiseln Bauarbeiten durchgeführt wurden, brauchte der Bus länger als sonst durch die Stadt. Ich hatte dir nie besonders ähnlich gesehen, aber als ich mein Spiegelbild in der schmutzigen Fensterscheibe betrachtete, entdeckte ich dich aus bestimmten Blickwinkeln in meinem Gesicht. Ich umklammerte mit beiden Händen die Rückenlehne des Vordersitzes. Am Abend würde ich packen, mir ein Auto mieten und das Wasser abstellen. Am Morgen würde ich losfahren, um deine Leiche zu identifizieren.
Als ich zu Hause ankam, war es dunkel. Ich wollte das Licht in der Küche einschalten und ertappte mich dabei, dass ich – wie schon so lange nicht mehr – Angst vor deinem plötzlichen Auftauchen hatte. Ich drehte das Wasser auf und ließ es mir so lange über die Hände laufen, bis es dampfte. Du bist damals schon kleiner gewesen als ich, mit breiten Hüften und so kleinen Füßen, dass du manchmal im Scherz gesagt hast, man habe sie dir als Kind eingebunden. Du hast dir nie das Haar geschnitten, das lang, dunkel und oben kraus war. Ab und an hast du es von mir flechten lassen. Gretel, Gretel, was für flinke Finger du hast. Dann hast du gelacht. Daran hatte ich lange nicht gedacht. Wie es sich anfühlte, dein Haar zu berühren. Kannst du mir einen Meerjungfrauenzopf machen? Nein, nicht so, versuch es noch mal. Einmal noch.
Ich versuchte, zu Hause weiterzuarbeiten. Break. Brechen. In Stücke teilen. Funktionsuntüchtig werden oder machen. Am Morgen würde ich dich im Leichenhaus endlich wiedersehen. Das Wort Dread konnte sowohl Angst bedeuten als auch das plötzliche Aufflattern eines Vogelschwarms. Jetzt stieg die Vogelschar in meinem Hals auf und strömte durch meinen rissigen Rachen nach draußen. Ich brach meine eigene Regel. Eingeklemmt zwischen Kühlschrank und der Wand steckte eine Flasche Gin. Mit Mühe zog ich sie heraus. Goss mir einen Dreifachen ein. Erhob das Glas auf dich. In meinem Kopf hörte ich deine Stimme, die redete und redete. Die Worte konnte ich nicht ausmachen, nur dass sie aus deinem Mund stammten; die Sätze hatten deine Betonung, die Wörter waren schlicht und hart. Ich presste die Zähne gegen den Rand des Glases. Ich machte die Augen zu. Da war ein lautes Geräusch, und ich spürte einen Lufthauch im Gesicht. Als ich wieder hinsah, stehst du in der niedrigen Tür, die auf den Hof hinausführt. Du trägst das alte orangefarbene Kleid, das an der Hüfte so eng gerafft ist, dass deine Beine unten herausklaffen. Als du mir die Hände entgegenstreckst, sind sie voller Schlamm. Der Fluss ist mit deiner linken Schulter verbunden und dehnt sich hinter dir aus. Er ist wie damals, als wir dort gelebt haben: zähflüssig, beinahe undurchsichtig. Nur dass ich hier, auf den Küchenfliesen, die Schatten tauchender, schwimmender Geschöpfe gut erkennen konnte. Ich ließ das Wasser wieder laufen und hielt die Hände unter den heißen Strahl. Als ich mich umdrehte, hast du dich näher herangeschlichen, Unkraut umschlingt dein zu beiden Seiten schwer herabhängendes Haar, dein Geruch nach altem Zigarettenrauch erfüllt die Küche. Ich konnte fühlen, wie du mein Leben begutachtest. Selbst in meiner Fantasie warst du rechthaberisch, kritisch. Du schälst ein Ei, pellst die Haut von der glatten weißen Kugel. Du jagst mich mit dem Schlauch, bis der Boden so matschig ist, dass wir stürzen, schmutzverkrustet daliegen wie Knollen, die gerade erst das Licht der Welt erblicken. Du starrst mich aus dem dunklen Schlund der Küche an, während hinter dir der Fluss rauscht. Was machst du?, sagst du. Hier bist du also gelandet? Pimperst einfach vor dich hin?
Ich schlüpfte in meine Stiefel und einen Mantel, setzte mir eine Mütze auf und rannte so schnell hinaus, dass ich es gerade noch schaffte, die Tür hinter mir zuzuziehen. Eine Schorfschicht aus Lichtverschmutzung, dazu ein Mondsplitter. Ich ging so schnell, dass ich nach einer Weile keuchend anhalten musste. Als ich mich umdrehte, war da ein einzelnes Quadrat aus Licht, das aus dem Küchenfenster des Cottage kam. Ein gelbes Loch im Hügel. Ich wusste nicht mehr, ob tatsächlich ich es angelassen hatte.
Mir war schon immer klar gewesen, dass die Vergangenheit nicht einfach stirbt, bloß weil wir es uns wünschen. Die Vergangenheit schickt uns Zeichen: das Knarren und Knarzen in der Nacht, falsch geschriebene Wörter, der Jargon der Werbeanzeigen, die Körper, zu denen wir uns hingezogen fühlen oder auch nicht, die Geräusche, die uns an dieses und jenes erinnern. Die Vergangenheit ist kein Faden, den wir hinter uns herziehen, sondern ein Anker. Darum habe ich all die Jahre nach dir gesucht, Sarah. Nicht, weil ich Antworten oder Beileid wollte; nicht, um dich mit Schuld zu überhäufen oder zu Fall zu bringen. Sondern weil du – vor langer Zeit – meine Mutter warst und fortgegangen bist.
DIE JAGD Der Mietwagen war rot, und das Krankenhaus schien hauptsächlich aus einem langen Korridor zu bestehen. Ich passierte die Eingänge zu Gynäkologie, Pulmologie, zur Privatstation. Es roch nach in der Mitarbeitermikrowelle aufgewärmter Suppe, verbranntem Toast, Bleichmittel. Die Pathologie befand sich drei Stockwerke tiefer. Ich drückte mich vor der Tür herum. Es gab ein Schwarzes Brett mit Anzeigen für Gassigeher, einen zu verschenkenden Hamster und ein neues Fahrrad für nur hundert Pfund. Die Klimaanlage war kaputt, und wann immer jemand aufstand, hinterließ er einen Schweißfleck auf dem Stuhl. Sanitäter kamen mit fahrbaren Krankenliegen, mit Stöpseln in den Ohren oder am Handy telefonierend vorbei. An Gesichter und Körper konnte ich mich kaum erinnern. Ich dachte an Wörter, die du oft verwendet hast: Fusel, Radiator, Glibber. Wie hast du gerochen? Ich schnupperte an meinem Handgelenk. Auf deine Zeit und deinen Freiraum hast du eifersüchtig und egoistisch geachtet. Selbst nach sechzehn Jahren ohne dich, selbst kurz bevor ich deine Leiche sehen würde, war ich immer noch bemüht, dir nicht auf die Zehen zu treten. Als ein Sanitäter ein Bett durch die Schwingtür schob, ging sie so weit auf, dass ich ein Dreieck des dahinterliegenden Zimmers erkennen konnte, den grellen Schein von Leuchtstoffröhren.
Im Lauf der Jahre hatte ich schon mehrmals mit dem Pathologieassistenten gesprochen. Pausen und Fragezeichen am Ende von Aussagen fragmentierten seine Sätze. Er war kahl, seine Glatze glänzte. Er sagte, mein Aussehen passe zum Klang meiner Stimme. Ich wusste nicht genau, was er damit meinte. Ich sah dir nicht besonders ähnlich. Du warst von einer kantigen Schönheit, die jeden einschüchterte, der deine Bekanntschaft machte. An der Wandtafel hingen ausgeschnittene Bilder von Kaktussen. Als er sah, dass ich sie betrachtete, zuckte er mit den Schultern.
Sie haben was, finden Sie nicht? Sie brauchen niemanden. Sie speichern Wasser in ihrem Inneren.
Ich war mir nicht sicher, wie ich in das Zimmer gekommen war. In die Wände waren Metalltüren eingelassen, und im Hintergrund spielte das Radio leise ein Lied, das ich nicht kannte. Er machte eine der Türen auf und zog eine Lade heraus. Du warst mit einem blauen Tuch bedeckt. Alle Luft war weg. Unter dem Stoff zeichneten sich Umrisse ab: eine Nase, ein Hüftknochen. Die Füße, die an einem Ende hervorragten, wirkten wie aus Wachs. An einer Zehe hing ein Etikett, an einer anderen eine Glocke.
Wofür ist die?, fragte ich.
Er strich sich über den kahlen Schädel. Seine Hände waren ausgesprochen gepflegt, aber in dem einen Winkel seines schmalen Mundes hing ein Essensrest. Eigentlich ist sie unnötig, sagte er, nichts weiter als eine Marotte. Aber bevor es Herzüberwachungsgeräte gab, hat man so sichergestellt, dass die Toten auch wirklich tot sind. Ich bewahre ein Stück Tradition.
So viel zum Thema Taphophobie, sagte ich, und er schaute mich an, wie die Leute mich manchmal anschauen, wenn ich wie ein Lexikon rede. Ich wollte ihm von all den schönen Wörtern erzählen, die mir auf der Hinfahrt durch den Kopf gegangen waren und mit denen wir die Orte benennen, an denen wir unsere Toten aufbewahren: Beinhaus, Ossarium, Sepulcrum.
Soll ich rückwärts zählen? Drei, zwei, eins?, fragte er. Manche Leute wollen das.
Nein.
Er zog das blaue Tuch zurück, bis knapp unter die Schultern. Ich spürte einen Schmerz im Magen, am Haaransatz, einen plötzlichen Kälteschock. Das warst du. Und kurz darauf bemerkte ich meinen Irrtum. Ihr Haar hatte – das stimmte wohl – dieselbe Farbe wie deines, und die Falten um ihre Augen und ihren Mund erinnerten an dich, ebenso die Form ihrer Stirn. Aber sie besaß weder deine breite Nase – die schief war, seit du sie dir vor meiner Geburt gebrochen hattest –, noch hatte das Muttermal auf der Schulter dieselbe Farbe wie deines, dieses fast schon gefährlich nach Krebs aussehende, dunkle Lila.
Sind Sie sicher? Er klang enttäuscht. Wahrscheinlich gab es in der Pathologie genauso viele verloren gegangene Leichen wie früher im Kanal, wo sie in der Trockenzeit aufgedunsen an die Oberfläche stiegen. Er lüpfte das untere Ende des Tuchs, um mir die Tätowierung zu zeigen, doch sie war frisch und dort, wo die Nadel eingedrungen war, noch ein bisschen entzündet: ein seitlich verrutschter Stern, die Umrisse eines nicht zu erkennenden Landes. Ich war mir nie sicher gewesen, was dein Tattoo darstellen sollte, und du hast dich geweigert, es mir zu sagen. Auch Mütter brauchen Geheimnisse.
Ja, klar, sagte ich.
Auf dem Rückweg hielt ich an, um zu tanken, und setzte mich dann auf eine Picknickbank aus Holz, die neben den Zeitungen und der Grillkohle stand. Alles schien falsch justiert: das Metall der Autotüren, das sich flirrend gegen den heißen Luftstrom vom Motorway abhob. Ich hatte einen säuerlichen, ungewaschenen Geschmack im Mund. Ich fühlte mich, als hätte man mir die Haut von den Händen und Wangen geschabt. Ich war erschöpft, als wäre dieser Augenblick schon zehnmal in meinem Leben passiert, als könnte ich nirgendwo anders enden als dort: in der Hitze an einer Tankstelle, nachdem ich eine Leiche gesehen hatte, die nicht deine war. Es war ein Fehler, hinter dir herzutelefonieren. In den Köpfen der Leute gab es Kurbeln und Wählscheiben, die man besser in Ruhe ließ. Ich holte die Karte aus dem Handschuhfach. Einige Straßenschilder waren mir bekannt vorgekommen (geschriebene Wörter kann ich mir gut merken), und als ich nachsah, fand ich heraus, dass ich mich in der Nähe der Stallungen befand. Ich hatte geglaubt, ich sei Stunden davon entfernt, eine Tagesreise. Aber es war nicht weit, höchstens eine Stunde. Es verunsicherte mich, dass ich die ganze Zeit in der Nähe dieses Ortes gewesen war. Ich kaufte mir einen Schokoriegel und setzte mich ins Auto, um zu überlegen, was ich tun sollte. Die Schokolade schmolz, noch bevor ich die Verpackung aufmachen konnte. Nach Hause zu fahren erschien mir unmöglich – jetzt, da das blaue Tuch wieder über dieses Gesicht gezogen war.
In einer engen Kurve rammte ich fast etwas, das über die Straße gesaust kam, knapp über dem Boden, ein Farbstreifen. Ich stieg voll auf die Bremse, biss mir auf die Zunge, schrie. Überzeugt, dass ich etwas überfahren hatte. Was auch immer es war. Ich stieg aus. Es war heiß. Viel zu heiß für all das. Ich ging in die Hocke, um unter dem Auto nachzusehen. Als ich mich aufrichtete, kam eine Frau in einem lilafarbenen Regenmantel auf mich zugerannt.
Haben Sie meinen Hund überfahren? Ihre rechte Gesichtshälfte hing schlaff herunter – vielleicht von einem Schlaganfall –, und sie sprach undeutlich. Ich wollte weiter, aber sie hielt mich am Arm fest. Haben Sie meinen Hund überfahren?
Ich weiß es nicht, sagte ich.
Trotz der Hitze war der Reißverschluss ihres Regenmantels bis unters Kinn hochgezogen. Wir schauten gemeinsam unter dem Auto nach, ob der Hund dort war, und anschließend in den Büschen zu beiden Seiten der Straße. Sie rief ihn nicht beim Namen, sondern pfiff nur mickrig und erfolglos nach ihm.
Er darf nichts fressen, erklärte sie, er muss eine strenge Diät halten. Wir müssen ihn finden, bevor er etwas frisst. Immer reißt er aus. Sie redete mit mir, als wären wir alte Freundinnen. Schon als Welpe war er ein Ausreißer.
Ein Auto kam um die Kurve und krachte beinahe gegen meines, das mitten auf der Straße stand.
Ich sehe ihn nirgends. Kann ich Sie irgendwohin fahren?
Doch sie war schon weg, kämpfte sich durch die dichte Hecke und den dahinterliegenden Graben. Mir lagen die Wörter für das Sammeln der Toten im Mund. Ich erwartete immer noch, dich irgendwo zu finden. Verschrumpelt, kalt und mit in verschiedene Richtungen zeigenden Füßen.
Eine steile, mit Schlaglöchern übersäte Straße führte hinab zu den Stallungen, zu einem mit einem Doppelbalken versehenen Tor, über das zwei Mädchen in engen Hosen kletterten, und einem Parkplatz weiter hinten. Das hier war der letzte Ort, an dem ich mit dir gelebt hatte, das letzte Zimmer, das ich mit dir geteilt hatte. Weißt du noch, wie die Mädchen, die an den Wochenenden dort arbeiteten, ihre halb leeren Cola-Flaschen an der Wand aufgereiht und die Köpfe zusammengesteckt haben? Wie wir ein paar der Mädchen nie auseinanderhalten konnten? Viele von ihnen hatten einen seltsam aufgebracht klingenden Essex-Akzent, den ich nicht richtig verstand, und zogen die Wörter mit zusätzlichen Os und Us in die Länge.
Erst schaute ich mich um, ohne mich bemerkbar zu machen. Auf dem Platz war gerade eine Reitstunde im Gange. Vier Kinder auf fetten Ponys. Die Lehrerin, die zu unserer Zeit hier unterrichtet hatte, war groß gewachsen gewesen und hatte geglättetes braunes Haar und lackierte Nägel gehabt. Eine Stimme wie ein Nebelhorn, aber zerbrechlich, oft mit Gipsverband in einer Schlinge um den Hals. Sie war nicht mehr da.
Ich schlich am Reitplatz vorbei. Ein paar der Stufen, die in unser ehemaliges Zimmer führten, waren kaputt. Ich erinnerte mich an diesen schmalen Gang zwischen Reitplatz und Stallgebäude, denn ich hatte oft auf der Treppe gesessen und auf deine Rückkehr gewartet, bei der du dann über den unebenen Boden gestolpert bist und fluchend an der Wand Halt gesucht hast. Mal ehrlich, ich muss doch gewusst haben, dass du fortgehen würdest, muss doch immer damit gerechnet haben, dass du nicht nach Hause kommst. Du bist wegen mir aufgeblieben? Wie lieb, hast du gesagt, doch dein Gesichtsausdruck verriet etwas anderes und überdeckte die Worte wie ein Baugerüst.
Ich ging zurück zum Parkplatz. Die Stunde war zu Ende, und die Lehrerin kam und fragte, ob ich ein Kind hätte oder selbst Unterricht nehmen wolle. Vierzehn Pfund die Stunde. Für mich mehr. Ich erklärte ihr, dass ich als Teenager hier gewohnt hätte, doch sie sah mich nur ausdruckslos an und suchte hinter meinem Rücken nach einer Fluchtmöglichkeit.
Wir hatten das Zimmer da oben gemietet.
Sie zuckte mit den Schultern. Das machen die nicht mehr.
Außerdem möchte ich meiner Nichte Reitstunden schenken, sagte ich. Kann ich mich noch ein bisschen auf dem Hof umsehen?
Ich ging nach hinten und hoch zu den Weiden. Ein Stück weiter oben machte sich eine Frau in gebückter Haltung am Boden zu schaffen. Ich schlüpfte unter dem Elektrozaun durch und näherte mich ihr. Sie hob scharfkantige Steine auf und warf sie aus der Wiese hinaus.
Suchen Sie was? Sie wischte sich die Hand an der Hose ab. Um den Hals trug sie ein kleines Silberkreuz, das bei jeder Bewegung nach vorne baumelte. Sie war älter als die Reitlehrerin, und ihr orangefarbenes Haar war am Ansatz herausgewachsen. Ich zeigte ihr ein Foto von dir.
Ich suche diese Frau, sie hat ein paar Jahre lang hier gewohnt. In dem Zimmer oberhalb der Reitanlage.
Sie wischte sich zum zweiten Mal die Hände ab. Nahm das Bild. Warf einen Blick darauf. Kann sein. Sie gab es mir zurück, schürzte die Lippen. Ich bin mir nicht sicher.
Können Sie es sich noch mal ansehen?
Oberhalb der Reitanlage?
In dem Zimmer, zur Miete. Sie hat die Ställe ausgemistet. Sie hatte ein Mädchen dabei. Ihre Tochter. Dürfte um die dreizehn gewesen sein, als sie hier ankamen. Ging nicht zur Schule. Lungerte meistens hier herum.
Doch.
Was?
Ja. Sie blickte zu den hässlichen Gebäuden hinunter, der rechteckigen Reithalle und den klobigen Stallungen. Ich erinnere mich an sie. An beide. Warum fragen Sie?
Ich bin ihre Nichte. Sie hatte schon lange keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Sie hat Geld geerbt. Ich muss sie finden.
Die Frau hob kurz ihr kantiges, schmutziges Kinn Richtung Küchencontainer, und wir gingen den Hügel hinunter. Sie lehnte sich gegen die Theke und wartete, dass das Wasser kochte. Ich lauschte ihren Erinnerungen an dich und das Mädchen, von dem sie nicht wusste, dass ich es war. In der Spüle standen mit grünem Schimmel gefüllte Tassen. Auf dem Sofa las eine Jugendliche eine Zeitschrift und trank einen Energy Drink. Einiges von dem, was die Frau mir erzählte, wusste ich nicht mehr, obwohl ich gedacht hatte, mich an alles aus dieser Zeit erinnern zu können. Die laute Musik aus dem Zimmer oberhalb der Reitanlage, dass du manchmal Reitstunden gegeben oder den Pferdetransporter zu Wettbewerben gefahren hast. Ich war verunsichert. Sogar die Geschichte, von der ich glaubte, ich hätte sie behalten, war falsch. Ich schlug mit der Faust auf die Theke.
Als das Wasser kochte, goss sie uns einen Instantkaffee auf. Wir haben keinen Zucker, aber es sind noch Pop-Tarts da.
Danke. Haben Sie sie später noch mal gesehen?, fragte ich und drückte beim Trinken den Rand der Tasse gegen meine Zähne. Nachdem sie weggegangen ist? Ist sie noch mal wiedergekommen? Mein Puls hämmerte in den Schläfen.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht?
Der Blick, mit dem sie mich ansah, verriet mir, dass meine Stimme zu laut war. Das Mädchen auf dem Sofa ließ das Magazin sinken und starrte mich an.
Leute kommen und gehen. Zeigen Sie mir das Foto noch mal. Sie hielt es zwischen Daumen und Zeigefinger, vorsichtig, um die Ränder nicht abzuknicken. Melanie?, sagte sie zu dem Mädchen. Musst du nicht ausmisten?
Ich bin schon fertig, erwiderte Melanie.
Erzähl keine Märchen.
Sie wartete, bis das Mädchen weg war, dann gab sie mir das Foto zurück. Vor ein paar Jahren war da eine Frau. Aber ich bin mir nicht sicher. Sie schüttelte den Kopf.
Reden Sie weiter, forderte ich sie auf.
Ich weiß nicht. Sie könnte es gewesen sein. Sie trieb sich ein paar Stunden auf dem Hof herum, ohne dass jemand von ihr Notiz nahm. Ich sah sie während meiner Mittagspause. Sie war auf die Weide hinausspaziert, auf der wir gerade noch zu tun hatten. Als ich sie ansprach, war sie nicht ganz richtig.
Wie meinen Sie das?
Sie neigte den Kopf, als wollte sie lieber nichts dazu sagen. Na ja, meiner Meinung nach hatte sie nicht alle beieinander. Sie ließ Wörter weg und schien nicht zu wissen, wo sie war oder was sie hier wollte. Hier in der Nähe gibt es ein Altersheim, und ich dachte, sie stamme vielleicht von dort, also rief ich die Polizei. Aber bis die hier ankam, war es schon dunkel, und die Frau war weg. Und als ich im Heim anrief, wurde niemand vermisst. Vielleicht war sie es auch gar nicht. Leute verschwinden. Sie sah mich an. Leute kommen und gehen. Vielleicht war es gar nicht die Frau, die Sie suchen.
Als ich wieder auf der Straße war und fort von den Stallungen fuhr, sah ich den Hund. Auf dem Seitenstreifen. Nicht sehr süß, eher ein ziemlicher Köter, mit seltsamen Proportionen und kahlen Stellen. Fast hätte ich nicht angehalten, und als ich es doch tat, hatten wir eine Meinungsverschiedenheit. Der Hund wahrte Abstand zu mir, lief hektisch hin und her und zeigte mir sein weißes Zahnfleisch. Als ich ihn endlich ins Auto verfrachtet hatte, wirkte er plötzlich ganz zufrieden. Ich beobachtete ihn im Rückspiegel, er hockte aufrecht auf dem mittleren Sitz und erwiderte meinen Blick. Ich mag keine Tiere, sagst du in meinem Kopf. So laut, als säßest du auf dem Beifahrersitz. Bring das Vieh dahin zurück, wo du es gefunden hast.
Ich mag Hunde auch nicht besonders, erklärte ich ihm, und er schloss die Augen, als hätte er schon jetzt genug von dem Gespräch.
Ich fuhr die Straße auf und ab und suchte nach seiner Besitzerin, fand jedoch keine Spur von ihr, und in keinem der Häuser kam jemand an die Tür. Eigentlich sollte ich auf dem Rückweg sein. Eigentlich sollte ich schon zu Hause sein und am nächsten Tag im Büro auftauchen.
Ich fuhr weiter, bis ich auf eine Fernstraße kam. Der Hund stieß ein kehliges Geräusch aus, das klang, als hätte er etwas gesagt, dass ich fast eine Vollbremsung hinlegte. Er lief unruhig auf der Rückbank hin und her, hob das Bein und senkte es wieder. Ich nahm die nächste Ausfahrt. Lichter von Little Chef, Burger King, Subway. Der Hund pinkelte auf den Parkplatz der Travelodge. Ich war so hungrig, dass ich mir Pommes kaufte und sie ans Auto gelehnt aß. Eine Geschichte fiel mir ein, über ein Mädchen, das in seinem Happy Meal eine Eidechse gefunden hatte. Frittiert. Die Art von Geschichte, die ich früher dir erzählt hätte, um dich zum Lachen zu bringen. Ich beobachtete ein Pärchen, das sich vor dem Eingang der Travelodge stritt, mit verzerrten Mündern und ausladenden Gesten. Dann folgte ich ihnen nach drinnen und fragte nach dem Preis für ein Zimmer. Fünfundzwanzig Pfund, kein Frühstück, aber ein Automat am Ende des Flurs. Ich fand mich in dem Zimmer wieder, bevor ich überlegen konnte, was ich da eigentlich tat. Benzingeruch durchs Fenster. Das schwarz-gelbe Dreiecksmuster des Teppichs. Fremde Haare im Ausguss des Waschbeckens.
Ein Wesen paddelte durch die sommerheiße Luft, kroch über die Flure, grub sich seinen Weg unter der Tür hindurch in mein Zimmer und unter die Bettdecke, legte den Kopf auf mein Kissen. Ich kniff die Augen fest zusammen. Da war der Geruch seiner langsamen, beinahe rinderartigen Verdauung. Die Matratze war durchgeweicht, gleich würde sie sich auflösen. Ich öffnete die Augen wieder, füllte die schmale Badewanne bis knapp unter den Rand, sperrte den Hund aus, stieg hinein. Ich musste wohl weggedöst sein, denn als ich aufwachte, befand ich mich unter Wasser. Über mir waren verschwommene Magnolienfliesen, und der abstoßende Duschkopf aus Metall reckte mir den Hals entgegen. Ich wollte mich aufsetzen, doch ein Gewicht drückte gegen meine Brust. Ich beobachtete die Luft, die aus meiner Nase und meinem Mund nach oben stieg, presste die Hände gegen den rauen Wannenboden, spürte, wie dieses Gewicht mich weiterhin unten hielt. Im kargen Weiß der Sauerstofflosigkeit hatte ich gewusst, was es war. Es war das, von dem ich mir vorgenommen hatte, dass ich nie wieder daran denken würde. Es war das, was in jenem letzten Monat auf dem Fluss gewesen war. Das Wort in meinem Mund fühlte sich falsch an. Ich sah weiße Sterne, spürte eine grässliche Kälte im Hals.
Dann war das Gewicht weg. Ich kam keuchend hoch, das Wasser krachte auf den Boden und strömte unter der geschlossenen Tür durch nach draußen. Ich sog so viel Luft ein, dass es brannte, kletterte aus der Wanne und knallte auf die Knie. Der Hund jaulte. Ich legte eine Wange auf die kalten Fliesen und blieb lange dort liegen.
DAS COTTAGE Worauf ich – natürlich – immer wieder zurückkomme, ist, wie du mich verlassen hast. Das liegt daran, sagst du von deinem Sessel aus, dass ich selbstsüchtig bin und zu sehr klammere. Du erklärst mir, dass ich schon immer so war. Du erklärst mir, dass ich auf dem Fluss wie eine Napfschnecke an dir gehangen und geheult habe, bis die Bäume umfielen. Du neigst zu Übertreibungen. Das Erzählen deiner Geschichte hat eher etwas mit Schürfen nach Einzelheiten als mit schlichtem Protokollieren zu tun. Manchmal hörst du ruhig zu. Manchmal unterbrichst du mich, und unsere beiden Erzählstränge finden zueinander und überlappen sich.
Ich weiß nicht mehr viel von dem, was auf dem Fluss passiert ist. Vergessen ist eine Art Schutz, glaube ich. Ich weiß, dass wir den Ort verließen, an dem wir seit meiner Geburt vertäut lagen, und dass Marcus nicht bei uns war. Ich weiß, dass wir mit dem Boot flussabwärts davonfuhren, in einer Stadt anlegten, in der die Glocken die Stunde schlugen. Dort vielleicht eine Woche blieben, nicht länger. Eines Tages bin ich aufgewacht, und du hattest bereits einen Rucksack und ein paar Plastiktaschen gepackt. Ich glaube, du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, das Boot abzuschließen. Da habe ich begriffen, dass wir nicht zurückkommen würden. Ich war damals dreizehn und alles, was ich je gekannt hatte, befand sich auf diesem Boot. Alles außer dir.