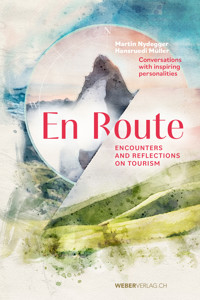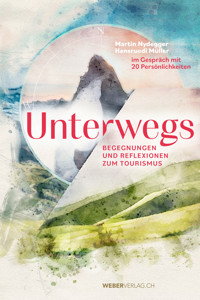
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Werd & Weber Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
«Unterwegs» ist die aufschlussreiche Reise der beiden Autoren mit rund 75 Jahren kollektiver Tourismuserfahrung. Nach ihrer gemeinsamen Veröffentlichung im 2008 «Der Schweizer Tourismus im Klimawandel» widmen sie sich in ihrem neuen Werk insgesamt 20 bedeutenden Themen, angefangen bei der Resilienz über Ästhetik oder Overtourismus bis zur Diversifikation. Zusammen mit 20 spannenden Schweizer und internationalen Persönlichkeiten entfaltet sich ein facettenreiches Panorama aus Diskussionen, Einschätzungen und Erkenntnissen. Das Sachbuch bietet eine differenzierte Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen und verspricht eine inspirierende Reise. «Unterwegs» wird zur anregenden Lektüre für Touristiker und Touristikerinnen und alle, die Einblicke hinter die Kulissen des Tourismus suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin NydeggerHansruedi Müller
im Gespräch mit 20 Persönlichkeiten
Unterwegs
BEGEGNUNGENUND REFLEXIONENZUM TOURISMUS
Vorwort
Unterwegs sind wir alle, die einen schneller, die anderen gemächlicher. Man kann nicht anders, als unterwegs zu sein. Schliesslich läuft die Zeit, die Erde dreht sich, wir verändern uns, träumen, schmieden Pläne, passen uns an, unternehmen etwas oder unterlassen es – ganz bewusst oder intuitiv. Ist Unterwegssein also gar nichts Besonderes? Oh doch! Für Touristinnen und Touristen ist Unterwegssein das Lebenselixier: Ein Leben ohne zwischenzeitliches Unterwegssein ist für die meisten unter uns kaum mehr vorstellbar, auch um Zwischenmenschliches zu erleben. Die Touristiker und Touristikerinnen haben sich dieses Elixiers angenommen, es angereichert, veredelt und kultiviert. Gastfreundlich bieten sie Transporte, Unterkünfte, Ausflugsziele, Speis und Trank oder Attraktionen an und stellen sich den Herausforderungen, die sich aus dem Unterwegssein ergeben. Tourismus wurde weltweit zu einem der grössten Wirtschaftszweige, aber auch zu einem Phänomen mit sieben Siegeln.
Bei einem der sporadischen Mittagessen, an denen wir über die unterschiedlichsten Facetten des Phänomens Tourismus diskutieren, Ideen und Gedanken austauschen, fiel die Bemerkung, dass unsere Reflexionen eigentlich genügend Stoff für ein Buch ergäben. Bei einem nächsten Treffen griffen wir die lockere Bemerkung wieder auf und es wurde ernst. So banal der Anfang dieses Buches war, umso anspruchsvoller gestaltete sich die Umsetzung, denn wir wollten kein konventionelles Sachbuch verfassen, sondern Fragestellungen vertiefen, die den Touristikern unter den Nägeln brennen. Dabei entschieden wir uns für ein Format, das sich abwechslungsreich und divers gestaltet. Wir skizzierten wichtige Themen, die uns fast täglich beschäftigen, kontaktierten Persönlichkeiten, mit denen wir sie gerne diskutieren würden, und begaben uns an symbolische Orte, die inhaltlich passten. So wurde aus einer flüchtigen Bemerkung eine einjährige Rundreise mit 20 Themen an 20 verschiedenen Örtlichkeiten, die im Baseltor in Solothurn begann und uns über das Entlebuch, Albonago hoch über Lugano, das Bundeshaus, die ETH Zürich, die ITB Berlin und den Europapark bis an die École hôtelière de Lausanne führte. Überall trafen wir uns mit einer faszinierenden Fachperson und diskutierten das ausgewählte Thema, mal gradlinig, mal ausschweifend, ganz so, wie es bei lebhaften Diskussionen häufig der Fall ist. Analog den Gesprächen gestalteten sich auch die Texte recht unterschiedlich, mal als Fliesstext, mal als Interview, mal als Intro, mal als Kästchen. Übrigens, worauf wir ein bisschen stolz sind: Keine einzige der angefragten Persönlichkeiten hat uns abgesagt. Sie alle haben sich viel Zeit genommen und sich mit Rat und Tat engagiert. Und wir durften feststellen, dass uns das gemeinsame Unterwegssein nicht nur inspirierte und Freude bereitete, sondern dass es zu einer echten Horizonterweiterung mit einem grossen Erkenntnisgewinn wurde.
«Unterwegs» ist also die aufschlussreiche Gedankenreise zweier Touristiker mit rund 75 Jahren kollektiver Berufserfahrung. Entstanden ist ein facettenreiches Panorama aus Diskussionen, Erzählungen, Einschätzungen, Erkenntnissen und Empfehlungen. Das vorliegende Sachbuch ist für Touristikerinnen und Touristiker gedacht, die sich ebenfalls mit unzähligen Fragen beschäftigen und nach Antworten suchen: für Geschäftsleitungs- und Vorstandsmitglieder von Leistungsträgern oder Tourismusorganisationen, für Gemeinderäte touristischer Destinationen oder für Interessierte in der Verwaltung, in der Beratung oder in der Ausbildung. Es bietet eine differenzierte Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen, zeigt neue Dynamiken auf, eröffnet Aussichten und vermittelt Denkanstösse. Es muss nicht von Buchdeckel zu Buchdeckel gelesen werden, sondern soll zum Durchblättern und Vertiefen animieren. Es möchte anregen, aufzubrechen und mit uns unterwegs zu sein.
Auf der Rundreise haben wir viel Gastfreundschaft und Unterstützung erfahren. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 20 Persönlichkeiten für die spannenden Gespräche und das aufmerksame Korrekturlesen, beim Vorstand von Schweiz Tourismus für die Unterstützung, bei Iris Schaerer für die Koordination der vielen Termine, bei Annette Weber für die begeisterte Aufnahme der Publikation ins Programm des Weber Verlags und bei ihren Mitarbeitenden David Heinen und Heinz Zürcher für das präzise Lektorat respektive Korrektorat sowie Sonja Berger und Shana Hirschi für die kreative Gestaltung. Mit all unseren Anliegen fühlten wir uns stets willkommen und gut aufgehoben.
Dieses Buch ist all den wundervollen Menschen gewidmet, die tagtäglich dafür sorgen, dass Unterwegssein so angenehm und entspannend, so erlebnis- und lehrreich sein kann.
Martin Nydegger und Hansruedi Müller
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Unterwegs – von Resilienz über Reiseverhalten bis zur Nachhaltigkeit
1Resilienz: Die Anpassungsfähigkeit stärken
mit Andrea Scherz
2Interkultureller Austausch: Reisen als Lebensschule
mit Luís Araújo
3Reiseverhalten: Destinationserlebnis im Fokus
mit Martin Lohmann
4Work-Life-Blurring: Verschmelzen von Geschäfts- und Freizeitreisen
mit Petra Hedorfer
5Klimawandel und Tourismus: Wege aus dem Dilemma
mit Reto Knutti
6Nachhaltigkeit: Zukunftsfähig bleiben
mit Theo Schnider
Teil 2: Unterwegs – von Märkten über Marketing bis zu Convenience
7Märktemix: Bedeutungsvolle Fernmärkte
mit Laura Meyer
8Smart Tourism Com: Vom Text zur Immersion
mit Dominique von Matt
9Smart Destination: Zwischen Vision und Notwendigkeit
mit Christian Laesser
10Total Convenience: Mit digitaler Exzellenz zu Leichtigkeit und Bequemlichkeit
mit Karin Seiler
Teil 3: Unterwegs – von Angebotsgestaltung über Qualität bis zum Erlebnis
11Ästhetik: Schöner werden
mit Martin Volkart
12Exzellenz am Berg: Mit Positionierung, Attraktionen und Marketing zum Erfolg
mit Urs Kessler
13Micro-Touring: Flexibel und frei die Welt entdecken
mit Renato Fasciati
14Erlebnis-Setting: Verzaubern und gestalten unvergesslicher Momente
mit Roland Mack
Teil 4: Unterwegs – von Rahmenbedingungen über Politik bis zur Hoffnung
15Demokratourismus: Erschwinglich im Inland – premium im Export
mit Marcel Dietrich
16Fachkräftemangel: Mit kreativen Ideen zum Erfolg
mit Michel Péclard und Florian Weber
17Diversität: Umgib dich mit Andersdenkenden
mit Janine Bunte
18Tourismuspolitik: So viel wie nötig, so frei wie möglich
mit Nicolò Paganini
19Wachstum: Besser mit weniger
mit Samih Sawiris
20Hoffnung: Mit viel Zuversicht in die touristische Zukunft
mit Lucile Allender
Epilog
Autoren
Impressum
Teil 1
Unterwegs
– von Resilienz über Reiseverhalten bis zur Nachhaltigkeit
Resilienz: Die Anpassungsfähigkeit stärken
Das Hotel Gstaad Palace steht da wie eine alte Eiche und vermittelt das Gefühl, jedem Windstoss gewachsen zu sein. Es hat schon viele Stürme überlebt, sich immer wieder angepasst; denn die Tourismusgeschichte ist voller Erfahrungen mit Krisen und Erschwernissen. Aktuell und wohl auch in Zukunft sind wir mit Krisen im Multipack konfrontiert. Sie überlagern sich und sind miteinander verknüpft. Verhindern lassen sie sich nicht. Man spricht auch von Sattelzeiten1, wenn langjährige Erfolgsgaranten hinterfragt werden müssen oder sich gar Paradigmen verändern. Die Resilienz zu stärken, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen sowie die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, wird immer wichtiger.
Der Begriff «Resilienz» stammt aus der Psychologie. Als resilient werden Menschen bezeichnet, die anpassungsfähig, belastbar, aufmerksam, neugierig, tüchtig, geschickt und voller Selbstvertrauen sind. Das Gegenstück zur Resilienz ist die Vulnerabilität. Vulnerabel bezeichnet Personen, die sich leicht durch äussere Einflüsse verunsichern lassen. Das Resilienz-Management umfasst Massnahmen zur Stärkung der Belastbarkeit von Betrieben gegenüber äusseren Einflüssen. Es unterstützt das Risiko- und Krisenmanagement mit dem Ziel, einen Betrieb widerstands- und anpassungsfähiger gegenüber Störungen jeglicher Art zu machen. Oft wird zwischen der Agilität als reaktiver Form der Resilienz und der Robustheit als proaktiver Form unterschieden. Robustheit bezieht sich darauf, wie gut eine Organisation mit externen Störungen umgehen kann, während Agilität sich darauf konzentriert, wie gut eine Organisation intern auf Veränderungen reagieren kann. Beide Konzepte sind wichtig, um mit den Herausforderungen einer sich ständig verändernden Umwelt umzugehen.
«Als resilient werden Menschen bezeichnet, die anpassungsfähig, belastbar, aufmerksam, neugierig, tüchtig, geschickt und voller Selbstvertrauen sind.»
Mit der Coronapandemie Anfang 2020 erlebten Gesellschaft und Wirtschaft den grössten Schock seit dem Zweiten Weltkrieg. Kaum ein Sektor, der von der Pandemie nicht betroffen war. In dieser Zeit war der Tourismus in aller Munde, denn Reisefreiheit und Freizeitaktivitäten wurden stark eingeschränkt. Zwar wurden Hotels in der Schweiz nicht geschlossen, Restaurants konnten unter starken Sicherheitsvorkehrungen den Betrieb weiterführen, und auch die Skigebiete durften unter Restriktionen geöffnet bleiben, doch war von allen Akteuren und Akteurinnen höchste Resilienz gefragt, denn die Bedrohungslage und damit die Vorgaben veränderten sich laufend.
Zum Gespräch über das Thema Resilienz trafen wir uns mit Andrea Scherz, dem Inhaber des Gstaad Palace sowie Präsidenten der Leading Hotels of the World. Das Gstaad Palace wurde 1913 eröffnet, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es thront auch nach weit über 100 Jahren in vollem Glanz über Gstaad und ist ein eindrückliches Symbol für Resilienz im Tourismus. Und es ist eines der letzten inhabergeführten Fünfsternehotels der Schweiz.
Coronapandemie – Resilienz auf dem Prüfstand
Wie hat das Gstaad Palace die Pandemie überstanden? Andrea S. erinnert sich: «Als es im März 2020 losging, habe ich meine Mitarbeitenden im Bankettsaal versammelt – coronakonform – und habe ihnen gesagt, dass ich es auch noch nicht genau verstünde, aber sie keine Angst zu haben brauchten. Das sei nicht die erste Krise, die das Palace zu überwinden habe. Wir würden auch diese meistern. Das gab Sicherheit, um gemeinsam weiter zu planen. Rückblickend haben wir die Krise gut gemeistert, weil wir als Familienunternehmen sehr flexibel waren, vom Staat unterstützt wurden, aber auch auf gute Partner und treue Gäste zählen durften. In Krisen ist es wichtig, dass man sehr schnell Entscheidungen treffen und umsetzen kann.»
Auf die Frage, ob ihn die Coronakrise gelehrt habe, dass auch das Gstaad Palace mehr finanzielle Reserven brauche, um resilient zu bleiben, meint Andrea S.: «Wir hatten in den letzten Jahren eine gute finanzielle Grundlage, denn wir wissen, dass wir immer wieder zwei oder auch drei schlechtere Saisons überstehen müssen. Wir haben stets darauf geachtet, die Liquidität gesichert zu haben und die Bankkredite nicht voll auszuschöpfen. Ziel war und ist noch immer, jederzeit auf 3 bis 5 Millionen Franken zurückgreifen zu können.»
Martin N. stellt fest, dass das Anlegen genügender Reserven zur DNA von uns Schweizern und Schweizerinnen gehört. Letztlich habe der Staat nur darum sehr schnell mit Unterstützungsmassnahmen reagieren können, weil Reserven vorhanden waren. Die persönlichen Finanzen seien meist etwas stabiler im Vergleich zu anderen Ländern, in denen Menschen oft von einem Gehalt zum nächsten leben müssten. Dieses Verhalten werde in Krisenzeiten belohnt. Und Andrea S. gibt zu bedenken, dass beispielsweise in den USA als bedeutendster Volkswirtschaft eine viel grössere Hand-in-den-Mund-Mentalität vorhanden sei und damit auch eine ausgeprägte Kreditkultur einhergehe. Das habe die Resilienz geschwächt. «Ich wage zu behaupten – oder ich befürchte sogar –, dass die nächste Krise von den USA mit ihrer enormen Verschuldung ausgeht.»
ANDREA SCHERZDipl. Hotelier EHL Lausanne / NDS HF Hotelmanagement Hotelmanagement-Erfahrungen in führenden Hotels wie Beau-Rivage Lausanne, The Savoy in London, InterContinental in Genf, in Hotels der USA und in Italien Seit 2001 Mehrheitsaktionär und CEO Gstaad Palace Von 2004 bis 2013 Vorstand und Vizepräsident Gstaad Saanenland Tourismus Von 2007 bis 2023 Verwaltungsrat Swiss Deluxe Hotels Seit 2022 Präsident der Leading Hotels of the World
Bezüglich finanzieller Sicherheit gebe es jedoch innerhalb des Tourismus grosse Unterschiede, meint Hansruedi M. Denken wir an das Gastgewerbe: Die Pandemie habe offengelegt, wie wenig es brauche, bis Reserven aufgebraucht seien. «Die Restauration in der Schweiz ist bereits seit Jahren in der Krise, nicht nur wegen der fehlenden finanziellen Reserven», ergänzt Andrea S. Das habe stark mit dem veränderten Konsumverhalten zu tun. Das Landbeizensterben sei die Folge. «Wenn ich jeweils für unser Rally-Event eine Strecke rekognosziere, gibt es entlang der Strecke zwar alte, wunderschöne Gasthöfe, aber viele davon sind geschlossen.» Andrea S. weiss, wovon er spricht, hat er doch während Jahren den «Bären» in Gsteig geführt. Einen traditionellen Gasthof, in dem der Raclettekäse über dem offenen Feuer geschmolzen und einzigartige Erlebnisse geboten werden. «Als bei einem Pächterwechsel die Nachfolge nicht mehr geregelt werden konnte, habe ich den Betrieb spontan übernommen. Doch heute ist es sehr schwierig, einen Gastronomiebetrieb rentabel zu führen, denn die Rahmenbedingungen haben sich stark verändert: verschärfte Alkohollimiten, Rauchverbot, Hygienevorschriften, Einkaufspreise, Fertiggerichte für zu Hause, Cateringservices, Personalmangel und als Folge das veränderte Konsumverhalten. Zudem muss man sich aufgrund der sozialen Medien weniger in der Beiz treffen, um sich zu unterhalten.» Das Beispiel des «Bären» zeige, wie anspruchsvoll Resilienz im Gaststättengewerbe sei.
Martin N. stellt fest, dass es sich wohl in vielen Fällen weniger um einen Mangel an Resilienz handelt, sondern dass zu viele Restaurants schlicht und einfach aus der Zeit gefallen seien. Hansruedi M. ergänzt: «Wenn Resilienz im Kern bedeutet, sich verändernden Begebenheiten immer wieder anzupassen – auch den veränderten Konsumgewohnheiten –, so wurde genau das in vielen Betrieben des Gaststättengewerbes verschlafen.»
«Eine ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel.»
«Meistens können wir die Konsequenzen von möglichen Risiken nicht richtig oder konkret genug abschätzen.»
Für Andrea S. waren die Erfahrungen während der zweiten Welle der Pandemie sehr wertvoll. «Wir haben uns entschieden, die aktuelle Situation aktiv zu kommunizieren. Das kam bei den Gästen gut an. Sie merkten, dass hier ‹im Schutz der alten Eiche› alles unternommen wurde, damit sie sich sicher fühlen konnten, und vertrauten uns. Eine ehrliche Kommunikation als Schlüssel.»
Lehren aus der Pandemie – Anpassungen im Risikomanagement
Welche Lehren können wir aus den Erfahrungen mit der Pandemie ziehen: Anpassungen im Risikomanagement, neue Sicherheits- oder Hygienemassnahmen, Änderungen in der Marktbearbeitung, andere Kooperationen, Überdenken des Finanzmanagements und als Folge die Steigerung der Resilienz? Andrea S. gibt offen zu, dass das Risikomanagement angepasst werden musste, weil die Pandemiegefahr schlicht und einfach gefehlt hatte. «Doch sind wir ehrlich: Meistens können wir die Konsequenzen von möglichen Risiken nicht richtig oder konkret genug abschätzen.»
Diese Einschätzung verleitet Martin N. zur Frage, ob man zur Erkenntnis kommen müsste, dass die so populär gewordenen Risikoanalysen wenig taugen. Wenn man die Risiken kenne und darauf reagieren könne, dann wären sie ja einfach ein mechanischer Akt. «So weit würde ich nicht gehen. Sicher ist es gut, mögliche Risiken zu antizipieren», meint Andrea S. und ergänzt, dass das folgenreichste Risiko im Gstaad Palace sei, dass ihm persönlich als Mehrheitsaktionär und CEO etwas passiere. Es könne nur wenig dagegen unternommen werden, denn klonen könne man ihn ja nicht. Hingegen müsse die Frage geklärt werden, wer das Hotel im entsprechenden Krisenfall weiterführen würde oder ob es verkauft werden müsste. Wichtig sei es, ein gutes Team aufzubauen, das den Betrieb auch ohne den CEO eine Zeit lang managen könnte. «Doch zugegeben: Risikoanalysen sind oft Sandkastenübungen, ohne dass wir wirklich etwas verändern.»
«Ein Maximalanteil von 10 Prozent pro Herkunftsland ist als Märktemix ein wichtiger Resilienzfaktor.»
«Während der Pandemie erarbeiteten wir einen Notfallplan und spielten unterschiedliche Szenarien durch», ergänzt Andrea S. «Wir haben die Rollenverteilung diskutiert und ganz konkret festgehalten, wer mehr Verantwortung übernehmen müsste, wenn Führungskräfte wegen einer Covid-19-Infektion ausfallen würden und in Quarantäne müssten. Oder wie wir Mitarbeitende verpflegen, die in Zimmern eingesperrt sind. Wir mussten sehr flexibel sein, schnell schalten und nach kreativen Lösungen suchen.» Bezüglich Resilienz sei für ihn die folgende Grundregel heilig, die schon vor der Pandemie gegolten habe. «Wir haben nie mehr als 10 Prozent Gästeanteil aus einem einzelnen Markt, ausser bei den Schweizern.» Ein Maximalanteil von 10 Prozent pro Herkunftsland ist als Märktemix ein wichtiger Resilienzfaktor, meint Hansruedi M. Auch für die Harmonie unter den Gästen sei es wichtig, wenn keine Gästegruppe dominiere.
«Während der Pandemie haben wir den Schweizer Markt stark und erfolgreich bearbeitet. Wir waren angenehm überrascht und bekamen viel positives Feedback. Die Sicherung des Schweizer Marktes ist eine Lehre aus der Pandemie», stellt Andrea S. fest. Auch für Martin N. hat der Heimmarkt eine stabilisierende Wirkung. «Das hat uns in der Krise resilient gemacht, zuerst im Berggebiet und in ländlichen Regionen, später auch in den Städten.» Schweiz Tourismus sei eine der wenigen NTO gewesen, die während der Pandemie kein Auslandsbüro geschlossen und keine Mitarbeitenden entlassen haben. Die Recovery-Mittel des Bundes hätten ein antizyklisches Krisenmanagement erlaubt. Damit habe die Präsenz aufrechterhalten und das Know-how gesichert werden können, und man sei schnell wieder einsatzbereit gewesen.
Andrea S. ergänzt: «Mit dem Halten der Mitarbeitenden konnten die Servicequalität und der Einfallsreichtum aufrechterhalten werden.» Daraus habe sich für das Gstaad Palace eine spannende neue Kooperation mit Ferrari ergeben, da sämtliche Messen und Showrooms geschlossen waren. Es seien zwei neue Modelle vorgestellt worden, die prominent vor dem Haupteingang parkiert wurden und von Gästen getestet werden konnten. «Das war ein riesiger Erfolg. Leider war die limitierte Produktion innert kürzester Zeit ausverkauft.» Es bestehe jedoch bereits Interesse von anderen Automarken, die ein neues Modell lancieren möchten. So sei während der Pandemie auch Neues entstanden.
Krisen verstärken den Zusammenhalt
Martin N. stellt fest, dass während der Pandemie auf nationaler Ebene die Tourismusdachverbände ausserordentlich gut zusammengearbeitet und gemeinsam viel erreicht hätten. Deshalb die Frage, ob die Krise auch die Leistungsträger vor Ort zusammengeschweisst habe. Andrea S. bestätigt, dass man diese hervorragende Zusammenarbeit der nationalen Dachverbände gespürt und die erzielte politische und finanzielle Unterstützung in der kritischen Zeit sehr geholfen habe. Auf Destinationsebene sei die Kooperationsbereitschaft im Saanenland traditionell hoch. Letztlich könne man die Verantwortung nicht auslagern, bekräftigt Andrea S. «Mir gelingt es meist, in Krisensituationen eigenständige Lösungen für den Moment zu finden.»
Auch Hansruedi M. stellt als ehemaliges Vorstandsmitglied von Gstaad Saanenland Tourismus fest, dass im Saanenland der Kooperationswille sehr ausgeprägt sei, auch während der Krise. Unter den Hoteliers seien in der Vergangenheit viele Gemeinschaftsprojekte lanciert worden: die Plattform für Mitarbeitende YourGstaad, die Zentralwäscherei, der Einkauf, das Marketing, die Mitarbeiterunterkunft, der Event-Supporter zur kollektiven Unterstützung von Events usw. Kooperationen seien ein wichtiger Eckpfeiler des Erfolgs.
Martin N. fragt nach, ob die Pandemie auch dazu geführt habe, dass Tourismus und Bevölkerung näher zusammengerückt seien. Eher nicht, meint Hansruedi M., denn die Destination Gstaad habe auch während der Pandemie gute Zahlen geschrieben, die Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung habe eher gelitten. «Es ist bekannt, dass die Tourismusakzeptanz immer dann tief ist, wenn es dem Tourismus gut geht, und wieder steigt, wenn die Frequenzen sinken.» Die gegenseitige Abhängigkeit komme in der Not viel besser zum Ausdruck als in guten Zeiten. Andrea S. ergänzt, dass es in der Region einen grossen Kreis von Personen gebe, die sich stark engagierten, in der Politik, in Verbänden oder für Grossevents, und zur Stärkung des Tourismus beitrügen. «Die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft war aber auch schon besser. Dazu muss man Sorge tragen.» Hansruedi M. erinnert an den Spruch von Horst Stern: «Erst geht die Kuh, dann der Gast; wen soll man dann noch melken?»
«Nebst einem gesunden geografischen Mix macht auch die thematische (Reisemotive) und zeitliche (Saisons) Diversifikation resilienter.»
Krisenherde im Multipack – der Tourismus immer mittendrin
Nach Aufhebung der Wechselkursparität zum Euro von CHF 1.20 im Januar 2015 sagte Andrea S. in einem Interview: «Für ein privates Hotelunternehmen ist das Umfeld momentan wirklich düster. Es geht in Richtung Überlebenskampf.» Er erinnert sich, dass man jenen Schock zu Beginn sehr stark zu spüren bekommen habe. Ein Gast habe ihm damals etwas sehr Schönes gesagt: «Euer Hotel ist mir jeden Euro wert. Aber ihr solltet nicht vergessen: Ich muss auch noch ein Mietauto, ein Skiabonnement, einen Skilehrer usw. bezahlen. Und all das ist von einem Tag auf den andern gegen 20 Prozent teurer geworden, aber nicht zwingend 20 Prozent besser.» Eine Schocksituation wie im Januar 2015 könne man nicht plötzlich mit besseren Leistungen kompensieren. Natürlich habe man mit den Preisen etwas variiert oder Zusatzleistungen angeboten, doch sei damit die Marge gesunken. «Wir haben damals Drei-für-zwei- oder Fünf-für-vier-Pakete angeboten, doch das waren nur kurzfristige Rezepte», erinnert sich Andrea S.
Martin N. weist darauf hin, dass für exakt solche Fälle eine gesunde Diversifikation auf den Märkten klug sei, denn während der Eurokrise seien weder der Dollar noch das Pfund oder der Yen von dieser betroffen gewesen. «Wir senken das Währungsrisiko oder andere Abhängigkeiten, indem wir auf geopolitisch und geografisch unterschiedlichsten Märkten mit unterschiedlichen Währungen und verschiedenen Volkswirtschaften präsent sind. Auch den Ausfall der Gäste aus China haben wir versucht, mit vermehrten Aktivitäten in anderen asiatischen Ländern abzufedern.» Nebst einem gesunden geografischen Mix mache auch die thematische (Reisemotive) und zeitliche (Saisons) Diversifikation resilienter.
Wo immer Krisenherde entstehen: Der Tourismus ist immer betroffen, und zwar unmittelbar, weil er als Querschnittssektor breit vernetzt ist und touristische Leistungen nicht lagerbar sind. «Jede dieser Krisen spürt der Tourismus sofort: die Lieferkettenprobleme fast bei jeder Investition, die gestiegene Inflation bei jeder Offerte, den Fachkräftemangel bei jeder neu zu besetzenden Stelle. Langfristig ist es der Klimawandel, der am gravierendsten ist», meint Andrea S. «Bei der Pandemie hatten wir grosses Glück, dass wir von der öffentlichen Hand stark unterstützt wurden und die Saisons solide liefen. Die Multikrise verursachte punkto Ukrainekriegs-bedingten Energiekosten im Winter 2022/23 Zusatzkosten von über 200 000 Franken.» Das sei bei einem Rekordumsatz verkraftbar, nicht zuletzt aufgrund der Investition in Fernwärmeanlage im Jahr 2008 – auch eine Massnahme zur Steigerung der Resilienz (vgl. Kästchen).
KRISENFELDER IM SCHWEIZER TOURISMUS
Schweiz Tourismus hat im Herbst 2022 auf die folgenden acht Krisenfelder hingewiesen, die alle miteinander verknüpft sind und den Tourismus stark betreffen
Nachwirkungen der Coronapandemie: Verunsicherungen und Einschränkungen
Energieversorgung: Rohstoffmangel, drohende Strommangellage, Preiserhöhungen
Fachkräftemangel: ausgetrockneter Arbeitsmarkt, Druck auf Löhne, abnehmende Dienstleistungsqualität
Geopolitische Konflikte: Verunsicherung und Angst, Sanktionen gegenüber Oligarchen/Russland, Ausfall Markt Russland, mögliche Eskalation in Osteuropa und im Nahen Osten
Klimawandel: Schneemangel, Gletscherrückzug, Extremwetterlagen, Steinschlag, Dilemma Reisen/Mobilität und Nachhaltigkeit, Fernmärkte in Kritik, Sensibilität der Gäste
Wechselkurs: Hochpreis-land Schweiz, gedämpfte Nachholeffekte
Inflation: Hohe Inflation in Herkunftsländern, reduziertes Reisebudget, Zinsanstieg bei Krediten/Hypotheken
Beschaffungskette: Lieferengpässe, insbesondere bei Hardware, Auswirkungen auf Kosten und Investitionstätigkeiten
Einschätzung ST Stand November 2022
«Wenn es stürmt, dann suchst du eine Eiche auf, die gut verwurzelt ist und jedem Sturm standhält.»
«Unser Hotel ist wie eine alte Eiche über Jahrzehnte gewachsen und vermittelt das Gefühl, jedem Sturm gewachsen zu sein. In einer sich immer schneller drehenden Welt suchen Leute Orte, die eine gewisse Ruhe, Sicherheit und Kontinuität ausstrahlen», sagte Andrea S. einmal in einem Interview. War das während der Pandemie ebenfalls so? «Ja», meint Andrea S.: «Wenn es stürmt, dann suchst du eine Eiche auf, die gut verwurzelt ist und jedem Sturm standhält. Viele krisengeschüttelte Manager schätzen es als Gast, zu wissen, dass im Gstaad Palace alles beim Alten bleibt: die gleiche Führung, die gleichen Bezugspersonen, die gleichen Settings. Dieses organisch Gewachsene wird gesucht. Die Gäste fühlen sich unter der gesunden Eiche sicher und wohl. In den Ferien möchte man sich möglichst nicht mit Krisen beschäftigen, sondern einfach entspannen und geniessen. ‹Peace of Mind› wird wichtiger.»
GSTAAD PALACE – ERSTER KUNDE FÜR FERNWÄRME
Quelle: Gstaad Palace: 100 Jahre Palace Gstaad, 2013, S. 195.
650 000 Franken hat sich das Gstaad Palace die Umrüstung von Ölheizung auf Fernwärme aus zentraler Saanenländer Produktion kosten lassen. Im Dezember 2008 weihte man die ökologische Wärmeanlage im Hotel ein. Jährlich spart man damit rund 270 000 Liter Heizöl ein und trägt so zur CO2-Reduktion und zur Steigerung der Luftqualität bei. Notabene ist es nicht das erste Mal, dass die Hotelräumlichkeiten mit Holz beheizt werden: Schon im Zweiten Weltkrieg, als die Kohle knapp wurde, musste man auf Holz umstellen. In den 50er-Jahren hielt dann die Ölheizung Einzug.
Und knapp 60 Jahre später also die Wende zurück zur zentralen Holzschnitzelverbrennung. Das ist im Saanenland besonders sinnvoll, weil durch das Holz-Obligatorium beim Bauen viele Holzabfälle entstehen, die so verwertet werden können.
«Als Touristiker und Touristikerinnen müssen wir uns auf diese Häufung und diese Dynamik von Krisen einstellen, da sie uns stärker beschäftigen werden als in der Vergangenheit.»
Die Eiche als Symbol für Sicherheit, Kontinuität und Ruhe gelte nicht nur für ein Hotel wie das Gstaad Palace, sondern auch für Destinationen wie Gstaad oder für die gesamte Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, ergänzt Hansruedi M. Martin N. warnt: «Nur bewahren wäre lähmend – Sicherheit und Stabilität ist nicht für alle Leistungsträger das Rezept. Doch es ist unbestritten, dass die Verlässlichkeit der Schweiz ein wichtiger Faktor war, weshalb wir die Pandemie so gut überstanden haben. Sicherheit, Vertrauen, Hygiene oder Qualität wurden von einer Voraussetzung zu einem Wettbewerbsvorteil, hin und wieder sogar zum Motiv.»
Vergangene Krisen wie 9/11, Sars, die Finanzkrise oder verschiedene militärische Konflikte haben gezeigt, dass der Einbruch im Tourismus schnell und stark erfolgt, während die Erholung in der Regel lange dauert. Martin N. ist der Ansicht, dass die aktuelle Situation durch die Häufung, Überlappung und Verknüpfung all dieser Krisenfelder völlig neu sei. Die Auswirkungen seien vielfältig, und die Dynamik ist hoch. «Als Touristiker und Touristikerinnen müssen wir uns auf diese Häufung und diese Dynamik einstellen, da sie uns stärker beschäftigen werden als in der Vergangenheit.»
«Wo führt das hin», fragt sich Andrea S. «Diese Anhäufung von Krisen hat auch mich nachdenklich gestimmt und mir persönliche Krisenmomente beschert. Der Job wurde sehr anstrengend. Heute bin ich an einem Punkt, an dem ich mir überlege, ob ich meinen Kindern wirklich ein Geschenk mache, wenn ich ihnen das Gstaad Palace übergebe. Werden die Krisen noch herausfordernder?» Hansruedi M. möchte wissen, ob sein Vater nicht auch schon ähnlich gedacht habe, bevor er ihm das Gstaad Palace übergab. «Nein, ich glaube nicht. Die Häufung der Krisen ist massiver geworden. Zwar war damals die Liquidität immer wieder ein Thema, doch die Situation hat sich bezüglich der externen Herausforderungen stark zugespitzt.»
Es ist hinlänglich bekannt, dass Nachfolgeregelungen in der aktuellen Zeit bei vielen Betrieben eine zentrale Thematik darstellen. Für Martin N. verfügt Andrea S. über das richtige, ermutigende Mindset. Das Schlimmste sei, wenn die Gäste merken würden, dass der Hotelier oder die Hotelière in einer Krise stecke. «Absolut», bestätigt Andrea S. und stellt folgende Frage in den Raum: «Gibt es in Zukunft noch genügend junge, motivierte Leute, die bereit sind, unter diesen neuen Herausforderungen im Tourismus und insbesondere in familiengeführten Hotels Führungsverantwortung zu übernehmen?» Es gebe zu viele andere Verlockungen. «Familienbetriebe als Auslaufmodell?», fragt sich Hansruedi M. Man müsse sich überlegen, Betriebe mit neuen Managementmodellen weiterzuführen.
Martin N. stellt fest, dass der Gedankengang spannend und wichtig sei. «Wir alle stehen vor der Frage, wie wir die nächste Generation auf die Herausforderungen im Tourismus vorbereiten können. Und in welchem Zustand wir der nächsten Generation das Tourismusland hinterlassen.» «Etwas vom Gravierendsten, was wir unseren Jungen übergeben, sind die Treibhausgase, die unsere Generation verursacht hat. Bezüglich der Klimakrise trauen wir der nächsten Generation sehr viel Resilienz zu», meint Hansruedi M.
«Bezüglich der Klimakrise trauen wir der nächsten Generation sehr viel Resilienz zu.»
Bewusstseinsschärfung – Aktivierung oder Aneignung von Resilienz-Skills
Eine Krise räumt auf, rekalibriert Werte, ermöglicht scheinbar Unmögliches und lässt Neues wachsen. Winston Churchill sagte einmal: «Never let a good crisis go to waste.» Aber wie lassen sich Krisen aktiv managen? Kann man sich Resilienz (vgl. Kästchen) aneignen oder antrainieren als persönliche Fähigkeit, oder wächst sie nur durch Erfahrung? Wie kann sich die Teamresilienz und die Prozessresilienz (vgl. Kästchen) weiterentwickeln, um als Betrieb bei weiteren Herausforderungen zukunftsfähig zu bleiben?
«Für mich ist Akzeptanz eine wichtige Grundlage von Resilienz. Man muss sich bewusst sein, dass nicht immer nur die Sonne scheint, nicht immer nur ‹Schoggi›-Zeiten herrschen. Auch die Natur hat Zyklen. Das Leben und die Wirtschaft ebenfalls», meint Andrea S. und ergänzt: «Mein Vater sagte mir immer: Nur eines ist sicher im Leben: Es kommt anders, als du denkst.» Man müsse akzeptieren, dass nicht alles perfekt laufe, sondern mit einer positiven Grundhaltung nach Lösungen zu suchen. «Ab und zu beflügeln mich neue Herausforderungen. Als Kapitän freute ich mich zwischendurch über einen hohen Wellengang, um zu zeigen, was man kann.» Hansruedi M. weist auf das Buch von Benedikt Weibel hin, dem ehemaligen CEO der SBB: «Endlich beginnen die Schwierigkeiten» (2016). Erst in schwierigen Situationen zeige sich, wer was kann.
RESILIENZFAKTOREN VON PERSONEN UND GRUPPEN
Quelle: In Anlehnung an wikipedia.org/wiki/Resilienz.
Zu den die Resilienz stärkenden Faktoren von Personen gehören:
Umweltfaktoren: Unterstützung durch die Familie, die eigene Kultur, die Gemeinschaft, das soziale Umfeld
Personale Faktoren: Kognitive Fähigkeiten (z. B. Intelligenz, Fähigkeit, sich selbstständig Informationen anzueignen) wie auch emotionale Fähigkeiten (z. B. Emotions- und Handlungskontrolle), Toleranz für Ungewissheit, die Fähigkeit, Beziehungen aktiv zu gestalten, oder die positive Einstellung gegenüber Problemen
Prozessfaktoren: Die Fähigkeit, in Krisen Opportunitäten und Perspektiven zu erkennen, die Akzeptanz des Unveränderbaren und die Fokussierung auf die nächste Herausforderung und die dafür entwickelten Strategien
Entsprechend gehören zu den die Resilienz schwächenden Faktoren von Personen unsichere Bindungen, geringe kognitive Fertigkeiten, geringe Fähigkeiten im Umgang mit Anspannung und Entspannung sowie in der Fokussierung auf Herausforderungen.
Zu den die Resilienz stärkenden Faktoren von Gruppen gehören:
Starker Zusammenhalt
Kollektivistische Orientierung
Gemeinsame Werte (shared values)
«Dieses positive Mindset muss gepflegt werden.»
«Eine Eigenschaft, die ich mir für Krisenzeiten angeeignet habe: herunterfahren und mich nicht ständig mit den Problemen beschäftigen», sagt Andrea S. «Ich gehe dann einfach Eichhörnchen füttern und kann für lange Zeit abschalten. Das macht mich ruhiger, ja glücklicher. Im Englischen sagt man: ‹Count your blessings›, also sich in einer düsteren Phase an die Glücksmomente erinnern und versuchen, die Situation wieder positiv zu sehen. Man merkt dann, dass die Liste der positiven Begebenheiten eigentlich lang ist. Dieses positive Mindset muss gepflegt werden.»
In Bezug auf das Mindset ergänzt Martin N.: «Embrace experiments.» Gerade in Krisenzeiten würden sich perfekte Möglichkeiten für Innovationen und Versuche bieten. Danach sei man entweder erfolgreicher oder klüger. Auch sei es entscheidend, der Durchschnittlichkeit zu entkommen und hohe Massstäbe zu setzen: «Aim high.» Und schliesslich sei der Tourismus eine von Menschen geschaffene Branche, und nur das stärkste Team könne Erfolg bringen. Daher: «Empower your workpartners.»
Für Andrea S. sei wichtig zu wissen, aus welcher Situation heraus man einem Sturm begegne. Viele touristische Leistungsträger seien schlecht vorbereitet oder ausgestattet: Es brauche einen etwas heftigen Windstoss und schon liege man flach. Für ihn sind finanzielle Stabilität, Erfahrungsschatz und ein gesundes Selbstvertrauen zentral. «Ich habe dieses Selbstvertrauen, weil ich weiss, dass meine Grosseltern dieses Hotel schon durch den Zweiten Weltkrieg gebracht haben, obwohl sie wenig finanzielle Reserven hatten.»
«Zu den wichtigen Managementaufgaben gehört es, bei der Auswahl der Mitarbeitenden auf Resilienzaspekte zu achten.»
Hansruedi M. verweist auf das viel zitierte Sieben-Schlüssel-Modell der persönlichen Resilienz und stellt fest, dass Andrea S. wohl viele dieser Eigenschaften in einer hohen Ausprägung vereint (vgl. Kästchen).
Es stellt sich die Frage, welche dieser Resilienzfaktoren angeeignet oder trainiert werden können. Für Martin N. klingen sie wie generelle Führungseigenschaften: Es seien Persönlichkeitsmerkmale. «Zwar nehmen auch bei Schweiz Tourismus die Kadermitarbeitenden immer wieder an Führungskursen teil, doch wenn gewisse Persönlichkeitsmerkmale fehlen, nützen solche Kurse wenig.» Resilienz sei nicht wirklich erlernbar, sondern wachse eher durch Erfahrungen, manchmal auch durch bittere.
«Aus meiner Optik können einige dieser Eigenschaften wie positive Grundhaltung, Akzeptanz oder Lösungsfokus auch vermittelt werden, sind also lernbar.» Voraussetzung sei eine hohe Willenskraft, ist Andrea S. überzeugt. «Zu den wichtigen Managementaufgaben gehört es, bei der Auswahl der Mitarbeitenden auf Resilienzaspekte zu achten», meint Hansruedi M. Im Zusammenstellen von Teams sei gut darauf zu achten, dass sich einzelne Personen gut ergänzen respektive Führungsteams möglichst heterogen und divers aufgestellt sind. Dies werde in Zukunft noch wichtiger. Und man könne sich an gewissen Prinzipien orientieren, beispielsweise jenen des Business Continuity Management (BCM)2:
SCHLÜSSEL DER INDIVIDUELLEN RESILIENZ
Quelle: Heller, Jutta: Resilienz: 7 Schlüssel für mehr innere Stärke, München 2013.
Die 7 Schlüssel der individuellen Resilienz sind:
Akzeptanz
Optimismus
Selbstwirksamkeit
Eigenverantwortung
Netzwerkorientierung
Lösungsorientierung
Zukunftsorientierung
1.Prepare: Vorbereitung auf mögliche Krisenereignisse, z. B. durch Frühwarnsysteme
2.Prevent: Abwendung oder Abschwächung von Krisenereignissen durch Reduktion von Risikofaktoren
3.Protect: Minimieren von negativen Auswirkungen durch physische und virtuelle Schutzsysteme
4.Respond: Schnelle, gut organisierte und effektive Reaktion auf Ereignisse – Finden von Opportunitäten (Chancen der Krise)
5.Recover: Erholung und Nutzung von Lerneffekten, um auf künftige Ereignisse besser vorbereitet zu sein
Messbarkeit der Resilienz
«Nur was messbar ist, wird lenkbar», besagt eine gängige Managementregel von Peter F. Drucker. Es ist bekannt, dass Resilienz nur schwierig zu messen ist. Natürlich könne im Nachgang einer Krise an den Erfolgszahlen eines Betriebes festgestellt werden, wie hoch die Resilienz gewesen sei, doch sie im Vorfeld zu bestimmen, sei kaum möglich, meint Hansruedi M. Hingegen könne Resilienz symbolhaft vermittelt werden, zum Beispiel mit dem Bild des 110-jährigen Gstaad Palace, das viele Krisen überstanden habe und weiterhin zu den besten Hotels der Welt gehöre.
Martin N. weist darauf hin, dass die Pandemieresilienz von Märkten mithilfe der Recovery-Rate gemessen werden könnte, also wie schnell sich ein Land im Vergleich zum Ankerjahr 2019 erholt hat. Würden die internationalen Ankünfte als Messgrösse genommen, lasse sich die unterschiedliche Resilienz von touristischen Märkten erahnen. Gemessen an den internationalen Ankünften aus den folgenden Märkten beträgt die Erholungsrate 2022 im Vergleich zu 20193 aus dem Nahen Osten minus 17 Prozent, aus Europa minus 21 Prozent, aus Afrika minus 35 Prozent, aus Amerika minus 35 Prozent und aus Asien minus 77 Prozent.
«Wenn die Mitarbeitenden motiviert sind, um einen Betrieb aus der Krise zu ziehen, dann ist auch die Resilienz höher.»
Wenn die Resilienz in Prozess-, Team-, Umfeld- und persönliche Resilienz unterteilt werde, dann sei die Prozessresilienz wohl am besten messbar, zum Beispiel mit der Recovery-Rate von Märkten. Auch wenn Resilienz im Vorfeld einer Krise kaum messbar sei, könnten Vorkehrungen (prevent) getroffen werden. «ST beschäftigt sieben Geschäftsleitungsmitglieder, und mein Ziel ist es, mich mit einem möglichst heterogenen Team zu umgeben», sagt Martin N. «Persönlichkeitsmerkmale zu verändern, ist ausserordentlich schwierig. Bei Wechseln wird das Team jeweils ergänzt mit einer Persönlichkeit, die Skills vorweist, die in der GL noch nicht präsent sind. Ich stelle mir dann jeweils die Frage, wer noch nicht am Tisch sitzt. Und dieses Profil suchen wir dann. Indem ich das Führungsteam auf diese Weise zusammenstelle, stärken wir die Resilienz der Organisation.»
«Mir scheint das Thema ‹Motivation› noch wichtig zu sein: Wenn die Mitarbeitenden motiviert sind, um einen Betrieb aus der Krise zu ziehen, dann ist auch die Resilienz höher», gibt Andrea S. zu bedenken. Das habe mit der Einstellung und der Identifikation mit dem Betrieb zu tun. Auf die Frage, ob das Gstaad Palace während der Pandemie auch Mitarbeitende, die mit der Krise nicht umgehen konnten, verloren habe, meint Andrea S.: «Wir haben natürlich Kurzarbeit eingeführt, die Lohneinbussen mit sich brachte, aber ich habe niemanden entlassen. Jetzt, nachdem wir gemeinsam die Krise überstanden und eine sehr gute Saison hinter uns haben, habe ich jedem Mitarbeitenden einen Tausender Bonus gegeben, unabhängig von der Stellung, vom Tellerwäscher bis zum Direktor.» Es seien die Mitarbeitenden, die in diesem People-Business den Erfolg ausmachen – und in Krisenzeiten für die Resilienz sehr wichtig seien.
Fazit
Resilienz ist in aller Munde. Das hat damit zu tun, dass sich in jüngster Zeit die Krisen häufen, überlappen und gegenseitig beeinflussen. Auf diese Dynamik muss sich der Tourismus, der immer und unmittelbar betroffen ist, mit einer Stärkung der Resilienz einstellen. Zu den resilienzstärkenden Faktoren von Personen gehören soziale Faktoren wie Familie oder die eigene Kultur, personale Faktoren wie die kognitiven und emotionalen Potenziale sowie die Prozessfaktoren, also die Fähigkeit, in Krisen Opportunitäten und Perspektiven zu erkennen. Als resilient werden Menschen bezeichnet, die anpassungsfähig, belastbar, aufmerksam und voller Selbstvertrauen sind. Diese Eigenschaften können zwar nur bedingt angeeignet werden und wachsen eher mit der Erfahrung, doch kann die Teamresilienz mit einer gezielten Zusammensetzung, mit starken gemeinsamen Werten sowie mit der Förderung des Zusammenhalts gestärkt werden. Andrea S. gibt zu bedenken, dass auch die Akzeptanz eine wichtige Grundlage von Resilienz ist: Man muss sich bewusst sein, dass nicht immer nur die Sonne scheint. Die Natur, die Wirtschaft, ja das ganze Leben verläuft in Zyklen. Resilient ist, wer mit einer positiven Grundhaltung nach Lösungen sucht.
1Strassberg, Daniel: Wenn Weltbilder wackeln, in: Republik, 28.2.23.
2Deutsche Gesellschaft für Qualität (https://blog.dgq.de/organisationale-resilienz-im-strategischen-management-viel-hilft-viel).
3UN Tourism
Interkultureller Austausch: Reisen als Lebensschule
Die Aussage «Reisen bildet» ist weit verbreitet und rückt touristische Beweg-Gründe wie «etwas für Kultur und Bildung tun», «Horizont erweitern» oder «neue Eindrücke gewinnen» in den Vordergrund. Sie gehören zwar nicht zu den wichtigsten Reisemotiven, aber es ist unbestritten, dass mit dem Kennenlernen fremder Kulturen Perspektiven erweitert, Respekt gefördert oder Toleranz eingeübt werden können. Das Reisen kann uns zu offeneren und spannenderen Mitmenschen machen. Manche sprechen auch vom Reisen als Lebensschule und davon, dass Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leistet. Auch ist bekannt, dass zwischen Einheimischen und Reisenden Konflikte entstehen können, insbesondere, wenn Gäste in Massen auftreten oder sich auffällig verhalten. Ein facettenreiches Thema also, das stark von der Art und Weise, wie gereist wird, von der Offenheit der Beteiligten sowie vom Geschick, wie Reiseströme gelenkt werden, abhängt.
«Reisen kann zu einem besseren Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen beitragen. Es macht Gesellschaften toleranter.»
Als Ausgangspunkt für unsere Diskussion zum interkulturellen Austausch haben wir sieben positive Aspekte als Denkanstösse formuliert:
Kulturverständnis: Reisen kann zu einem besseren Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen beitragen. Es macht Gesellschaften toleranter.
Bildung: Durch den interkulturellen Austausch können Perspektiven sowie Wissen über andere Kulturen erweitert und Sprachkenntnisse verbessert werden.
Erfahrungen: Reisen ermöglicht es, Neues zu erfahren und Abenteuer zu erleben. Durch Begegnungen mit Einheimischen und das Kennenlernen von lokalen Traditionen und kulinarischen Spezialitäten können einzigartige Erfahrungen gesammelt werden.
Emanzipation: Reisen befreit von sozialen Kontrollen und ermöglicht selbstverantwortliches Handeln. Vor allem jüngere Menschen lernen beim Reisen neue Formen der Lebensgestaltung kennen und können sich emanzipieren.
Netzwerke: Interkulturelle Begegnungen können dazu beitragen, weit über die Landesgrenzen hinaus ein Netzwerk von Freunden und Kontakten aufzubauen und das Interesse für andere Lebensweisen zu fördern.
Identität: Durch den rituellen, utopischen und mythischen Charakter des Reisens wird die kulturelle Identität gestärkt, indem Verhaltenssicherheit vermittelt, Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen und der Pluralismus erweitert werden.1
Völkerverständigung: Der Tourismus leistet einen wesentlichen Beitrag zur Öffnung von politischen Grenzen. Dadurch werden sozio-kulturelle Distanzen zwischen Völkern verringert.
Zweifelsohne: Der interkulturelle Austausch auf Reisen bietet viele Möglichkeiten, den Horizont zu erweitern und Verständnis für andere Kulturen und Lebensweisen zu erlangen. Der interkulturelle Austausch darf jedoch nicht nur romantisiert werden. Es bestehen auch erhebliche Konfliktpotenziale:
Vorurteile: Reisen kann Stereotypen, Klischees und Vorurteile bestätigen oder festigen. Besonders problematisch wird dies, wenn Vorurteile zur Benachteiligung von bestimmten Gruppen führen.
Überheblichkeit: Vermeintliche Überlegenheit ist insbesondere bei Reisen in Entwicklungsländern verbreitet und kann bis zu Ausbeutung oder Missbrauch führen. Flashbacks an Kolonialzeiten und entsprechende Verhaltensmuster verleiten zu überheblichem Gebaren.
Übervorteilung: Ausnutzung von Unkenntnissen von Touristen durch Einheimische, indem Dienstleistungen oder Waren zu überteuerten Preisen verkauft werden.
Xenophobie: Tourismus kann zu rassistischen Konflikten führen, wenn die lokale Bevölkerung den interkulturellen Austausch als störend empfindet. So können in Nikab gehüllte Gäste aus dem arabischen Raum im Westen oder zu freizügig gekleidete westliche Gäste in Nahost xenophobische Reaktionen auslösen.
Massentourismus: Das Risiko von Konfliktsituationen steigt, wenn Reisende in Massen auftreten. Ablehnung und Intoleranz nehmen insbesondere gegenüber grossen Gästegruppen aus fernen Kulturen zu und Kapazitätsengpässe entstehen.
PORTRÄT LUÍS ARAÚJOStudium der Rechtswissenschaft Von 2016 bis 2023 CEO von Turismo de Portugal: Vorsitzender eines Teams von 650 Personen sowie weiteren 350 externen Trainern, mit denen 26 Quellmärkte für Portugal abgedeckt werden Vor 2016 Geschäftsleitungsmitglied der Pestana Group mit 100 Hotels in 15 Ländern, Verantwortlicher für die nachhaltige Entwicklung in Lateinamerika Von 2005 bis 2007 Stabschef des portugiesischen Staatssekretariats für Tourismus Von 2020 bis 2023 Präsident der European Travel Commission (ETC) mit 33 nationalen Tourismusorganisationen (NTO) Europas
Ob die Chancen des interkulturellen Austauschs genutzt werden können oder sich die Konfliktsituationen häufen, hängt stark von der Art und Weise ab, wie gereist wird – Form, Intensität und Einstellungen –, welche Gastgeberkultur herrscht und wie die Gästeströme gelenkt werden. Während auf Kreuzfahrten oder in Clubferien eher der zwischenmenschliche Kontakt unter den Touristen im Vordergrund steht, spielen bei Bildungs- und Studienreisen Begegnungen mit Einheimischen eine bedeutendere Rolle.
Aus all diesen Reflexionen ergab sich ein Bündel von Fragen, die wir anlässlich der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin mit Luís Araújo, dem damaligen CEO von Turismo de Portugal und Präsidenten der European Travel Commission (ETC), besprachen.
Kampagnen mit immateriellen Botschaften
Ein relevanter Aspekt des Tourismus ist der interkulturelle Austausch. Was fällt dir als Erstes dazu ein?
Luís Araújo: Ich bin auf der Ferieninsel Madeira aufgewachsen. In meiner Kindheit habe ich dadurch ein starkes Gefühl für Tourismuswerte mitbekommen. Meine Eltern luden oft Touristinnen und Touristen, die sie beim Spazierengehen trafen, zu uns nach Hause zu einem Essen ein. Wenn sie später auf die Insel zurückkehrten, besuchten sie uns wieder, und die Beziehung wurde fortgesetzt. Diese Erfahrung zeigte mir die Kraft des interkulturellen Austauschs: Menschen zusammenzubringen, um voneinander zu lernen. Die Gastfreundschaft meiner Familie gegenüber den Gästen war trotz der Sprachbarriere eigentlich immer eine Win-win-Situation. Meine Grossmutter, die kein Englisch sprach, kommunizierte mithilfe der Zeichensprache. Meine Eltern schlossen interessante Freundschaften ausserhalb der kleinen Insel, und unsere Gäste hatten die einmalige Gelegenheit, das Leben auf Madeira authentisch zu erleben. Ich glaube, dass dieser zwischenmenschliche Austausch das Herzstück des Tourismus ist. Es gibt zwar Herausforderungen und Risiken, aber das Potenzial für bereichernde Erfahrungen ist grenzenlos. Bereits meine Jugend hat mir aufgezeigt, dass ein offener Umgang mit Gästen für beide Seiten positive Auswirkungen haben kann.
«Die Chancen des interkulturellen Austauschs hängen stark von der Art und Weise ab, wie gereist wird – Form, Intensität und Einstellungen –, welche Gastgeberkultur herrscht und wie die Gästeströme gelenkt werden.»
«Die Kraft des interkulturellen Austauschs besteht darin, Menschen zusammenzubringen, um voneinander zu lernen.»
Wird der interkulturelle Austausch bei Turismo de Portugal gezielt gefördert oder muss sich dies individuell und situativ ergeben?
In unserem kleinen Land und seinen Menschen war es schon immer wichtig, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Unterschiede willkommen sind und respektiert werden sollten. Diese Überzeugung steht im Mittelpunkt unserer Zielsetzung und ist etwas, das wir in unseren Kampagnen hervorheben. Wir wollen Portugal nicht nur als Reiseziel für touristische Attraktionen anpreisen, sondern als Ort zeigen, an dem Menschen unabhängig von Herkunft oder Interessen herzlich willkommen sind. Wir möchten den Reisenden ans Herz legen, dass es beim Reisen nicht nur darum geht, etwas zu nehmen, sondern auch darum, etwas zurückzugeben. Unsere Kampagnen sind darauf ausgerichtet, diese Botschaft weltweit zu verbreiten, ohne die Marke Portugal zu oft zu verwenden. So deuten wir darauf hin, dass sich unsere Gäste nicht allzu stark von uns unterscheiden und wir uns als gleichwertig betrachten sollten.
Wird der interkulturelle Austausch in den Kampagnen als Marketingbotschaft genutzt oder überrascht ihr die Gäste damit erst vor Ort? In Peru wird beispielsweise neben dem Besuch historischer Stätten wie den Incatempeln auch ein Austausch mit indigenen Gemeinschaften explizit empfohlen, um die Kultur des Landes besser zu verstehen.
«Vor zwei Jahren starteten wir die Kampagne ‹Travel better›, die Reisende dazu ermutigt, die Gastfreundschaft unseres Landes zu erleben, anstatt nur touristische Highlights abzuarbeiten.»
Unsere Kampagnen heben die Gastronomie, die Geschichte, die Denkmäler und die Sehenswürdigkeiten des Landes insbesondere in den sozialen Medien hervor. Das Hauptkonzept der Kampagnen basiert jedoch nicht nur auf diesen bekannten Elementen. Unsere letzte Kampagne «Time to be» war beispielsweise ein Konzept mit immateriellen Botschaften, das Portugal als ein gastfreundliches Reiseland hervorhebt. In unseren Kampagnen versuchen wir, ein Gefühl der kulturellen Integration zu vermitteln, anstatt platt affirmativ zu klingen. Vor zwei Jahren starteten wir die Kampagne «Travel better», die Reisende dazu ermutigt, die Gastfreundschaft unseres Landes zu erleben, anstatt nur touristische Highlights abzuarbeiten. Wir konzentrieren uns darauf, jene Reisenden zu erreichen, die die portugiesischen Werte zu schätzen wissen.
LERNERFAHRUNGEN AUS DEN REISEERLEBNISSEN VON REISEJOURNALISTIN SUSANNA MÜLLER
Quelle: NZZ vom 19.11.2022.
Susanna Müller reiste oft in Länder mit unterschiedlichen Werten und Bräuchen. Sie nahm von jedem Ort, den sie besuchte, etwas mit. Die Ansammlung von interkulturellen Erkenntnissen ist beeindruckend.
«In der Unordnung wohnen böse Geister»: Susanna lernte von Ali, einem Berber aus Siwa in Ägypten, dass Unordnung böse Geister anziehen kann. Seitdem ist sie wachsamer und beobachtet, wo sich in ihrer Wohnung Unordnung und Chaos ansammeln.
«Etwas zurückgeben macht glücklich»: Beat, der Schweizer Reiseleiter, der besonders mit den Tuareg in Afrika verbunden ist, zeigte Susanna, dass das Helfen und das Zurückgeben an andere Menschen Freude und Glück bereiten.
«Einfachheit bringt Klarheit»: Auf einer Reise nach Grönland erfuhr Susanna, dass ein einfaches Leben ohne viele materielle Dinge grosse Klarheit und Freiheit ermöglichen kann.
«Man kann immer etwas lernen»: Susanna lernte in Mexiko die lokale Küche kennen und erkannte, dass es mit etwas Neugier immer wieder Neues zu entdecken gibt, selbst wenn man glaubt, eine Sache bereits gut zu kennen.
«Kommunikation ist der Schlüssel»: In Indonesien wurde Susanna klar, dass Sprachbarrieren dazu führen können, dass man sich gegenseitig missversteht. Sie erkannte, wie wichtig es ist, die Sprache des Gastlandes zu verstehen, um Kulturen besser kennenzulernen und Gastfreundschaft zu geniessen.
Unterschiedliche Bedeutung von interkulturellem Austausch
Im Schweizer Tourismus ist die Bedeutung des interkulturellen Austauschs vergleichsweise weniger ausgeprägt, weil Landschaft, Berge und Natur im Vordergrund stehen. Habt ihr bei euren Erhebungen irgendwelche Trends bezüglich des Interesses von Gästen an interkulturellem Austausch ausgemacht?
Begegnungen mit Menschen sind ein entscheidender und aufwertender Teil der Reiseerfahrung. Viele Reisende sind zwar nicht auf philosophische Diskussionen vorbereitet, die beim Zusammentreffen mit Menschen aus anderen Kulturen entstehen können, aber wenn es dazu kommt, empfinden sie es oft als eine wertvolle Bereicherung. In Portugal sind Begegnungen mit Menschen der wichtigste Teil einer Reise, gefolgt von dem Klima, der Landschaft, dem Essen, der Geschichte und dem Erzählen von Geschichten.
Interessant ist, was Reisen sowohl bei Touristen wie auch bei den Einheimischen auslösen können. In Lissabon zum Beispiel kommen Besucher manchmal zunächst für eine Woche, verlängern dann aber ihren Aufenthalt um Monate oder beschliessen sogar, sich niederzulassen, eine Wohnung zu kaufen oder ein Unternehmen zu gründen. Dies kann Vielfalt und neue Ideen in die Stadt bringen, aber es kann auch zu Spannungen führen, wenn Besucher die lokalen Werte sowie die Lebens- und Denkweisen nicht respektieren. So eröffneten beispielsweise einige französische Unternehmer Geschäfte oder Restaurants in Lissabon, doch wird dort nur auf Französisch oder Englisch kommuniziert: Speisekarte, Angebote, Mitarbeitende. Sie ignorieren die lokale Sprache und Kultur. Ein solches Verhalten ist respektlos gegenüber der Gastgeberstadt und ihren Einwohnern, die ja auch Kunden sind.
«In Portugal sind Begegnungen mit Menschen der wichtigste Teil einer Reise, gefolgt von dem Klima, der Landschaft, dem Essen, der Geschichte und dem Erzählen von Geschichten.»
Wie würdest du den Stellenwert des interkulturellen Austauschs in Portugal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Glaubst du, dass Portugal dem menschlichen Miteinander eine höhere oder niedrigere Priorität einräumt als die Schweiz?
Ich würde Portugal eine 8 geben. Was die Relevanz des interkulturellen Austauschs betrifft, so legt die Schweiz grossen Wert auf die Schönheit der Natur, die Infrastruktur, die Züge, die Berge usw. Die Bedeutung der zwischenmenschlichen Interaktionen steht wohl nicht ganz so weit oben auf der Prioritätenliste wie bei uns in Portugal.
Wir sind auch der Meinung, dass wir in der Schweiz dem interkulturellen Austausch mit den Gästen, die uns besuchen, eine höhere Priorität einräumen sollten. Die sozialen Bedingungen und die Unterschiede im Lebensstil zwischen der Schweiz und den südlicheren Ländern wie Portugal tragen zu diesem Unterschied bei, vielleicht auch, dass wir in der Schweiz temperaturbedingt mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, während Menschen im Süden öfters draussen sind und zwischenmenschliche Kontakte pflegen. Welchem europäischen Land oder welcher Region würdest du eine 10 geben?
Madeira.
Die Priorität des interkulturellen Austauschs liegt also in Portugal bei 8 und in der Schweiz bei 3 bis 4. Wo würde deiner Meinung nach Europa als Ganzes rangieren?
Zwischen 4 und 5, denn bestimmt gehört Europa im globalen Quervergleich nicht zu den gast- und kommunikationsfreundlichsten Kontinenten. Soft Skills sollten im Vordergrund stehen, auch um die Vielfalt und die Werte Europas (Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit) hervorzuheben.
DISCLAIMER AUF LINKEDIN VON MARTIN NYDEGGER
https://ch.linkedin.com/in/martinnydegger
«DISCLAIMER: At Switzerland Tourism we believe that travelling, exploring new cultures, and meeting different people is essential for broadening our mental and human horizon. Discover the world – start in Switzerland.»
Noch die umgekehrte Richtung: Die Schweizer und Schweizerinnen sind sehr reisefreudig und reisegewohnt, doch die Sehnsucht nach interkulturellem Austausch in den Ferien halten sich mit unserem eigenen Schätzwert von 5 bis 6 in Grenzen. Welchen Stellenwert hat er für Portugiesen, wenn sie ins Ausland reisen?
Portugiesen haben hohe Erwartungen, wenn sie ins Ausland reisen, sind stark vom Wunsch nach interkulturellem Austausch geprägt. Ich würde die Priorität des interkulturellen Austauschs mit 8 bis 9 bewerten. Wenn man sich die Länder ansieht, die sie am liebsten besuchen, wird deutlich, dass sie sich von warmen und einladenden Orten wie Brasilien oder Asien angezogen fühlen. Was die Nähe betrifft, so sind Kurzstreckenziele wie Spanien oder die Mittelmeerländer bei den Portugiesen ebenfalls beliebt, da diese Länder seit Langem den Ruf haben, zugänglich und freundlich zu sein.
Geschichte und Migration haben Einfluss auf den interkulturellen Austausch
Inwieweit ist Portugal offen für Kulturen, die sich von der eigenen stark unterscheiden? Wie aufgeschlossen ist Portugal insbesondere gegenüber Menschen aus Ländern wie Indien, Japan und China oder aus dem arabischen Raum?
Ich würde gerne sagen, dass Portugal allen Kulturen gegenüber gleichermassen aufgeschlossen ist. Tatsache ist aber, dass wir dazu neigen, einige Nationalitäten zu bevorzugen. Das mag an unserer Geschichte, an Konflikten oder Freundschaften mit bestimmten Ländern liegen. So schätzen wir zum Beispiel Brasilianer sehr. Allerdings hatten wir in der Vergangenheit einige Probleme im Zusammenhang mit grossen Migrationswellen aus Brasilien, die zu sozialen Spannungen führten. Es ist schwierig, derartige Probleme von der Art und Weise zu trennen, wie wir Gästen begegnen. Die Einwanderung hat erhebliche Auswirkungen auf den Umgang mit anderen Kulturen.
«Letztlich geht es weniger um eine Segmentierung als vielmehr um Offenheit, um Neugierde oder um Einstellungen.»
Ist der interkulturelle Austausch in deinen Augen für den Luxustourismus oder den Rucksacktourismus wichtiger?
Es scheint, dass der interkulturelle Austausch für alle wichtig ist, auch für den neuen Luxustourismus, der den Schwerpunkt vermehrt auf Begegnungen legt. Es kann jedoch von der Art des Reisens abhängen, ob der Austausch eher innerhalb der eigenen Reisegruppe oder eher mit den Einheimischen stattfindet. Auf einer Kreuzfahrt, in einem Clubhotel oder einem Fünf-Sterne-Luxushotel tauschen sich Touristen und Touristinnen eher untereinander aus. Andererseits neigen Rucksacktouristen dazu, den interkulturellen Austausch mit Einheimischen zu suchen, was durch das junge Alter oder die Nutzung des öffentlichen Verkehrs begünstigt wird. Letztlich geht es weniger um eine Segmentierung als vielmehr um Offenheit, um Neugierde oder um Einstellungen.
Ist der interkulturelle Austausch kostenlos oder eher eine Investition?
Um den interkulturellen Austausch zu erhöhen, muss in die Entwicklung der sozialen Kompetenzen der Menschen «investiert» werden. Es handelt sich um einen zweistufigen Prozess: Erstens muss den Menschen beigebracht oder in Erinnerung gerufen werden, stolz auf ihr Land zu sein. Zweitens müssen die Einheimischen für den Tourismus und dessen Wichtigkeit sensibilisiert werden. Ich wünschte, dass Schulen und Universitäten ihren Schwerpunkt etwas verlagern von Hard Skills auf Soft Skills und interkulturelles Lernen (vgl. Kästchen) respektive den Tourismus als wichtigen Teil der Wirtschaft in ihre Lehrpläne aufnehmen. Es scheint, dass der Beruf des Ingenieurs weltweit einen höheren Stellenwert hat als der einer Hotelfachkraft oder von anderen dienstleistungsorientierten Berufen, und dies sollte korrigiert werden, um den Wert einer Karriere in dieser Branche anzuerkennen.
DIE BEDEUTUNG DER HISTORISCHEN GRAND TOUR
Grand Tour, auch Kavalierstour oder Cavaliersreise, war die Bezeichnung für eine seit der Renaissance obligatorische Reise der Söhne des europäischen Adels, später auch des gehobenen Bürgertums, durch Mitteleuropa, Frankreich, Italien, Spanien oder auch ins Heilige Land. Im erweiterten Sinne wurden auch Bildungsreisen erwachsener Angehöriger unterschiedlichster Stände so bezeichnet. Insbesondere in England fand die Grand Tour im 18. Jahrhundert einen reichen literarischen Niederschlag.
Auch heute sind unterschiedliche Formen von Grand Tours populär: als Rundreise mit dem Auto, dem Motorrad, dem Bike oder dem Zug. Das Kernmotiv bleibt der internationale Austausch. Durch das Kennenlernen von fremden Kulturen wächst die Erfahrung, die Reife, die Eigenständigkeit und der Charakter.
Risiken des interkulturellen Austauschs
Werden Vorurteile und Stereotype von Touristinnen und Touristen auf ihren Reisen in fremden Kulturen eher verstärkt oder eher abgebaut?
Ich bin überzeugt, dass der Kontakt mit anderen Kulturen durch Reisen die Wahrnehmung der Menschen verändert und zu mehr Toleranz und Respekt führen kann. In Portugal, einem traditionell katholischen Land mit relativ wenigen Besuchern aus dem Nahen Osten, hat die steigende Zahl der arabischen Besucher zu einem grösseren Verständnis geführt. Vorurteile wurden korrigiert. Wenn sich Menschen öffnen und mehr Akzeptanz zeigen, kann sich die Haltung gegenüber anderen Kulturen verändern.
INTERKULTURELLE KOMPETENZ
Quelle: https://www.lern-und-berufswelt.de.
Bei der interkulturellen Kompetenz handelt es sich um die Fähigkeit, respektvoll mit Menschen anderer Kulturen umzugehen, Unterschiede zu akzeptieren und Missverständnisse, Konflikte und Kulturschock-Erlebnisse zu vermeiden.
Die interkulturelle Kompetenz kann in drei Bereiche unterteilt werden:
Wissen (kognitiv): Sprachkenntnisse, landesspezifisches Wissen, Kulturkonzepte, Ethnozentrismus usw.
Fähigkeiten (affektiv): Beobachtung, Selbstreflexion, Anerkennung und Wertschätzung, Offenheit usw.
Fertigkeiten (behavioral): Stressmanagement, Konfliktbewältigung, gewaltfreie Kommunikation, Kommunikationskompetenzen usw.
Oft wird das interkulturelle Lernen in einem Phasenmodell dargestellt: Verleugnung (1), Abwehr (2), Bagatellisierung (3), Akzeptanz (4), Anpassung (5), Integration (6), interkulturelle Kompetenz (7).
10 Tipps zur Förderung der interkulturellen Kompetenzen
1.Das Wissen um andere Kulturen anreichern
2.Nachfragen, ohne auszufragen
3.Unsicherheiten und Irritationen frühzeitig klären
4.Interesse am Gegenüber zeigen
5.Eigene Wahrnehmungen reflektieren
6.Verallgemeinerungen vermeiden
7.Mehrdeutigkeiten akzeptieren, niemand muss allein recht haben
8.Sich in die Lage des Gegenübers versetzen
9.Ständige Bereitschaft, dazuzulernen und Neues zu erkunden
10.Die eigene Haltung und den eigenen Standpunkt zeigen
«Es ist wichtig, dass Reisende eine respektvolle Haltung gegenüber den Menschen und Kulturen vor Ort einnehmen und sich bewusst sind, dass sie Gäste in einem fremden Land sind.»
Reisen kann helfen, Gemeinsamkeiten und Verbindungen untereinander zu finden, statt sich auf (störende) Unterschiede zu fokussieren. An die Adresse der Gäste: Es ist wichtig, dass Reisende eine respektvolle Haltung gegenüber den Menschen und Kulturen vor Ort einnehmen und sich bewusst sind, dass sie Gäste in einem fremden Land sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Reisen in fremde Länder die Macht hat, Menschen zu transformieren und das Verständnis für andere Kulturen zu stärken.
Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, ob bestimmte Nationalitäten, Kulturen oder Verhaltensweisen eine Rolle spielen, wenn es an exponierten Orten zu Overtourism-Situationen mit einer Häufung von Touristen kommt?
Natürlich kann es zu Störungen des täglichen Lebens kommen, wenn sich Massen von Menschen – unabhängig von ihrer Nationalität – zu bestimmten Jahreszeiten oder Uhrzeiten in konzentrierter Form an beliebten Reisezielen und Attraktionen aufhalten. Viele halten dies für eine Auswirkung bestimmter Aktivitäten, beispielsweise wenn Kreuzfahrtschiffe anlegen und Tausende von Menschen gleichzeitig von Bord gehen. Oder sie geben spezifischen Nationalitäten die Schuld, wenn wegen Gruppen, zum Beispiel aus asiatischen Ländern, in Situationen mit begrenzten Kapazitäten Engpässe entstehen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass Störungen weniger mit der Segmentierung oder der Nationalität zu tun haben, sondern vielmehr mit einem schlechten Management der Reiseströme. Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass es weniger um die Art des Reisens oder die Farbe des Reisepasses geht, sondern um die intelligente Steuerung der Reise- und Personenströme. Eine weitere Sorge sind langfristige Auswirkungen eines florierenden Tourismus, zum Beispiel die Wohnungsknappheit oder der Anstieg der Grundstückspreise in beliebten Reisezielen aufgrund der steigenden Nachfrage von Ausländern.
SUCHEN STATT FINDEN
Quelle: Hansruedi Müller.
Be-nehmen statt nehmenzu-hören statt hörenbe-greifen statt greifenver-stehen statt da-stehenbe-gegnen statt ent-gegnener-leben statt aus-lebenachten statt ver-achtenlachen statt aus-lachenfragen statt antwortensuchen statt finden.
«Beim interkulturellen Austausch geht es im Kern um gegenseitigen Respekt. Und der Schlüssel dazu ist eine klare Kommunikation.»
Kann es beim Kulturaustausch zwischen Reisenden und Einheimischen auch zu rassistischen Konflikten kommen, insbesondere dann, wenn die einheimische Bevölkerung die kulturellen Unterschiede als störend empfindet?