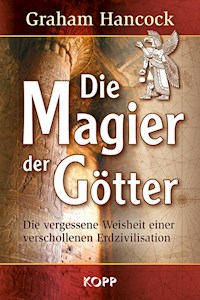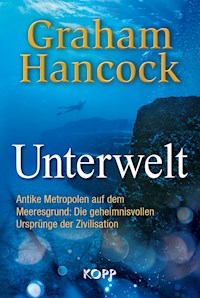
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was uns versunkene Städte auf dem Grund der Ozeane über frühgeschichtliche Hochkulturen berichten
Welche Geheimnisse verbergen sich in den Tiefen der Ozeane? Unterwelt entführt Sie auf eine außergewöhnliche Reise zum Meeresgrund. Sie werden Zeuge einer spannenden Jagd nach uralten, noch nie zuvor entdeckten Ruinen.
In diesem brisanten Buch begibt sich der bekannte Forscher und Bestsellerautor Graham Hancock auf eine faszinierende unterseeische Entdeckungsreise und beschreibt seine archäologische Detektivarbeit in den Tiefen der Meere. Sein Ziel: die Ruinen einer mythischen verschollenen Zivilisation zu finden, die seit Jahrtausenden in den Weltmeeren verborgen sind. Mithilfe modernster Wissenschaft, innovativer Computer-Kartierungsverfahren und neuester archäologischer Erkenntnisse untersucht Hancock das große Geheimnis am Ende der letzten Eiszeit und stellt mit seinen erstaunlichen Entdeckungen alles infrage, was wir bisher über die versunkene Welt am Meeresgrund zu wissen glaubten.
Versunkene Königreiche auf dem Meeresgrund
In spannenden Berichten über seine eigenen Tauchabenteuer vor den Küsten Japans, aber auch im Mittelmeer, im Atlantik und im Arabischen Meer lässt Hancock den Leser direkt an der Entdeckung uralter unterseeischer Ruinen teilnehmen. Die Bauwerke im Meer liegen genau dort, wo sie von den alten Mythen und Legenden lokalisiert wurden - es sind jene Unterwasserkönigreiche, an die die etablierte Archäologie bisher nie geglaubt hat.
Lassen Sie sich von Unterwelt begeistern und lesen Sie dieses provokante Buch, das handfeste Beweise für eine vergessene Epoche der Menschheitsgeschichte mit einer völlig neuen Erklärung für den Ursprung der Zivilisation kombiniert.
»Hancock fordert mit seinen ungewöhnlichen Theorien über eine untergegangene frühe Zivilisation die etablierte Geschichtswissenschaft heraus. . Sein Streifzug durch die vorgeschichtliche Welt ist ebenso kühn wie fesselnd.« Daily Mail
Seit über 15 Jahren fand sich kein deutscher Verlag, der bereit gewesen wäre, dieses brisante und enorm wichtige Buch zu veröffentlichen. Nun liegt es erstmals und ungekürzt in deutscher Sprache vor!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
1. Auflage November 2019 Copyright © 2002 bei Graham Hancock Originally published in Great Britain by Michael Joseph, an imprint of The Penguin Group, London. Illustrationen © 2002 bei David Graham Fotos © 2002 bei Santha Faiia Reinel-Karte von 1510 © The Bodleian Library, University of Oxford. Faksimile von Portugaliae Monumenta Cartographica, G24/B1.62 (B1) Tafel (9). Cantino-Karte von 1510 © The Bodleian Library, University of Oxford. Faksimile von Portugaliae Monumenta Cartographica, G24/B1.62 (B1) Tafel (5). Pisan-Karte von circa 1290 © Bibliothèque Nationale de France. Illustration Behaim-Globus, kartografische Degeneration von Japan © Robert H. Fuson. Legendary Islands of the Ocean Sea, 1995. Titel der englischen Originalausgabe:Underworld. The Mysterious Origins of Civilization Copyright © 2019 für die deutschsprachige Ausgabe bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Übersetzung aus dem Amerikanischen: Peter Hiess Lektorat: Jorinde Reznikoff Satz und Layout: Martina Kimmerle Umschlaggestaltung: Koen Peleman ISBN E-Book 978-3-86445-719-7 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Widmung
Für Santha …, weil sie wieder dabei war.
Mit meiner ganzen Liebe.
Danksagungen
Danksagungen
Unterwelt war ein gigantisches, ausgesprochen forderndes Vorhaben, das sich über beinahe 5 Jahre hinzog. Daher kann ich an dieser Stelle nur einigen der vielen Personen danken, die auf diese oder jene Weise dazu beigetragen haben.
Zuallererst danke ich meiner Frau Santha, die bei jedem einzelnen Schritt auf dieser Reise an meiner Seite war und alle Risiken mitgetragen hat, jeden Tauchgang mit mir gemeinsam unternommen hat, sich mit mir jeder Herausforderung gestellt hat – und ebenso wie ich 5 Jahre lang praktisch nur für Unterwelt gelebt hat. Alle Fotos im vorliegenden Buch stammen natürlich von Santha; aus Platzgründen können wir leider nur einen winzigen Bruchteil ihrer Arbeiten abdrucken. Eine wesentlich größere Auswahl der wunderbaren Bilder von unseren Abenteuern finden Sie auf meiner Website www.grahamhancock.com.
Ein besonderer Dank geht an meinen brillanten Rechercheur Sharif Sakr, der im Sommer 2000, als ich gerade mit dem Schreiben dieses Buches begann, direkt von der Oxford University zu mir stieß. Sharif ist all das, was einen guten Forscher ausmacht: ein origineller Denker und ein eigenwilliger Macher, der mit hoher Intelligenz, schier grenzenloser Energie und unerschöpflicher Unternehmungslust ausgestattet ist. Man muss ihm nie sagen, was zu tun ist, weil er sich immer schon aus eigener Initiative ans Werk gemacht hat. Sharifs Beitrag zu den Stärken von Unterwelt ist unermesslich.
Ich bedanke mich auch bei John Grigsby, der vor Sharif einige Jahre lang mein wissenschaftlicher Mitarbeiter war, sowie bei Shanti Faiia für ihre ausgezeichnete Leistung bei der Recherche, Planung und Koordination vieler der Abbildungen im vorliegenden Buch. Dank auch an Sean Hancock für seine Recherchen zu den Eiszeit-Chronologien und die Erforschung von Gerüchten über Unterwasserruinen vor Pohnpei und Kosrae. Ebensolcher Dank gilt Leila Hancock für ihre Recherchen zum Wesen und den Eigenschaften Shivas. Weiterer Dank geht an Shakira Bagwandeen für ihre Forschungsaufzeichnungen zu mehreren Themenkomplexen der indischen Religion und Vorgeschichte.
Dr. Glenn Milne von der Geologischen Fakultät der University of Durham spielte eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung der in Unterwelt verwendeten Überflutungskarten. Dass Glenn so freundlich war, uns diese Karten zur Verfügung zu stellen, soll keineswegs bedeuten, dass er die hier aufgestellten Theorien und Ideen unterstützt; diese liegen in meiner alleinigen Verantwortung.
Ich danke auch Ashraf Bechai, der uns die geheimnisvollen unterseeischen megalithischen Fundstätten vor Alexandria gezeigt hat – vor allem die gigantischen Felsblöcke von Sidi Gaber, die die orthodoxe Archäologie bis heute nicht erklären kann.
In meinen Bemerkungen über Malta habe ich mich weitgehend auf die bemerkenswerten Forschungsergebnisse von Dr. Anton Mifsud gestützt. Ihm danke ich ganz besonders für die Erlaubnis, seine Erkenntnisse hier so ausführlich wiedergeben zu dürfen. Wenn meine Prognose zutrifft und tatsächlich bald ein neues Kapitel über die Urgeschichte Maltas geschrieben werden muss, dann liegt das einzig und allein an Antons unermüdlicher Suche nach der Wahrheit und den weitreichenden Forschungen zur maltesischen Vergangenheit, die er bis heute durchführt. Ich danke übrigens auch den Mitautoren von Antons Büchern – Charles Savona-Ventura, Simon Mifsud und Chris Agius Sultana.
In Indien schulde ich allen Mitarbeitern der archäologischen Abteilung des National Institute of Oceanography (NIO) großen Dank, insbesondere Kamlesh Vora, Sundaresh und Dr. A. S. Gaur. Mein besonderer Dank gilt auch Dr. Ehrlich Desa, dem Leiter des NIO, der sich sehr dafür einsetzte, uns die Tauchgänge in Dvaraka und Poompuhar zu ermöglichen, und Santha und mich bei unserem ersten Besuch in der NIO-Zentrale in Dona Paula in Goa mit so viel Freundlichkeit und Entgegenkommen empfing.
Ich bedanke mich auch beim indischen National Institute of Ocean Technology (NIOT), über dessen bahnbrechende Entdeckungen im Golf von Khambhat im vorliegenden Buch zum ersten Mal berichtet wird. Besonders seien an dieser Stelle Dr. S. Kathiroli, der Projektleiter des NIOT, Dr. S. Badrinarayan, geologischer Berater des NIOT, und G. Janaki Raman, der Leiter des Schiffsmanagements, erwähnt.
In Japan haben uns im Laufe der Jahre derart viele Menschen unterstützt, dass es unmöglich ist, sie alle hier aufzuzählen – mögen jene, deren Namen hier unerwähnt bleiben, mir vergeben. Besondere Erwähnung muss aber unser Freund Shun Daichi finden, der meine Bücher ins Japanische übersetzt und mich und Santha auf unseren Reisen in Japan (über und unter Wasser) begleitet hat. Ich danke auch dem Seamen’s Club in Ishigaki; ohne die Hilfe seiner Belegschaft und Unternehmensführung wären unsere Tauchabenteuer in Japan unmöglich gewesen. Abgesehen vom Seamen’s Club tauchten auch Kiyoshi Nagaki, Isamu Tsukahara, Kihachiro Aratake, Yohachiro Yoshimaru, Mitsutoshi Taniguchi und Kuzanori Kawai mit uns und unterstützten uns bei unseren Unterwasserforschungen.
Zu guter Letzt möchten Santha und ich noch unseren Kindern Ravi Faiia, Shanti Faiia, Sean Hancock, Leila Hancock, Luke Hancock und Gabriele Hancock für ihre Geduld danken, mit der sie es hinnahmen, dass wir so oft von zu Hause fort und mit anderem beschäftigt waren. Sie alle hatten auf ihre Art an unserem Abenteuer teil, lernten tauchen und begleiteten uns bei manchen unserer Tauchausflüge. Wir sind stolz und glücklich, eine so intelligente und unternehmungslustige Gruppe junger Leute um uns zu haben.
Graham Hancock
London, Januar 2002
Teil I – Initiation
Teil I
Initiation
Kapitel 1: Relikte
Kapitel 1
Relikte
Wenn man das Unerwartete nicht erwartet, entdeckt man es auch nicht, denn dann lässt es sich nicht aufspüren und bleibt unzugänglich.
Heraklit
5 Kilometer vor der Südostküste Indiens, 23 Meter tief in den trüben Gewässern des Golfs von Bengalen, wo es von Haien nur so wimmelt, befindet sich auf dem Meeresgrund ein uraltes von Menschen errichtetes Bauwerk. Der Bau hat die u-förmige Gestalt eines großen Hufeisens, einen Umfang von 85 Metern und Wände, die etwa 1 Meter dick und 2 Meter hoch sind. 1
Die Ruine wurde im März 1991 von einem Team aus Unterwasserarchäologen des indischen National Institute of Oceanography (NIO) entdeckt, als die Forscher vor der Küste von Tranquebar-Poompuhar bei Nagapattinam im Bundesstaat Tamil Nadu tätig waren. Sie waren mit einem Seitensichtsonar ausgerüstet, das eine bis zu 1000 Meter breite Schallwelle erzeugt und die Stärke des zurückkehrenden Echos misst. Mit einem solchen Sonar, das hinter einem Forschungsschiff hergeschleppt wird, lassen sich genaue Karten von Konturen am Meeresboden anfertigen und offensichtliche Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel Schiffswracks erkennen.
Am 7. März 1991 lokalisierte das Sonar in einer Tiefe von 19 Metern ein Wrack. Als es Taucher am 8. und 9. März genauer in Augenschein nahmen, entdeckten sie auf dem umgebenden Meeresgrund zahlreiche verstreute Objekte wie Bleibarren und Kanonenkugeln aus Eisen. Im offiziellen Projektbericht heißt es:
Die Taucher arbeiteten [am 9. März] bis 13 Uhr an den verstreuten Objekten. T. C. S. Rao, der 5 Kilometer vor Chinnavanagiri [unweit des Wracks] Sonarmessungen durchführte, berichtete davon, dass mittels Sonografie ein weiteres Objekt von 40 x 10 Meter aufgezeichnet wurde, das die Form eines Schiffs [?] hat. Shri Bandodkar wurde zur Fundstelle (die die Bezeichnung PMR2 erhielt) entsandt und brachte dort zwei Markierungsbojen aus. Um 14 Uhr begannen Manavi und Chinni ihren Tauchgang, doch da die Bojen abgetrieben waren, konnte das Objekt nicht erforscht werden. 2
Eine später an diesem Nachmittag durchgeführte zweite Erkundung mit dem Seitensichtsonar erbrachte präzisere Messergebnisse, die darauf hindeuteten, dass das Objekt oval war, in Ost-West-Richtung 30 bis 35 Meter und in Nord-Süd-Richtung 10 Meter maß. Auf einer Seite schien es eine Öffnung zu haben. 3
Am 16. und 19. März setzte T. C. S. Rao die Erkundung fort und berichtete:
Es handelt sich eigentlich um drei Objekte, deren zentrales eine ovale Form und eine Öffnung an der Nordseite besitzt. Seine längere Achse ist 20 Meter lang. An der östlichen Seitenfläche befindet sich eine Tonablagerung, unter der eine weitere halbkreisförmige Struktur zu erkennen ist. Im Südwesten des zentralen Objekts finden sich noch ein oder mehrere ovale Objekte. 4
Am 23. März 1991 schafften es drei Taucher endlich, das Objekt unter Wasser genauer zu untersuchen. Ihr Luftvorrat reichte aber nur für eine Erkundung der zentralen Struktur aus. Was sie dabei feststellten, wird im offiziellen Bericht wie folgt beschrieben:
ein hufeisenförmiges Objekt mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern. In dem 1 Meter breiten Arm wurden einige Steinblöcke gefunden. Die Distanz zwischen den beiden Armen beträgt 20 Meter. Ob das Objekt ein Schrein oder eine andere von Menschen errichtete Struktur ist, die nun 23 Meter unter Wasser liegt, kann erst in der nächsten Forschungskampagne untersucht werden. 5
Tief kann sehr alt bedeuten
Leider kam es hier im folgenden Jahr zu keiner neuen Forschungskampagne. Erst 1993 wurde die Struktur von den NIO-Unterwasserarchäologen erneut untersucht. Die Forscher nahmen genaue Messungen vor und berichteten über ihre Ergebnisse wie folgt:
Die u-förmige Struktur liegt etwa 5 Kilometer vor der Küste in einer Wassertiefe von 23 Metern. Der Gesamtumfang des Objekts beträgt 85 Meter, die Distanz zwischen den beiden Hufeisenarmen 13 Meter und die Maximalhöhe 2 Meter. Der östliche Arm ist höher als der westliche. Die Mitte des Objekts ist von Sedimenten bedeckt, jedoch konnten dazwischen kleinere Gesteinsflächen festgestellt werden. Beim Abwischen mit der Hand zeigte sich, dass der mittlere Teil des Objekts aus Gestein besteht und eine Tiefe von 10 bis 15 Zentimetern besitzt. Laut Beobachtung der Taucher ist die Struktur zwar dicht mit Meeresorganismen bewachsen, weist aber in einigen Abschnitten Mauerwerk auf. 6
Seit 1993 wurden vor der Küste von Poompuhar mangels Finanzierung keine unterwasserarchäologischen Maßnahmen mehr durchgeführt. In der archäologischen Fachliteratur machte sich der Eindruck breit, dass das NIO keine Unterwasserstrukturen entdeckt habe, die aus einer Zeit vor dem 3. Jahrhundert v. Chr. stammen. 7 Das mag zwar für zahlreiche Unterwasserruinen stimmen, die in unmittelbarer Nähe der Küste und zumeist in einer Tiefe von weniger als 2 Metern liegen, sodass oft Teile von ihnen bei Ebbe sichtbar werden, 8 doch bei der u-förmigen Struktur in 23 Metern Tiefe handelt es sich um etwas ganz anderes, das man keinesfalls automatisch dem 3. Jahrhundert v. Chr. zuordnen kann. Im Gegenteil: Da wir wissen, dass der Meeresspiegel in den vergangenen 19000 Jahren stetig angestiegen ist, 9 sagt uns schon der gesunde Menschenverstand, dass Bauten, die sich heute 23 Meter tief unter Wasser befinden, um einiges älter sein müssen als Ruinen in nicht einmal 2 Metern Tiefe.
»Niemand hat nachgesehen …«
Im Februar 2000 reiste ich nach Bangalore, um S. R. Rao, den Doyen der indischen Unterwasserarchäologie und Gründer des Marine Archaeology Centre am NIO, zu besuchen. Rao hatte die Erkundung vor der Küste von Tranquebar-Poompuhar geleitet. Zum Zeitpunkt meines Besuchs war er ein vornehmer Mittsiebziger mit schon etwas hageren Gesichtszügen, der sich aber nach wie vor mit unerschöpflicher Energie für sein Thema begeisterte. Nach einem ersten Austausch von Höflichkeiten erzählte ich ihm, dass mich die u-förmige Struktur, die sein Team vor Poompuhar entdeckt hatte, sehr faszinierte. »23 Meter sind ganz schön tief«, sagte ich, »könnte das nicht bedeuten, dass die Struktur sehr alt ist?«
»Aber ja, definitiv«, antwortete Rao, »dieser Ansicht waren wir auch. Wir nahmen sogar unseren Meerestechniker mit hinunter, um die Frage zu beantworten, ob die Struktur eventuell der Erosion durch das Meer oder ihres Eigengewichts wegen so tief gesunken sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Es handelt sich um ein gewaltiges Bauwerk, das errichtet wurde, als das Meer noch viel weiter draußen und der Bauplatz an Land war. Allerdings stellte sich uns die Frage, ob der Meeresspiegel in so kurzer Zeit so weit ansteigen konnte – 23 Meter in nur 2000 Jahren, war das möglich?«
»Vielleicht erfolgte der Anstieg des Meeresspiegels, der dieses Bauwerk überschwemmte, aber auch schon sehr viel früher«, warf ich ein. »Vielleicht stammt die Struktur aus einer sehr viel früheren Periode als die 2000 Jahre alten Ruinen in der Gezeitenzone vor Poompuhar? Es hat Meeresspiegelanstiege gegeben, die dafür verantwortlich gewesen sein könnten, aber die fanden vor sehr langer Zeit statt – am Ende der Eiszeit.«
»Richtig. Die fallen in diese Zeit. Sie haben recht.«
»Am Ende der Eiszeit gab es drei große Überflutungsereignisse, von denen allein das jüngste schon 8000 Jahre zurückliegt. Könnte die u-förmige Struktur aus dieser Zeit stammen?«
»Das wissen wir nicht«, sagte Rao, »weil wir aus den vorhandenen Materialien auf keine Entstehungszeit schließen können.«
»Warum nicht?«
»Weil sich in den entnommenen Proben kein organisches Material fand, das sich mit der C14-Methode hätte datieren lassen; ebenso wenig wie Keramik, die wir mittels einer Thermolumineszenz-Datierung oder Keramiktypologie hätten zuordnen können. Wir haben nur Steine, die sich nicht aussagekräftig datieren lassen.«
»Abgesehen von einem Faktor: Die Struktur liegt heute 23 Meter unter Wasser, und der Anstieg des Meeresspiegels könnte für die Datierung durchaus hilfreich sein.«
»Das ist korrekt. Mir ist eine ozeanografische Studie für den Golf von Kachchh im nordwestlichen Teil Indiens bekannt, laut der 10000 v. Chr. der Meeresspiegel 60 Meter tiefer lag als heute. Wenn das für dort gilt, dann gilt es auch für hier.«
»Und das könnte bedeuten, dass wir es mit den Hinterlassenschaften einer uralten unbekannten Kultur zu tun haben.«
»Uralt – auf jeden Fall!«, rief Rao aus. »Über die Frage, wo die Ursprünge der Indus-Kultur, der ältesten indischen Zivilisation, wirklich liegen, können die Gelehrten nur Vermutungen anstellen, doch keiner weiß es genau. Als die Indusschrift im 3. Jahrtausend v. Chr. erstmals auftauchte, war sie bereits eine hoch entwickelte Schrift; und auch die frühe Architektur dieser Kultur ist mit ihren Ziegelbauten, Abwasserkanälen, einer genauen Planung und anderem bereits sehr weit entwickelt. Also muss es davor schon etwas gegeben haben. Aber wo gibt es Belege für diese Entwicklungsphase? Bisher wissen wir nichts darüber.«
Mit diesen Worten war Dr. Rao nahe an den wahren Grund meines Besuchs herangekommen.
»Vielleicht lassen sich ja Beweise für diese Frühphase unter Wasser aufspüren«, sagte ich.
»Ja, unterseeisch. Das ist sehr gut möglich.«
»Wenn das der Fall ist, dann könnte dieses unterseeische Bauwerk vor Poompuhar unglaublich wichtig sein – allein schon der Wassertiefe wegen, in der es liegt.«
»23 Meter …«
»23 Meter, genau. Falls wir eine Landabsenkung ausschließen können – wozu, wie ich weiß, noch weitere Forschungen notwendig sind –, und sich diese Tiefe definitiv als Folge des steigenden Meeresspiegels erweist, dann haben wir es hier mit einer Entdeckung zu tun, die den allgemein anerkannten Zeitablauf der Zivilisation in Frage stellt.«
Rao dachte einen Augenblick nach, bevor er antwortete: »Wissen Sie, es gibt einige Leute und Traditionen, die davon ausgehen, dass es vor sehr langer Zeit, vor mehr als 10000 Jahren, einen Kontinent im Indischen Ozean gab, der später versank … Und das ist durchaus möglich. Wir führen ja in diesem Bereich keine gründliche wissenschaftliche Forschung durch. Wenn wir mehr Zeit und mehr Geldmittel zur Verfügung hätten, fänden wir vielleicht noch weitere Bauten dieser Art, und dann ließen sich Rückschlüsse auf dieses sehr viel frühere Zeitalter ziehen.«
Ich erzählte Rao, dass mir die südindischen Überlieferungen, von denen er sprach, bekannt waren. In ihnen ist von großen Landgebieten im Indischen Ozean die Rede, die sich einst südlich des heutigen Kap Komorin befanden und vor etwa 11000 Jahren im Meer versanken. Der mythische Kontinent trug den Namen Kumarikkandam. Als er überflutet wurde, lebte dort, so besagt die Überlieferung, eine hoch entwickelte Zivilisation, die sich sogar einer »Akademie« für höhere Studien rühmen konnte, an der Philosophie und Literatur gelehrt wurden.
»Sie muss existiert haben«, erklärte Rao, »jedenfalls kann man das keinesfalls ausschließen – vor allem seit wir, wie gesagt, dieses Bauwerk in 23 Metern Tiefe entdeckt haben. Wir haben es fotografiert, es ist da, jeder kann es sich ansehen. Meiner Ansicht nach handelt es sich nicht um einen vereinzelten Bau, sondern man wird bei fortgesetzten Erkundungen in seinem Umfeld noch mehr derartige Strukturen finden. Und dann kann man auch noch tiefer gehen, wissen Sie, und vielleicht sogar auf bedeutsamere Dinge stoßen.«
Ich fragte ihn, ob es seit 1993 weitere Versuche gegeben habe, vor Südindien unterseeische Ruinen aufzuspüren.
»Nein«, erwiderte Rao, »da hat niemand nachgesehen.«
Ken Shindos Geschichte
1996, 4 Jahre vor meinem Treffen mit Rao, landete mein Buch Die Spur der Götter in Japan – einem Land, das mich seit meiner Kindheit fasziniert hat – auf Platz eins der Bestsellerliste. Dank dieses Erfolgs hatte ich erstmals Gelegenheit, auch dieses Land zu bereisen.
Gleich zweimal besuchte ich Japan in diesem Jahr, um eine Reihe öffentlicher Vorträge zu Themen zu halten, die ich in Die Spur der Götter behandelt hatte. Bei meinem zweiten Besuch nahm nach einem dieser Vorträge ein Fotoreporter namens Ken Shindo, der für die einflussreiche Nachrichtenagentur Kyōdō Tsūshinsha arbeitet, Kontakt mit mir auf. Er zeigte mir beeindruckende Unterwasserbilder von einem bizarren terrassenförmigen Bauwerk. Shindo hatte die Fotos dieses anscheinend von Menschen geschaffenen Monuments vor der Südküste der japanischen Insel Yonaguni in bis zu 30 Metern Tiefe aufgenommen. Da die Möglichkeit einer untergegangenen Zivilisation, die in den verheerenden weltweiten Überschwemmungen am Ende der Eiszeit zerstört wurde, seit Jahren im Fokus meiner Forschung und schriftstellerischen Tätigkeit stand, stieß Ken Shindos Geschichte auf meine sofortige Begeisterung. »Eine unterseeische Ruine hier in Japan!«, rief ich begeistert aus. »Ist es denn sicher, dass sie von Menschen geschaffen wurde?«
»Manche Leute glauben, dass es sich um eine Laune der Natur handelt«, sagte Shindo nach einem kurzen Auflachen. »Aber die haben sich auch nicht so ausführlich damit beschäftigt wie ich. Ich bin absolut sicher, dass sie aus Menschenhand stammt.«
Shindo erzählte mir, dass er mit dem Meeresgeologen Professor Masaaki Kimura von der Universität Ryūkyū in der Präfektur Okinawa zusammengearbeitet habe. Kimura, der dieses mysteriöse unterseeische Bauwerk vor Yonaguni seit 1994 untersucht, ist ebenso davon überzeugt, dass es von Menschen erschaffen wurde. Seine umfassende Erforschung, Probenentnahme und Messtätigkeit haben gezeigt, dass die Struktur aus massivem Gestein geschlagen wurde, als der Standort noch nicht unter Wasser lag. Berücksichtigt man allein den Anstieg des Meeresspiegels, deuten vorläufige Berechnungen auf einen Überflutungszeitpunkt vor etwa 10000 Jahren hin.
Damit wäre der unterseeische Bau ungefähr 5000 Jahre älter als die ältesten bisher bekannten Monumentalbauten der Erde – die Zikkurats aus dem frühen Sumer in Mesopotamien.
Wie ein Seemannsgrab
Nun war mir klar, dass ich tauchen lernen musste. Ich überredete meine Frau Santha während eines Aufenthalts in Los Angeles, mit mir zusammen Tauchstunden zu nehmen; und im November 1996 machten wir in den kühlen, seetangreichen Gewässern vor Catalina Island eine Ausbildung zu autonomen Tauchern.
Am Anfang war das Tauchen eine merkwürdige und beängstigende Erfahrung für mich, sie schien allen Gesetzen der Natur zu widersprechen, und ich hatte das Gefühl, das kaum überleben zu können. Wie das Michelin-Männchen war ich in einen Ganzkörpertaucheranzug aus Neopren eingewickelt und schleppte eine geradezu lächerliche Menge Ausrüstung mit mir herum, die an meinem Körper festgeschnallt, mit Kreppband befestigt oder angehängt war.
Fangen wir mit den Füßen an. Ein Taucher trägt kurze Gummistiefel, die in die Knöchelmanschetten seines Anzugs gesteckt werden. Der Taucheranzug lässt eine dünne Schicht Wasser zwischen sich und die Haut des Tauchers; die Flüssigkeit erwärmt sich rasch auf Körpertemperatur und bleibt dann auch eine Zeit lang warm, weil das Neopren des Anzugs hervorragend isoliert. Über die Stiefel werden die Taucherflossen geschnallt, ohne die der Taucher unter Wasser fast so schwerfällig und unbeweglich wäre wie an Land, wenn er dort die gesamte Ausrüstung mit sich trüge. Paddelbewegungen ohne Flossen würden unnötig viel Energie verbrauchen. An die Wade des Tauchers sollte ein starkes Messer aus rostfreiem Stahl geschnallt sein, das lebensrettend sein kann, wenn man in ein Treibnetz oder eine andere unnachgiebige, meist von Menschen produzierte Gefahrensituation gerät.
Um die Taille trägt der Taucher einen Gürtel mit mehreren Bleigewichten, die den natürlichen Auftrieb des Körpers und den zusätzlichen Auftrieb des Taucheranzugs ausgleichen sollen. Mittlerweile nehme ich beim Tauchen häufig nur 2 Kilo Gewicht mit, aber unerfahrene Taucher brauchen da schon wesentlich mehr. Bei meinen ersten Tauchgängen im Jahr 1996 und der ersten Jahreshälfte von 1997 musste ich noch 12 und einmal sogar 14 Kilogramm mitschleppen – eine schwere Last.
Weiter oben am Körper trägt der Taucher zur Regulierung des Auftriebs eine Tarierweste (abgekürzt auch BCD für »Buoyancy Control Device« oder BC für »Buoyancy Compensator«). Hinten am BCD ist eine Druckluftflasche angebracht, die ihn unter Wasser mit Luft versorgt und 10, 12 oder 15 Liter enthält. Eine mittelgroße Flasche wiegt mehr als 15 Kilo und enthält bei den meisten Tauchgängen normale, aber stark komprimierte Atemluft. Diese Luft wird dem Taucher über zwei Umwandler zugeführt, die den Druck der Luft vermindern, bis sie problemlos eingeatmet werden kann. Die »erste Stufe«, der Druckminderer, ist oben an der Flasche angebracht und reduziert den Flaschendruck auf einen konstanten Mitteldruck. Von hier aus gelangt die Luft über einen Gummischlauch zur »zweiten Stufe«, dem Atemregler, dessen Mundstück in der Tauchmaske dem Taucher Luft auf knapp über Umgebungsdruck liefert. Aus dem Druckminderer führen noch drei weitere Schläuche heraus. Einer davon ist mit dem BCD verbunden, das vom Taucher direkt aus dem Drucklufttank aufgeblasen werden kann. Der zweite führt zu einer frei hängenden Instrumentenkonsole, die üblicherweise mit einem Kompass sowie Messgeräten ausgestattet ist. Letztere verraten dem Taucher, wie viel Luft er noch zur Verfügung hat und in welcher Tiefe er sich gerade befindet. Der dritte, der sogenannte Oktopus, ist eine zusätzliche zweite Stufe für Notfälle – zum Beispiel, wenn der Tank eines Taucherkollegen leer ist.
Manchmal tragen Taucher auch eine Kopfhaube aus Gummi, weil ein ungeschützter Kopf sehr schnell Wärme verliert. Eine Tauchermaske mit einer Sichtscheibe aus Glas, ohne die das menschliche Auge unter Wasser nur verschwommen sehen könnte, umschließt Augen und Nase. Weitere wichtige Ausrüstungsgegenstände sind ein kleiner Armbandcomputer, der dem Taucher die oft lebensrettende Information geben kann, dass er zu schnell aufsteigt, und ein paar Handschuhe, mit denen man die Hände warmhalten und vor Schürfwunden sowie versehentlichen Kontakten mit eher unangenehmen Meeresorganismen wie Feuerkorallen schützen kann.
Mit all diesem Zeug behängt und einer Taucherfahrung, die sich auf drei halbstündige Swimmingpool-Tauchgänge beschränkte, hatten Santha und ich gewisse Vorbehalte, was die Tiefen des Pazifiks anbelangte. Ehrlich gesagt, wir hatten Angst. Das Meer dort unten zwischen den hin- und herwogenden Seetangfäden sah tief, dunkel und gefährlich aus, wie ein Seemannsgrab … Doch wenn wir diesen unglaublichen Unterwasserbau in Japan mit unseren eigenen Augen betrachten wollten, kamen wir ums Tauchen nicht herum. Also folgten wir der Aufforderung unseres Tauchlehrers, sprangen ins Wasser und paddelten vom Ufer weg.
Vier Tage später hatten wir zwar unseren Tauchschein, aber noch lange nicht genug Erfahrung, um vor Yonaguni zu tauchen.
Ein großzügiges Angebot
Ich wusste nicht, wann wir einen Tauchausflug nach Japan organisieren würden können, aber ich wusste, dass er teuer werden würde. Doch dann kam es zu einer seltsamen Synchronizität: Im Januar 1997 erhielt ich aus heiterem Himmel ein Fax von einem amerikanischen Unternehmen, das einen japanischen Geschäftsmann vertrat. In dem Fax hieß es, besagter Geschäftsmann habe Die Spur der Götter gelesen und würde nun Santha und mich dazu einladen, erster Klasse nach Yonaguni zu fliegen, um die Insel und das Unterwassermonument dort zu erforschen. Außerdem wolle er für unsere Sicherheit sorgen, indem er uns auf seine Kosten eine Gruppe erstklassiger Tauchlehrer aus dem Seamen’s Club – einem Hotel mit Tauchschule auf der Nachbarinsel Ishigaki – sowie ein voll ausgestattetes Tauchboot und sämtliche weiteren Notwendigkeiten zur Verfügung stellen würde.
Das großzügige Angebot war an keinerlei Bedingungen geknüpft, also nahmen wir es gerne an. So flogen wir im März 1997 von London nach Tokio und von dort aus weiter über Okinawa nach Yonaguni, wo wir unsere ersten Tauchgänge unternahmen. Das war der Beginn einer langen Freundschaft mit dem japanischen Geschäftsmann (dessen Privatsphäre ich respektiere) und eines anfangs informellen Projekts zur Erforschung uralter und höchst ungewöhnlicher Bauwerke, die unter Wasser vor Yonaguni und anderen Inseln im südwestlichen Japan entdeckt worden waren, und die wir dokumentieren und in ihrer historischen Abfolge besser verstehen lernen wollten.
Yonaguni
Die erste ungewöhnliche Struktur, die vor Yonaguni entdeckt wurde, liegt an der Südküste der Insel unterhalb von finsteren Klippen. Die einheimischen Taucher nennen diese Stelle »Iseki Point« (Monument-Punkt). In die Südseite der Struktur wurde in einer Tiefe von etwa 18 Metern ein terrassierter Bereich mit auffällig ebenen Flächen und rechten Winkeln eingeschnitten. Zwei gewaltige, parallel zueinander angeordnete Steinblöcke mit je circa 30 Tonnen Gewicht, die durch einen Spalt von nicht einmal 10 Zentimetern Breite voneinander getrennt sind, sind in der nordwestlichen Ecke der Struktur nebeneinander aufgestellt. An der Oberseite der Struktur, in etwa 5 Metern Tiefe, befindet sich ein nierenförmiger »Pool«, und in dessen Nähe ein Element, das viele Taucher für die in den Felsen gehauene primitive Darstellung einer Schildkröte halten. Am Fuß der Struktur, in 27 Metern Tiefe, ist ein deutlich ausgeprägter, mit Steinen gepflasterter Weg zu sehen, der nach Osten weist.
Folgt der Taucher diesem Weg – was nicht schwierig ist, da an dieser Stelle oft eine West-Ost-Strömung herrscht –, dann gelangt er nach wenigen Hundert Metern zum »Megalithen«, einem abgerundeten, 2 Tonnen schweren Felsblock, der so aussieht, als wäre er absichtlich auf einem eingeschnittenen Felsvorsprung in der Mitte einer riesigen Steinplattform platziert worden. 10
2 Kilometer westlich vom Iseki Point befindet sich der »Palast«. Hier führt ein unterseeischer Durchgang zum nördlichen Ende einer geräumigen Kammer mit megalithischen Mauern und einer ebensolchen Decke. Am Südende der Kammer gibt ein hohes Portal mit Türsturz den Weg in eine dahinterliegende kleinere Kammer frei. Am Ende dieser zweiten Kammer stößt man auf einen vertikalen, aus dem Felsen gehauenen Schacht, der zum Dach des »Palasts« führt. In der Nähe ist ein flacher Stein mit einem Muster aus seltsamen tiefen Rillen zu sehen. Ein klein wenig östlich davon befindet sich ein zweiter megalithischer Durchgang, dessen Dach von einer gigantischen Steinplatte gebildet wird, die passgenau auf den Oberseiten der Stützmauern aufliegt.
2 Kilometer östlich vom Iseki Point finden wir Tategami Iwa (wörtlich: der »stehende Gottstein«), eine natürlich ausgebildete Spitze aus zerklüftetem schwarzen Fels, die aus dem Meer ragt. Am Fuß dieses Gebildes verläuft in 18 Metern Tiefe ein horizontaler Tunnel, in dem nicht mehr als ein Taucher Platz hat und der vollkommen gerade von Westen nach Osten verläuft, wo er zwischen verstreuten Felsblöcken mit sauber geschnittenen Kanten wieder hervorkommt.
Schwimmt man von hier 3 Minuten lang nach Südosten, so gelangt man zu einer Ansammlung von Gebilden, die aussehen wie eine ausgedehnte, aus Stein gemeißelte zeremonielle Anlage. In einer Wassertiefe von 15 bis 25 Metern findet man hier massive geradlinige Strukturen mit steilen Wänden, die durch breite Straßen voneinander getrennt sind.
Im Zentrum liegt das Monument, das Taucher die »Steinbühne« nennen und in dessen südwestlicher Ecke die Natur oder aber der Mensch ein Bild geformt hat, das für manche wie ein gigantisches menschenähnliches Gesicht mit zwei deutlich erkennbaren Augen aussieht …
Kerama-Inseln
Vor der Insel Aka in der Kerama-Inselgruppe 40 Kilometer westlich von Okinawa fanden einheimische Taucher vor einigen Jahren in einer Wassertiefe von 30 Metern eine Reihe von Steinkreisen. In demselben Gebiet wurden auch dazugehörige geradlinige Gebilde entdeckt, die so aussehen, als wären sie von Menschen behauen und bearbeitet worden.
Die Tauchverhältnisse vor den Kerama-Inseln sind ausgesprochen schwierig (ähnlich wie bei Yonaguni). Es herrscht dort eine starke und gefährliche Strömung, die aber zwischen Ebbe und Flut für ungefähr eine Stunde fast völlig aussetzt. Nur während dieser Pause kann man produktiv arbeiten und diese rätselhaften Strukturen näher erkunden, ohne dauernd gegen das Meer ankämpfen zu müssen.
Das am meisten beeindruckende Gebilde in der Nähe der Kerama-Inseln ist der »Zentralkreis« mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern und einer maximalen Tiefe von 27 Metern. Hier wurden konzentrische Ringe aufrecht stehender Megalithen von mehr als 3 Metern Höhe aus dem Felsen geschlagen, die in ihrer Mitte einen Menhir umgeben.
Ein zweiter, ganz ähnlicher Kreis, der von einheimischen Tauchern als »Kleiner Zentralkreis« bezeichnet wird, befindet sich unmittelbar nordöstlich davon und ist deutlich kleiner als der erste Kreis.
Ein Stück weiter südlich liegt der »Steinkreis«, der aus viel kleineren abgerundeten Steinen besteht und einen gewaltigen Durchmesser von circa 150Metern aufweist. In seinem Inneren befinden sich untergeordnete Steinkreise, die einander gelegentlich wie Kettenglieder an den Rändern berühren.
Die Insel Aguni
Die Insel Aguni, 60 Kilometer nördlich der Kerama-Inselgruppe, zeichnet sich durch ihre steilen, unzugänglichen Klippen aus. An der Südwestseite der Insel ragen diese Klippen über einer turbulenten Meeresregion auf, die von den örtlichen Fischern »Waschmaschine» genannt wird. Die Turbulenzen werden durch einen Unterwasserberg verursacht, der aus großer Tiefe ragt und etwa 4 Meter unterhalb der Meeresoberfläche ein kleines Plateau bildet. Auf dieser Ebene, über die permanent starke Strömungen hinwegfegen, findet sich eine Reihe kreisförmiger Löcher, die auf den ersten Blick wie Brunnenschächte aussehen.
Da rund um diese Löcher kleine Steinblöcke angeordnet sind, kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Schächte von Menschenhand gebohrt wurden. Der größte und tiefste von ihnen hat einen Durchmesser von 3 Metern und erreicht eine maximale Tiefe (vom Gipfel des Unterwasserberges aus gemessen) von etwa 10 Metern. Andere Löcher haben etwa 2 bis 3 Meter Durchmesser und reichen keine 7 Meter in die Tiefe; wieder andere sind noch kleiner und weniger tief. Einer der Schächte weist in seinem Verlauf eine schmale, seitlich in den Felsen gehauene Nebenkammer auf.
Chatan
An der Küste Okinawas wurde in den vergangenen 50 Jahren fleißig gebaut. 30 Kilometer nördlich des Verwaltungssitzes Naha, an der Westküste der Insel, befindet sich der beliebte Urlaubsort Chatan. Nicht einmal einen Kilometer vor dessen Küste stößt man in Tiefen von 10 bis 30 Metern auf ein unterseeisches Fantasieland aus »Mauern«, »Zinnen« und »Stufenpyramiden«. Sind diese seltsamen unter Wasser liegenden Strukturen auf natürliche Weise entstanden, oder wurden sie von Menschen geschaffen? Und wenn Letzteres – wann und von wem?
Fischer aus der Gegend vertreten die Ansicht, die »Strukturen« seien durch militärische Ausbaggerungen vor relativ kurzer Zeit erzeugt worden. Es ist durchaus richtig, dass in unmittelbarer Nähe zu Chatan mehrere große US-Luftwaffenstützpunkte stationiert sind und die erwähnte Stelle permanent von amerikanischen Kampfflugzeugen überflogen wird, die dort ihre Manöver durchführen. Zwar stehe ich der Möglichkeit, dass Ausbaggerungen für einige der unter Wasser sichtbaren Strukturen verantwortlich sein könnten, weiterhin offen gegenüber, dagegen spricht aber ein Bericht, den ich von dem japanischen Geschichtsforscher Akira Suzuki erhalten habe. Suzuki hat sowohl amerikanische als auch japanische Archive in Okinawa sorgfältig untersucht und keine einzige Erwähnung derartiger Aktivitäten in diesem Gebiet gefunden. 11
Die eindrucksvollste Struktur vor der Küste Chatans ist eine Mauer, die in 30 Metern Tiefe auf Sand aufruht, über den Meeresgrund etwa 10 Meter hinausragt und dabei »Zinnen« und einen abgesenkten »Laufsteg« bildet. An einem Punkt ist der Laufsteg durch einen vertikalen u-förmigen Schacht unterbrochen, der sich über die gesamte Höhe der Mauer erstreckt.
Wenn man vor Chatan taucht, fällt einem unweigerlich ein Element aus dem Nihonshoki ein – einem der ältesten Geschichtswerke Japans, das die Frühzeit des Landes behandelt. In einem langen einleitenden Abschnitt mit dem Titel »Das Zeitalter der Götter« wird unter anderem beschrieben, wie eine männliche Gottheit namens Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto in einen umgestülpten, wasserdichten Korb kletterte und darin zum Meeresgrund hinabstieg. Dank dieses improvisierten U-Boots »fand er sich an einem angenehmen Strand wieder … Als er weiterging, gelangte er plötzlich zum Palast des Meergottes. Dieser Palast war mit Umzäunungen und Brustwehren ausgerüstet und hatte stattliche Türme.«
Zweifellos lassen sich viele der seltsamen Dinge, die das Nihonshoki über das Zeitalter der Götter zu erzählen weiß, als Mythologien und Fantasien abtun. Gleichwohl finde ich es merkwürdig, dass ausgerechnet in Japan – einem Land, wo es so viele unterseeische »Anomalien« gibt – eine altehrwürdige schriftliche Überlieferung existiert, die eindeutig von unterseeischen Bauwerken berichtet, zu denen nur Taucher gelangen können.
15000 Jahre
In den Jahren von 1996 bis 2000, während ich meine Tauchpraxis zwischen den unterseeischen Ruinen Japans vertiefte, wurde ich mehrmals in die heftige Diskussion über die Herkunft dieser Bauten verwickelt. Nach Ansicht einiger Wissenschaftler und Journalisten sind sie völlig natürlichen oder »großteils natürlichen« Ursprungs – Letzteres behauptet beispielsweise Robert Schoch von der Boston University. Andere Experten wie Professor Kimura und Professor Teruaki Ishii von der Universität Tokio sind nach wie vor davon überzeugt, dass es sich um von Menschen geschaffene Bauwerke handelt, sind sich aber über deren Alter im Unklaren. Bei der Bestimmung, wann ein bestimmter Standort unter Wasser geraten ist, muss man nicht nur den Anstieg des Meeresspiegels, sondern auch andere komplexe Faktoren wie mögliche Landabsenkungen – durch Vulkanismus, Materialfluss oder postglaziale Landhebung – in Erwägung ziehen. 12 In dieser Debatte ist so bald keine Lösung abzusehen, da es hier nicht nur um allgemein anerkannte Fakten, sondern auch um Meinungen geht. Wer einen natürlichen Ursprung hinter den Strukturen vermutet, wird allen Gegenargumenten zum Trotz dieser Vermutung weiterhin nachgehen; und dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Offenbar befinden wir uns hier in einer Pattsituation.
Doch gibt es noch einen anderen Ansatzpunkt zur Lösung dieses Problems, der potenziell ergiebiger ist, an den aber keine von beiden Seiten bisher gedacht hat. Ob die japanischen Unterwasserruinen nun wegen des steigenden Meeresspiegels oder durch irgendeine Art von Landabsenkung (was in einem derart erdbebengefährdeten Gebiet wie Japan durchaus möglich ist) überflutet wurden: Irgendwann müssen sie sich ja über Wasser befunden haben. Und dieser Zeitraum muss zwischen dem Ende des Letzteiszeitlichen Maximums [engl.: »Last Glacial Maximum«, abgekürzt: LGM] vor 17000 Jahren und den nur 2000 Jahren gelegen haben, die manche Forscher als spätestmöglichen Zeitpunkt für das Versinken der Strukturen angegeben haben.
Was ist in Japan in diesen 15000 Jahren geschehen? Könnte sich in der fernen Urgeschichte der Inseln etwas ereignet haben, was danach in Vergessenheit geriet, uns aber einen Kontext und eine völlig logische Erklärung für die unterseeischen Ruinen liefern könnte?
Alexandria
1998 und 1999 wurde in den Medien häufig über die ägyptische Mittelmeerstadt Alexandria berichtet. Ein französisches Archäologenteam unter der Leitung von Dr. Jean-Yves Empereur vom Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) hatte damals die Entdeckung versunkener Ruinen inklusive unterseeischer Säulen, Sphinxe und Granitstatuen gemeldet. Und an demselben Standort wollte es auch die Überreste des berühmten Pharos von Alexandria – des 135 Meter hohen Leuchtturms, der zu den sieben Weltwundern der Antike zählte – gefunden haben. 13 Dieser Pharos überblickte den Osthafen von Alexandria von der Stelle aus, wo bis heute die Festung des Mameluken-Sultans Qait Bey steht. Der höchste je gebaute Leuchtturm soll Anfang des 3. Jahrhunderts v. Chr. errichtet worden und historischen Berichten zufolge bis zum 8. August 1303, als die ägyptische Küste von einem starken Erdbeben erschüttert wurde, wenigstens teilweise erhalten geblieben sein. 14
Bei den Recherchen für meine früheren Bücher hatten sich für mich nie Gründe ergeben, Alexandria aufzusuchen. Ich hatte zwar ein Jahrzehnt lang Ägypten bereist, mich aber nur für die ältesten historischen Stätten – aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. oder einer noch früheren Zeit – interessiert: das Gizeh-Plateau mit seinen drei Pyramiden und der großen Sphinx, Sakkara mit den bemerkenswerten Pyramidentexten an den Innenwänden von Pharaonengrabmälern aus der fünften und sechsten Dynastie, aber auch Abydos mit seinen Bootgräbern aus der ersten Dynastie und dem geheimnisvollen Osireion. 15
Da allgemein bekannt war, dass Alexandria vor seiner Gründung durch Alexander den Großen im Jahr 332 v. Chr. nicht existiert hatte, 16 hegte ich nie ein besonderes Interesse an dieser Stadt. Mir war vage bekannt, dass sie am Ort einer früheren Siedlung namens Raqedu oder Rhakotis erbaut worden war, die jedoch in den meisten Fachbüchern als »obskures Fischerdorf« beschrieben wurde. 17 Ich hätte also nie vermutet, dass es dort bedeutende Spuren früherer Monumentalbauten geben könnte.
Auch die unterseeischen Entdeckungen, die Ende der 1990er-Jahre durch die Medien geisterten, änderten nichts an meiner Meinung, denn sie führten nur auf die Ptolemäerzeit zurück, die nach ihrem Herrscherhaus – mit dessen letzter Königin Kleopatra – benannt ist; und diese ptolemäische Dynastie war erst nach dem Tod Alexanders des Großen von dessen General Ptolemaios begründet worden. Anfangs faszinierte mich die Tatsache, dass man in den unterseeischen Ruinen Inschriften zu viel früher lebenden Pharaonen gefunden hatte. Dazu zählten die Kartusche von Ramses II. (1303–1213 v. Chr.) auf »Papyrusbündel«-Säulen aus rosa Granit, die aus Assuan stammen; ein Obelisk für seinen Vater Sethos I. (1323–1279 v. Chr.); eine Sphinx aus der Zeit von Sesostris III. (der von 1878 bis 1839 v. Chr. regierte) sowie zahlreiche andere Artefakte und Objekte mit alten Inschriften. 18
Die Archäologen hatten allen Grund dazu, diese Entdeckungen als Beweis für eine frühere Monumentalsiedlung in Alexandria einzustufen, denn die Ptolemäer hatten die mittlerweile recht bekannte Angewohnheit, sich religiöse Kunstwerke und architektonische Elemente aus Tempeln zu holen, die von früheren Pharaonen errichtet worden waren. 19 Jean-Yves Empereur lässt daran keinen Zweifel:
Die zahlreichen Erzeugnisse aus pharaonischer Zeit – Sphinxe, Obelisken und Papyrussäulen [wie sie unter Wasser bei der Qait-Bay-Festung gefunden wurden] – ändern nichts Signifikantes an unserem bisherigen Wissen über die Geschichte Alexandrias und seiner Gründung durch Alexander den Großen. 20
Tauchen mit Empereur
Da man von dieser Stadt also wusste, dass sie vor Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. keine Geschichte hatte, gab es keinen vernünftigen Grund für mich, sie aufzusuchen, und es fiel mir nicht schwer, von einer Forschungsreise nach Alexandria abzusehen. Die Ruinen des Pharos-Leuchtturms und des umfangreichen Gebäudekomplexes, der sich seeseitig von ihm befunden haben muss, waren nicht am Ende der letzten Eiszeit, also in der Epoche versunken, die mich interessierte, sondern zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem 13. Jahrhundert n. Chr. Die Ursache hierfür war wahrscheinlich das gewesen, was die Geologen eine durch Erdbeben verursachte »vertikale tektonische Absenkung« nennen. 21 Abgesehen davon muss man sich einem quälend umständlichen Genehmigungsritual unterziehen, wenn man vor Alexandria tauchen will. Man muss sich die Erlaubnis des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie, des Ministeriums für Nationale Sicherheit, des Obersten Rats für Altertümer, der Polizei, der Zollbehörde und der Marine einholen; und bis man alle nötigen Papiere zusammen hat, vergeht im Durchschnitt ein ganzer Monat …
Also verwarf ich die Idee, bevor sie in meinem Kopf überhaupt Gestalt annehmen konnte, bis mir schließlich einfiel, dass mein guter Freund Robert Bauval, der ganz in der Nähe von London wohnte, in Alexandria zur Welt gekommen ist und mehrere Mitglieder seiner umfangreichen Globetrotter-Familie nach wie vor dort lebten. Ich rief ihn spontan an und fragte ihn, ob er etwas über Empereur wisse und es für möglich halte, einen inoffiziellen Tauchtag mit dem französischen Archäologenteam zu organisieren.
Rob genießt den Ruf, sogar aus dem fernen England in Alexandria wahre Wunder bewirken zu können. Daher überraschte es mich auch nicht sonderlich, als er mich am nächsten Tag zurückrief und mir berichtete, dass er mit seiner Großtante Fedora gesprochen habe, die eine Bekannte Empereurs sei und bei ihm ein gutes Wort für mich eingelegt habe. Das Ergebnis der Telefonate war, dass wir ohne offizielle Genehmigungen vor Qait Bey tauchen durften, wann auch immer es uns in den kommenden Wochen in den Plan passte.
Jahrtausendschlaf
Schwer beladen mit unserer Ausrüstung, trafen Santha und ich Robert am 30. September 1999 vor dem Torhaus zur Festung Qait Bey. Er führte uns in das mittelalterliche Bauwerk mit seinen Kalksteinmauern, beruhigte den Wächter auf Arabisch und brachte uns in einen Innenhof, in dem etliche Tauchflaschen lagen. Dort schlüpfte gerade eine Gruppe junger Archäologen – muskulöse, stoppelbärtige Männer und sonnengebräunte Frauen mit ernsten Gesichtern – in ihre Taucheranzüge und überprüfte ihre Ausrüstung.
Als Endvierziger war Empereur älter als sein Team. Er trug eine Tropenjacke aus Leinen, einen Panama-Hut und eine Aktentasche. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte er, als er uns per Handschlag begrüßte, »aber ich muss dringend weg und kann heute nicht mit Ihnen tauchen.«
»Kein Problem. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns so kurzfristig diese Möglichkeit gegeben haben.«
Empereur zuckte mit den Schultern. »Ist mir ein Vergnügen. Ich hoffe, der Ausflug gefällt Ihnen.« Er stellte uns den anderen Teammitgliedern vor, verabschiedete sich dann von uns und eilte mit großen Schritten davon.
Weil man sich unter Wasser nur schwer Notizen machen kann, dokumentiere ich meine Tauchgänge normalerweise auf Video. Das hatte ich auch diesmal vor, erfuhr aber während unserer Vorbereitungen, dass wir dazu keine Erlaubnis erhalten würden; man ersuchte auch Santha, ihre drei Nikons 5s nicht mitzunehmen. Offenbar hatte das Verbot mit einem Exklusivvertrag zu tun, den die Archäologen mit der französischen Fotoagentur Sygma abgeschlossen hatten. Doch Robert erhob in unserem Namen lautstarken Protest gegen diese Entscheidung, sodass wir schließlich zu einem Kompromiss gelangten: Santha durfte ihre Kameras benutzen, doch meine Videoausrüstung musste zurückbleiben.
Nachdem das geklärt war, führte man uns durch eine Reihe feuchtkalter Gänge mit Schießscharten, durch die man aufs Meer hinausblicken konnte, bis wir den Rand der – längst durch eine Dammstraße mit dem Festland verbundenen – Insel erreichten, auf dem die Festung Qait Bey steht. Dort legten wir unsere Ausrüstung und die Tauchflasche an, sprangen mit einem der Archäologen als unserem Führer ins Wasser und landeten umgehend in einem unterseeischen Wunderland, das nicht einmal 12 Meter unter uns gelegen war.
Es dürfte die schönste altertümliche Stätte gewesen sein, die ich je erkunden durfte. Die Sicht war schlecht, wodurch die vor uns liegende Szenerie einen diffusen Glanz erhielt, und wir mussten im Rahmen dreier längerer Tauchgänge erst ein paarmal kreuz und quer durch die Ruinenlandschaft tauchen, bis wir begriffen, wie riesig und vielfältig sie war. Es gab eine Unmenge Säulen, von denen manche zerbrochen und andere praktisch unversehrt, aber alle umgestürzt waren. Dazwischen standen dorische Säulensockel, die von Trümmerteilen umgeben waren. Hier und da konnte man den Verlauf einer Wand sehen, die aus dem trüben Wasser aufragte. Auch Dutzende halbkugelförmige, ausgehöhlte Steine von einem Meter Breite, wie ich sie in Ägypten noch nie gesehen hatte, befanden sich hier. Zudem gab es mehrere kleine Sphinxe, deren eine gezackt in der Mitte durchgebrochen war, und massive Teile von mehr als nur einem Granitobelisken schienen wie Streichhölzer durcheinandergeworfen zu sein. Auch behauene Granitblöcke konnte ich überall sehen; die meisten in der Größenordnung von 2 bis 3 Quadratmetern, einige aber auch viel größer, mit 70 Tonnen oder mehr Gewicht. Eine auffällige Gruppe dieser Giganten, von denen einige erstaunliche 11 Meter lang waren, lag in einer Linie angeordnet, die im offenen Meer vor Qait Bey von Südwesten nach Nordosten verlief. Meine späteren Recherchen ergaben, dass diese Blöcke zu jenen gehörten, die Empereurs Ansicht nach vom Pharos-Leuchtturm stammten:
Manche davon sind in zwei oder drei Teile zerbrochen, was darauf hindeutet, dass sie aus großer Höhe herabgestürzt sind. Wenn man vom Standort ausgeht, den die antiken Autoren für den Leuchtturm angeben, und die technischen Schwierigkeiten bei der Beförderung derart großer Objekte berücksichtigt, dann ist die Annahme zulässig, dass es sich hierbei um Teile des Pharos handelt, die genau dort liegen geblieben sind, wohin sie von einem besonders schweren Erdbeben geschleudert wurden. 22
Wenn die Sonne durch die Wolkendecke über Alexandria brach und einen Lichtstrahl in die dunklen Winkel der versunkenen Ruinen warf, wurden uns wunderbare Momente zuteil. In solchen Augenblicken schienen die gefallenen Bauwerke, über denen wir dahintauchten, wieder ihre einstige Gestalt anzunehmen, wie Geister, die sich für einen kurzen Moment inkarnieren, bevor sie wieder in ihren jahrtausendelangen Schlaf zurücksinken.
Der Schatz der versunkenen Stadt
Noch Wochen später wollte mich der Anblick der unterseeischen Ruinen vor Qait Bey nicht loslassen; irgendwie hatte ich das Gefühl, dort etwas Wichtiges übersehen zu haben. Ohne eine bestimmte Absicht zu verfolgen, begann ich, Bücher über Alexandria zu kaufen; ich wollte einfach nur mehr über die Vergangenheit der Stadt erfahren. Eines Abends Mitte Oktober fand ich bei Amazon eine gebrauchte Ausgabe von Alexandria – A History and a Guide, das der britische Romancier E. M. Forster während des Ersten Weltkriegs geschrieben und 1922 veröffentlicht hatte – und das ein Quell der Weisheit sein soll. 23 Ich schlug sofort zu und erwarb dazu das von Roy Macleod herausgegebene Werk The Library of Alexandria – Centre of the Ancient World, das Buch Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria von Mostafa El-Abbadi, Philo’s Alexandria von Dorothy L. Sly sowie Die verschwundene Bibliothek von Luciano Canfora. 24
Seltsamerweise wurde ich bei meiner Amazon-Suche nicht gleich unter dem Stichwort »Pharos« fündig. Darüber nachdenkend, wonach ich stattdessen suchen sollte – vielleicht den sieben Weltwundern der Antike? –, gab ich Jean-Yves Empereurs Namen ein, um eine vollständige Liste seiner Publikationen zu sehen. Sein Buch Alexandria Rediscovered, in dem er über seine Unterwasserausgrabungen vor Qait Bey berichtet, besaß ich bereits, hoffte aber, dass er noch weitere Bücher über diese Region verfasst hatte. Doch das war leider nicht der Fall. Dafür fand ich unter den Rezensionen von Alexandria Rediscovered den Beitrag eines Lesers aus Phoenix, Arizona. Er schrieb, dass er – bei allem Respekt für Dr. Empereur – nach 17 Jahren als Unterwasserarchäologe in Ägypten der Ansicht, Empereurs Team habe den Pharos-Leuchtturm entdeckt, keineswegs zustimmen könne. Die Forscher hätten sicher etwas Interessantes entdeckt, aber garantiert nicht den Pharos.
Warum hielt sich jemand, der 17 Jahre lang als Unterwasserarchäologe in Ägypten gearbeitet hatte, ausgerechnet in der amerikanischen Wüstenstadt Phoenix auf? Und was wusste der Mann über den Pharos (oder glaubte er zu wissen)? Mein Instinkt sagte mir, dass sich dahinter eine interessante Geschichte verbergen könnte. Der Rezensent hatte keinen Namen angegeben, aber eine E-Mail-Adresse. Ich schickte ihm sofort eine Nachricht, in der ich mein Interesse an den unterseeischen Ruinen von Alexandria darlegte und ihn ersuchte, mir seine Ansichten über den Pharos-Leuchtturm näher zu erläutern.
Am nächsten Tag, dem 17. Oktober, erhielt ich folgende Antwort:
Mr. Graham,
mein Name ist Ashraf Bechai. Ich bin der ehemalige Leiter des Unterwasser-Teams des Maritimen Museums, wo ich von 1986 bis 1989 tätig war. Ich habe außerdem als Tauchingenieur am Institute of Nautical Archaeology gearbeitet; auf der Website des Instituts können Sie mehr über mich erfahren. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie bei der Beantwortung Ihrer Fragen zu unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ashraf Bechai, Phoenix AZ, USA
Im Anhang fand ich einen 23 Seiten umfassenden Bericht mit dem Titel »Der Schatz der versunkenen Stadt: die Wahrheit über die Entdeckung des Leuchtturms«.
Ashraf Bechais Geschichte
Ashraf Bechais verärgerter und leidenschaftlicher Bericht vermittelte vor allem ein Gefühl intellektueller Entrüstung. Seiner Ansicht nach waren Jean-Yves Empereur und dessen Team bei der Interpretation ihrer Unterwasserfunde vor Qait Bey viel zu engstirnig gewesen:
In den vergangenen 3 Jahren wurde immer wieder die Behauptung geäußert, dass das französische Team von Unterwasserarchäologen, die vor der Festung Qait Bey gearbeitet haben, die Überreste eines großen Gebäudes gefunden hätten, das von französischen und ägyptischen Archäologen als der Leuchtturm von Pharos identifiziert wurde.
Aber ist es wirklich der Pharos?
Ich sehe nicht ein, warum wir das unwidersprochen hinnehmen sollten. Ich sehe auch nicht ein, warum man von uns erwartet, unseren gesunden Menschenverstand aufzugeben, nur weil diese Funde unterseeisch gemacht wurden und im Fernsehen so beeindruckend aussehen.
Wäre der Pharos nämlich tatsächlich über 100 Meter hoch gewesen, wie alle historischen Quellen behaupten, dann musste es sich bei ihm – so Bechai – um ein wahrhaft gewaltiges Bauwerk handeln. Die Cheopspyramide von Gizeh mit ihrer Höhe von 150 Metern und einer Grundfläche von 5,3 Hektar wiegt 6 Millionen Tonnen und besteht aus 2,5 Millionen Steinblöcken. 25 Da die Bautechnik im 4. Jahrhundert v. Chr. der des 3. Jahrtausends v. Chr. eindeutig unterlegen war, ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Leuchtturm mit seiner angeblichen Höhe von 135 Metern auf einer Grundfläche von weniger als 4,85 Hektar gestanden oder ein Gewicht von unter 5 Millionen Tonnen gehabt haben kann. »Man muss sich einmal vorstellen, wie hoch der Steinhaufen wäre, der von einem solchen Gebäude übrig geblieben wäre«, schreibt Bechai. Und weiter:
Kann eine solche Menge Steine einfach verschwinden? Sich im Wasser in Nichts auflösen? In Wahrheit ist es doch so, dass derart viele Steine eine Insel im Meer gebildet hätten und all die Statuen, Sphinxe und anderen altägyptischen Artefakte, die das französische Team zwischen den Steinblöcken gefunden hat, für immer unter einem riesigen Steinhaufen begraben wären.
Sogar dann, wenn man – allen Beweisen zum Trotz – annimmt, dass in der alexandrinischen Zeit eine weit bessere Bautechnik existiert hat als in der Epoche, als die Cheopspyramide erbaut wurde, oder wenn man die Höhe des Pharos von 135 auf 100 Meter reduziert, bleibt es äußerst unwahrscheinlich, dass der Leuchtturm aus weniger als 500000 (im Vergleich zu den 2,5 Millionen Blöcken für die Große Pyramide) Steinblöcken erbaut worden sein könnte. Aber nehmen wir einmal rein theoretisch an, dass es nur 100000 oder auch 50000 Blöcke gewesen wären.
Doch Empereur schreibt: »Sobald man vor Qait Bey den Kopf unter die Wasseroberfläche steckt, schwindelt einem beim Anblick der etwa 3000 behauenen Steinblöcke, die den Meeresgrund bedecken.« 26 Genau dieses »schwindelerregende« Schauspiel von nur 3000 Blöcken aber war es, was Bechai ärgerte. Denn wären die Ruinen vor Qait Bey tatsächlich die Überreste des Leuchtturms und diverser Nebengebäude, wären 3000 Steinblöcke bei Weitem nicht genug:
Aus 3000 Blöcken ließe sich nicht einmal ein größerer Tempel errichten, geschweige denn ein 100 Meter hoher Leuchtturm! Dazu kommt, dass viele der von Empereur beschriebenen Blöcke in weiter Entfernung um Qait Bey herum verstreut liegen. Manche davon sind fast einen Kilometer entfernt, und es gibt sogar einen 75 Tonnen schweren Granitblock, der einen halben Kilometer von der Küste und 1,5 Kilometer von Qait Bey entfernt liegt. Sollen wir etwa glauben, dass dieses Erdbeben so heftig war, dass es einen 75 Tonnen schweren Steinblock so weit wegschleudern konnte?
Bechai trug noch ein weiteres stichhaltiges Argument vor. In antiken Texten über den Pharos heißt es übereinstimmend, dass der Leuchtturm aus Blöcken von »weißem Stein« – Kalkstein – erbaut wurde, der vor Ort in großer Menge zur Verfügung steht. Das unterseeische Ruinenfeld vor Qait Bey besteht aber in erster Linie aus verstreuten Granitblöcken und anderen architektonischen Elementen wie Säulen, die ebenfalls aus Granit gefertigt wurden – ein viel schwerer zu bearbeitendes Material, das aus fast 1000 Kilometer südlich liegenden Steinbrüchen nach Alexandria befördert werden musste. Bechai räumt zwar ein, dass Kalkstein eine sehr viel höhere Erosionsrate aufweist als Granit, glaubt aber trotzdem nicht, dass derartige Mengen Kalkstein, wie sie für den Bau des Pharos nötig gewesen wären, komplett der Erosion zum Opfer gefallen sein können. Also kam er zu dem Schluss:
Wir haben es an dieser Fundstelle mit vereinzelten Artefakten aus unterschiedlichen zeitlichen Perioden zu tun, mit unterschiedlichen Ausführungen von Steinblöcken, Säulen und Statuen – die nicht Indiz für eine Sache, sondern für viele verschiedene Sachen sind.
Die Riesenblöcke von Sidi Gaber
Noch bevor ich den Bericht zur Hälfte fertig gelesen hatte, war mir klar, dass er auf Paradoxien und Anomalien hinwies, die mir während meiner Tauchgänge mit dem französischen Team völlig entgangen waren. Empereur würde all diese Fragen sicher beantworten können, aber ich muss zugeben, dass mir Bechais Argumente während der Lektüre durchaus vernünftig erschienen.
Mir fiel auf, dass der Autor nicht nur wegen des Pharos-Problems erregt war. Er schrieb: »Ich habe in den vergangenen 17 Jahren unter Wasser vor Alexandria Dinge gesehen, die all unser historisches Wissen über diese Gegend in Frage stellen.« So berichtete er zum Beispiel darüber, wie er 1984 mit ein paar Freunden vor der Küste von Sidi Gaber, einem Viertel von Alexandria, das neben der belebten Corniche und etwa 3 Kilometer östlich von Qait Bey liegt, unter Wasser fischte:
Wir waren etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt und unternahmen unsere Tauchgänge von einem kleinen Boot aus. Ich erinnere mich noch, dass die Sichtverhältnisse unter Wasser ausgesprochen gut waren. Damit hatten wir nicht gerechnet, weil es paar Tage zuvor einen Sturm gegeben hatte, der Sand und Schlick auf dem Meeresgrund ziemlich durcheinandergewirbelt hatte. Plötzlich sah ich Hunderte Sandstein- oder Kalksteinblöcke, in drei Reihen ausgelegt und jeweils zwei aufeinander, die am Meeresboden in einer Tiefe von etwa 6 bis 8 Metern freigelegt worden waren. Die Blöcke schienen identische Ausmaße zu haben – 4 mal 4 Meter mit einer jeweiligen Höhe von 2 Metern. Sie waren auf einer Art unterseeischem Bergrücken aufgestapelt, da das Wasser zwischen ihnen und der Küste eindeutig wieder tiefer wurde. Rundherum lagen noch Hunderte weitere Blöcke von ähnlicher Größe, die stark erodiert oder beschädigt oder aus der Anordnung herausgefallen waren.
Diese Gruppe von Steinblöcken wurde in den vergangenen 25 Jahren immer wieder von Fischern und Tauchern beobachtet, doch es gibt bis heute keinerlei Erklärung für sie. Ich hatte mit den Sichtverhältnissen an dieser Stelle nie wieder so viel Glück wie damals, und auch die Verhältnisse auf dem Meeresgrund waren nie wieder dieselben. Deshalb gelang es mir trotz zahlreicher Versuche auch nicht, den genauen Standort der Blöcke wiederzufinden.
Ein weiterer interessanter Ort, den Bechai allerdings nicht selbst gesehen hatte, war die sogenannte Kinessa – ein arabisches Wort, das »Kirche« oder »Tempel« bedeutet.
Wenn man lange genug in der wunderbaren Stadt Alexandria gelebt und dort mit Fischern zu tun gehabt hat, die Schleppnetzfischerei betreiben, dann hat man sicher auch schon von »Al Kinessa« gehört. Manche sagen, dass sich diese Stelle auf offener See befindet, etwa einen Kilometer nördlich von Qait Bey, und dass man bei Ostwind und klarem Wasser manchmal die Reste eines unterirdischen Gebäudes sehen könne. Laut Aussage anderer liegt der Ort viel weiter im Norden, vielleicht 5 Kilometer vor der Küste. Drei unterschiedliche Personen lokalisierten sie ganz genau 5 Kilometer nördlich bis nordwestlich von Qait Bey. Bevor man sie erreicht, fällt der Meeresboden auf 40 Meter ab, und am Grund ist es sandig mit ein paar felsigen Stellen; dann fährt man über eine Region mit Felstürmen, die bis zu 20 Metern aus dem Meeresboden ragen. Und danach steigt das Bodenprofil wieder sprunghaft an, von 40 Metern auf nur 18 Meter Tiefe, wodurch in 5 Kilometer Küstenentfernung, mitten im Nirgendwo, ein glattwandiger Hügel mit flacher Oberseite entstanden ist. Dort soll die Kinessa liegen.
Geheimnis des Meeres
Als ich Ashraf Bechais Bericht zu Ende gelesen hatte, begann ich per E-Mail über bestimmte Punkte mit ihm zu korrespondieren. Es dauerte nicht lange, bis wir uns auf einen gemeinsamen Tauchgang geeinigt hatten, bei dem wir im Sommer 2000 die Blöcke von Sidi Gaber und die Kinessa finden wollten. Obwohl er mittlerweile in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona beheimatet war und dort eine Firma betrieb, kehrte er nach eigener Aussage jedes Jahr für 3 Monate nach Alexandria zurück und würde gerne dort mit mir zusammenarbeiten, wenn ich es schaffte, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten.
In der Zwischenzeit hatte ich noch einige andere Reisen zu absolvieren. Bei einer davon – ich weiß nicht mehr, welche es war – hatte ich E. M. Forsters Alexandria – A History and a Guide als Flugzeuglektüre dabei. Ich fand es hochinteressant, dass Forster darin auf einen 1910 veröffentlichten Bericht des französischen Archäologen Gaston Jondet verwies, der den Titel Les Ports submergés de l’ancienne île de Pharos trug. 27 Jondet hatte laut Forster behauptet, dass irgendjemand in einiger Entfernung vor der Küste von Alexandria, jenseits der Insel Pharos, eine ganze Reihe hoher megalithischer Mauern und Dammwege errichtet hatte, die mittlerweile in einer Tiefe von bis zu 8 Metern unter dem Meeresspiegel zu finden sein sollten. Die Art dieser Bauwerke hielt er für »prähistorisch«. 28 Forster fasste die Reaktionen auf diese Entdeckung wie folgt zusammen:
Die Theosophen haben sie mit mehr Eifer als hoher Wahrscheinlichkeit für die verschwundene Zivilisation von Atlantis annektiert; M. Jondet neigt zur Theorie, dass es sich um minoische Bauten handelt, die von der Seemacht Kreta errichtet wurden. Sind sie ägyptischen Ursprungs, dann wurden sie wahrscheinlich unter Ramses II. (1300 v. Chr.) erbaut … Die Anlage selbst … gibt keinerlei Aufschluss zu Nationalität oder Entstehungszeit. Sie kann nicht erst zur Zeit Alexanders des Großen entstanden sein, weil es sonst Aufzeichnungen über sie gäbe. Auf jeden Fall handelt es sich um die ältesten Bauwerke des Landkreises – und auch um die romantischsten, weil zu ihrem Alter noch das Geheimnis des Meeres dazukommt. 29
Ich fragte mich, wie viele Archäologen heute noch wie Forster über das Alter und die Romantik des prähistorischen Hafens denken. Jean-Yves Empereur tat es mit Sicherheit nicht. Vor Alexanders Ankunft, schrieb er in voller Übereinstimmung mit der gängigen wissenschaftlichen Ansicht, »waren die einzigen Bewohner der Gegend wohl nur ein paar Fischer und eventuell eine dort stationierte Garnison, die den Zugang zum Delta bewachen sollte«. 30 Wenn dem wirklich so war, wer hat dann den um vieles älteren und nun versunkenen Hafen gebaut – wenn es sich denn wirklich um einen Hafen gehandelt hat? Und wie passte das alles zu den megalithischen unterseeischen Blöcken vor Sidi Gaber oder der schwer zu findenden Kinessa, die gelegentlich unter den glitzernden Meereswellen auftauchte und dann wieder verschwand, wie das Schloss des Meereskönigs?
Sintflutgerüchte
In der Mythologie des Altertums ist allerorten von einer tödlichen weltweiten Sintflut die Rede, die sämtliche bewohnten Länder der Welt überschwemmte. In vielen dieser Mythen gibt es außerdem den Hinweis, dass die Sintflut eine Hochkultur hinwegfegte, die in irgendeiner Weise die Götter verärgert hatte, und »nur die der Schrift Unkundigen und Ungebildeten zurückließ«. 31 Die Überlebenden mussten »wie Kinder« von vorne beginnen, »in völligem Unwissen, was … in früheren Zeiten vorgefallen war«. 32 Geschichten wie diese tauchen im vedischen Indien, im präkolumbischen Amerika und im alten Ägypten auf. Sie wurden von den Sumerern ebenso wie von den Babyloniern, den Griechen, den Arabern und den Juden erzählt. Auch in China und Südostasien, im prähistorischen Nordeuropa und jenseits des Pazifiks waren sie bekannt. Fast überall, wo wahrhaft alte Traditionen überlebt hatten, selbst unter Bergvölkern und Wüstennomaden, wurden anschauliche Beschreibungen globaler Überflutungen, in denen der Großteil der Menschheit zugrunde ging, von einer Generation zur nächsten weitergegeben. 33
Diese Mythen ernst zu nehmen und vielleicht sogar die Möglichkeit einzuräumen, dass an ihnen etwas Wahres sein könnte, wäre für einen modernen Wissenschaftler riskant, denn er würde sich damit unweigerlich dem Spott und dem Tadel seiner Kollegenschaft aussetzen. Der heutige und seit etwa einem Jahrhundert allgemein akzeptierte wissenschaftliche Konsens besagt, dass derartige Mythen entweder reine Fantasieprodukte oder fantastische Ausschmückungen lokal begrenzter Überschwemmungen seien, die beispielsweise durch Hochwasser führende Flüsse oder Flutwellen hervorgerufen wurden. 34 »Es ist seit Langem bekannt«, kommentierte der berühmte Anthropologe J. G. Frazer im Jahr 1923,
dass Legenden über eine Sintflut, die beinahe die gesamte Menschheit auslöschte, in der ganzen Welt weit verbreitet sind … Geschichten über solch gewaltige Katastrophen sind mit ziemlicher Gewissheit fantastischer Natur; [doch] es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass viele von ihnen unter einer mythologischen Schale einen wahren Kern enthalten; das heißt, dass sie Erinnerungen an Überflutungen enthalten können, die tatsächlich manche Landstriche ereilten und in der Volkstradition dann zu weltweiten Katastrophen vergrößert wurden. 35
Noch heute halten sich zahlreiche Gelehrte widerspruchslos an Frazer und beharren darauf, dass Sintfluterzählungen
stark verzerrte und übertriebene … Erinnerungen … an tatsächlich örtliche Katastrophen sind … Es gibt keine einheitliche Sintflutlegende, sondern eine Sammlung von Überlieferungen, die sich so stark voneinander unterscheiden, dass sie weder durch eine weltumspannende Katastrophe noch durch die Verbreitung einer einzigen lokalen Überlieferung erklärt werden können … Sintflutüberlieferungen sind vor allem deshalb fast universell, … weil Überflutungen die beinahe universellste aller geologischen Katastrophen sind. 36
Nicht alle Mainstream-Akademiker schließen sich dieser Theorie vorbehaltlos an. Doch selbst unter denen, die andere Ansichten vertreten, herrscht offenbar Einigkeit darüber, dass nahezu jede Erklärung, mag sie auch noch so hirnverbrannt sein, einer wörtlichen Auslegung des Sintflutmythos vorzuziehen sei. Bevor sie anzuerkennen bereit sind, dass es tatsächlich eine weltumspannende Flut (oder mehrere) gegeben haben könnte, versteigen sie sich lieber zu den wildesten Interpretationen. So gilt zum Beispiel die Theorie von Alan Dundes, dem 2005 verstorbenen Professor für Anthropologie und Folklore an der University of California, Berkeley, als absolut akzeptabel: »Dieser Mythos ist eine Metapher – eine kosmogene Projektion der hervorstechendsten Details der menschlichen Geburt, da ja jeder Säugling aus einer ›Flut‹ von Fruchtwasser geboren wird.« 37
Doch angesichts der stetigen Zunahme wissenschaftlicher Beweise für eine Reihe gigantischer Kataklysmen wird sich diese Denkweise, so vermute ich, nicht mehr lange halten lassen. Die Flutkatastrophen, für die wir heute mehr und mehr Belege finden, stimmen genau mit denen überein, die in den Sintflutmythen beschrieben werden, und veränderten im Zeitraum von vor 17000 bis 8000 Jahren die Erdoberfläche völlig. Zu Beginn dieser Periode ganz außergewöhnlicher klimatischer Turbulenzen und Extreme soll es bereits seit 100000 Jahren voll entwickelte Menschen des modernen Typs gegeben haben; 38 diese Zeitspanne würde theoretisch dafür ausreichen, dass wenigstens einige dieser Menschen in dieser Zeit eine Hochkultur entwickelt haben könnten. Heute ist zwar ein Großteil des Landes, das sie einst bewohnt haben, im Meer versunken und den Archäologen so fremd wie die dunkle Seite des Mondes – aber wie sicher können wir uns sein, dass es solche uralten Hochkulturen nicht wirklich gegeben hat?
Dunkelzone
SCUBA – ein anderer Ausdruck für Drucklufttauchgerät – steht für die Abkürzung »Self-Contained Underwater Breathing Apparatus« und wurde 1943 von Jacques Cousteau und Émile Gagnan erfunden. 39 Anfangs galt die neue Technik als teuer und nur für Spezialisten geeignet, doch sie eroberte sehr schnell den Massenmarkt. Heute ist Gerätetauchen der am schnellsten wachsende Sport der Welt. 40
Auch wenn es auf der Hand liegt, sollte man nicht vergessen, dass eine systematische Unterwasserarchäologie erst mit dem Aufkommen des Gerätetauchens möglich wurde. Und obwohl die Meere äußerst groß sind und mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken, bleiben die für diesen Forschungszweig zur Verfügung gestellten Geldmittel nach wie vor begrenzt.