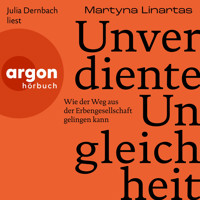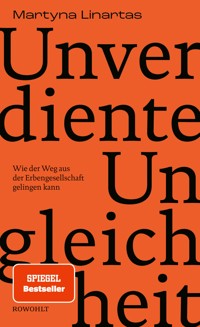
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Noch nie gab es so viel Reichtum – und das ist ein Problem für uns alle! In kaum einem anderen westlichen Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie in bei uns – und die Schere geht immer weiter auf. Dieses Buch zeigt das schockierende Ausmaß der Ungleichheit in Deutschland. Dass die Vermögen der Reichen von Generation zu Generation immer weiter wachsen, während jeder Sechste in Armut lebt, ist gesellschaftliches Dynamit. Martyna Linartas zeigt, dass es von unserem politischen Willen abhängt, daran etwas zu ändern, und wie eine gerechte Lösung aussehen könnte. In dieser hellsichtigen und fundierten Analyse wird das politische Tabuthema unserer Zeit seziert: Dass wir die Reichen nicht besteuern, gefährdet unseren Wohlstand, unsere Umwelt und unsere Demokratie. Aber es geht auch anders – wenn wir nur wollen! Anhand von exklusiven Interviews mit der mächtigen Wirtschaftselite über Ungleichheit und das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik sowie einer einmaligen historischen Analyse zeigt sich, wie eine Besteuerung von Überreichen funktionieren kann. Dieses Buch gibt uns alle Argumente an die Hand, um jetzt zu handeln. «Ganz wenige haben zu viel. Zu viele haben ganz wenig. Dieses Buch verdeutlicht dies grandios und zeigt die Auswege aus dem Wahnsinn auf.» - Tilo Jung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Martyna Linartas
Unverdiente Ungleichheit
Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann
Über dieses Buch
Noch nie gab es so viel Reichtum – und das ist ein Problem für uns alle!
In kaum einem anderen westlichen Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland – und die Schere geht immer weiter auf. Dieses Buch zeigt das schockierende Ausmaß der Ungleichheit in Deutschland. Dass die Vermögen der Reichen von Generation zu Generation immer weiter wachsen, während jeder Sechste in Armut lebt, ist gesellschaftliches Dynamit. Martyna Linartas zeigt, dass es von unserem politischen Willen abhängt, daran etwas zu ändern, und wie eine gerechte Lösung aussehen könnte.
In dieser hellsichtigen und fundierten Analyse wird das politische Tabuthema unserer Zeit seziert: Dass wir die Reichen nicht besteuern, gefährdet unseren Wohlstand, unsere Umwelt und unsere Demokratie. Aber es geht auch anders – wenn wir nur wollen! Anhand von exklusiven Interviews mit der mächtigen Wirtschaftselite über Ungleichheit und das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik sowie einer einmaligen historischen Analyse zeigt sich, wie eine Besteuerung von Überreichen funktionieren kann. Dieses Buch gibt uns alle Argumente an die Hand, um jetzt zu handeln.
«Ganz wenige haben zu viel. Zu viele haben ganz wenig. Dieses Buch verdeutlicht dies grandios und zeigt die Auswege aus dem Wahnsinn auf.» Tilo Jung
Vita
Martyna Linartas ist promovierte Politikwissenschaftlerin und ausgebildete Pressereferentin. Neben ihrem Masterstudium der Politikwissenschaft hat Linartas während des Bundestagswahlkampfs 2017 in der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen ihre Ausbildung zur Pressereferentin absolviert. 2018 ging sie an die Freie Universität (FU) Berlin zurück, arbeitete von 2018 bis 2021 nebenher im Bundestagsbüro von Annalena Baerbock und promovierte 2023 im Exzellenzcluster SCRIPTS mit summa cum laude. 2022 gründete sie die Wissensplattform ungleichheit.info, leitet diese seitdem und ist Teil der Inequality Steering Group der Denkfabrik Forum New Economy. Aktuell arbeitet Linartas an ihrer Habilitationsschrift zur (Re-)Produktion von Vermögen in Deutschland, lehrt an der FU Berlin und an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Grafiken © Luzie Bayreuther
Covergestaltung Luzie Bayreuther
Coverabbildung ohne
ISBN 978-3-644-02235-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
VorwortIn was für einer Gesellschaft leben wir?
In den vergangenen Jahren sprach ich mit den mächtigsten Menschen des Landes über Ungleichheit. Genau genommen sprach ich auch mit den mächtigsten Menschen Mexikos. Doch dieses Buch handelt vor allem von Deutschland: von der extremen Vermögensungleichheit in unserem Land; davon, dass Deutschland keine Leistungs-, sondern bereits Stand heute eine Erbengesellschaft ist. Eine Gesellschaft also, in der es zunehmend darauf ankommt, in welche Familie man geboren wird und wie groß die Erbschaft wird, die einem eines Tages in den Schoß fällt.
Die größten Vermögen und zugleich die größten Erbschaften sind mittlerweile so extrem, dass allein zwei Familien zusammen mehr Vermögen besitzen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Zwei Familien haben somit mehr als 42 Millionen Menschen. Ein Skandal – und doch bleibt der Aufschrei aus. Weil vielen das Bewusstsein fehlt, wie extrem die Ungleichheit tatsächlich ist. Weil die Ungleichheit derart groteske Züge angenommen hat, dass sie unsere Vorstellungskraft sprengt. Weil Mythen unseren Blick auf Fragen der Gerechtigkeit vernebeln. Und vielleicht auch, weil uns die Lehren aus unserer Vergangenheit fehlen, um die Ereignisse und Entwicklungen der Gegenwart und Zukunft besser begreifen zu können. Wir machen daher in diesem Buch einen Ritt durch 100 Jahre Geschichte, erkunden, was uns an diesen Punkt brachte, und blicken dabei vor allem auf die wirtschaftliche und auf die politische Elite: Wie stehen diese einflussreichen Teile unserer Gesellschaft heute zu Staat, Steuern und Ungleichheit?
Ungleichheit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wenn es uns nicht gelingt, dem wachsenden Trend Einhalt zu gebieten, gefährden wir nichts Geringeres als unsere Demokratie und unser Klima. Dass diese steile These keine bloße Meinung ist, sondern den aktuellen Stand der Forschung abbildet, werde ich in diesem Buch sachlich und im Detail darlegen.
Ich möchte niemanden auf die Folter spannen: Es gibt Lösungen für dieses Problem, und es ist an uns, die nötigen Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Ja, ich gestehe: Ich bin Optimistin. Aber das hat auch gute Gründe. Der Blick in die Vergangenheit hat mich gelehrt, was es braucht, um Ungleichheit zu senken. Schritt Nummer eins: begreifen, dass sie weder gottgegeben noch ein Naturphänomen ist. Ungleichheit ist ein politisches Phänomen. Und als solches lässt sie sich auch politisch lösen. Dieses Buch zeigt auf, wie der Weg aus der Erbengesellschaft hin zu einer stärkeren Demokratie gelingen kann. Was Sie hier in Händen halten, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, zahlreicher Interviews mit führenden Akteuren[1] aus Wirtschaft und Politik, herausgezogen aus einem tiefen Strudel der Analyse, um das Verständnis über die Zusammenhänge von Ungleichheit zu schärfen.
Dass ich meine Erkenntnisse mit Ihnen teilen kann, ist selbst das Ergebnis von Ungleichheit. Einer Ungleichheit, die mein Leben früh gezeichnet und mich später fasziniert hat.
Als meine Eltern nach Deutschland kamen, hatten wir nichts. Keine Wohnung, keine Möbel, noch nicht einmal der Sprache waren wir mächtig. Meine Mutter war hochschwanger und zog mit mir – keine zwei Jahre alt – und meinem Vater von Polen nach Deutschland. Wir wollten in der Wohnung meiner Großeltern unterkommen, die kurz vor uns nach Kiel gezogen waren. Doch weil uns die Nachbarn verpfiffen, mussten wir wieder aus der kleinen Sozialwohnung in Mettenhof, einem sogenannten Brennpunktstadtteil, ausziehen. Und zwar buchstäblich sofort, denn andernfalls würden meine Großeltern ihre Wohnung verlieren, und wir alle würden auf der Straße landen. Aber wo sollten wir hin? Als mein Bruder auf die Welt kam, ging es für ihn vom Krankenhaus ins Obdachlosenheim. Meine Eltern nannten ihn Kevin. Sie wussten es nicht besser.[2]
Weil mein Urgroßvater Deutscher war, durften mein Opa, mein Vater und schließlich auch mein Bruder und ich die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Auch wenn die ersten Monate extrem schwierig waren, glaubten meine Eltern fest daran: Der deutsche Pass sei das Ticket in ein besseres Leben. Mein Bruder und ich würden es eines Tages hier besser haben.
Das Obdachlosenheim lag in der Kaiserstraße 40 und war einst das Hotel Medusa. Es lag in einem anderen Brennpunktstadtteil, Gaarden, und war so heruntergekommen, dass längst keine Gäste mehr kamen. Der Spanier, der das Heim leitete, vergab die Zimmer an Migranten wie uns, an Polen oder Rumänen. Ein eigenes Bad oder eine eigene Küche gab es nicht. Wir teilten sie uns mit den anderen Familien. Was wir vier hatten, waren unsere vier Wände: ein Zimmer. Das Sozialamt zahlte, bis es nach einem Jahr in unsere erste eigene Wohnung in der Saarbrückenstraße am Südfriedhof ging. Wenn ich heute meine Eltern von den ersten Monaten und Jahren erzählen höre, staune ich nicht schlecht, wenn ich mir ausmale, wie stark und groß die Hoffnung auf ein besseres Morgen gewesen sein muss.
Meine Mutter stellte schnell fest, dass sie mit ihrem abgeschlossenen Physikstudium in Deutschland nicht viel anfangen konnte und machte, mit zwei Babys auf dem Arm, eine Ausbildung zur Buchhalterin. Mein Vater hatte sein Philosophie-Studium in Polen abgebrochen, ganz so, wie es sich für einen guten Philosophie-Studenten gehört (das scheint international zu gelten). In Deutschland angekommen, wurde er Krankenpfleger und arbeitete meist in Nachtschichten im Universitätsklinikum. Was die beiden in den ersten Jahren verdienten, war zwar nicht viel. Aber es reichte, um damals einen Kredit aufnehmen zu können und ein kleines Endreihenhäuschen für unsere vierköpfige Familie zu kaufen. Wir zogen in eine schmale, schöne Straße, an deren Ende die Grundschule Wellsee mitsamt Bibliothek war. Die Bibliothekarin hieß Frau Schmidt. Eine kleine und alte, sehr zierliche Dame, mit kurzen weißblonden Locken und einer recht dicken Hornbrille auf der Nase. Jeden Donnerstag öffnete sie die kleine Bibliothek für einige Stunden. Ich liebte die kleine Bibliothek. Und ich liebte Frau Schmidt.
Als ich etwa acht Jahre alt war, besuchten meine Familie und ich die Patentante meines Vaters in Mexiko-Stadt. Mit 20 Millionen Einwohnern war Mexiko-Stadt damals die weltweit größte Metropole und somit eine ganz andere Welt als jene, die wir bis dahin erlebt hatten. Meine Familie in Mexiko ist reich. Und mächtig. Der erste Ehemann meiner Großtante war der Enkel des ersten demokratisch gewählten Präsidenten von Mexiko, Plutarco Elías Calles. Als Kind lernte ich den zweiten Ehemann meiner Großtante kennen, meinen Großonkel Miguel. Miguel war einer der beeindruckendsten Menschen, denen ich zeit meines Lebens begegnete. Er war klug und besonnen, herzlich und bescheiden, und er erschien mir als wandelndes Lexikon auf zwei Beinen. Ich glaubte wirklich, er wisse alles. Selbst Deutsch konnte er sprechen. Wir würden im Salon, der sich über zwei Etagen erstreckte, beieinander sitzen, beim Kamin oder am Klavier, und ich würde darauf warten, wieder in seinen Bann gezogen zu werden: wenn er mir von den Azteken, Inkas und Mayas erzählte, von seiner Arbeit als Archäologe, als Architekt, bei den Vereinten Nationen oder von den unzähligen Reisen, von denen er und meine Großtante Kunst aus aller Welt mitbrachten. Kunstwerke und Bücher füllten den Raum in seiner Gänze aus.
Doch draußen, vor den bewachten Toren der geschlossenen Wohnanlage im wunderschönen Stadtteil Coyoacán, war das Pflaster ein anderes. Noch nie hatte ich so viele Menschen auf den Straßen sitzen, arbeiten, tanzen, musizieren sehen. Sie bereiteten Essen zu, knüpften Puppen, flochten Körbe, einige bettelten und kamen mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Junge, Alte, ganz Junge und ganz Alte, sie alle schienen ihr Leben vor uns auszubreiten.
Als wir meinen Onkel treffen wollten – der im Übrigen, nach meinem Großonkel benannt, ebenfalls Miguel heißt –, bat uns dieser darum, dass wir uns direkt zum Essen verabreden. Damals war er gerade frisch mit seiner Doktorarbeit in Wirtschaftswissenschaften fertig, hielt das Diplom der amerikanischen Elite-Universität Harvard in Händen und trat direkt darauf eine Stelle im Finanzministerium an. Zu Hause war er nur zum Schlafen. Am Tag unserer Verabredung wurden wir von seinem Chauffeur in einer schwarzen Limousine vor dem Haus abgeholt und ins Restaurant kutschiert. Wir fuhren durch die Straßen der Metropole, und ich erinnere mich an meine Gedanken und Gefühle, die Achterbahn fuhren: Wie konnte es eine solche Gleichzeitigkeit von Armut und Reichtum geben? Das waren die Welten, die ich kennenlernte. Die Kontraste, zwischen denen ich mich bewegte, die mich bewegten.
Zwei Jahrzehnte später, inzwischen war es 2019, begann ich meine Doktorarbeit in Politikwissenschaft zu schreiben. Unbedingt wollte ich weiter über Ungleichheit forschen. Unbedingt sollte es um Vermögensungleichheit gehen. Als ich überlegte, welche Länder ich unter die Lupe nehmen wollte, schaute ich mir das wohl bekannteste Standardmaß der Ungleichheit an, den sogenannten Gini-Koeffizienten.[3] Der Gini verläuft zwischen 0 und 1, wobei 0 heißt, alle hätten gleich viel, und 1 bedeutet, einer hätte alles. Ich staunte wirklich nicht schlecht, als ich erstmals sah, dass der Vermögens-Gini von Deutschland auf demselben Level ist wie der Vermögens-Gini von Mexiko. Diese beiden Länder sind so unterschiedlich, und doch haben sie dies gemeinsam: Sie zählen mit einem Gini-Index von etwa 0,8 zu den ungleichsten Demokratien der Welt.
Ich würde also diese beiden Staaten vergleichen, Deutschland und Mexiko, um dann herauszuarbeiten, was sie – bei aller Unterschiedlichkeit – gemeinsam haben.[1] Während ich 20 Jahre nach meinem ersten Besuch in Mexiko-Stadt über das Thema meiner Doktorarbeit grübelte, hatte mein Onkel Miguel eine steile Karriere hingelegt. Unter anderem war er für einige Jahre Stellvertretender Finanzminister von Mexiko. Er würde mir, wie sich noch zeigen sollte, für meine Forschung Türen öffnen, an deren Schwellen andere nicht einmal hätten treten dürfen. Ich wiederum hatte gerade meine Ausbildung zur Pressereferentin absolviert und arbeitete als studentische Hilfskraft im Bundestagsbüro einer Abgeordneten. Das erklärt, warum die mächtigsten Menschen Deutschlands und Mexikos mit mir Interviews führten.
Auch wenn es im Folgenden vor allem um Deutschland gehen wird, gibt es eine Anekdote aus Mexiko, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Weil sie exemplarisch für das steht, was wir dort wie hier, was wir überall vorfinden. Nachdem einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse Mexikos – nennen wir ihn einfach mal Carlos[4] – und ich ein einstündiges Interview führten, meinte er, es habe ihm Spaß gemacht, mit mir zu diskutieren. «Das war keine Diskussion. Das war ein Interview. Ich habe eine ganz andere Sicht auf die Dinge als du», antwortete ich. Bei meiner nächsten Forschungsreise nach Mexiko wollten wir uns wiedersehen, diesmal um wirklich zu diskutieren. Wir trafen uns in seinem Apartment. Wenn er in Mexiko-Stadt ist, residiert er im Stadtteil Polanco in einem der besten Hotels der ganzen Stadt, im 19. Stock. Er zahlt aber nicht pro Nacht. Das gigantische Apartment gehört ihm. Ich setzte mich auf die Couch, vor mir stand, so Carlos, «der beste Whisky der Welt». Zu meiner Linken hing ein echter Rafael Coronel. Coronel ist für Mexiko, was Andy Warhol für Amerika ist. Ich mag Coronel. Ich mag Whisky. Und ich mochte den Panoramablick über die Metropole. Wir diskutierten also. Dass wir in vielen Punkten völlig entgegengesetzte Positionen vertraten, überraschte uns nicht. Es machte Spaß, wir hörten einander zu und gingen auf die Argumente des anderen ein. An einer Stelle hakte ich ein:
Linartas: «Das siehst du so, weil du reich bist.»
Carlos: «Ich schwöre dir, nein. Meine Art zu leben ist sehr simpel.»
Linartas: «Also bitte, das stimmt nicht. Das hier ist ein unglaubliches Apartment. Und natürlich bist du reich.»
Carlos: «Ich gehöre zu den ganz kleinen Fischen.»
Sosehr ich Carlos auch schätze, an dieser Stelle möchte ich doch darauf beharren: Er ist reich. Bis zu diesem Gespräch glaubte ich, dass der CDU-Politiker Friedrich Merz es nicht ernst gemeint haben könne, als er vor einigen Jahren davon sprach, zur oberen Mittelschicht zu gehören. Tatsächlich hatte sich Merz dank seines ehemaligen Postens im Aufsichtsrat der deutschen Tochtergesellschaft des weltweit größten Vermögensverwalters Blackrock ein Vermögen von 12 Millionen Euro aufbauen und sich einen Flugzeug zulegen können - eine Diamond-DA62-Propellermaschine mit fünf Sitzen, Kostenpunkt fast eine Million Euro..[2] Doch als er 2018 der Bild ein Interview gab, meinte er von sich, dass er «sicher nicht» zur Oberschicht zähle.[3] Das Absurde ist: Neben dem mexikanischen Wirtschaftsboss wirkt Merz in der Tat geradezu bescheiden. Das Phänomen der maßlosen Fehleinschätzung scheint weitverbreitet. Und tatsächlich zeigen Studien: Das ist es auch.[4] Dabei wollen nicht nur die Reichen Mitte sein. Auch Menschen in Armut glauben daran, dass sie es wären.
Wenn alle glauben, sie wären weder arm noch reich, wenn alle meinen, sie würden zur Mitte gehören, dann braucht es auch keine entsprechende Politik der Rückverteilung, die die Menschen von den oberen und unteren Rändern einander näher rücken lässt. Wenn die Bevölkerung nicht um die extreme Vermögensungleichheit und ihren Platz in der Gesellschaftspyramide weiß: Wie sollen wir dann überhaupt in der Gesellschaft diese Debatte führen? Wie sollen wir Forderungen der Rückverteilung an die Politik formulieren? Der französische Dadaismus-Künstler Marcel Duchamp hat einst gesagt: «Es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt.»[5] Das verdeutlicht die Misere sehr gut: Wo die Menschen kein Problem erkennen, da braucht es auch keine Lösung.
Dabei ist die extreme und wachsende Vermögensungleichheit eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Genau diese These möchte ich gleich zu Beginn belegen. Wenn wir es nicht schaffen, die Ungleichheit zu reduzieren, wird sich unsere Gesellschaft immer weiter spalten. Menschen in Armut und in der Mitte der Gesellschaft würden ihr ohnehin bereits schwindendes Vertrauen in politische Institutionen weiter verlieren. Ungleichheit wirkt wie Dünger auf dem braunen Nährboden extremistischer Parteien, die unsere Demokratie vollends zu demontieren drohen. Zugleich würde es zunehmend schwerer, der Einflussnahme der Vermögenden auf Gesetzgebungsverfahren entgegenzutreten. Allem voran ist die Ausgestaltung der Steuerpolitik Ausdruck der Interessen einer mächtigen Lobby und führt dazu, dass Arbeit und Leistung sich immer weniger lohnen, während zugleich die reichsten Dynastien in Deutschland ihre Vermögen und ihre Macht weiter ausbauen. Dabei charakterisiert die reichsten Familien Deutschlands bereits jetzt vor allem eins: Sie sind Erben. Die Vorstellung, Deutschland wäre eine Leistungsgesellschaft, ist eine Mär. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte aller Vermögen nicht selbst erarbeitet, sondern geerbt oder als Geschenk empfangen. Tendenz steigend. Bei Milliardenvermögen trifft dies gar auf vier von fünf Vermögen zu.
Ohne eine Trendumkehr ist nicht nur unser gesellschaftlicher Frieden in Gefahr: Je reicher einzelne Individuen sind, desto mehr CO2 stoßen sie aus. Es ist eben nicht nur eine Frage des Verhältnisses von Arm und Reich. Exzessiver Reichtum, der Überreichtum der wenigen, ist auch einfach zu viel. Wenn wir den Überreichen gestatten, dass ihre Vermögen immer größere Dimensionen annehmen, wird auch ihr CO2-Ausstoß immer weiter wachsen und die Klimaziele von Paris in unerreichbare Ferne rücken. Doch das muss so nicht sein.
Ungleichheit wurde schon einmal durch politische Maßnahmen stark reduziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es vor allem Steuern auf hohe Vermögen, die dazu führten, dass die Schere zusammenging. Mit Blick darauf, welche Rolle Erbschaften heutzutage – und in Zukunft in noch größerem Maße – spielen, widmen wir uns daher der Erbschaftsteuer. Sie ist eins der mächtigsten Werkzeuge, um die fortschreitende Ungleichheit über Generationen hinweg effektiv zu bekämpfen. Seit dem Ausruf der Weimarer Republik im Jahr 1919 hat die Erbschaftsteuer Stärkungen als auch Schwächungen erfahren.
Wir werden auf ein Jahrhundert der Auf und Abs zurückblicken und sehen, was genau dazu führte, dass sie manches Mal geschwächt wurde, und was es braucht, um sie zu stärken. Das Grandiose an einem so langen Überblick von einhundert Jahren ist, dass uns die Flughöhe erlaubt zu erkennen, wie sehr sich die Dinge gedreht und gewendet haben. Die Erbschaftsteuer wurde nicht immer als ein Jobkiller verstanden. Sie bedrohte früher nicht das Häuschen der Oma. Es gab auch Zeiten, in denen es weitestgehend Konsens war, dass sie eins der wichtigsten Werkzeuge überhaupt ist, um die Ungleichheit zu senken, Gerechtigkeit walten zu lassen und die Demokratie zu stärken – ja, überhaupt die Demokratie möglich zu machen. Betrachten wir also, wie sich die Sicht der politischen Elite, also all derjenigen, die an der Ausarbeitung der Gesetzestexte mitwirkten, seit der Weimarer Republik gewandelt hat.
Die politische Elite ist das eine. Doch wie steht es eigentlich um die Elite, der sogar eine noch größere Macht zugesprochen wird? Wir wissen um die Macht der Wirtschaftselite, politische Ergebnisse, die politische Agenda und die öffentliche Meinung maßgeblich zu beeinflussen. Doch wie steht es überhaupt um ihre Präferenzen? Was halten die mächtigen DAX-Vorstände von Staat, Steuern und konkret von der Erbschaftsteuer? Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich die Chefs von Siemens, BASF, RWE, E.ON & Co. in Interviews genau dazu befragt. Die Einblicke, die mir Joe Kaeser, Martin Brudermüller, Markus Krebber, Leonhard Birnbaum und viele mehr gewährten, sind einzigartig, überraschend und spannend. Die erste Erkenntnis: Es gibt nicht die eine Wirtschaftselite. Die zweite: Eine kritische Betrachtung offenbart den hohen Mythengehalt viele ihrer mächtigsten Narrative.
Wenn wir verhindern wollen, dass Deutschland vollends zu einer Erbengesellschaft verkommt, benötigen wir eine tiefgreifende, ganzheitliche Strategie. Eine Maßnahme allein ist nicht genug. Was wir brauchen, ist ein wahrer Paradigmenwechsel – sprich: ein Wandel der höchsten Ziele in unserer Gesellschaft und der Werkzeuge, die es zur Erreichung dieser Ziele braucht. Es ist dabei von größter Bedeutung, die verfassungswidrige Erbschaftsteuer endlich gerecht zu gestalten. Es ist an der Politik, darauf zu achten, dass sich Vermögen nicht in den Händen weniger konzentriert. Wir sollten aber nicht nur von oben nehmen, sondern auch bei der Vermögensbildung von unten anpacken. Wissenschaftlerinnen haben wiederholt aufgezeigt, dass wir vor allem über eine Idee nachdenken sollten, wenn wir die Ungleichheit wirklich schnell und effektiv senken wollen: das Grunderbe. Doch das Grunderbe ist mehr als nur eine Wunderwaffe gegen Ungleichheit. Es sind auch Fragen der Gerechtigkeit, die sehr stark für eine Einführung sprechen. Es ist an der Zeit, dem Grunderbe den Raum zu geben, den es verdient hat, und es endlich genau zu betrachten.
Worum es mir geht, ist Ungleichheit als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit be-/greifbar zu machen. Was es dafür braucht, ist eine grundlegende Übersetzungsarbeit der Erkenntnisse der Wissenschaft der letzten Jahre in eine allgemein verständliche Sprache. Wir können die Debatte über eines der drängendsten Probleme unserer Zeit nicht nur Expertinnen überlassen. Um es in aller Deutlichkeit klarzustellen: Dies ist kein essayistischer Meinungsbeitrag. Auch wenn dies kein klassisches akademisches Werk ist, so fußt es doch auf meiner Doktorarbeit.[6] Es basiert aber auf etwas noch viel Größerem. Auf der Hoffnung, hier ein Buch zu liefern, das eindrücklich ist, das Stoff für Gespräche liefert. Das hilft, allen Leserinnen einen weiten und kritischen Blick auf das Thema zu werfen. Und vor allem hoffe ich eines: dass es im besten Sinne, im Sinne des Optimismus, ansteckend ist und Mut macht. Denn die wichtigste aller Erkenntnisse ist die: Dass die Lösungen gegen Ungleichheit in unserer Hand liegen.
Teil IExtreme Ungleichheit ist ein extremes Problem
1.Auftakt: Die Ungleichheit betritt die Bühne
Als Anfang 2017 die Nichtregierungsorganisation Oxfam einen Bericht veröffentlichte, gingen die Schlagzeilen um die Welt: Nur acht Männer besitzen zusammen so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.[5] In diesem Bericht warnt Oxfam vor einer wachsenden und gefährlichen Vermögenskonzentration, die «mehr als grotesk» sei. Solche Statistiken sind besorgniserregend. Und in der Tat fanden diese Zahlen in derselben Woche, in der das Weltwirtschaftsforum seine Jahreskonferenz in Davos abhielt, Eingang in die Debatte. «Es handelt sich um weit mehr als ein Zahlenspiel: Dies sind die Kennzeichen eines Wirtschaftssystems, das die Menschen vergessen hat … Der Reichtum sickert nicht zu den Armen hinunter. Oxfam weiß das, der Internationale Währungsfonds weiß das, die Weltbank weiß das.»[6] Der Wohlstand muss alle Bürgerinnen erreichen.
Doch davon sind wir weit entfernt.[7] Die gute Nachricht: Zwischen den Ländern ist die Ungleichheit im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte gesunken. Die schlechte Nachricht lautet, dass die Ungleichheit innerhalb der Länder zugenommen hat und die Mittelschicht schrumpft. Die Kluft zwischen oben und unten hat sich stetig vergrößert.[8] Wenn wir weitermachen wie bisher, wird die Schere weiter wachsen. Lange Zeit galt nur der Armut die Aufmerksamkeit. Doch heute wissen wir, dass Armut nur die eine Seite der Medaille darstellt.
Denn all die Probleme, Sicherheit, Kriminalität und das Unglücksempfinden in der Bevölkerung, hängen ganz direkt mit Ungleichheit zusammen. Wenn die wirtschaftliche Ungleichheit zunimmt, verschlechtern sich auch unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ungleichheit kann sich auf das Ausmaß der Gewalt (einschließlich Morde), die Ausbreitung chronischer Krankheiten und auf die Sterblichkeitsrate einer Gesellschaft auswirken. In Deutschland bedeutet dies etwa, dass Männer in Armut über acht Jahre kürzer leben als wohlhabende Männer. Bei Frauen wird das Lebensband vier Jahre früher durchschnitten.[9] Diese Befunde sind keine bloße Korrelation. Die desaströsen Probleme und hohe Ungleichheit hängen nicht lose miteinander zusammen; der Zusammenhang ist kausal: Ungleichheit führt zu diesen Problemen.[10]
Dass die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit eine Herausforderung darstellt und dass man sich Sorgen und Gedanken machen sollte, wie diese zu reduzieren sei, mag offensichtlich erscheinen. Doch es ist erst wenige Jahre her, dass sich Ungleichheit als Debatten- und Forschungsthema entscheidend von den Rändern in das Zentrum des Interesses bewegt hat. Mit Das Kapital im 21. Jahrhundert hat Thomas Piketty im Jahr 2014 das Thema salonfähig gemacht und die Diskussion über die politische Dimension von Ungleichheit entfacht.[11] 2015 wurde ein weiterer Meilenstein gelegt, als Ungleichheit in den Kanon der 17 Nachhaltigkeitsziele – bekannt als Sustainable Development Goals, kurz: SDGs – der Vereinten Nationen aufgenommen wurde.[12] «Die Reduzierung der Ungleichheit» als SDG 10 stellt «nicht nur ein moralisches oder ethisches Problem dar; es wird zunehmend als ein zentrales Hindernis für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung gesehen».[13] Bereits acht Jahre später umfasst der Chor derjenigen, die diese Botschaft laut verkünden, die mächtigsten Stimmen der Wirtschaftswissenschaften: Am 17. Juli 2023 sendeten 200 führende Ökonominnen einen offenen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Präsidenten der Weltbank, in dem sie feststellten, dass «SDG 10 kein separates, eigenständiges Ziel ist: Alle wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Maßnahmen sollten im Hinblick auf ihre wahrscheinlichen Auswirkungen auf dieses Ziel bewertet werden».[14]
Die Protagonistin des Buches
Wenn Ungleichheit die Protagonistin des Buches ist, dann sollte eingangs kurz geklärt werden: Was ist Ungleichheit überhaupt? Eine der wichtigsten Prämissen für ein solides Verständnis dessen, was im Buch folgt, ist die unumstößliche Annahme, dass Ungleichheit sozial und politisch gestaltet ist.
Ungleichheit ist eben nicht gleich Unterschied. Ungleichheit und Unterschied auseinanderzuhalten, schärft nicht nur den Blick für die Analyse, sondern ist zugleich auch der entscheidende Faktor, der Hoffnung macht. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Menschen und Menschengruppen, die offen beschrieben werden können und real erfahrbar sind. Sobald aber diese Unterschiede durch unser Zusammenleben in der Gesellschaft eine Hierarchie erfahren – die einen privilegiert behandelt werden, die anderen Diskriminierung erleiden –, sprechen wir von Ungleichheit.[15] Wenn ich Ungleichheit kritisiere, dann tue ich dies mit Blick auf die Gleichheit, die in unserem Grundgesetz in Artikel drei verankert ist: Vor dem Gesetz sind alle gleich, «(n)iemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, [der rassistischen Zuschreibung], seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.»[16] Das ist der Anspruch, dem wir als Gesellschaft gerecht werden müssen. Und es ist an der Politik, diesen Anspruch zu gestalten. Denn die Politik setzt den Rahmen und die Gesetze, durch die Normen und Werte geprägt und gelebt werden.
Die bestehenden Ungleichheiten sind weder gottgegeben noch folgen sie physikalischen Gesetzen. Doch oftmals erscheinen Formen der Ungleichheit geradezu natürlich, unabänderlich und werden insbesondere von denjenigen, die in der Hierarchie höher stehen, gar nicht erst wahrgenommen. Das macht die Sache nun etwas kompliziert. Denn es bedeutet, dass diejenigen, die zu den vermeintlichen Gewinnern zählen, selbstkritisch ihre eigene Position abklopfen müssten, um überhaupt zu erkennen, wo sie stehen. Nämlich oben. Privilegiert. Das passiert leider viel zu selten. In aller Regel – ob im Kampf um das Frauenwahlrecht, die Rechte von Schwarzen oder für die LGBTQIA*-Community[17] – waren es die marginalisierten Gruppen selbst, deren Aufschrei und Protest zu größerer Gerechtigkeit in der Gesellschaft führten. Trotz all der Kämpfe und vieler Errungenschaften ist die Schere an vielen Stellen noch groß. Zu groß. Wenn also Unterschiede dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen von Diskriminierung und Armut betroffen sind, andere hingegen privilegiert werden und wesentlich höhere Einkommen und Vermögen erzielen, dann läuft auf politischer Ebene etwas gewaltig schief.
Es klang nun bereits an: Es gibt nicht die eine Ungleichheit. Ungleichheit hat viele Formen und Facetten. Um sie zu unterscheiden, kann man zwei Achsen betrachten. Von den horizontalen, den sozialen Ungleichheiten sprechen wir, wenn Menschen aus gesellschaftlichen, sozialen Gründen über unterschiedliche Lebenschancen verfügen. Dazu zählen beispielsweise Geschlecht, Hautfarbe und Religion; ja eigentlich all die Unterschiede, die in Artikel drei des Grundgesetzes genannt werden. Zum Zweiten gibt es die vertikalen, die wirtschaftlichen Ungleichheiten. Diese erfassen die Unterschiede zwischen Arm und Reich.
In Bezug auf die wirtschaftlichen Ungleichheiten werden in der Regel zwei Formen unterschieden: Einkommens- und Vermögensungleichheit. Die Einkommensungleichheit gibt an, wie ungleich die Einkommen verteilt sind, die meist monatlich auf das Konto eingehen. Zu Vermögen – oder auch Kapital oder Eigentum – zählen alle Güter, Rechte und Forderungen, die durch eine Eigentümerin in Geld umgemünzt werden können. Dazu gehören ganz klassisch Geld, Immobilien, Autos, Hausrat, aber auch Aktien, Patent- oder Urheberrechte, die entweder privat, als Betriebsvermögen, Kirchen- oder Staatsvermögen gehalten werden können.[18] Einkommen betreffen (fast) alle und können besser gemessen werden. Doch die Vermögen sind sehr viel ungleicher verteilt.
In diesem Buch widmen wir uns der Schere zwischen Arm und Reich, genauer der grotesken Vermögensungleichheit. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass die verschiedenen Formen von Ungleichheit miteinander verschränkt sind. Der Fachbegriff dafür heißt Intersektionalität. In den sozialen Ungleichheiten gibt es in jeder Kategorie einen Status, der über den anderen steht. Indem man Intersektionalität auf Ungleichheit anwendet, kann man sowohl Überschneidungen von Benachteiligungen (z.B. die Mehrfachdiskriminierung von Frau und BIPoC[19]) als auch Überschneidungen von Privilegien (z.B. Mann und weiß) untersuchen. Durch das Prisma der Intersektionalität zu blicken bedeutet, die Achsen der sozialen Ungleichheiten zu demaskieren, die strukturell vorgeben, wer gesellschaftlich von Diskriminierung und Armut betroffen ist und wer wiederum Macht und Vermögen auf sich konzentriert. Was nach einem wissenschaftlichen, theoretischen Konzept klingt, ist aus der realen Not Schwarzer Frauen heraus entstanden. «Intersektionalität», wie Kimberlé Crenshaw betont, «war gelebte Realität, bevor sie zu einem Begriff wurde.»[20]
1 Geschlecht, Hautfarbe, Klasse und sexuelle Orientierung haben Einfluss darauf, wie hoch das durchschnittliche Einkommen und Vermögen einer Personengruppe ist.
Um Ihnen vor Augen zu führen, wie etwa eine Überlappung von Privilegien aussehen kann: Erinnern Sie sich an das Foto der Sicherheitskonferenz in München im Jahr 2022, das auf X, vormals Twitter, viral ging? Abgebildet war das Treffen von 30 Vorstandsvorsitzenden der größten börsennotierten Unternehmen bei einem Business-Lunch. Das Bild ging viral, weil «die Chefs … vor allem männlich und weiß» waren, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb.[21] Im Nachhinein hieß es, dass dieses Bild nicht die Wahrheit abgebildet habe. Eine Frau war gerade zur Toilette gegangen, als das Foto entstanden ist. Dieser klägliche Versuch der Relativierung hat eine zweite Welle der Empörung ausgelöst. Eine fehlende Diversität und eindeutige Unwucht zugunsten von weißen Männern in den mächtigsten und höchstdotierten Positionen (im Schnitt verdient ein Vorstandsvorsitzender eines solchen Unternehmens ein Jahresgehalt von 5,7 Millionen Euro[22]) war nicht von der Hand zu weisen. Das Bild sprach für sich. Es entspricht aber auch den Forschungsergebnissen von Wirtschaftswissenschaftlern des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die in einer Studie MillionärInnen unter das Mikroskop nahmen (die Studie heißt tatsächlich so).[23] Und was stellten sie fest? Dass Millionäre meist weiß, männlich, aus Westdeutschland und höheren Alters (über 50) sind.
Andersherum sind Frauen, die BIPoC und jung sind, in der Regel ärmer. Das soll nun keineswegs bedeuten, dass nicht auch etwa eine Schwarze junge Frau horrende Summen auf ihrem Konto haben könnte. Es bedeutet lediglich, dass es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass alte weiße Männer – so polemisch aufgeladen diese Zuschreibung auch klingen mag – vermögender sind. Solche Feststellungen haben nichts Wertendes, nichts Normatives. Es sind schlicht Tatsachenbeschreibungen. Diese Beobachtungen wissenschaftlich, also empirisch, zu erfassen, ist von größter Bedeutung. Denn wenn wir feststellen, dass ganze Gruppen in der Bevölkerung entweder besonders arm oder reich sind, dann können wir von strukturellen Phänomenen sprechen. Und somit gesellschaftlich und politisch nach strukturellen Lösungsansätzen für diese Probleme suchen.
Unsere perfide Vermögensungleichheit
Wenden wir uns also der Ungleichheit von Vermögen zu. Auf globaler Ebene verfügt das reichste 1 Prozent über 44,5 Prozent allen Vermögens.[24] Ein ganz schön großes Stück vom Kuchen also. Und das Stück wird immer größer: In den drei Jahren nach 2020 haben die fünf reichsten Männer der Welt (ja, es sind nur Männer) ihr Vermögen mehr als verdoppelt: von 405 auf 869 Milliarden US-Dollar.[25] Dieses Backpulver möchte man haben. Im selben Zeitraum haben die fünf Milliarden ärmsten Menschen mehrere Milliarden verloren.[26] Während die einen unter den Kriegen und Krisen dieser Erde leiden, wurden die wenigen an der Spitze zu Profiteuren in leidvollen Zeiten.
2 Das reichste 1 Prozent der Weltbevölkerung besitzt 44,5 Prozent des gesamten globalen Vermögens.
Und in Deutschland? Ohne jegliche Übertreibung können wir von einer Vermögensungleichheit der Extralative sprechen. Wie exakt diese aussieht, können wir nicht mit letzter Gewissheit sagen. Denn seit die Vermögensteuer 1997 ausgesetzt wurde, fehlen die Steuerangaben, die für die genaue Berechnung vonnöten sind. Das bedeutet in logischer Konsequenz, dass die Wissenschaft spitzfindig und kreativ werden musste, um eine zuverlässige Antwort auf diese Frage zu liefern. Das Forschungsteam von Carsten Schröder vom DIW hat in dieser Hinsicht wirklich ganze Arbeit geleistet. Denn anders als bei Einkommen können wir uns bei Vermögen nicht auf Bevölkerungsbefragungen wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) verlassen. Ganz einfach, weil im SOEP die Vermögen der Multimillionäre und Milliardäre leider kaum bis gar nicht erfasst werden.
Also haben besagte Ökonomen vom DIW eine Extra-Stichprobe erhoben, die auf Hochvermögende abzielte – sie nannten diese dann SOEP-P.[27] Ausgestattet mit dem SOEP, dem SOEP-P und der Reichenliste des Manager Magazins, konnten Schröder und seine Kolleginnen Datenlücken schließen und das Ausmaß der Vermögensungleichheit in Deutschland statistisch aussagekräftig bestimmen. Wurde bis dahin angenommen, dass das reichste 1 Prozent über 22 Prozent des Gesamtvermögens verfügte, stellte sich nun heraus, dass es in Wirklichkeit mehr als 35 Prozent sind. Von 100 Menschen hat also der eine an der Spitze mehr als ein Drittel des gesamten Kuchens. Die reichsten 10 Prozent der Deutschen verfügen denn auch nicht über knapp 59 Prozent, wie noch vor bis nicht allzu langer Zeit angenommen, sondern über 67 Prozent allen Vermögens.
Die ärmere Hälfte der Haushalte kommt auf nur 1,4 Prozent. Auf Ebene von Einzelpersonen ist die Vermögensverteilung sogar noch extremer: Laut dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung besitzt die reichere Hälfte 99,5 Prozent des sogenannten Nettovermögens (sprich Vermögen abzüglich der Kredite und Schulden) und die ärmere Hälfte muss sich mit verschwindend geringen 0,5 Prozent zufriedengeben.[28] Es ist frappierend, über wie wenig die ärmeren Teile der deutschen Bevölkerung verfügen – egal, ob man sich Haushalte oder Einzelpersonen ansieht.
3 Die reichere Hälfte in Deutschland hält auf individueller Ebene 99,5 Prozent des gesamten Nettovermögens, die ärmere Hälfte besitzt lediglich 0,5 Prozent.
Ganze 40 Prozent der deutschen Haushalte haben keinerlei Ersparnisse.[29] Das muss man sich einmal vorstellen: vier von zehn Familien in Deutschland haben überhaupt nichts auf der hohen Kante, wenn einmal die Waschmaschine kaputtgeht, Winterschuhe hinüber sind oder wenn die Preise in die Höhe schnellen. Diese Menschen, Zigmillionen an der Zahl, müssen sich jede Extraanschaffung im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde absparen.
Kann eine Gesellschaft sehr viel ungleicher sein? Die Antwort mit Blick auf den Gini-Index lautet: Nein. Bei Einkommen liegt der Gini in Deutschland bei etwa 0,3, allerdings nach Steuern und Transferleistungen. Bevor der Staat eingreift, liegt der Einkommens-Gini bei 0,5. Das bedeutet, dass es dem Staat tatsächlich gelingt, durch politische Maßnahmen die Ungleichheit von Einkommen massiv zu senken. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten sind wir in puncto Einkommensungleichheit im Mittelfeld. Doch bei Vermögen sieht es schon ganz anders aus: Laut neuesten Berechnungen liegt der Vermögens-Gini bei sage und schreibe 0,83, wobei 1, wir erinnern uns, die höchstmögliche Ungleichheit bedeutet. Mit diesem hohen Gini nimmt Deutschland im internationalen Vergleich einen unrühmlichen Spitzenplatz unter den Demokratien mit der extremsten Vermögensungleichheit ein. Das ist auch der Grund, warum es in diesem Buch um Vermögensungleichheit geht. Denn viel zu häufig sprechen wir noch über das Einkommen, wenn wir an wirtschaftliche Ungleichheit denken.
Die Vermögen der Deutschen nehmen schier unvorstellbare Dimensionen an. «Wetten, dass …» Sie eine Weile brauchen werden, um die Vermögen der reichsten Deutschen wirklich zu begreifen? Beginnen wir behutsam, in der Sphäre des noch Vorstellbaren, im Millionenbereich. Wer hierzulande zu den reichsten 1,5 Prozent der Bevölkerung zählt, gehört bereits zum Club der Millionäre. Das sind 1,6 Millionen Menschen.[30] Die meisten von ihnen sind männlich (69 Prozent), über 50 Jahre alt (77 Prozent), weiß (86 Prozent haben keinen Migrationshintergrund) und überwiegend aus Westdeutschland (94 Prozent).[31]
Wer Millionär ist, hat nicht einfach eine Million Euro auf dem Konto liegen. Millionärsvermögen setzen sich anders zusammen als jene vom Rest der Bevölkerung. Millionäre verfügen nicht nur über sehr viel höhere Summen auf der Bank, sie besitzen im Schnitt auch mehr als nur die Immobilien, die sie selbst nutzen (sodass sie durch Mieten weiteres Einkommen erzielen). Zudem halten Millionäre hohe Finanzvermögen. Vor allem aber besitzen sie zusammen über 86 Prozent aller Betriebsvermögen – also Anteile von Firmen und Unternehmen. Diese besondere Form des Vermögens ist der wichtigste aller Faktoren, mit dem die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland erklärt werden kann.[32]
Ganze 872000 Deutsche, also grob das reichste 1 Prozent, darf sich gar als «Rentier» verstehen.[33] Diese Menschen müssen für ihr Einkommen nicht arbeiten. Sie leben von sogenannten «passiven Einkommen» aus ihrem Großvermögen. Ihr Vermögen arbeitet für sie. Nur dass Vermögen eben nicht «arbeitet». Oder haben Sie, wie Volker Pispers ironisch fragt, «schon mal versucht, einem 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand zu drücken»?[34] Diese Rentiers besitzen Vermögen, die so angelegt sind, dass sie Einnahmen erzielen. Sie arbeiten nicht für ihr Einkommen, sie häufen es an. Ein einfaches Beispiel sind Mietwohnungen. Im bundesweiten Durchschnitt zahlen Deutsche knapp 28 Prozent ihres Einkommens für die Miete.[35] Das bedeutet ganz einfach, dass knapp 28 Prozent des Lohns nicht in die eigenen Taschen fließen, sondern in die des Vermieters. Allerdings entsprechen diese Zahlen längst nicht mehr der Realität von Geringverdienern und Menschen in Metropolen. Immer mehr Haushalte in Deutschland sind überlastet durch ihre Miete. Sie müssen also mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für Mieten aufwenden. Die Anzahl der Haushalte, die derart überlastet sind, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten fast verdreifacht (von 5 auf 14 Prozent).[36]
Bei Studierenden ist es nochmals extremer: Studierende müssen 54 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben.[37] Dabei wird der Wohnraum knapp und Mieten für das Gros der Bevölkerung immer teurer: 2023 mussten Mieterinnen bei Neuverträgen in Deutschland im Schnitt 3,9 Prozent mehr auf den Tisch packen, in den Millionenstädten Berlin, Hamburg, München und Köln gar 11,8 Prozent.[38] Der lang anhaltende Trend der Mietsteigerungen macht zwar die Mieterinnen ärmer. Doch für die Besitzer von Mietshäusern oder Aktien von Immobilienkonzernen hat sich die Entwicklung bezahlt gemacht. Ihre «passiven Einkommen» sind weiter gestiegen. Die Ungleichheit ebenso.
Deutschlands Überreiche
Nochmals eine Stufe höher kommen wir in den Bereich, in dem in aller Regel bewundernd von den «Superreichen» die Rede ist. Eine einheitliche Definition gibt es nicht. Mal wird die Grenze bei 30 Millionen, mal bei 50 oder auch 100 Millionen US-Dollar oder Euro gezogen. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) etwa setzt die Grenze im dreistelligen Millionenbereich. Als die BCG den Global Wealth Report 2024 präsentierte, titelten zahlreiche deutsche Zeitungen, dass 3300 deutsche Superreiche 23 Prozent des gesamten deutschen Finanzvermögens[7] besitzen. Das ist doch verrückt: Nur 3300 Menschen besitzen fast ein Viertel allen Finanzvermögens. In den meist auf Englisch verfassten Vermögensberichten lautet die Bezeichnung für Menschen mit solch hohen Vermögen Ultra High Net Worth Individuals. Meist werden aus diesen in der deutschen Debatte dann die Superreichen. Ich persönlich spreche von «Überreichen» und «Überreichtum» – weil Sprache unser Verständnis prägt und Wirklichkeit schafft. Welche Bilder kommen einem in den Sinn, wenn man von Superreichtum spricht? Dass er super sei. Doch wie ich noch zeigen werde, ist exzessiver Reichtum, ob er nun bei 30, 50 oder 100 Millionen Euro beginnt, alles andere als das.[39]
Und wie steht es um die deutschen Milliardäre, an der Spitze des Überreichtums? Hier ist nun Ihre Fantasie gefragt. Nicht bei der Anzahl der Milliardäre, diese Zahl ist leicht zu verdauen: Es sind 249. Das mag wenig klingen, bugsiert uns im weltweiten Ranking aber immerhin auf den vierten Platz.[40] Doch das Milliardenvermögen ist kaum zu begreifen. Das Manager Magazin schätzt den Überreichtum der Milliardäre in Deutschland auf 1100 Milliarden Euro. Wir sind also bereits im Billionenbereich. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit kommt dank neuester Daten und Berechnungen auf eine noch höhere Summe: Auf sage und schreibe mindestens 1,4 Billionen Euro.[41]
Mindestens 300-mal 1000-mal eine Million Euro – dieses gigantische Vermögen kann man noch mal obendrauf packen. Und beinahe ein Dutzend der deutschen Milliardäre, die das Netzwerk Steuergerechtigkeit in seiner Studie ausfindig gemacht hat, sind in der Reichenliste des Manager Magazins nicht einmal aufgetaucht. Der wohl erstaunlichste Fund: Die reichste Familie Deutschlands wird nicht gelistet.
Wenn man eine Umfrage auf deutschen Straßen durchführen und die Passanten nach den reichsten Deutschen fragen würde, würden wohl die meisten passen müssen. Die deutschen Überreichen sind den meisten Menschen unbekannt. Anders als in den USA – Jeff Bezos, Elon Musk, Marc Zuckerberg – sind sie kaum bis gar nicht in der Öffentlichkeit. Warum deutsche Überreiche sich so bedeckt halten, mag mit der Furcht vor Entführungen zusammenhängen, von denen es in der Vergangenheit mehrere gab.[42] Bescheidenheit ist in Deutschland zudem eine Tugend, hierzulande wird Geprotze nicht gern gesehen und der Reichtum weniger zur Schau gestellt als etwa in den USA. Vielleicht hängt es auch mit der Herkunft der Vermögen zusammen, doch dazu später mehr.
Wen ich kannte und wer sich an der Spitze der Reichenlisten immerzu ein spannendes Rennen lieferte, waren bis dato Susanne Klatten und Stefan Quandt als BMW-Erben, der öffentlichkeitsscheue Lidl-Gründer Dieter Schwarz,[8] die Aldi-Erben Beate Heister und Karl Albrecht Junior und auch Klaus-Michael Kühne, der zwar den Hamburger Fußballverein HSV als Großinvestor großzügig unterstützt, aber von Deutschland in die Schweiz zog, weil er sich daran störte, dass «immer der Fiskus reingrätschte».[43] Doch keiner der Genannten landet im Reichenranking an oberster Spitze. Dank der Recherchen von Andreas Bornefeld, die Eingang in die Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und in die ZDF-Doku Die geheime Welt der Superreichen gefunden haben, kennen wir nun den Namen der reichsten deutschen Dynastie: Es ist die adelige Familie Boehringer und von Baumbach, die Familie, in deren Besitz das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ist.
Wie konnte es sein, dass die reichste Familie Deutschlands noch bis vor Kurzem unbekannt war? Das Manager Magazin, das seit dem Jahr 2000 die Reichenliste erstellt,[44] gibt an, dass es entgegen besserem Wissen die Namen einiger reicher Familien nicht öffentlich nannte, da diese juristisch gegen sie vorgegangen seien.[45]
Boehringer Ingelheim ist vollständig im Besitz der Familiengesellschafter. Im Fachjargon spricht man davon, dass der Eigenkapitalwert des Unternehmens exakt dem gebundenen Familienvermögen entspricht.[46] Nach fundierten Schätzungen – die nötig sind, weil es sich um ein Unternehmen handelt, das nicht an der Börse ist und somit der Wert berechnet werden muss – hält die Familie der Boehringers und von Baumbachs ein Vermögen von atemberaubenden 52 bis 101 Milliarden Euro.[47] Es ist eine gigantische Spannbreite, aber Genaueres lässt sich leider tatsächlich nicht sagen.[9] Selbst wenn sie «nur» 52 Milliarden Euro besitzen sollte: Sie sind die reichste Familie Deutschlands.
Zum Vergleich: Das Vermögen des nunmehr zweitreichsten Deutschen, Dieter Schwarz, wurde Stand 2024 auf 43,7 Milliarden Euro geschätzt. Und nun lassen Sie uns einmal unsere Fantasie bemühen, um diese gigantischen Zahlen in den Bereich des Vorstellbaren zu rücken. Setzen wir diese Vermögen also einmal ins Verhältnis, etwa zum Vermögen der ärmeren Hälfte der Bevölkerung Deutschlands. Im Vorwort war die Zahl einmal kurz gefallen – wie viele Familien braucht es, um auf das Vermögen der ärmeren 42 Millionen Menschen in Deutschland zu kommen, erinnern Sie sich?
Der Spiegel machte 2018 damit Schlagzeilen, dass 45 Familien so viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung insgesamt. Nun wurden jüngst die weit klaffenden Datenlücken bei sehr großen Vermögen geschlossen, und es wurde deutlich, dass die Vermögenskonzentration tatsächlich extremer ist als bisher angenommen. Hinzu kommt, dass sich die Reichtümer der Unternehmerdynastien trotz des gesamtwirtschaftlichen Abschwungs durch die Corona-Pandemie und den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine weiter vervielfacht haben. Allein in den ersten 18 Monaten der globalen Krisenzeit haben die zehn reichsten deutschen Familien einen Vermögenszuwachs von sagenhaften 75 Prozent erlebt.[48] Wenn man nun die neue Datenlage, die ungleiche Vermögensverteilung und die Vermögensentwicklung berücksichtigt – wie viele Familien braucht es dann, die mehr als die ärmere Hälfte besitzen? Die Antwort lautet: eine, vielleicht zwei.
Die Rechnung ist leicht aufgestellt: Das gesamte deutsche Nettovermögen beträgt laut Deutscher Bundesbank 16,6 Billionen Euro.[49] 0,5 Prozent davon sind 83 Milliarden Euro – und damit weniger als das Vermögen der beiden reichsten Familien Deutschlands.[50] Je nachdem, wie hoch das Vermögen von Boehringer Ingelheim tatsächlich ist – nehmen wir an, es seien «nur» 52 Milliarden Euro –, kommt mit jenem von Dieter Schwarz eine Summe von 95,7 Milliarden Euro zusammen. Noch einmal: Die Mitglieder von ein bis zwei Familien verfügen über mehr als die ärmeren 50 Prozent aller Deutschen.
4 Dieter Schwarz und die Familie Boehringer und von Baumbach besitzen mit mindestens 95 Milliarden Euro mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung.
Nehmen wir einen weiteren Vergleich vor, um nun uns selbst ins Verhältnis zu diesem Überreichtum zu setzen.[51] Stellen Sie sich vor, 50000 Euro würden auf einem Zentimeter abgebildet werden. Nun stellen wir ein DIN-A4-Blatt vor uns. Der untere Zentimeter stellt 50000 Euro dar, bis zum oberen Blattrand summieren sich die Vermögen auf fast 1,5 Millionen Euro (knapp 30 cm × 50000 Euro). Sollten Sie zu den unteren 99 Prozent der Deutschen zählen, könnten Sie Ihr Vermögen irgendwo auf diesem Blatt eintragen. Wenn Sie wohlhabend sind, Hausbesitzer und Gutverdiener, dann sind Sie irgendwo im mittleren Bereich dieses Blattes. Wo aber sind die reichsten Deutschen nach neuestem Kenntnisstand? Ein Blatt weiter oben, ein Meter gar über den 99 Prozent? 100 Meter? Weit gefehlt. Es sind mindestens 10 Kilometer. Blicken Sie weit nach oben, etwa dorthin, wo die Flugzeuge unterwegs sind. 99 Prozent aller Deutschen sind am Boden, irgendwo auf diesem einen Blatt Papier. Die beiden reichsten Familien können aus ihrer Flughöhe die Massen am Boden nicht einmal erahnen. Und wir ihren Überreichtum ebenfalls nicht.
Wenn man die himmelhohe Ungleichheit begreifen möchte, hilft es sehr, sich einer weiteren Dimension zu bedienen: entweder der Distanz, so wie im vorherigen Beispiel, oder beispielsweise der Zeit. Ich möchte Ihnen gerne einen weiteren Vergleich an die Hand geben. Oxfam wollte in einer Umfrage von Passanten wissen: «Wenn ich Ihnen jeden Monat eine Million Euro geben würde, wie lange würde es dauern, bis Sie die reichste Person in Deutschland sind?» Ich stellte dieselbe Frage auf Instagram: Wie lange dauert es also bei 12 Millionen Euro pro Jahr? Die Antwortmöglichkeiten waren 34 Jahre (das schätzten 8 Prozent), über 340 Jahre (27 Prozent) oder über 3400 Jahre (65 Prozent). Nicht schlecht. Laut Oxfam war die richtige Antwort: über 3400 Jahre. Doch in Wirklichkeit würde man nie ganz oben ankommen. Weil die Renditen – also die Gewinne, die mit extrem hohen Vermögen gemacht werden – extrem viel höher sind als das, was man ausgehändigt bekäme.[10] Die reichste deutsche Einzelperson ist Dieter Schwarz mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro. Selbst wenn wir überaus niedrig ansetzen und eine Rendite von nur 7 Prozent veranschlagen würden, hätte er alleine dieses Jahr über 3 Milliarden Euro einkassiert.[11] Sie würden also 12 Millionen Euro erhalten, Dieter Schwarz im selben Zeitraum rund 3000 Millionen Euro. Ganz ehrlich: Dieses Rennen ist nicht zu gewinnen.
Wer wird Milliardär?
Überreichtum entsteht nie einzig aus einem unternehmerischen Geistesblitz, viel Fleiß und Arbeit von nur einer Person. In aller Regel besteht er aus Betriebsvermögen, das per Definition von vielen Menschen, die den Betrieb tragen, erwirtschaftet wird. Die größten Betriebsvermögen werden zudem über Generationen hinweg aufgebaut und weitergegeben. Wie eine Studie zeigt, hält sich Überreichtum in Deutschland hartnäckig in denselben Familien – und das trotz zweier Weltkriege, der Großen Depression, Regimewechsel und verschiedener Währungsreformen. Ein Drittel der Unternehmen, die mit den heutigen Vermögen der Überreichen in Verbindung gebracht werden können, wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg gegründet.[52] Viele dieser Vermögen gehen damit einher, dass immense Teile auch oder vielmehr gerade in Zeiten des Nationalsozialismus angehäuft wurden. Ich möchte auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren, doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieses dunkle Kapitel viele Unternehmen betrifft. Insbesondere Vermögen an der Spitze der Reichenlisten gründen sich auf diese Zeit.
In seinem Werk Braunes Erbe (im Original heißt das Buch noch treffender Nazi Billionaires) umreißt der niederländische Historiker David de Jong die Ursprünge und Entwicklungen der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Was tatsächlich frappierend ist: Familien wie die Quandts, die Flicks, die von Fincks und Porsche-Piëchs wurden nicht nur durch den Nationalsozialismus reicher – sie haben die Machtergreifung Adolf Hitlers durch Großspenden überhaupt erst ermöglicht. Großindustrielle und Banker haben 1933 den Wahlkampf der NSDAP finanziert, traten nach der Machtübernahme in die Partei ein und bereicherten sich vielfach durch die Enteignung jüdischer Unternehmer.
Wie eng die Schicksale der führenden NS-Funktionäre mit jenen der mächtigen Wirtschaftsbosse verbunden waren, ist im Laufe der Jahrzehnte in den Hintergrund geraten. Etwa, dass Harald Quandt, der Halbonkel der heutigen BMW-Erben, der Ziehsohn von Joseph Goebbels, einem der engsten Vertrauten Adolf Hitlers, war. Oder dass Ferdinand Porsche und Anton Piëch die Gunst der Stunde in Zeiten der sogenannten Arisierung nutzten, um ihren jüdischen Geschäftskollegen Adolf Rosenberger aus dem Geschäft auszuschließen, und mit der Produktion des Volkswagens ihr Milliardengeschäft begründeten. Auch August Baron von Finck stieg mit seiner Privatbank Merck Finck & Co in Zeiten des Nationalsozialismus auf. Dabei half ihm die «Arisierung» der jüdischen Banken J. Dreyfus und Rothschild.
Friedrich Flick, die Oetkers, Bahlsen – auch diese Familien werden von de Jong behandelt. Und siehe da: Ihre Angehörigen befinden sich noch immer auf den Listen der reichsten Deutschen. David de Jong beschreibt eindringlich, wie unmenschliche Arbeits- und Lebensbedingungen zur Grundlage der größten Familiendynastien Deutschlands wurden: «So arbeitete beispielsweise das KZ Auschwitz mit der IG Farben zusammen, das KZ Dachau mit BMW, Sachsenhausen mit Daimler-Benz, Ravensbrück mit Siemens, Neuengamme mit Quandts AFA, Porsches Volkswagenwerk und Dr. Oetker.»[53] Teilweise machten Zwangsarbeiter mehr als die Hälfte der Belegschaften aus.
Auf der Reichenliste vertreten ist auch Klaus-Michael Kühne, der Erbe des Logistikunternehmens Kühne + Nagel, das im Nationalsozialismus ebenfalls eine unrühmliche Rolle spielte. Kühne + Nagel sorgte zwischen 1942 und 1944 im Rahmen der sogenannten «M-Aktion» dafür, dass Möbel und Einrichtungen Zigtausender Wohnungen von ausländischen Jüdinnen, die in Ghettos und Konzentrationslager deportiert wurden, ins Reichsgebiet transportiert wurden. M stand für Möbel. Es ging um fast 70000 Wohnungen von Jüdinnen in Holland, Frankreich, Belgien und Luxemburg, die systematisch geplündert wurden. Nach Aussagen von Frank Bajohr, der zur Arisierung jüdischen Eigentums forscht, war die Firma Kühne + Nagel bei dieser logistischen Umsetzung maßgeblich beteiligt.[54]
Obwohl die Kühne-Brüder nach Ende des Zweiten Weltkriegs von amerikanischen Ermittlern als «hochrangige Nazi-Industrielle» und von den britischen Behörden als «big time Nazis» eingestuft wurden, wurden beide 1948 als bloße «Mitläufer» beurteilt.[55]
Als die Quiz-Sendung Wer wird Millionär? im Jahr 2024 ihr 25. Jubiläum feierte, nahm die Satiresendung heute-show das zum Anlass, darauf zu antworten: «Die Antwort ist gleich geblieben: vor allem Leute, die erben.» Die Liste der reichsten Deutschen ist nicht mit innovativen, geistreichen Unternehmenspionieren gespickt, sondern vor allem mit Erben. Ganze 80 Prozent der Milliardenvermögen wurden nicht selbst erarbeitet, sondern gehen auf eine (teils tiefbraune) Erb-Geschichte zurück.[56]
Bleibt nach der Betrachtung der extremen und wachsenden Vermögensungleichheit nun noch eines zu klären: Ist sie ein extremes Problem? Die Antwort lautet eindeutig, wie sollte es anders sein: Ja! Ich möchte im Folgenden zwei große Felder betrachten: die Bestrebungen, die Pariser Klimaziele einzuhalten, damit es nicht zu einer globalen Katastrophe kommt, sowie der Schutz unserer Demokratie, die immer weiter unter Druck gerät. Auch diese Probleme hängen mit der extremen und wachsenden Vermögensungleichheit zusammen.
2.Extreme Ungleichheit: Es steht viel auf dem Spiel
Die Überreichen befeuern die Klimakrise
Als am 30. August 2022 die Wissenschaftler am Pult der Bundespressekonferenz Platz nahmen, war ihnen die Aufmerksamkeit der Journalistinnen gewiss: «50 Jahre nach Die Grenzen des Wachstums präsentiert der Club of Rome einen neuen Bericht zu konkreten Wegen aus der Klimakrise.»[57]