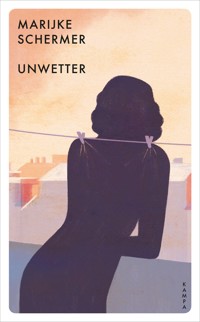
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pocket
- Sprache: Deutsch
Emilias Leben scheint perfekt zu sein. Sie liebt ihren Job, ist glücklich verheiratet und Mutter zweier kleiner Söhne. Seit die Familie vor den Toren Amsterdams lebt, verbringen Emilia und ihr Mann ihre Zeit damit, den Kindern hinterherzurennen, Freunde einzuladen und ihr Haus zu renovieren. Sie erfreuen sich an den kleinen Dingen des Lebens. Doch dann bricht die Vergangenheit in die Gegenwart ein, die Erinnerung an ein traumatisches Erlebnis überfällt Emilia, und ihre Welt gerät aus den Fugen ... Zwölf Jahre lang hat Emilia ein schreckliches Geheimnis gehütet, kann sie es weiter verbergen? Würde ihr Mann verstehen, dass sie so lange geschwiegen hat? Während Emilia mit ihrer Vergangenheit ringt, zieht das Misstrauen ein in ihre Ehe. Und der Himmel über der ländlichen Idylle verfinstert sich. Ein Roman über die Paradoxien des Zusammenlebens - das Bedürfnis nach Freiheit und die Sehnsucht nach Intimität, der die Frage stellt, ob wir einander je wirklich kennen können, ob nicht ein jeder von uns unter seiner eigenen Glasglocke lebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Marijke Schermer
Unwetter
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Kampa
1
»Nehmen wir dein Auto?«
»Wir sind viel zu spät dran.«
Ihr Mann kommt aus der Küche, im schicken Anzug. Er ist groß und hager und hat ein ausgesprochen schönes Gesicht. Der Topf in seinen Händen und das Geschirrtuch über seiner Schulter zeugen von ganzem Einsatz. Er stellt den Topf auf den Tisch und wirft das Tuch Richtung Büfett, das er um ein Haar verfehlt. Leo lacht mit hohem, klarem Stimmchen. Alicia, das Nachbarsmädchen, das zum Aufpassen da ist, bindet Osip ein Lätzchen um. Sie hat sich in ein paar Wochen vom androgynen Kind zur Jahrmarktsattraktion gewandelt. Wangen und Lippen sind rot angemalt, und sie trägt idiotische Klamotten, die viel zu viel Haut frei lassen. Sie küssen die Kinder zum Abschied, und Emilia muss sich beherrschen, um nicht auch Alicia über den Kopf zu streichen.
»Du fährst. Wir schaffen es.«
Sie prescht die Auffahrt hoch und biegt auf die Straße. Der erste Streckenabschnitt führt über den Deich, durch das wellige Flussdelta, auf einer schmalen Landstraße zwischen Pappeln entlang. Die untergehende Sommersonne hat nicht mehr viel Kraft, und es bläst ein tüchtiger Wind. Auf den Wiesen zu ihrer Rechten stehen Schafe. Wenig später, auf der Autobahn, kann sie richtig schnell fahren, das macht sie gerne. Sie reden nicht viel. Durch das Fenster weht eine Erinnerung an lange Fahrten in den Süden herein, die nackten Beine aus dem Fenster, singend. Kurz vor Amsterdam entspinnt sich eine kleine Diskussion darüber, wie sie am besten zum Leidseplein kommen.
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagt sie und fährt so, wie sie es für am besten hält. Sie spekuliert auf einen Parkplatz nah am Theater und hat Glück. Das Lösen eines Parkscheins würde genau die Zeit kosten, die sie nicht mehr haben, beschließen sie. Sie rennen quer über den Platz und werden fast von einem Radfahrer erwischt. Bruch ruft, beim nächsten Mal sollten sie sich ein Hotelzimmer nehmen; für einen Moment kommt der Wunsch in ihnen auf, sie könnten sich vom Stadtleben aufsaugen lassen, statt später, garantiert wieder gehetzt, in die Stille zurückkehren zu müssen.
Sie rennen ins Schauspielhaus, die Treppe zum Rang hinauf. Sie sind die letzten, bevor rundum die Türen geschlossen werden. Er knüllt ihre Mäntel unter seinen Sitz und zwickt sie kurz in die Seite.
Nach dem Applaus, beim Verlassen des Saals, verlieren sie sich aus den Augen. Emilia sucht eine Weile. Bruch wartet weder an der Tür noch oben an der Treppe auf sie. Sie irrt durch die Gänge, schaut auf ihr Handy. Keine Mitteilung. Vermutlich hat Bruch Vincent getroffen, den Regisseur der Aufführung, der ein alter Freund von ihm ist. Im Foyer bestellt sie sich ein Bier. Die Schauspielerin, die die Blanche spielte, hat die ganze biedere Inszenierung gerettet. Jeden Satz von Tennessee Williams machte sie Wort für Wort zur Verkündigung. Ich habe Gott gedankt dafür, dass Sie da waren, denn Sie schienen gütig zu sein – ein Spalt im Felsen der Welt, in dem ich mich verstecken konnte! Sie ließ die innere Verzweiflung hervorbrechen wie eine Woge, der kein Einhalt zu gebieten ist. Für Emilia ist irgendwo an diesem Abend ein Gefühl der Leere aufgeklafft, das sie mit tiefer Bedeutung assoziiert. Es hat sie melancholisch gemacht.
Sie geht auf den Ajax-Balkon hinaus. Er ist so leer und verlassen, dass sie sich fragt, ob es überhaupt gestattet ist, dass sie sich hier aufhält. Aufeinandergetürmte Getränkekisten stehen herum und zwei windschiefe Sonnenschirme. Es hat geregnet. Sie kramt in ihrer Tasche erfolglos nach Zigaretten. Gähnt. Und da packt sie plötzlich jemand von hinten, fasst ihre Schulter mit eisernem Griff. Eine große, warme, leicht nach Kreuzkümmel riechende Hand legt sich über ihr Gesicht und drückt ihr die Augen zu, zwei Finger liegen schräg über ihren Lippen, mit Fingerkuppen, deren Hornhaut spürbar ist. Ihr Rücken stößt an einen massigen Leib. Hinter ihren Augen explodiert etwas. Eine Stichflamme panischer Angst. Gleich darauf schwinden ihr alle Kräfte, ihr Körper wird formlos, und sie sinkt völlig schlapp, ohne den geringsten Fluchtreflex oder irgendeine Gegenwehr, auf die großen, harten, regennassen Betonplatten nieder.
»He, Emilia, was tust du denn?« Verzögert dringt die Stimme durch die rauschende Stille. Es ist Frank, der oft genug an ihrem Esstisch gesessen hat. Ein Spaßvogel, ohne Zweifel, und in der Tat mit diesem an Kreuzkümmel erinnernden Körpergeruch behaftet, wie sie sich nun erinnert, sie hätte ihn daran erkennen können.
»Machst du jetzt Spaß?«, ruft er von oben. Es vergehen bestimmt zwanzig Sekunden, in denen die Nässe von den Fliesen in den Stoff ihrer Kleidung kriecht und in denen sie sich fragt, ob sie ihre Reaktion mit irgendeiner Bemerkung ungeschehen machen könnte. Dann erst findet Emilia Muskeln und Knochen wieder und richtet sich auf.
»Ich wollte dich nicht erschrecken.« Er stammelt noch weiter, dass er sie necken wollte, dass sie raten sollte, wer er ist, das kenne sie doch, oder? Mit seinen borstigen schwarzen Augenbrauen hat er etwas Verwildertes an sich. Er sagt, es sei ein spontaner Impuls gewesen, wie unpassend der war, sei ihm erst aufgegangen, als es schon zu spät gewesen sei. Sie nimmt eine Zigarette von ihm an, lässt sich Feuer geben, inhaliert. Sie rauchen und blicken auf den Platz hinunter, auf die Leute in Ausgehlaune, die zwischen den Straßenbahnen umherwuseln. Emilia fröstelt in ihrer dünnen Bluse.
»Ist ja gemeingefährlich«, sagt sie, »solche Impulse zu haben.«
Er beteuert erneut, dass es ihm leidtue.
Wenn du das noch einmal sagst, denkt Emilia, hau ich dir eine runter.
Im Spiegel sieht sie, wie blass sie ist. Sie stützt sich auf das Waschbecken. Aus ihrem Kehlkopf kriecht die Erinnerung an einen Sommerabend empor, eine Erinnerung, die sie mit Erfolg in einen fernen Winkel ihres Systems verbannt und in den Schlafmodus versetzt hatte. Die Tür hinter ihr öffnet sich und schnatternd kommen sie herein, junge Mädchen. Sie verzieht sich auf eine Toilette, schließt behutsam ab. Dann lässt sie ihre Tasche fallen, fasst sich an den Hals und ringt nach Luft. Anschließend drückt sie die Hände flach auf die kalten Wandkacheln. Sie atmet wieder, aber zu weit oben, zu schnell. Gleich muss sie sich übergeben. Sie setzt sich. Keine Angst, du stirbst nicht, der Atem selbst bringt dich in Atemnot, du bist in Sicherheit, im Heute. Auf der anderen Seite der Tür erörtern die Mädchen die Frage, ob sie noch auf eine Party gehen sollen oder nicht. Ihre Stimmen sind hell und melodiös. Während sie ihnen lauscht, bekommt sie ihren Atem allmählich unter Kontrolle. Sie klatscht sich wieder Blut in die Wangen. Erst als der Toilettenvorraum leer ist, verlässt sie ihre Kabine. Sie geht durch den halbrunden Flur mit den Schauspielerporträts zurück und die weich ausgelegte Treppe hinunter, wo sie auf halber Höhe an Frank vorbeikommt. Er unterhält sich mit jemandem und fasst dabei mit beiden Händen um seinen Schlips wie um eine Rettungsleine. Er zwinkert ihr zu, als teilten sie ein Geheimnis. Im Foyer unten legt jemand Musik auf. Tanzmusik, aber niemand tanzt. Sie holt sich noch ein Bier. Bruch kommt zu ihr und schiebt die Hand unter ihre Bluse auf ihren nackten Rücken.
»Hier bist du! Die ganze Zeit schon? Ich hab dich gesucht.«
»Hier bin ich, Bruch. Hier bin ich schon die ganze Zeit.«
»Lass uns gehen, bevor irgendwer anfängt, Brando zu imitieren.« Er reicht ihr den Mantel, sie leert ihr Glas. Sie gehen hinaus, es regnet wieder.
»An Marlon Brando scheiden sich die Geister«, sagt Bruch unter dem Vordach. »Es gibt Menschen, die ihm nicht widerstehen können, wenn er nach Stella ruft, und es gibt Menschen, die das sehr wohl können.« Sie biegen um die Ecke. Er bleibt vor einem Lokal stehen. Da haben sie früher schon einmal gesessen. Sie weiß noch, dass er damals ein grünes Oberhemd trug. Sie weiß noch, dass sie sich an dem Tag die Haare hatte schneiden lassen, denn sie fasste sich immerzu an den Kopf, um zu fühlen, wie kurz sie waren. Sie weiß noch, wie deutlich sie spürte, dass sie ihn liebte. Sie weiß noch, dass sie ein Glas Wein trank, bevor sie den Schwangerschaftstest, auf den sie kurz davor gepinkelt hatte, unter der Serviette hervorholte. Und dass Bruch weinen musste. Vor Rührung. Da war sie drauf und dran gewesen, ihm alles zu erzählen.
Das Lokal hat sich verändert, wenn sie auch nicht genau sagen könnte, wie, aber die Wand mit Hirschgeweihen und Kuckucksuhren, auf die sie damals blickte, ist noch da. Sie bestellen Wein und lassen sich auf der Sitzbank nieder.
»Wie fandst du’s?«, fragt sie.
»Ich fand’s grässlich. Und du?«
»Es ist ein so unglaublich schönes Stück …«
»Genau! Deswegen!«
»Ich liebe dieses Stück einfach unglaublich.«
»Ja, das sagtest du bereits.«
»Darf ich das denn nur einmal sagen?«
»Nein, aber nach einem Mal weiß ich es.«
»Ja.«
»Es ist also nicht nötig.«
»Übrigens, beim ersten Mal sagte ich, dass es schön ist. Und beim zweiten Mal, dass ich es liebe.«
»Unwesentlicher Unterschied.«
»Was wesentlich anderes. Nicht alles, was ich schön finde, liebe ich.«
»Nein, aber du findest schon alles, was du liebst, schön.«
»Ist das so?«
»Ist das nicht so?«
»Ich weiß nicht. Was ist schön?« Sie hofft, dass er jetzt nicht sagt: Du bist schön. Er sagt gar nichts. Sie denkt an das Spiel, das sie früher immer spielten, wenn sie in einem Lokal saßen. Sie malten sich das Leben der Leute um sie herum aus. Warum haben sie irgendwann damit aufgehört?
»Weißt du noch, wie wir hier gesessen haben? Wie wir hier erfuhren, dass ich Leo erwartete?«
»Das war nicht hier.«
»Doch, das war hier.«
»Nein, nein. Das war nicht hier. Das war auf keinen Fall hier.« Er blickt misstrauisch, als wollte sie diese Erinnerung hinterlistig in jenen Abend einschmuggeln.
»Wo war es denn dann?«
»Weiß ich nicht.«
»Wie kannst du dann wissen, dass es nicht hier war?«
»Das weiß ich einfach. Kann doch sein, oder? He, da ist Vincent. Vin!« Bruch reckt den Arm in die Höhe. Vincent steuert auf sie zu. Er wirft seinen Mantel und seine Taschen und Blumensträuße auf einen Stuhl, während er sich an ihrem Tisch niederlässt, als seien sie hier verabredet und er sei endlich da. Auf seine unverbesserliche Art, mit der er auf vertraut macht, beugt er sich vor.
»Ich bin geflüchtet. Es lässt sich ja doch nichts mehr ändern. Es ist, was es ist. Daran veränderst du nichts mehr. Ich kenne mich. Ich versuche trotzdem noch, den Leuten alles zu erklären, was sie nicht begriffen haben. Morgen in der Zeitung werden sie ohnehin kein gutes Haar an mir lassen. Ich kapier nicht, wieso ich mir das noch antue. Zuerst ist es meine Idee, dann wird es zu meiner Verantwortung, und am Ende ist es meine Schuld. Es sei denn natürlich, alle finden es gut, dann ist es natürlich ihr Verdienst. Schauspieler. Hinterhältige Bande. Warum bin ich nicht einfach Arzt geworden oder sonst was Respektables, so wie du, Bruch. Arzt! Wunderbar! Sinnvoll! Mein Gott! Apropos Ärzte, ich werde demnächst Tschechow machen, in Den Haag. Aber Leute, he! Was ist das lange her! Wie hat es euch gefallen? Ach nein, lasst, sagt lieber nichts. Es sei denn, es ist was Nettes. Für mich das Gleiche, was sie trinken, eine ganze Flasche, bitte. Ich hab dieses Stück echt begriffen, glaubt mir, Blanche und Mitch und Stella und Stanley, die sind hier«, er schlägt sich hart mit der Faust auf die Brust, »in meinem Herzen. Ich bin sie. Ich verstehe sie. Letztlich wollen sie alle das Gefühl haben, dass sie von Bedeutung sind. Letztlich ist alles, was sie antreibt, die Suche nach Liebe. Was uns alle antreibt. Was mich antreibt. Was auch euch antreibt.« Emilia vermeidet es, Bruch anzusehen. Er legt ihr unter dem Tisch die Hand aufs Bein.
»Es war sehr speziell, Vin. Sehr speziell.«
»Ja, nicht, ja, das war es, es war echt speziell. Ich hab Sachen in dem Stück entdeckt, die ich vorher komischerweise nie gesehen habe, Sachen, die andere also auch immer ungenügend rausgearbeitet haben. Wenn du es erst weißt, ist es aber glasklar. Wenn du’s mal weißt, kapierst du nicht, wie du das je übersehen konntest. Emilia, Schatz. Wie geht es dir? Wie hat es dir gefallen?« Bruch zwickt sie ins Bein.
»Blanche war gut.«
»Christine, ja, Christine war gut. Sie hat mich zwar zur Verzweiflung getrieben, die Frau spielt ja nur vor Publikum, bei den Proben macht sie gar nichts, aber heute Abend hat sie alles gegeben, das stimmt, heute Abend war sie gut. Christine ist vielleicht deshalb so gut, weil sie sich in einer ähnlich prekären Lage befindet wie Blanche. Ihr Mann hat sie verlassen, und sie ist allein, und sie ist zu alt, eine Spur zu alt, und das weiß sie. Prost. Schön, mal wieder mit euch zu reden. Endlich mal Menschen, die was Sinniges sagen.«
»Zu alt für was?«
»Zu alt für eine schöne neue, junge Liebe. Eine Frau jenseits der fünfundvierzig sollte es sich dreimal überlegen, bevor sie das, was sie hat, über Bord wirft.«
»Aber er hat doch sie über Bord geworfen, wenn ich das richtig verstanden habe?«
»Lass gut sein, ich erspare euch lieber die ganze Geschichte.« Er kneift die Augen zu und ergänzt in süffisantem Tonfall: »Und ich habe keine Lust auf eine Diskussion über die Frage, ob ich jetzt gerade etwas Frauenfeindliches gesagt habe. Was mich betrifft, ist es eine völlig wertfreie Feststellung. Ich kann nichts dafür, ich sage nur, wie es ist. Das Ende! Wie hat euch das Ende gefallen?« Er gießt die Gläser voll. Sie stoßen an. Bruch gibt ein paar wohlwollende Allgemeinplätze über das Ende von sich, die Vincent allesamt zu seinen Gunsten auslegt, während er den Wein in sich hineinschüttet. Emilia und Bruch erheben sich schließlich, warten darauf, dass Vincent aufhört zu reden, was er nicht tut. Emilia bezahlt die Rechnung. Bruch unterbricht Vincents Redefluss, um sich zu verabschieden. Als sie an der Tür sind, ruft Vincent ihnen nach, dass er bald mal bei ihnen reinschauen werde, wenn er denn je einen Tag frei habe, was verdammt noch mal nie der Fall sei, weil ihn das verflixte Theater immer wieder in die Arena rufe.
Sie gehen schweigend zum Auto. Wenn sie in einer anderen Stimmung wäre, würde Emilia Vincent jetzt nachäffen. Aber dieses Monologisieren von ihm, die Schmierenkomödie, die er aufgeführt hat, war einfach zu deprimierend. Bruch setzt sich ans Steuer und startet den Motor schon, bevor sie die Tür zugemacht hat. Er hat zu viel getrunken, um zu fahren. In der Stille des Wagens, auf Straßen, die immer leerer werden, denkt sie an das Aufeinandertreffen mit Frank. Sie fragt sich, ob Bruch ihn gesehen hat. Sie fragt sich, wo er war, als sie auf der Toilette war. Sie fragt sich, woran er denkt. Er biegt in die Zufahrt zu ihrem Haus ein und macht den Motor aus. Da der Weg abschüssig ist, können sie den Wagen im Leerlauf weiterrollen lassen. Es dauert noch fast eine Minute, bis er zum Stehen kommt.
»Vincent hat so getan, als wäre diese ganze Vergewaltigungsszene seine Erfindung. Eine neue Erkenntnis oder so.«
»Und eigentlich war es nicht mal eine Vergewaltigung.«
»Wie meinst du das?«
»Dass er es inszeniert hat, als machte es irgendwie Spaß.«
»Ja?«
»Das fand ich am schlimmsten.«
»Ich dachte, du fandst es schön.«
»Ich sagte, dass ich das Stück schön finde.«
»Oh.«
»Das Stück. Von Williams.«
»Ja, ja, ja, ich weiß, von wem das Stück ist.«
Als sie die Haustür öffnet, schlägt die Küchentür mit einem lauten Knall zu. Im Kaminofen knistert ein Feuer, und alle Lichter brennen. Auf dem Büfett steht eine angebrochene Flasche Single Malt aus ihrem Geburtsjahr, und ein letzter Rest Eiswürfel schmilzt in der Form vor sich hin. Die Terrassentüren sind offen, und der Vorhang weht wie ein Segel nach draußen. Das Geschirrtuch, das Bruch am früheren Abend Richtung Büfett warf, liegt noch an derselben Stelle auf dem Boden. Alicia ist nirgendwo zu entdecken. Emilia ruft sie. Es kommt keine Antwort.
Diese Küche wurde überstürzt und ungeplant verlassen. Emilia stockt der Atem in der Kehle, und Panik treibt ihr Gänsehaut über den Körper. Sie lässt ihre Tasche und ihren Mantel auf den Küchenfußboden fallen und rennt die Treppe hinauf. Als sie die Tür zu Osips Zimmer aufstößt, sieht sie in dem hineinfallenden Streifen Licht sofort, dass er in seinem Bett liegt. Sie legt eine Hand auf sein Köpfchen, um zu fühlen, ob er lebt. Er gibt einen kleinen Laut von sich. Warm, schlafend, unversehrt, folgert sie, während sie leise die Tür schließt und die Leos öffnet. Das Rechteck seines Betts leuchtet weiß und starr in dem dunklen Zimmer. Keine Decke, keine Stofftiere, kein Leo. Sie schlägt mit der Faust auf den Lichtschalter, und das Licht macht den Anblick des leeren, unordentlichen Zimmers für einen Moment extrem alltäglich. Über den Boden verstreutes Spielzeug, Stifte mit den Verschlusskappen daneben auf dem kleinen Tisch. Aus dem Kleiderschrank hängen Sachen heraus. Auf dem kleinen Sofa liegt eine enthauptete Puppe. Automatisch schaut sie sich kurz nach dem Kopf um, den sie nicht findet. Ein Sammelsurium aus Steinen und Muscheln und Zweigen türmt sich auf der Fensterbank. Die Vorhänge sind nicht zugezogen, das Fenster ist gekippt. In der Spiegelung der Scheibe sieht sie sich selbst, einen Fleck. Sie sollte rufen, denkt sie, während sie stumm das Zimmer verlässt und Bruch die Treppe heraufkommen sieht.
»Was ist denn los? Was tust du?«
»Leo ist weg«, sagt sie.
»Was meinst du mit weg? Wovon sprichst du?«, fragt er, als sie sich auf der Treppe, zurück nach unten, an ihm vorbeischiebt. Sie läuft in die Küche und sinkt neben ihrem Mantel und ihrer Tasche auf die Knie, um das Handy zu suchen. Bei einer Kindesentführung kommt es auf jede Sekunde an, mit jeder Stunde, die jemand nicht gefunden wird, halbieren sich die Chancen auf ein gutes Ende. Warum rennt Bruch nicht in den Garten, warum ruft er nicht, tut er nicht irgendwas? Sie sieht vor sich, wie Leo, in seine Decke gerollt, über eine Schulter geworfen und weggetragen wird. Sie sieht vor sich, wie er geschlagen, gequält, missbraucht wird. Sie sieht verschiedene Szenarien seiner Ermordung vor sich. Sie sieht vor sich, wie seine Leiche in den Fluss geworfen, in einem Erdloch verscharrt, in einen Müllsack gesteckt wird. Durch die offenstehenden Türen, in denen die Vorhänge hin- und hergeschlagen werden, sind Blätter hereingeweht. Emilia kippt ihre Tasche aus – Taschentücher, Tampons, Lutschbonbons, Bleistifte, eine Brotrinde, ein USB-Stick, Haarnadeln, Notizhefte, eine Zeitung, Playmobilfiguren, Geld, Kundenkarten, Zigaretten, Wimperntusche und ein Schnuller.
Warum wohnen sie hier? So gottverlassen weit draußen.
2
Sie entdeckten ständig etwas Neues. Einen dritten und einen vierten Pflaumenbaum, eine Spirale aus Steinen, die irgendwann jemand sorgsam ausgewählt und so dort hingelegt hat, Stachelbeersträucher, ein in den Stamm der Linde geritztes Herz, Rosen, einen ausgetrockneten Brunnen, einen Winkel voller Minze und Melisse, den sie ihre Teeplantage tauften. Sie entdeckten, dass der kleine Hügel hinten kein Hügel war, sondern ein überwucherter Schutthaufen. Wenn etwas reif war, pflückten sie es. Sie machten Mirabellenmarmelade. Kuchenteig, in den sie Pflaumen schütteten, was ein matschiges, rosafarbenes, säuerliches Etwas ergab, das völlig auseinanderfiel. Sie machten Apfelmus und Apfelkuchen. Eine Nachbarin kam vorbei und zeigte ihnen den überall wuchernden Giersch. Bruch entdeckte online, dass Giersch nicht nur eine Plage war, sondern auch etwas, woraus man Suppe oder Pesto machen konnte. Sie waren fest entschlossen: Sie würden nicht die Natur bezwingen, sondern es andersherum machen und sich selbst zähmen lassen.
Der Herbst verwandelte in Windeseile das gesamte Bild des Gartens. Die Aussicht auf weitere Auswirkungen der Jahreszeiten, wie prägend diese hier sein würden, erfüllte sie mit Ehrfurcht. Sie wurden sich bewusst, dass es ewig dauern würde, bis sie hier ganz zu Hause waren. Mit Leo im Tragesack machten sie Spaziergänge über ihr eigenes Grundstück. Achtzig Meter vom Haus entfernt der morsche Steg, der Fluss, der von links nach rechts strömte, immer von links nach rechts, wie eine Gedichtzeile, sagte Bruch an dem Abend, da ihnen das aufgefallen war.
Anfangs hatten sie Wohnzeitschriften gekauft und sich in Küchenstudios umgesehen. Sie hatten Skizzen gemacht und verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Sie wollten Wände durchbrechen, die Treppe versetzen, den Dachboden ausbauen. Doch schon nach einer Woche beschlossen sie, die gelbe Fünfzigerjahreküche einfach so zu lassen, wie sie war. Und in den Wochen darauf ließen sie nach und nach auch alle ihre anderen Vorhaben fallen. Das Haus war genau richtig, mochte es auch noch so veraltet und baufällig sein. Emilias Lieblingsort war vorläufig der Wintergarten. Dessen Fensterscheiben hatten eine kaum wahrnehmbare Verfärbung, wodurch das Licht dort unglaublich war. Emilia lag mit Leo auf dem Bauch in dem warmgelben, staubigen Schein und verschlief ganze Nachmittage.
Bruch würde seine neue Stelle am regionalen Krankenhaus erst Mitte Oktober antreten, und Emilia hatte Babypause. Sie waren praktisch ununterbrochen zusammen. Sie packten Umzugskartons aus. Sie lasen, lagen im Gras, schauten in die Wolken und schwammen im Fluss. Sie betrachteten Leos stilles, ernstes Gesichtchen. Er war wehrlos und schien zugleich mit etwas verbunden zu sein, das außerhalb ihrer Reichweite lag, eine Verbindung, die ihm Autonomie verlieh. Er war ein pflegeleichtes Baby. Wenn er weinte, konnte sie ihn trösten. Er schlief viel und trank problemlos. Während der Schwangerschaft hatte sie eine Abneigung gegen die sich ausstülpende Körperlichkeit gespürt, insbesondere die Öffentlichkeit dieser Transformation. Aber derartige Gedanken über sich selbst hatte sie jetzt nicht mehr, sie war da und sie war nicht da.
Einmal holte sie Bruch einen runter, während sie Leo stillte. Blickte auf Leos kleine Lippen an ihrer Brustwarze und auf das konzentrierte Gesicht Bruchs. Sie war in ein neues Universum gelangt, von der Außenwelt isoliert, eine Intimität von schwindelerregender Tiefe. Es bestand kein Gegensatz zwischen ihrem Körper in seiner Funktion als Ernährer und Beschützer ihres Kindes und als Bestandteil der sexuellen Beziehung zu ihrem Mann, alles floss nahtlos ineinander über. Ihr Glück war ein Rausch, der ihr Dasein ganz wirklich machte und sie selbst zugleich verwischte. Es hatte die Intensität des Verliebtseins, aber weitaus mehr Gewicht und nichts Flatterhaftes. Es war nicht so, dass sie keine Gedanken gehabt hätte. Eher so, als wäre ihre Persönlichkeit abhandengekommen. Sie war Kopf, und sie war Körper, aber es gab kein übergeordnetes Ganzes, keine Verantwortung, kaum Reflexion. Sie war nicht mehr verankert. Bevor sie das erlebte und nachdem es wenig später verging, war es für sie völlig un- denkbar gewesen, dass es so etwas gab und wie schön es war.
Sie kamen auf die Idee, ein Fest zu geben. Mutter und Kind besuchen und Hauseinweihung in einem Aufwasch. Es sollte der krönende Abschluss dieser Phase ohne Verpflichtungen sein und auch den Beginn der neuen Realität markieren. Sie verschickten mit Pflaumenflecken verzierte Einladungen und gaben Herbstlaub in die Kuverts. Sie räumten auf und richteten Betten für Übernachtungsbesuch her. Sie reservierten die drei Zimmer in der örtlichen Pension. Bei den Nachbarn kauften sie Hähnchen, die vor ihren Augen betäubt, geköpft, gerupft, ausgenommen und eingepackt wurden. Sie hängten Lampions im Garten auf.
»Essen wir draußen an einem langen Tisch? Oder ist es zu kalt dafür?«
»Es ist viel zu kalt.«
»Jacob findet garantiert, dass das hier ’ne Ruine ist.«
»Jacob ist selbst ’ne Ruine.«
»Meinst du, dass alle kommen?«
»So gut wie alle.«
»Sollen wir es abblasen?« In der Küche fing Leo an zu schreien.
»Quatsch.«
»Ich gehe einkaufen.«
»Leo schreit.«
Sie nahm Schlüssel und Geldbeutel vom Schrank, ging zur Tür hinaus, stieg ins Auto, ignorierte Bruch, der ihr von der Tür aus nachrief und mit den Armen fuchtelte. Sie fuhr zum Supermarkt. Sie machte Einkäufe. Danach setzte sie sich in ein Café und trank Kaffee. Sie las die Zeitungen, sie las die Prospekte, die auf dem Tisch lagen, sie las die Speisekarte. Als sie sich endlich auf den Heimweg machte, fühlte sie sich krank. Sie fuhr die schmale Landstraße entlang. Die Milch nässte ihre Bluse.
Bruch war sauer. Er hatte sich drei Stunden lang aufgeschmissen gefühlt.
»Er schläft, Bruch.«
»Seit fünf Minuten!«
»Ich weck ihn jetzt.«
»Vor Erschöpfung! Nicht!« Sie machte ihren Oberkörper frei und hob Leo aus seiner Wiege. Er musste ihr Erleichterung verschaffen, denn sie platzte schier. Sie sah, wie Bruch auf sie schaute. Auf das Kind, das mit rotem Kopf seine Mutter fraß. Auf die Mutter, die mit ebenso rotem Kopf und bleichen, nassen Brüsten auf dem Sofa saß und heulte. Es war vorbei: das Zeitloch, das Paradies der Gedankenlosigkeit, die Idylle.





























