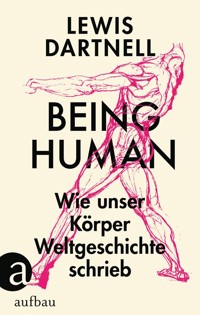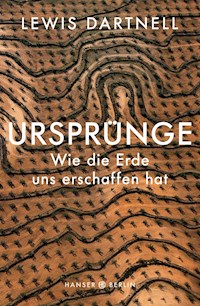
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum stehen in New York so viele Wolkenkratzer? Warum hat sich dagegen in London ein so weit reichendes U-Bahn-Netz entwickelt? Zufall? Menschlicher Einfallsreichtum? Nein, sagt Lewis Dartnell, die Gründe reichen viel tiefer in die Vergangenheit – bis zur Geburtsstunde unseres Planeten. Denn alles, was unsere moderne Welt ausmacht – seien es Metropolen, technische Errungenschaften oder globale Handelswege –, hat seinen Ursprung in der natürlichen Beschaffenheit der Erde: ihrem Klima, ihrer Landschaft, ihren geologischen Veränderungen. In "Ursprünge" deckt er das Zusammenspiel aus Kräften auf, das die Umwelt geformt, die Evolution gesteuert und letztendlich unsere Gesellschaft gebildet hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Warum stehen in New York so viele Wolkenkratzer? Warum hat sich dagegen in London ein so weitreichendes U-Bahn- Netz entwickelt? Zufall? Menschlicher Einfallsreichtum? Nein, sagt Lewis Dartnell, die Gründe reichen viel tiefer in die Vergangenheit – bis zur Geburtsstunde unseres Planeten. Denn alles, was unsere moderne Welt ausmacht – seien es Metropolen, technische Errungenschaften oder globale Handelswege –, hat seinen Ursprung in der natürlichen Beschaffenheit der Erde: ihrem Klima, ihrer Landschaft, ihren geologischen Veränderungen. In Ursprünge deckt er das Zusammenspiel aus Kräften auf, das die Umwelt geformt, die Evolution gesteuert und letztendlich unsere Gesellschaft gebildet hat.
Lewis Dartnell
Ursprünge
Wie die Erde uns erschaffen hat
Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt
Hanser Berlin
Inhalt
Einleitung
1Wie wir entstanden sind
2 Umtriebige Kontinente
3 Unser biologischer Schatz
4 Die Geografie der Meere
5 Unsere Baustoffe
6 Unsere metallische Welt
7 Seidenstraßen und Steppenvölker
8 Die globale Windmaschine und das Zeitalter der Entdeckungen
9 Energie
Schluss
Danksagung
Weiterführende Literatur und Quellenangaben
Website
Bildnachweis
Bibliographie
Register
Einleitung
Warum ist die Welt, wie sie ist? Ich meine dies nicht auf eine abstrakte philosophische Art – Warum existieren wir überhaupt? –, sondern in einem tief naturwissenschaftlichen Sinne: Welche Kräfte haben das Erscheinungsbild der Erde gestaltet, die physische Landschaft der Kontinente und Ozeane, der Gebirge und Wüsten geformt? Und wie haben die Geländeformationen und Aktivitäten unseres Planeten und jenseits dessen unsere kosmische Umgebung die Entstehung und Entwicklung unserer Art und die Geschichte unserer Gesellschaften und Zivilisationen beeinflusst? Inwiefern ist die Erde selbst Akteur in der Menschheitsgeschichte gewesen – eine Figur mit unverwechselbaren Gesichtszügen und Stimmungsschwankungen sowie gelegentlichen Wutausbrüchen?
Ich will der Frage nachgehen, wie die Erde uns erschaffen hat. Selbstverständlich besteht jeder von uns, wie alle anderen Lebewesen auf dem Planeten, buchstäblich aus Erde. Das Wasser in unserem Körper floss einst den Nil hinunter, fiel als Monsunregen auf Indien und wirbelte über dem Pazifik. Der Kohlenstoff der organischen Moleküle unserer Zellen wurde der Atmosphäre über die Pflanzen, die wir verzehren, entzogen. Das Salz unseres Schweißes und unserer Tränen, das Kalzium unserer Knochen und das Eisen unseres Blutes wurden aus den Felsen der Erdkruste herausgewaschen; und den Schwefel der Eiweißmoleküle unserer Haare und Muskeln haben Vulkane ausgespien. Die Erde liefert uns auch die Rohstoffe, die wir abbauen, veredeln und dann zu Werkzeugen und anderen technischen Geräten weiterverarbeiten, von den grobgefertigten Faustkeilen der frühen Steinzeit bis hin zu den heutigen Computern und Smartphones.
Die aktiven geologischen Kräfte unseres Planeten haben unsere Evolution in Ostafrika angetrieben und uns zu einer einzigartig intelligenten, kommunikativen und findigen Primatenspezies gemacht, während Klimaschwankungen uns auf weltweite Wanderzüge schickten, was uns zu jener Tierart mit dem weltweit größten Verbreitungsgebiet werden ließ.1 Weitere planetarische Prozesse und Ereignisse gigantischen Ausmaßes brachten die verschiedenen Landschaftstypen und Klimaregionen hervor, die bei der Entstehung und Entwicklung von Zivilisationen im Lauf der Geschichte grundlegend beteiligt waren. Diese planetarischen Einflüsse auf die Menschheitsgeschichte reichen vom vermeintlich Trivialen bis hin zum fundamental Bedeutsamen. Wir werden sehen, warum eine langanhaltende Kühl- und Trockenperiode im Erdklima die Ursache dafür ist, dass die meisten von uns eine Scheibe Toastbrot oder eine Schüssel Müsli zum Frühstück essen; auf welche Weise der Zusammenprall der Kontinentalplatten den Mittelmeerraum zu einer Brutstätte vielfältiger Kulturen machte und wie gegensätzliche Klimabänder in Eurasien grundverschiedene Lebensweisen hervorbrachten, die die Geschichte der Völker auf dem Kontinent über Jahrtausende prägten.
Heute sind die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Umwelt Anlass zu großer Sorge. Im Lauf der Zeit hat die Weltbevölkerung stark zugenommen, immer mehr Bodenschätze verbraucht und Energiequellen zunehmend effizienter erschlossen. Mittlerweile hat Homo sapiens die Natur als bestimmende Gestaltungskraft der Umwelt auf der Erde abgelöst. Die von uns erbauten Städte, Verkehrswege und Stromtalsperren sowie unsere industriellen und Bergbautätigkeiten haben tiefgreifende und langanhaltende Auswirkungen, weil sie die Landschaft umgestalten, das globale Klima verändern und ein massives Artensterben verursachen. Wissenschaftler haben angesichts unseres dominanten Einflusses auf die natürlichen Prozesse der Erde vorgeschlagen, eine neue geologische Epochenbezeichnung einzuführen: das Anthropozän, das »jüngste Zeitalter des Menschen«. Aber als Spezies sind wir nach wie vor untrennbar mit unserem Planeten verbunden, und die Geschichte der Erde hat ihre Spuren in unseren Genen hinterlassen, so wie unsere Aktivitäten der natürlichen Umwelt ihren Stempel aufgedrückt haben. Um unsere eigene Geschichte wirklich zu verstehen, müssen wir die Biografie der Erde selbst erkunden – ihre Geländeformen und die zugrundeliegenden Strukturen, die atmosphärische Zirkulation und die Klimaregionen, die Plattentektonik und frühere Episoden des Klimawandels. In diesem Buch möchte ich der Frage nachgehen, wie unsere Umwelt uns geformt hat.
In meinem früheren Buch, dem Handbuch für den Neustart der Welt, habe ich ein Gedankenexperiment durchgespielt: Ich wollte herausfinden, wie wir die Zivilisation nach einer hypothetischen Apokalypse so schnell wie möglich neu starten können. Ausgehend vom Verlust all dessen, was wir in unserem Alltagsleben als selbstverständlich erachten, habe ich erkundet, wie unsere Zivilisation »hinter den Kulissen« funktioniert. Dort beschreibe ich die wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen und technologischen Innovationen, die uns dazu befähigt haben, die moderne Welt aufzubauen. Diesmal möchte ich die Perspektive erweitern, um nicht nur den menschlichen Einfallsreichtum, der uns dorthin brachte, wo wir heute sind, zu diskutieren, sondern auch um den klärenden Gedankengängen noch tiefer in die Vergangenheit zu folgen. Die Ursprünge unserer modernen Welt reichen weit zurück, und wenn wir sie über das sich wandelnde Äußere der Erde hinweg nachverfolgen, stoßen wir auf kausale Zusammenhänge, die oftmals bereits in der Geburtsstunde unseres Planeten ihren Ausgangspunkt nehmen.
Jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich hier spreche. Wenn Sie mit einem wissbegierigen Sechsjährigen darüber plaudern, wie etwas funktioniert oder warum etwas so ist, wie es ist, wissen Sie, dass Ihre erste Antwort das Kind niemals zufriedenstellt, sondern es nur auf weitere Rätsel hinweist. Das Kind reagiert stets mit einer ganzen Serie von »Warum?«, »Aber wieso?« und »Warum ist das so?«. Mit unstillbarer Neugierde versucht es die Welt, die es umgibt, immer tiefer zu ergründen und zu verstehen. Ich will unsere Geschichte gleichermaßen erkunden, indem ich mich durch die Zwiebelschalen aufeinanderfolgender Erklärungsebenen zu immer tieferen Ursachen vorarbeite und erkunde, wie scheinbar unzusammenhängende Facetten der Welt tatsächlich auf einem tieferen Niveau miteinander verknüpft sind.
Die Geschichte verläuft chaotisch, sprunghaft und ziellos – ein paar Jahre mit geringem Niederschlag führen zu Hungersnot und sozialen Unruhen; ein Vulkan bricht aus und zerstört nahe gelegene Ortschaften; inmitten des schweißtreibenden, blutigen Schlachtgetümmels trifft ein General eine falsche Entscheidung, und ein Reich geht unter. Aber jenseits der speziellen historischen Kontingenzen lassen sich eindeutige Trends und verlässliche Konstanten erkennen und die tieferen Ursachen dahinter erklären, sofern man die Welt auf einer hinlänglich großen räumlichen wie zeitlichen Skala betrachtet. Selbstverständlich hat die physische Struktur unseres Planeten nicht alles bereits vorherbestimmt; dennoch lassen sich eine Reihe übergeordneter Themen von grundlegender Bedeutung erkennen.
Wir werden eine riesige Zeitspanne überblicken. Die gesamte Menschheitsgeschichte passt sozusagen in ein einzelnes Standbild des Films der Erdgeschichte. Aber die Welt hat nicht von jeher so ausgesehen, und obgleich Kontinente und Ozeane sich über geologische Zeiträume nur langsam verschieben, haben frühere Gestaltungsformen der Erdoberfläche unsere Geschichte erheblich beeinflusst. Wir werden das wandelbare Gepräge der Erdhülle und die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten in den letzten Jahrmilliarden betrachten, die Evolution des Menschen aus seinen Menschenaffen-Vorfahren in den letzten fünf Millionen Jahren; die Steigerung der menschlichen Fähigkeiten und die weltweite Ausbreitung des Menschen in den letzten hunderttausend Jahren; die zivilisatorische Höherentwicklung in den letzten zehntausend Jahren; die jüngsten Trends der Kommerzialisierung, Industrialisierung und Globalisierung im letzten Jahrtausend; und schließlich sehen wir uns an, wie wir diese erstaunliche Geschichte unserer eigenen Entstehung im Verlauf des letzten Jahrhunderts immer besser begriffen haben.
Dabei werden wir an die Enden der Geschichte – und darüber hinaus – reisen. Historiker entziffern und interpretieren alte Schriftzeugnisse, um die Geschichte unserer frühesten Kulturen zu erzählen. Archäologen, die antike Artefakte und Ruinen freilegen, rekonstruieren unsere Frühgeschichte und das Leben der Gesellschaften von Jägern und Sammlern. Paläontologen haben das Puzzle unserer Evolution als biologische Art zusammengesetzt. Und um noch weiter in die Vergangenheit zurückzublicken, wenden wir uns Erkenntnissen anderer Wissenschaften zu: Wir werden das in den Gesteinsschichten, die buchstäblich das Fundament unseres Planeten bilden, konservierte erdgeschichtliche Archiv durchstöbern, die uralten Inschriften des genetischen Codes entziffern, die in der DNS-Datenbank in jeder unserer Zellen gespeichert sind, und durch Teleskope spähen, um den kosmischen Kräften, die unseren Planeten formten, bei ihrer Arbeit zuzusehen. Von Anfang an werden die Erzählstränge der Geschichts- und Naturwissenschaft in diesem Buch eng miteinander verwoben sein; sie bilden Kette und Schuss seines Gewebes.
Jede Kultur hat ihren eigenen Ursprungsmythos erfunden – von der Traumzeit der australischen Aborigines bis zur Schöpfungsgeschichte der Zulu. Aber die moderne Naturwissenschaft hat eine immer vollständigere, faszinierende Erzählung darüber entwickelt, wie die Welt um uns herum entstanden ist und wir unseren Platz darin eingenommen haben. Statt uns ausschließlich auf unsere Fantasie zu stützen, sind wir nun in der Lage, die Chronik der Schöpfung mithilfe dieser naturwissenschaftlichen Werkzeuge zu erhellen. Und dies ist dann die tatsächlich umfassende Schöpfungsgeschichte: die gesamte Menschheitsgeschichte und auch die Geschichte des Planeten, auf dem wir leben.
Wir gehen der Frage nach, warum sich das Erdklima seit mehreren zehn Millionen Jahren in einer anhaltenden Kalt- und Trockenzeit befindet und wie diese die Pflanzenarten und pflanzenfressenden Säugetiere hervorbrachte, die wir dann kultiviert respektive domestiziert haben. Auch untersuchen wir, wie sich der Mensch im Zuge der letzten Kaltzeit über die Erde ausbreitete und warum die Menschheit erst in der gegenwärtigen Zwischeneiszeit sesshaft wurde und Landwirtschaft zu betreiben begann. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir gelernt haben, aus der Erdkruste eine Vielzahl von Metallen zu gewinnen und weiterzuverarbeiten, die eine Reihe von Revolutionen in der Werkzeugherstellung und in der Technik antrieben, und wie uns die Erde die fossilen Energieträger schenkte, die unsere Welt seit der Industriellen Revolution mit Energie versorgen. Und dann sprechen wir noch über das Zeitalter der Entdeckungen im Zusammenhang mit den globalen Zirkulationssystemen in der Erdatmosphäre und in den Ozeanen und erfahren, wie Seefahrer nach und nach konstante Windsysteme und Meeresströmungen entdeckten, was ihnen ermöglichte, transkontinentale Handelswege und maritime Imperien aufzubauen. Wir ergründen, wie die Geschichte der Erde die Grundlagen für die heutigen geostrategischen Interessengegensätze schuf und die Politik nach wie vor beeinflusst – wie die politische Karte des Südostens der USA auch heute noch von Sedimenten eines ehemaligen Meeres, das vor 75 Millionen Jahren existierte, geprägt wird und wie sich die Lage geologischer Schichten, die sich vor 320 Millionen Jahren im Karbon bildeten, im Wahlverhalten britischer Bürger widerspiegelt. Durch die Kenntnis unserer Vergangenheit können wir die Gegenwart verstehen und uns für die Zukunft wappnen.
Unsere umfassende Schöpfungsgeschichte beginnen wir nun mit der grundlegendsten Frage überhaupt: Welche irdischen Prozesse haben die Evolution des Menschen gesteuert?
Kapitel 1Wie wir entstanden sind
Wir sind Affen.
Der menschliche Zweig des evolutionären Stammbaums, die sogenannten Homininen oder Hominini, ist Teil der größeren Säugetiergruppe der Primaten oder Herrentiere.2 Unsere engsten lebenden Verwandten sind die Schimpansen. Genetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass unsere evolutionäre Trennung von den Schimpansen ein langwieriger Prozess gewesen ist, der bereits vor 13 Millionen Jahren begonnen hat, wobei sich Individuen beider Gruppen bis vor rund 7 Millionen Jahren miteinander kreuzten. Schließlich trennten sich unsere evolutionären Entwicklungslinien jedoch; aus dem einen Zweig gingen die heutigen Gemeinen Schimpansen und die Bonobos hervor, während sich der andere in die verschiedenen Hominini-Arten auffächerte, wobei unsere eigene Spezies, Homo sapiens, nur einen Unterzweig bildet. Wenn wir unsere derartige Entwicklung betrachten, können wir nicht sagen, dass sich der Mensch aus den Menschenaffen entwickelte, vielmehr sind wir noch immer Affen, genauso wie wir noch immer Säugetiere sind.
Alle größeren Übergänge in der Evolution der Hominini ereigneten sich in Ostafrika. Diese Region liegt innerhalb des Regenwaldgürtels am Äquator, auf gleicher Höhe wie der Kongo, der Amazonas und die tropischen Inseln des Malaiischen Archipels. Eigentlich müsste daher auch Ostafrika dicht bewaldet sein, aber stattdessen herrscht dort Trockensavanne vor. Während unsere Primaten-Vorfahren Baumbewohner waren, die sich von Früchten und Blättern ernährten, hat irgendein einschneidendes Ereignis in dieser Region der Erde, unserer Wiege, dazu geführt, dass die üppigen Wälder einer Trockensavanne wichen, und dies wiederum gab den Anstoß zu einem evolutionären Entwicklungsschub, der uns von baumbewohnenden Primaten in aufrecht gehende Homininen verwandelte, die im goldenen Grasland auf Jagd gingen.
Worin eigentlich liegen die planetarischen Ursachen, dass sich gerade in dieser Region das Habitat in einer Weise verändert hat, die der Evolution intelligenter, hoch anpassungsfähiger Säugetiere förderlich war? Und da wir nur eine von einer ganzen Reihe ähnlich intelligenter, Werkzeuge benutzender Homininenspezies sind, die in Afrika entstanden, stellt sich die Frage, welche die eigentlichen Gründe dafür sind, dass Homo sapiens als einzige Spezies unseres evolutionären Zweigs überlebt und sich die Erde untertan gemacht hat.
Globale Abkühlung
Unser Planet ist ein Ort ruheloser Aktivität, der unentwegt sein Aussehen verändert. Ließen wir die gesamte Erdgeschichte im Schnelldurchlauf an unserem Auge vorbeiziehen, sähen wir, wie sich die Kontinente verschieben und zahllose unterschiedliche Konfigurationen bilden, vielfach miteinander kollidieren und nahtlos aneinanderfügen, nur um wieder auseinandergerissen zu werden, wobei riesige Ozeane, kaum entstanden, schon wieder schrumpfen und verschwinden. Große Vulkanketten werden plötzlich aktiv und erlöschen ebenso schnell, die Erde wird von Beben erschüttert, und hohe Gebirgszüge falten sich empor, ehe sie wieder zu Staub zermahlen werden. Die treibende Kraft all dieser hektischen Aktivitäten ist die Plattentektonik – die tiefere Ursache unserer Evolution.
Die äußere Haut der Erde, die Kruste, gleicht einer zerbrechlichen Eierschale, die den heißen, zähen Erdmantel darunter umhüllt. Die Erdkruste ist geborsten und in viele getrennte Platten zerfallen, die auf dem Erdmantel driften. Aus einer dickeren Kruste weniger dichten Gesteins setzen sich die Kontinente zusammen, während die ozeanische Kruste dünner, aber schwerer ist und daher nicht so hoch auf dem Erdmantel »schwimmt« wie die kontinentale Erdkruste. Die meisten dieser tektonischen Platten bestehen sowohl aus kontinentaler als auch aus ozeanischer Erdkruste, und diese »Flöße« reiben und stoßen fortwährend aneinander, während sie in dem aufgewühlten heißen Mantel auftauchen und in seinen launischen Strömungen dahintreiben.
Wo zwei Platten entlang einer sogenannten konvergierenden Plattengrenze aufeinanderstoßen, muss eine von beiden nachgeben. Die Vorderkante einer der beiden Platten wird unter die andere geschoben und in die gesteinsschmelzende Hitze des Mantels hinuntergezogen, was regelmäßige Erdbeben auslöst und einen Vulkanbogen mit Magma speist. Weil die Gesteine der kontinentalen Kruste eine geringere Dichte und daher einen höheren Auftrieb haben, ist es fast immer die ozeanische Kruste, die bei einer Plattenkollision unter die andere sinkt. Dieser Prozess der Subduktion geht so lange weiter, bis der Ozean dazwischen verschlungen wird und die beiden Stücke kontinentaler Erdkruste zusammengeschweißt werden, wobei eine große, zerknautschte Gebirgskette die Linie des Zusammenpralls markiert.
Divergierende beziehungsweise konstruktive Plattengrenzen sind die Orte, an denen zwei Platten auseinandergezogen werden. Heißes Material aus den Tiefen des Mantels steigt in diesem Riss auf, wie Blut in eine klaffende Wunde unseres Arms schießt, und verfestigt sich zu neuer Gesteinskruste. Auch wenn sich inmitten eines Kontinents ein neuer, sich spreizender Grabenbruch auftut und diesen in zwei Teile zerreißen kann, hat diese frisch gebildete Kruste eine hohe Dichte, sinkt daher tief in den Mantel und wird von Wasser überflutet. An konstruktiven Plattengrenzen bildet sich neue ozeanische Erdkruste – der Mittelatlantische Rücken ist ein bekanntes Beispiel für einen solchen sich verbreiternden Graben auf dem Meeresboden.
Die Plattentektonik ist ein Leitthema, auf das wir in diesem Buch immer wieder zurückkommen werden, doch vorläufig konzentrieren wir uns darauf, wie der Klimawandel, den sie in der jüngsten geologischen Vergangenheit antrieb, die Voraussetzungen für die Entstehung des Menschen schuf.
Die letzten 50 Millionen Jahre waren von einer Abkühlung des globalen Klimas gekennzeichnet. Dieser Prozess wird känozoische Abkühlung genannt und gipfelte vor 2,6 Millionen Jahren in der gegenwärtigen Periode pulsierender Kaltzeiten, die wir uns im nächsten Kapitel eingehender anschauen. Dieser langfristige globale Abkühlungstrend wird weitgehend von der kontinentalen Kollision Indiens mit Eurasien und der Auffaltung des Himalaja angetrieben. Die anschließende Erosion dieses hoch aufragenden Felsenrückens hat eine Menge Kohlenstoff aus der Atmosphäre ausgewaschen, was den Treibhauseffekt, der den Planeten in der Vergangenheit isolierte (vgl. Kapitel 2), abschwächte und zu sinkenden Temperaturen führte. Die globale Abkühlung ihrerseits verringerte die Verdunstung aus den Ozeanen, sodass weltweit weniger Niederschlag fiel und die Trockenheit zunahm.
Auch wenn sich dieser tektonische Prozess rund 5000 Kilometer von Ostafrika entfernt ereignete, jenseits des Indischen Ozeans, zeitigte er auch direkte regionale Auswirkungen auf den Schauplatz unserer Evolution. Der Himalaja und das Hochland von Tibet haben ein sehr mächtiges Monsunsystem über Indien und Südostasien geschaffen. Aber dieser gewaltige atmosphärische Saugeffekt über dem Indischen Ozean hat zudem Feuchtigkeit von Ostafrika abgezogen und den dortigen Niederschlag verringert. Andere globale tektonische Ereignisse haben vermutlich ebenfalls zur Aridisierung Ostafrikas beigetragen. Vor rund 3 bis 4 Millionen Jahren drifteten Australien und Neuguinea nach Norden, wobei sie die als Indonesischen Seeweg bezeichnete Wasserstraße schlossen. Diese Blockade verringerte den Fluss warmen Meerwassers aus dem Südpazifik nach Westen, stattdessen strömte kälteres Wasser aus dem Nordpazifik in den zentralen Indischen Ozean. Da sich der Indische Ozean abkühlte, verringerte sich die Verdunstung, was abermals weniger Niederschlag in Ostafrika bedeutete. Eine weitere gigantische tektonische Verwerfung, die sich in Afrika selbst ereignete, sollte sich jedoch als der maßgebliche Faktor für die Evolution des Menschen erweisen.
Die Brutstätte der Evolution
Vor etwa 30 Millionen Jahren stieg glutflüssiges Material aus dem Erdmantel in die Erdkruste Nordostafrikas auf und breitete sich dort in Form eines Plumes – einer pilzförmigen Struktur – aus. Die Landmasse schwoll dabei um etwa einen Kilometer an, einem riesigen Pickel gleich. Die Haut der kontinentalen Kruste über dieser geschwollenen Kuppe streckte und dünnte sich aus, bis sie schließlich in der Mitte aufriss und eine Reihe von Grabenbrüchen entstand. Der Ostafrikanische Grabenbruch verläuft annähernd in Nord-Süd-Richtung; ein östlicher Ast erstreckt sich durch das heutige Äthiopien, Kenia, Tansania und Mosambik, während ein westlicher Ast den Kongo durchschneidet und sich dann entlang seiner Grenze mit Tansania fortsetzt.
Dieser Prozess der Rissbildung in der Erdkruste war im Norden intensiver; hier wurde die Kruste direkt aufgerissen, sodass Magma durch die lange Wunde einsickern und eine neue Kruste aus Basaltgestein bilden konnte. Anschließend drang Wasser in diesen tiefen Graben ein – so entstand das Rote Meer; aus einem weiteren Grabenbruch ging der Golf von Aden hervor. Die den Meeresboden spreizenden Grabenbrüche rissen einen Brocken vom Horn von Afrika ab, der eine neue tektonische Platte, die Arabische Platte, formte. Das Y-förmige Zusammentreffen des Afrikanischen Grabens mit dem Roten Meer und dem Golf von Aden wird auch Triple Junction (Tripelpunkt) genannt. Im Zentrum dieses Kreuzungspunkts liegt eine dreieckige Tiefebene, die sogenannte Afar-Senke, die sich über Nordostäthiopien, Dschibuti und Eritrea erstreckt. Wir kommen später noch auf diese wichtige Region zurück.
Der Ostafrikanische Graben erstreckt sich über Tausende Kilometer von Äthiopien nach Mosambik. Da der Magmaplume darunter weiterhin anschwillt, wird der Graben stetig auseinandergezogen. Dieser »extensionale (sich dehnende) tektonische« Prozess führt dazu, dass entlang von Verwerfungen ganze Felsplatten reißen und abbrechen, wobei die Flanken als Steilstufen nach oben gedrückt werden und die Blöcke dazwischen absacken und die Talsohle bilden. Vor etwa 5,5 bis 3,7 Millionen Jahren schuf dieser Prozess die gegenwärtige Landschaft des Ostafrikanischen Grabens: ein breites, tiefes Tal, 800 Meter über dem Meeresspiegel und auf beiden Seiten von Bergketten gesäumt.
Das Anwachsen dieser Aufwölbung in der Erdkruste und die hohen Gebirgskämme des Ostafrikanischen Grabens bewirkten, dass die Niederschlagsmenge über weiten Teilen Ostafrikas stark zurückging. Feuchte Luftmassen vom Indischen Ozean werden in große Höhen umgelenkt, wo sie abkühlen, kondensieren und in Küstennähe als Regen niedergehen. Dies sorgt dafür, dass es landeinwärts trockener bleibt – ein auch Regenschatten genanntes Phänomen. Gleichzeitig wird die feuchte Luft aus den zentralafrikanischen Regenwäldern durch das Hochland des Ostafrikanischen Grabens ebenfalls daran gehindert, Richtung Osten zu ziehen.
All diese tektonischen Prozesse – die Entstehung des Himalaja, die Schließung des Indonesischen Seewegs und insbesondere die Auffaltung der hohen Gebirgszüge des Ostafrikanischen Grabens – zusammengenommen bewirkten, dass Ostafrika austrocknete. Die Entstehung des Grabens änderte nicht nur das Klima, sondern auch die Landschaft, wodurch sich die Ökosysteme der Region tiefgreifend wandelten. Ostafrika, bis dahin eine gleichförmige, von Tropenwald bedeckte Ebene, wurde zu einer zerklüfteten Gebirgslandschaft mit Hochebenen und tiefen Tälern, deren Vegetation von Nebelwäldern über Savannen bis zu Wüsten-Buschland reichte.
Obgleich sich dieser Grabenbruch bereits vor etwa 30 Millionen Jahren zu bilden begann, ereigneten sich die Aufwölbung und Aridisierung größtenteils erst in den letzten 3 bis 4 Millionen Jahren. Diese langfristige Austrocknung Ostafrikas, in deren Verlauf die Waldlandschaft mehr und mehr zurückgedrängt, zerstückelt und durch Savanne ersetzt wurde, war einer der wichtigsten Faktoren, die dafür sorgten, dass sich Homininen und baumbewohnende Menschenaffen auseinanderentwickelten. Diese Ausbreitung von Trockenrasen-Biotopen förderte auch die Vermehrung pflanzenfressender Großsäuger, Huftierarten wie Antilopen und Zebras, die von Menschen gejagt wurden.
Aber das war nicht der einzige Faktor. Aufgrund seiner tektonischen Entstehung gedieh der Ostafrikanische Graben zu einer sehr komplexen Umwelt, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Landschaften in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander: Wälder und Graslandschaften, Gebirgsrücken, Steilabbrüche, Hügel, Hochplateaus und Ebenen, Täler und tiefe Süßwasserseen am Grund des Grabenbruchs. Dies wird auch »Lebensraummosaik« genannt, das Homininen vielfältige Nahrungsquellen, Ressourcen und Chancen bot.
Die Verbreiterung des Grabens und das Aufströmen von Magma wurden von heftigen Vulkanausbrüchen begleitet, bei denen Bimsstein und Asche über der gesamten Region niedergingen. Der Ostafrikanische Graben ist auf seiner gesamten Länge von Vulkanen übersät, von denen sich viele in den letzten Jahrmillionen bildeten. Die meisten davon liegen im Grabenbruch selbst, einige der größten und ältesten hingegen entstanden an den Rändern, unter anderem der Mount Kenya, der Mount Elgon und der Kilimandscharo, der höchste Berg Afrikas.
Die bei den häufigen Vulkanausbrüchen freigesetzten Lavaströme erstarrten und bildeten Felskämme, die die Landschaft durchschnitten. Diese konnten von leichtfüßigen Homininen überquert werden, und im Verbund mit den steilen Felswänden innerhalb des Ostafrikanischen Grabens stellten sie möglicherweise wirksame natürliche Hindernisse und Barrieren für die von ihnen gejagten Tiere dar. Frühe Jäger konnten die Bewegungen ihrer Beutetiere recht verlässlich vorhersagen und kontrollieren, indem sie Fluchtwege versperrten und sie in eine Falle lenkten, um sie dort zu erlegen. Die gleichen geologischen Merkmale haben verletzlichen Frühmenschen wahrscheinlich ein gewisses Maß an Schutz und Sicherheit vor ihren eigenen Fressfeinden, die die Region durchstreiften, geboten. In diesem unwegsamen Gelände fanden die Homininen scheinbar ideale Entwicklungsbedingungen vor. Frühmenschen, die, wie wir, relativ schwach waren und nicht die Schnelligkeit eines Gepards oder die Kraft eines Löwen besaßen, lernten zu kooperieren und sich die Topografie des Geländes mit seiner komplexen Tektonik und Vulkanaktivität bei der Jagd zunutze zu machen.
Aktive Tektonik und Vulkanismus brachten diese Merkmale einer vielfältigen und dynamischen Landschaft im Lauf unserer Evolution hervor. Gerade weil der Ostafrikanische Graben eine tektonisch so aktive Region ist, hat sich die Landschaft seit der frühesten menschlichen Besiedlung stark verändert. In dem Maße, wie sich der Graben verbreitert hat, sind die ehedem von Homininen besiedelten Gebiete der Talsohle an den Flanken des Grabens angehoben worden; heute entdecken wir hier Fossilien von Homininen und machen archäologische Funde, die vollständig aus ihrer ursprünglichen Einbettung herausgelöst wurden. Und gerade dieser große Grabenbruch, die weltweit bedeutendste und langlebigste von Dehnungstektonik geprägte Region, soll nach herrschender wissenschaftlicher Meinung von entscheidender Bedeutung für die Evolution des Menschen gewesen sein.
Von Bäumen zu Werkzeugen
Die erste unumstrittene Homininenspezies, von der wir gut erhaltene fossile Überreste gefunden haben, ist Ardipithecus ramidus, der vor rund 4,4 Millionen Jahren in den Waldtälern des Flusses Awash in Äthiopien lebte. Diese Spezies hatte in etwa die Körpergröße heutiger Schimpansen, ein gleich großes Gehirn und Zähne, die darauf hindeuten, dass sie Allesfresser waren. Die versteinerten Skelette lassen darauf schließen, dass sie noch immer überwiegend Baumbewohner waren und sich nur primitiv aufrecht gehend fortbewegen konnten. Die ersten Vertreter der Gattung Australopithecus – des »südlichen Affen« –, die vor rund 4 Millionen Jahren lebten, hatten mehrere Merkmale mit modernen Menschen gemein, so etwa einen schlanken und grazilen Körper (aber noch immer mit recht primitiver Schädelform), und sie konnten sich bereits geschickt aufrecht fortbewegen. Über Australopithecus afarensis zum Beispiel wissen wir aufgrund erhaltener Fossilien relativ viel. Eines davon ist das bemerkenswerterweise vollständige Skelett eines Weibchens, das vor 3,2 Millionen Jahren im Tal des Flusses Awash lebte und den Namen Lucy erhielt.3
Lucy maß aufrecht stehend nur rund 1,1 Meter, besaß jedoch eine Wirbelsäule, ein Becken und Oberschenkelknochen, die große Ähnlichkeit mit denen moderner Menschen aufweisen. Während Lucy und andere Exemplare von A. afarensis noch immer über ein kleines Gehirn verfügten, das ungefähr die Größe eines Schimpansengehirns hatte, spricht ihr Skelett eindeutig für einen Lebensstil der bipeden Fortbewegung über große Entfernungen.4 Tatsächlich hat ein Bett aus Vulkanasche (Tuff) in Laetoli, Tansania, drei verschiedene Fußspuren erhalten, die dort vor 3,7 Millionen Jahren hinterlassen wurden. Erzeugt haben sie vermutlich Individuen von A. afarensis – und sie besitzen erstaunliche Ähnlichkeit mit denjenigen, die Sie selbst bei einem Strandspaziergang im Sand hinterlassen.
Im Lauf der Evolution entstand die Bipedie eindeutig lange vor der deutlichen Größenzunahme des Gehirns – wir konnten also bereits aufrecht gehen, bevor wir Sprache benutzen. Diese Australopithecus-Fossilien zeigen zusammen mit den älteren Ardipithecus-Arten, dass Bipedie nicht als Anpassung an die Fortbewegung in offenen, grasreichen Savannen-Habitaten entstand, wie man früher glaubte, sondern erstmals bei Homininen auftrat, die noch immer weitgehend auf Bäumen in Waldgebieten lebten. Doch Bipedie wurde zweifellos zu einer immer nützlicheren Anpassung, als die Wälder schrumpften und zunehmend zerstückelten. Unsere frühen homininen Vorfahren konnten von Waldinsel zu Waldinsel ziehen und sich von dort in die Grassavanne hinauswagen. Dank der Bipedie war es ihnen möglich, über das hohe Gras hinwegzuspähen, außerdem minimierte sie die der heißen Sonne ausgesetzte Körperfläche; dies trug dazu bei, dass ihre Körpertemperatur in der Hitze der Savanne nicht übermäßig anstieg. Auch die opponierbaren Daumen, die so nützlich wurden, um Werkzeuge zu halten und zu handhaben, sind ein evolutionäres Erbe unserer waldbewohnenden Primaten-Vorfahren. Die Hand, von der Evolution gestaltet, um nach einem Ast zu greifen, war damit auch prädisponiert, um später den Schaft einer Keule, eine Axt, einen Stift und schließlich den Steuerknüppel eines Düsenflugzeugs zu halten.
Vor etwa 2 Millionen Jahren waren die Homininenspezies der Gattung Australopithecus allesamt ausgestorben, während unsere Gattung, Homo, aus ihnen hervorgegangen war. Homo habilis (der »geschickte Mensch«) war der erste mit einem grazilen Körperbau, ähnlich den früheren Australopithecinen, und einem nur geringfügig größeren Gehirn. Eine dramatische Zunahme der Größe von Körper und Gehirn sowie eine grundlegende Veränderung des Lebensstils kamen dann mit Homo erectus, der vor rund 2 Millionen Jahren in Ostafrika auftrat. Unterhalb des Schädels weist das Skelett von H. erectus große Ähnlichkeit mit dem der anatomisch modernen Menschen auf, ebenso Anpassungen an den Langstreckenlauf und eine derart gestaltete Schulter, dass sie sich für das Werfen von Geschossen eignete. Man nimmt an, dass sie weitere Merkmale mit uns teilten, etwa eine lange Kindheit aufgrund verlangsamter Entwicklung und ein hochentwickeltes Sozialverhalten.
H. erectus war wahrscheinlich auch der erste Hominine, der als Jäger und Sammler lebte und die Nutzung des Feuers beherrschte – nicht nur zum Wärmen, sondern möglicherweise auch zur Nahrungszubereitung. Vielleicht sind sie sogar auf Flößen über große Gewässer gefahren. Vor 1,8 Millionen Jahren hatte sich H. erectus über ganz Afrika ausgebreitet und wurde dann der erste Hominine, der den Kontinent verließ und sich vermutlich in mehreren voneinander unabhängigen Wanderungswellen in Eurasien ansiedelte. Diese Spezies hielt sich fast 2 Millionen Jahre. Anatomisch moderne Menschen dagegen sind erst ein Zehntel dieser Zeit auf der Erde – und gegenwärtig könnten wir uns glücklich schätzen, sollten wir die nächsten 10.000 Jahre überleben, ganz zu schweigen von 2 Millionen.
Vor etwa 800.000 Jahren ging aus H. erectus der Homo heidelbergensis hervor, der sich vor 250.000 Jahren zum Homo neanderthalensis (Neandertaler) in Europa und zum Denisova-Menschen in Asien weiterentwickelte. Der erste anatomisch moderne Mensch, Homo sapiens, entstand zwischen 300.000 und 200.000 Jahren vor unserer Zeit.
Im Verlauf der Evolution des Menschen nahm die Bipedie der Homininen allmählich zu, die in der Folge auch effizientere Langstreckenläufer wurden, was mit Veränderungen des Skeletts einherging, wie einer S-förmigen Wirbelsäule, einem schüsselförmigen Becken und längeren Beinen zur Abstützung dieser aufrechten Haltung und Fortbewegungsweise. Die Körperbehaarung nahm ab, außer auf dem Kopf. Auch die Schädelform veränderte sich, mit der Folge, dass die Nase schmaler, das Kinn stärker ausgeprägt und die Hirnschale schüsselförmiger wurden. Tatsächlich bestand der Hauptunterschied zwischen der früheren Gattung Australopithecus und der Homo-Linie in dieser Zunahme des Gehirnvolumens. Im Lauf ihrer 2 Millionen Jahre währenden Evolution blieb das Gehirnvolumen der Australopithecinen mit rund 450 Kubikzentimetern, was ungefähr dem eines modernen Schimpansen entspricht, erstaunlich konstant. H. habilis aber hatte mit etwa 600 Kubikzentimetern ein um ein Drittel größeres Gehirn, und von H. habilis über H. erectus bis zu H. heidelbergensis verdoppelte sich das Gehirnvolumen sogar. Vor 600.000 Jahren verfügte H. heidelbergensis über ein Gehirn, das ungefähr genauso groß war wie das moderner Menschen und dreimal größer als das der Australopithecinen.
Neben der Zunahme des Gehirnvolumens war ein weiteres definierendes Merkmal der Homininen die Anwendung ihrer Intelligenz auf die Herstellung von Werkzeugen. Die ältesten weitverbreiteten Steinwerkzeuge – Geröllgeräte der sogenannten Oldowan-Industrie – sind etwa 2,6 Millionen Jahre alt und wurden von den späteren Australopithecus-Spezies sowie von H. habilis und H. erectus verwendet. Rundliche Geröllsteine aus einem Fluss wurden dazu benutzt, um auf einen flachen Ambossstein gelegte Knochen oder Nüsse aufzuknacken. Scharfe Kanten erzeugte man dadurch, dass man Splitter von den Steinen abschlug; dieser bearbeitete Stein wurde dann dazu verwendet, um das Fleisch erlegten Wilds zu zerschneiden und es von Knochen und Fell abzuschaben sowie um Holz zu bearbeiten.5
Eine technologische Revolution in der Steinzeit ereignete sich, als H. erectus diese Oldowan-Werkzeuge übernahm und verfeinerte: So entstand vor 1,7 Millionen Jahren die sogenannte Acheuléen-Industrie. Acheuléen-Werkzeuge wurden sorgfältiger bearbeitet, indem immer kleinere Späne abgeschlagen wurden; auf diese Weise stellte man symmetrischere und dünnere birnenförmige Faustkeile her. Diese Acheuléen-Werkzeuge stellten während des größten Teils der Menschheitsgeschichte die vorherrschende Technik dar. Aus einer späteren Transformation ging die Moustérien-Technik hervor, die während der letzten Kaltzeit von den Neandertalern und anatomisch modernen Menschen verwendet wurde. Der Kernstein wurde hier durch Behauen des Steinrands sorgfältig präpariert und bekantet, ehe man mittels eines geschickten Hiebs einen großen Abschlag gewann. Dieser, nicht der bearbeitete Kernstein, war das eigentliche Zielprodukt: eine dünne, spitze Scherbe, die sich hervorragend als Messer oder auch als Speer- beziehungsweise Pfeilspitze eignete.
Diese Steinwerkzeuge sowie hölzerne Speerschäfte machten Homininen zu äußerst erfolgreichen Jägern, ohne – wie andere Beutegreifer – an ihren Körpern große Zähne oder Klauen entwickeln zu müssen. Wir verwendeten Stöcke und Steine als künstliche Zähne und Klauen, um Wild zu jagen oder uns zu verteidigen, während wir zugleich Beutetiere und Fressfeinde auf sicherer Distanz halten konnten, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Diese Entwicklungen in Körperform und Lebensstil verstärkten sich gegenseitig. Effizientere Lauf- und hochentwickelte kognitive Fähigkeiten verbesserten in Kombination mit Werkzeuggebrauch und Beherrschung des Feuers unseren Jagderfolg, sodass wir uns immer fleischreicher ernährten und somit den Energiebedarf eines größeren Gehirns decken konnten. Dieser Umstand wiederum befähigte uns zu komplexerer sozialer Interaktion und Kooperation, kulturellem Lernen und Problemlösen und, vielleicht am wichtigsten, zur Sprachentwicklung.
Das Klima-Pendel
Viele dieser bahnbrechenden Übergänge in unserer Evolution sind in der Afar-Region am nördlichen und ältesten Ende des Ostafrikanischen Grabens erhalten geblieben. Die ersten homininen Fossilien, diejenigen des Ardipithecus ramidus, wurden im Awash-Tal entdeckt, das sich vom äthiopischen Hochland in nordöstlicher Richtung bis nach Djibouti erstreckt und mitten durch das Afar-Dreieck verläuft. Dasselbe Flusstal konservierte die 3,2 Millionen Jahre alten Überreste Lucys – und tatsächlich wurde die Art, der sie angehört, Australopithecus afarensis, nach dieser Region benannt. Auch die ältesten bekannten Oldowan-Werkzeuge wurden am Fundplatz Kada Gona in Äthiopien entdeckt, der ebenfalls innerhalb des Afar-Dreiecks liegt. Der Ostafrikanische Grabenbruch ist jedoch auf seiner ganzen Länge eine Keimzelle der Homininenevolution gewesen.
Das trockene Klima und das Grabensystem mit seiner vielfältigen Mosaikstruktur einschließlich der Vulkanketten und Bruchstufen prägten jene Umweltbedingungen maßgeblich, die die Evolution des Menschen antrieben. Aber selbst wenn diese komplexe tektonische Landschaft umherziehenden Homininen günstige Entwicklungsbedingungen bot, erklärt dies noch nicht hinlänglich, wie eine solch unglaubliche Vielseitigkeit und Intelligenz ursprünglich entstanden ist. Die Antwort darauf dürfte in einer Besonderheit der Dehnungstektonik des Großen Afrikanischen Grabenbruchs und ihren Wechselwirkungen mit Klimaschwankungen liegen.
Wie wir gesehen haben, ist das globale Klima in den vergangenen rund 50 Millionen Jahren kühler und trockener geworden; die tektonische Hebung und Entstehung des Ostafrikanischen Grabenbruchs hatten zur Folge, dass insbesondere Ostafrika austrocknete und seine einstigen Wälder verlor. Im Zuge dieses globalen Trends zunehmender Abkühlung und Trockenheit allerdings geriet das Klima sehr instabil und war dramatischen Schwankungen unterworfen. Wie wir im nächsten Kapitel ausführlicher schildern werden, begann das gegenwärtige Eiszeitalter vor rund 2,6 Millionen Jahren, wobei der Wechsel von Kalt- und Warmzeiten von rhythmischen Verschiebungen der Erdbahn (Umlaufbahn der Erde um die Sonne) und der Neigung der Erdachse – den sogenannten Milanković-Zyklen – bestimmt wird. Ostafrika war zu weit von den Polen entfernt, als dass es von den vorrückenden Eisschilden hätte erreicht werden können, was jedoch nicht bedeutet, es wäre von diesen kosmischen Zyklen nicht stark beeinflusst worden. Insbesondere die periodische Streckung der Erdumlaufbahn um die Sonne zu einer länglichen Ellipse – der sogenannte Exzentrizitätszyklus – hat Perioden starker klimatischer Schwankungen in Ostafrika erzeugt. Während jeder dieser Phasen extremer Variabilität schwankt das Klima mit dem schneller werdenden Takt des Präzessionszyklus der geneigten Erdachse, auf den wir noch zurückkommen werden, zwischen sehr trockenen und feuchteren Phasen.
Dennoch wirken diese kosmischen Periodizitäten und die von ihnen angetriebenen Klimaumschwünge über Tausende und Abertausende von Jahren. Wollen wir die Evolution des Menschen verstehen, müssen wir das Phänomen berücksichtigen, dass die erwähnten Prozesse, die den größten Einfluss auf Ostafrika ausübten, im Vergleich zur Lebensspanne eines Tieres außerordentlich langsam wirken. Intelligenz und das extrem vielseitige Verhalten, das sie ermöglicht, sind dagegen eine Anpassung, die mit dem Gebrauch eines Schweizer Taschenmessers vergleichbar ist, das zahlreiche Werkzeuge integriert und seinem Besitzer hilft, vielfältige Herausforderungen zu bewältigen, da er zu Lebzeiten immer wieder sehr unterschiedlichen Umweltbedingungen ausgesetzt ist. Auf sehr langfristige Veränderungen der Umwelt kann die Evolution reagieren, indem sie den Körper oder die Physiologie einer Spezies im Lauf von Generationen modifiziert (wie sich etwa das Kamel an die konstante Trockenheit seines Habitats angepasst hat). Intelligenz dagegen ist die evolutionäre Lösung für das Problem, dass sich ein Lebensraum schneller verändert, als die natürliche Selektion den Körper ummodellieren kann. Ein starker Evolutionsdruck, der Homininen zu immer flexiblerem und intelligenterem Verhalten drängte, setzt folglich voraus, dass es irgendetwas gegeben haben muss, das in sehr kurzem zeitlichen Rahmen auf unsere Vorfahren einwirkte.
Welche besonderen Umstände in Ostafrika begünstigten nun die Evolution hochintelligenter Homininen wie uns selbst? Die sich in den letzten Jahren abzeichnende Antwort setzt einmal mehr an der besonderen tektonischen Beschaffenheit der Region an. Wie erwähnt hat sich Ostafrika mit dem Magma-Plume aufgewölbt, und diese Bewegung dehnte die Kruste, bis sie Risse bekam und sich verwarf. Die Geografie des Großen Afrikanischen Grabenbruchs zeichnet sich daher durch eine flache Talsohle aus, wo große Krustebrocken eingesunken sind und die auf beiden Seiten von Bergketten gesäumt wird. Vor etwa drei Millionen Jahren bildeten sich insbesondere zahlreiche große, isolierte Becken im Talboden, die sich mit Wasser füllen und zu Seen werden konnten, sofern die Klimabedingungen ausreichend feucht waren. Diese tiefen Seen sind wichtig, weil sie Homininen während der jährlichen Trockenperioden eine verlässlichere Wasserquelle boten als Fließgewässer. Viele davon waren indes kurzlebig: Sie entstanden und verschwanden im Lauf der Zeit mit dem sich wandelnden Klima.
Der Große Ostafrikanische Grabenbruch, verzeichnet mit den großen Seen und den sogenannten Verstärkerseen
Die Landschaft des Grabenbruchs sorgt dafür, dass sich die klimatischen Verhältnisse in den höheren Lagen deutlich von denen am Talgrund unterscheiden. Der auf die hohen Grabenwände und Vulkangipfel niedergehende Regen fließt in die Seen, die den Talboden sprenkeln und wo es viel heißer ist und viel mehr Wasser verdunstet. Dadurch bedingt, reagieren viele der Seen im Ostafrikanischen Grabenbruch außerordentlich empfindlich auf das Gleichgewicht zwischen Niederschlag und Verdunstung, und schon eine kleine Veränderung des Klimas bewirkt eine erhebliche und schnelle Zu- oder Abnahme ihres Wasserpegels – sie reagieren viel stärker als andere Seen weltweit beziehungsweise in anderen Regionen Afrikas; daher werden sie auch »Verstärkerseen« genannt – sie funktionieren als eine Art Hifi-Verstärker für ein schwaches Signal. Man nimmt an, dass ebendiese Verstärkerseen als zentrales Bindeglied zwischen den langfristigen Trends der Tektonik, die den Grabenbruch schufen, und den Klimaumschwüngen und schnellen Habitatwechseln fungieren, die sich direkt und dramatisch auf unsere Evolution auswirkten.
Hier sind zwei besondere astronomische Merkmale unseres Planeten von Bedeutung: die Dehnung der Erdumlaufbahn um die Sonne (Exzentrizität) und die Kreiselbewegung der Erdachse (Präzession). Jedes Mal, wenn die Umlaufbahn der Erde in eine langgestreckte Form gezogen wurde (maximale Exzentrizität), wurde das Klima in Ostafrika sehr instabil. Während jeder dieser Phasen klimatischer Variabilität fiel immer dann, wenn die Sonne aufgrund des Präzessionszyklus die Nordhalbkugel etwas stärker aufwärmte, mehr Regen auf die Wände des Ostafrikanischen Grabenbruchs. Die Verstärkerseen entstanden und wurden größer, Wälder säumten ihre Ufer. Und umgekehrt: Während der entgegengesetzten Phase des Präzessionszyklus bekam der Grabenbruch weniger Niederschlag ab, die Seen schrumpften oder verschwanden völlig. Dann kehrte der Ostafrikanische Grabenbruch in einen extrem trockenen Zustand mit minimaler Belaubung zurück. En gros war das Klima in Ostafrika in den letzten Jahrmillionen also überwiegend sehr trocken, aber dazwischen gab es immer wieder hochvariable Perioden, in denen das Klima schnell zwischen weitaus feuchteren und dann wieder sehr trockenen Phasen schwankte.
Die Etappen starker Klimaschwankungen ereigneten sich ungefähr alle 800.000 Jahre, und während dieser Perioden flackerten die Verstärkerseen wie ein lockeres Leuchtmittel: Die Verfügbarkeit von Wasser, Vegetation und Nahrung änderte sich mit jedem Umschwung tiefgreifend, was weitreichende Auswirkungen auf unsere Vorfahren hatte. Diese raschen Klimaschwankungen begünstigten nämlich das Überleben von Homininen, die vielseitig und anpassungsfähig waren, weshalb sie die Triebkräfte der Evolution größerer Gehirne und höherer Intelligenz darstellten.
Die drei jüngsten Perioden solcher extremen Klimaschwankungen ereigneten sich vor 2,7 bis 2,5, 1,9 bis 1,7 und 1,1 bis 0,9 Millionen Jahren. Bei der Analyse des Fossilberichts – aller dokumentierten fossilen Funde – haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung gemacht: Der Zeitpunkt, an dem neue Homininenarten auftraten – oftmals verbunden mit einer Zunahme des Gehirnvolumens – oder wieder ausstarben, fällt tendenziell mit diesen Perioden des schnellen Wechsels zwischen feuchtem und trockenem Klima zusammen. So ereignete sich beispielsweise eine der bedeutendsten Episoden in der Evolution des Menschen in der Periode hoher Klimavariabilität vor 1,9 bis 1,7 Millionen Jahren. In dieser Zeit wurden fünf der sieben großen Seebecken im Grabenbruch wiederholt gefüllt und entleert. Während dieser Zeit erreichte die Anzahl verschiedener Homininenspezies ihren Höchststand, auch H. erectus mit seinem dramatisch vergrößerten Gehirnvolumen tritt hier erstmals in Erscheinung. Von den fünfzehn Homininenarten, die wir kennen, tauchten zwölf erstmals während dieser drei Phasen erhöhter Klimaschwankungen auf. Zudem deckt sich die Entwicklung und Ausbreitung der weiter oben erwähnten verschiedenen Stufen an Werkzeugtechniken – Oldowan, Acheuléen und Moustérien – mit diesen Exzentrizitätsperioden extremer klimatischer Variabilität.
Diese Perioden verstärkter Klimaumschwünge haben nicht nur unsere Evolution beschleunigt, vielmehr gelten sie obendrein als die treibende Kraft, die mehrere Homininenarten dazu veranlasste, ihren Geburtsort zu verlassen und nach Eurasien auszuwandern. Im nächsten Kapitel werden wir detailliert erkunden, wie sich unsere Spezies, H. sapiens, über die gesamte Erde ausbreiten konnte; die Umstände, die die Homininen ursprünglich zur Auswanderung aus Afrika veranlassten, hängen jedoch abermals mit den Klimaschwankungen im Ostafrikanischen Grabenbruch zusammen.
Während jeder Feuchtphase dürften das Auffüllen der großen Verstärkerseen und die zusätzliche Verfügbarkeit von Wasser und Nahrung eine starke Bevölkerungszunahme verursacht haben, während sie gleichzeitig den Platz für Wohnstätten auf den baumbestandenen Schultern des Grabenbruchs einschränkten. Daraufhin dürfte die Homininenspezies bei jedem »Feuchtigkeitsstoß« der Klimapumpe im Präzessionszyklus an der röhrenförmigen Talsohle des Rift Valley zusammengedrängt und schließlich aus Ostafrika vertrieben worden sein. Ein feuchteres Klima dürfte diesen homininen Migranten darüber hinaus erlaubt haben, Richtung Norden entlang der Zuflüsse des Nils und durch die grüneren Korridore der Halbinsel Sinai und der Levante zu ziehen und sich dann über Eurasien zu verbreiten. Homo erectus verließ Afrika während der Phase starker Klimaschwankungen vor etwa 1,8 Millionen Jahren und breitete sich schließlich bis nach China aus. In Europa entwickelte sich H. erectus weiter zum Neandertaler, während aus der in Ostafrika verbliebenen Population von H. erectus vor 300.000 bis 200.000 Jahren die anatomisch modernen Menschen hervorgingen.
Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, wanderte unsere eigene Spezies vor etwa 60.000 Jahren aus Afrika aus. Wir begegneten den Nachfahren früherer Homininenauswanderer – Neandertalern und Denisova-Menschen –, als wir uns über Europa und Asien ausbreiteten, doch starben diese beiden vor rund 40.000 Jahren aus, und allein anatomisch moderne Menschen blieben übrig. Ausgehend von einem Gipfel der homininen Artenvielfalt in Afrika vor etwa 2 Millionen Jahren über unsere Kontakte (und Kreuzungen) mit eng verwandten Menschenarten während unserer Ausbreitung in Eurasien wurde Homo sapiens schließlich zur einzigen überlebenden Art der Gattung Homo und sogar des gesamten Hominini-Stammbaums.
Das ist schon an sich ein Kuriosum. Aufgrund der umfangreichen archäologischen Funde wissen wir, dass die Neandertaler selbst eine äußerst anpassungsfähige und intelligente Spezies waren. Sie fertigten Steinwerkzeuge und jagten mit Speeren, beherrschten das Feuer, tätowierten sich und bestatteten ihre Toten. Auch an Körperkraft waren sie Homo sapiens überlegen. Und dennoch verschwanden die Neandertaler bereits kurz nach unserer Ankunft in Europa. Vielleicht fielen sie den lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen in den Tiefen der Kaltzeit zum Opfer (auch wenn die verblüffende Koinzidenz mit unserer Ankunft diese Erklärung eigentlich widerlegt), oder vielleicht kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen anatomisch modernen Menschen und diesen sozusagen alteingesessenen Europäern – und wir schlachteten sie ab und ließen sie dem Vergessen anheimfallen. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass wir sie in dem Lebensraum, den wir mit ihnen teilten, bei der Konkurrenz um Ressourcen ausstachen. Man nimmt an, dass moderne Menschen sich viel besser sprachlich verständigen und folglich ihr soziales Verhalten differenzierter koordinieren konnten und ihren Verwandten außerdem bei der Werkzeugherstellung überlegen waren. Und obwohl wir erst vor kurzem aus dem tropischen Afrika ausgewandert waren, konnten wir Nähnadeln anfertigen und daher in den kurzen, bitterkalten Phasen der Eiszeit wärmere, eng anliegende Kleidung herstellen.
Menschen erlangten ihrer Intelligenz wegen, nicht aufgrund ihrer Muskelkraft, den Neandertalern gegenüber die Oberhand und machten sich anschließend die ganze Welt untertan. Und dies wiederum ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Tatsache zurückzuführen, dass unsere Vorfahren den extremen Klimaschwankungen Ostafrikas im Lauf ihrer Evolution längere Zeit ausgesetzt waren, was sie schließlich dazu zwang, eine größere Flexibilität und Intelligenz als die Neandertaler zu entwickeln. Wir haben uns länger an die raschen Umschwünge zwischen humiden und ariden Phasen, wie sie für das Rift Valley charakteristisch waren, angepasst, was uns auch in die Lage versetzte, besser mit den verschiedenen Klimata zurechtzukommen, denen wir auf unseren globalen Wanderungen, auch durch die eiszeitlichen Landstriche der Nordhalbkugel, begegneten.
Alles in allem ist das (höhere) Säugetier Mensch das Produkt einer besonderen Kombination planetarischer Prozesse, die sich zeitgleich in den letzten Jahrmillionen in Ostafrika ereigneten. Nicht genug damit, dass die Region ausgetrocknet war, als sich die Erdkruste in dem Maße aufwölbte, wie Magma durch den Erdmantel aufströmte und einen Plume bildete, wodurch sich das relativ flache, waldbedeckte Habitat unserer Primaten-Ahnen in eine Trockensavanne verwandelte; vielmehr transformierte sich die gesamte Landschaft in eine zerklüftete Region, die von steilen Bruchstufen und Höhenrücken aus erstarrter Vulkanlava durchschnitten wurde: Es war ein Gebiet, das in ein komplexes Mosaik verschiedener Habitate zerfiel, die sich im Lauf der Zeit weiterhin veränderten. So riss insbesondere die Dehnungstektonik Ostafrikas das Rift Valley auf und schuf auf diese Weise eine besondere geografische Struktur aus hohen Grabenwänden, an denen sich heranziehende Wolken abregnen, und einem heißen Talgrund. Kosmische Zyklen der Erdumlaufbahn und der Rotationsachse der Erde füllten Becken in der Grabensohle in regelmäßigen Abständen mit Wasser, und die so entstandenen Verstärkerseen reagierten rasch auf nur geringfügige Klimaschwankungen und erzeugten folglich einen starken Evolutionsdruck auf alle Lebensformen in dieser Region.
Diese einzigartigen Umweltbedingungen im Ursprung der Homininen förderten die Entwicklung anpassungsfähiger und vielseitiger Arten. Unsere Vorfahren begannen, sich mehr und mehr auf ihre Intelligenz und die Zusammenarbeit in sozialen Gruppen zu stützen. Die vielgestaltige Landschaft, sowohl in räumlicher als auch zeitlicher Dimension einen hohen Abwechslungsreichtum aufweisend, war die Wiege der Evolution der Homininen, aus der ein nackter und geschwätziger Affe hervorging, der so intelligent war, dass er das Rätsel seiner eigenen Herkunft löste. Die Kennzeichen des Homo sapiens – Intelligenz, Sprachfähigkeit, soziales Lernen und kooperatives Verhalten, die uns erlaubten, Landwirtschaft zu betreiben, in Städten zu leben und Zivilisationen aufzubauen – sind Produkte dieser extremen Klimaschwankungen, die den besonderen Bedingungen im Rift Valley geschuldet sind. Wie alle Arten sind auch wir ein Produkt unserer Umwelt, eine Primatenart, die ihre Entstehung dem Klimawandel und der Tektonik Ostafrikas verdankt.
Wir sind die Kinder der Plattentektonik
Die Plattentektonik schuf nicht nur die vielfältige und dynamische Umwelt Ostafrikas, in der wir als Spezies entstanden sind; sie war auch ein Faktor, der definierte, wo der Mensch begann, die frühen Zivilisationen aufzubauen.
Schaut man sich eine Karte der sich aneinander reibenden tektonischen Plattengrenzen an und legt eine Folie mit den Standorten der frühen Hochkulturen darüber, zeigt sich, dass sie erstaunlich nahe beieinanderliegen: 13 von 15 befinden sich in unmittelbarer Nähe von Plattengrenzen. In Anbetracht des auf der Erde insgesamt verfügbaren Siedlungsraums ist dies ein erstaunlicher Zusammenhang, ein Zufall ist sehr unwahrscheinlich. Frühe Kulturen scheinen sich gezielt dicht an tektonischen Brüchen angesiedelt zu haben, und zwar Jahrtausende, bevor sie von Wissenschaftlern entdeckt wurden. Irgendetwas an den Plattengrenzen muss ungeachtet der Gefahren von Erdbeben, Tsunamis und Vulkaneruptionen, die von diesen Brüchen in der Erdkruste ausgingen, die Ansiedlung früher Kulturen begünstigt haben.
Im Industal entstand die Harappa- beziehungsweise Indus-Kultur um 3200 v.Chr. als eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt (neben Mesopotamien und Ägypten), in einem Muldengebiet, das sich am Fuß des Himalaja erstreckt. Der Zusammenstoß tektonischer Platten faltet hohe Gebirgszüge auf – wie etwa den Himalaja, der entstand, als die Indische Platte mit der Eurasischen Platte kollidierte –, aber das immense Gewicht des Gebirgszugs drückt die an ihm entlang verlaufende Erdkruste nach unten und erzeugt so ein tiefliegendes, einsinkendes Becken.
Frühe Hochkulturen und ihre Nähe zu den Plattengrenzen
Die im Himalaja entspringenden Flüsse Indus und Ganges fließen durch dieses Vorlandbecken, wo sie Sedimente ablagern, die sie von den Bergen abgetragen haben. Auf diese Weise entstanden sehr fruchtbare Böden, die von frühen Ackerbauern bewirtschaftet wurden. Man könnte sagen, dass die Harappa-Kultur aus der kontinentalen Kollision zwischen der Indischen und der Eurasischen Platte hervorgegangen ist.
In Mesopotamien flossen der Tigris und der Euphrat ebenfalls durch ein einsinkendes Vorlandbecken, durch das Zagros-Gebirge heruntergedrückt, das sich wiederum bildete, als sich die Arabische Platte unter die Eurasische Platte schob. Die Böden in Mesopotamien wurden daher ganz ähnlich mit Sedimenten angereichert, die aus diesem Gebirgszug herausgewaschen worden waren. Die Kulturen der Assyrer und Perser entstanden beide direkt über dieser Nahtstelle zwischen der Arabischen und der Eurasischen Platte.
Auch die Kulturen der Minoer, der Griechen, der Etrusker und der Römer entwickelten sich in unmittelbarer Nähe zu Plattengrenzen innerhalb des komplexen tektonischen Umfelds des Mittelmeerbeckens. In Mesoamerika entwickelte sich seit etwa 2000 v.Chr. die Maya-Kultur und breitete sich über einen Großteil Südostmexikos, Guatemalas und Belizes aus; große Städte wurden zwischen den Gebirgen erbaut, die durch die Subduktion der Cocosplatte unter die Nordamerikanische und die Karibische Platte aufgeworfen worden waren. Die spätere Azteken-Kultur erlebte ihre Blüte in der Nähe derselben konvergierenden Plattengrenze, und die hier entstehenden Erdbeben und Vulkane wie der Popocatépetl, der »Rauchende Berg«, waren den Azteken heilig.6
Nicht nur tiefliegende Becken am Fuß von Gebirgsketten bieten fruchtbares Ackerland, auch Vulkane erzeugen nährstoffreichen Ackerboden. Sie tauchen in einer breiten Linie in rund 100 Kilometern Entfernung von einer Subduktionslinie auf, wenn die verschlungene Platte tiefer in das heiße Erdinnere absinkt und im Schmelzen aufsteigende Magmablasen freisetzt, die Eruptionen an der Erdoberfläche erzeugen. Zivilisationen im Mittelmeerraum, wie etwa die griechische, etruskische und römische, entstanden in Gebieten mit fruchtbarem vulkanischen Boden in ebenjenem Band, wo die Afrikanische Platte unter die kleineren Platten geschoben wird, aus denen sich die Mittelmeerregion zusammensetzt.
Tektonische Spannungen halten zudem Brüche in Felsgestein offen oder drücken in einer sogenannten Überschiebung Krustenblöcke nach oben, was oftmals Wasserquellen entstehen lässt. Die lange Linie miteinander verbundener Berge entlang des südlichen Eurasiens, die durch die Kollision der Afrikanischen Platte mit der Arabischen und der Indischen aufgefaltet wurde, fällt zufälligerweise mit dem sich über die Erde ziehenden Trockengürtel zusammen. Dieser schließt die Arabische und Große Indische Wüste ein und wird von den trockenen, absinkenden Luftmassen im System der atmosphärischen Zirkulation geschaffen (darauf werden wir in Kapitel 8 zurückkommen). Hier befinden sich derartige Überschiebungen oftmals an der Verbindungsstelle zwischen tiefliegenden vegetationslosen Wüsten und hoch aufragenden unwirtlichen Bergen oder Hochländern, und so verlaufen Handelsrouten oftmals entlang solcher geologischen Grenzen. Städte, die an diesen Wegen liegen und von Quellen am Fuß der Berge mit Wasser versorgt werden, bieten reisenden Kaufleuten Unterkunft. Obgleich tektonische Bewegungen in ansonsten trockenen Lebensräumen Wasserquellen schaffen können, laufen diese Siedlungen Gefahr, bei jeder neuen Gleitbewegung der Erdkruste von zerstörerischen Erdbeben heimgesucht zu werden.
Im Jahr 1994 wurde das kleine Wüstendorf Sefidabeh im Südostiran durch ein Erdbeben vollständig zerstört. Dabei ist Sefidabeh eine sehr abgelegene Ortschaft: einer der wenigen Stopps auf einer langen Handelsstraße zum Indischen Ozean und die einzige menschliche Siedlung im Umkreis von 100 Kilometern. Und dennoch schien das Erdbeben das Dorf mit nachgerade unheimlicher Präzision ins Visier genommen zu haben. Es zeigte sich, dass Sefidabeh unmittelbar auf einer Überschiebung errichtet wurde, die tief unter der Erde liegt. Die Verwerfung lag in so großer Tiefe, dass sie an der Oberfläche keine sichtbaren Anzeichen hinterlassen hatte – wie etwa eine verräterische Steilstufe –, weshalb sie von Geologen bis dahin nicht entdeckt worden war. Im Rückblick bestand das einzige Anzeichen in einer leicht abgekanteten Geländestufe, die entlang der Ortschaft verlief und sich im Lauf von Hunderttausenden von Jahren aufgrund von Geländebewegungen durch Erdbeben langsam aufgebaut hatte. Die Siedlung war gerade hier angelegt worden, weil der anhaltende tektonische Aufwärtsdruck von Gesteinsschichten am Fuß der Stufe dauerhaft Quellen gespeist hatte – die einzige Möglichkeit im Umkreis etlicher Kilometer, sich mit Wasser zu versorgen. Die tektonische Verwerfung hatte die Bedingungen geschaffen, die Leben in der Wüste ermöglichten; doch drohte eben auch die Entladung der angestauten Spannungen mit katastrophalen Folgen.
Die durch diese Überschiebungen entstandenen Wasserquellen werden seit Jahrtausenden genutzt und erklären, warum viele frühe Siedlungen an tektonischen Grenzen angelegt wurden. Heutzutage sind sie Anlass wachsender Besorgnis. Die Hauptstadt des Iran, Teheran, bestand ursprünglich aus einer Gruppe von Ortschaften, die am Fuß des Elburs-Gebirges an einer wichtigen Handelsroute lagen. Seit den 1950er Jahren ist die Stadt schnell gewachsen und mit heute acht Millionen Einwohnern und zusätzlichen zwei Millionen Pendlern dicht bevölkert. Die kleinen Handelsstädte, die sich ursprünglich in dieser Gegend befanden, wurden im Lauf der Jahrhunderte allerdings wiederholt durch Erdstöße beschädigt oder gar dem Erdboden gleichgemacht, als sich die Überschiebung verlagerte, um die steigenden tektonischen Spannungen abzuführen. Die Stadt Täbris, nordöstlich von Teheran ebenfalls am Rand dieses Gebirges gelegen, wurde 1721 und 1780 von Erdbeben verwüstet; jedes forderte über 40.000 Todesopfer – zu einer Zeit, als sämtliche Städte nur einen Bruchteil ihrer heutigen Einwohnerzahl hatten. Falls beziehungsweise wenn ein weiteres großes Erdbeben diese Überschiebung erschüttert, könnten die Auswirkungen auf Teheran verheerend sein. Seit Jahrtausenden siedeln Menschen an solchen Überschiebungen, angelockt von den Wasserquellen, die sie hervorbringen, und den Handelsrouten, die entlang der Landschaftsgrenze verlaufen; die hier entstandenen modernen Großstädte sind aufgrund dieses geologischen Erbes heute besonders stark gefährdet.
Wir sind die Kinder der Plattentektonik. Einige der größten Städte der Welt liegen heute auf tektonischen Verwerfungen, und viele der ältesten Zivilisationen wurden an den Grenzen der Platten begründet, aus denen sich die Erdkruste zusammensetzt. Tektonische Prozesse in Ostafrika waren von entscheidender Bedeutung für die Evolution der Homininen und die Entstehung des besonders intelligenten und anpassungsfähigen Homo sapiens. Wenden wir uns jetzt jener besonderen Periode in der Geschichte unseres Planeten zu, in der der Mensch seinen Geburtsort im Großen Afrikanischen Grabenbruch verließ und sich schließlich die Erde untertan machte.
Kapitel 2Umtriebige Kontinente
Gegenwärtig leben wir in einem besonderen geologischen Zeitalter, das sich durch ein Leitmerkmal auszeichnet: Eis. Angesichts unserer gegenwärtigen Befürchtungen in Bezug auf die globale Erwärmung mag sich dies überraschend anhören. Dass die Durchschnittstemperaturen seit der Industriellen Revolution und insbesondere in den letzten sechzig Jahren angestiegen sind, ist eine unbestreitbare Tatsache. Dieser jüngste, menschengemachte Temperatursprung ereignet sich indes innerhalb des allgemeinen Zeitrahmens der langfristigen Vereisung im Quartär. Vor etwa 2,6 Millionen Jahren, zu Beginn der jüngsten geologischen Periode, bildete sich auf der Erde ein neues Klimaregime aus, das sich durch regelmäßig wiederkehrende Kaltzeiten auszeichnet. Diese klimatischen Bedingungen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Welt, in der wir heute leben, und darauf, wie wir es zur dominanten Spezies der Erde brachten.
Gegenwärtig leben wir in einer Zwischeneiszeit (Interglazial) mit relativ warmem Klima, geschrumpften Eiskappen und folglich höheren Meeresspiegeln. Doch im Durchschnitt der vergangenen 2,6 Millionen Jahre ist es auf der Erde viel kälter gewesen als heute. Aus Museumsausstellungen und Dokumentarfilmen haben wir vielleicht eine Vorstellung davon, wie die Erde in der letzten Kaltzeit aussah – eine Zeit, als sich mächtige Eisschilde über einen Großteil der Nordhalbkugel ausdehnten, Wollhaarmammuts durch die tundraähnliche Landschaft streiften, in der ihnen Säbelzahntiger auflauerten, und in Felle gekleidete altsteinzeitliche Menschen mit Steinspitzen-Speeren auf Jagd gingen.
So stellte sich nur die letzte Phase der Vereisung unserer jüngsten Erdgeschichte dar. In den vergangenen 2,6 Millionen Jahren gab es zwischen 40 und 50 Kaltzeiten, die im Lauf der Zeit immer länger und frostiger gerieten. Tatsächlich ist das Quartär eine außergewöhnlich instabile Zeitspanne in der Geschichte des Erdklimas, das zwischen bitterkalten Eiszeiten und wärmeren Zwischeneiszeiten pendelte, welche die periodische Ausdehnung und Schrumpfung der mächtigen Eisschilde antrieben. Die Frostperioden dauern im Schnitt 80.000 Jahre, die kürzeren Verschnaufpausen zwischen den Eiszeiten nur etwa 15.000 Jahre. Jede Zwischeneiszeit, wie etwa die gegenwärtige Holozän-Periode, in die wir vor 11.700 Jahren eintraten, ist nicht mehr als ein kurzes, warmes Zwischenspiel, ehe das Klima in eine weitere Frostperiode zurückfällt. Später werden wir erfahren, warum unser Planet in diese wechselhafte Klimaphase eingetreten ist, wollen uns zunächst jedoch die Verhältnisse in der letzten Kaltzeit näher anschauen.
Frostige Zeiten
Die letzte Kaltzeit begann vor etwa 117.000 Jahren und dauerte rund 100.000 Jahre, bis zum Beginn der gegenwärtigen Holozän-Warmzeit. Auf ihrem Höhepunkt, vor 25.000 bis 22.000 Jahren, stießen von Norden aus riesige, bis zu vier Kilometer dicke Eisschilde vor, die schließlich Nordeuropa und -amerika bedeckten. Ein weiterer, kleiner Eisschild dehnte sich über Sibirien aus, und große Gletscher breiteten sich von Gebirgen wie den Alpen, den Anden und dem Himalaja sowie den zerklüfteten Gebirgszügen, die das geologische »Rückgrat« Neuseelands bilden, in flachere Gebiete aus.
Diese ausgedehnten Eisschilde und Gletscher banden so große Mengen Wasser, dass die Meeresspiegel weltweit um bis zu 120 Meter sanken, wodurch die Festlandsockel an den Rändern der großen Landmassen weitflächig trockenfielen. Der Nordamerikanische, der Grönländische und der Skandinavische Eisschild breiteten sich bis an die Kante dieser Festlandsockel aus, während die umgebenden Meere wahrscheinlich von treibenden Eisschichten bedeckt waren.
Die Meere in der Nähe der Eisschilde waren nicht nur bitterkalt; weil weniger Wasser aus ihnen verdunstete, dürfte die Trockenheit weltweit stark zugenommen haben. Heulende Winde trieben heftige Staubstürme über trockene Ebenen. Die Landschaften Europas und Nordamerikas dürften überwiegend tundraähnlich gewesen sein, wobei der Untergrund das ganze Jahr hindurch gefroren war (Permafrost); weiter südlich erstreckten sich wahrscheinlich trockene Grassteppen, so weit das Auge reichte. Viele der heute in ganz Europa wachsenden Bäume überlebten nur in isolierten Refugien rings um das Mittelmeer. Vor 20.000 Jahren dürften die dichten Wälder und Waldlandschaften der Region, die wir heute Mitteleuropa nennen, ausgesehen haben wie das gegenwärtige Nordsibirien.
Die eiszeitliche Erde mit den größten kontinentalen Eisschilden und Meeresspiegeln, die 120 Meter tiefer lagen als heute
Am Ende jeder Eiszeit stiegen die Ozeane wieder an und überfluteten die Festlandsockel. Im zurückkehrenden zwischeneiszeitlichen Klima breiteten sich die Ökosysteme der Erde wieder langsam zu den Polen hin aus, wobei sie den sich verbessernden Bedingungen hinter den zurückweichenden Eisschilden folgten. Wanderungen sind in der Tierwelt weit verbreitet – Vögel fliegen zum Überwintern in den Süden, und große Gnuherden branden wie eine Sturmflut durch die Serengeti –, doch auch Wälder wandern. Selbstverständlich können einzelne Bäume sich nicht selbst entwurzeln und losziehen, aber in dem Maße, wie sich das Klima erwärmt, überleben Samen und Setzlinge jedes Jahr etwas weiter nördlich, weshalb der Wald dann im Lauf der Zeit tatsächlich marschiert (wie in der Prophezeiung der Hexen in Macbeth). Man schätzt, dass Baumarten in Europa und Asien nach der letzten Eiszeit mit durchschnittlich über 100 Metern pro Jahr nach Norden wanderten. Ihnen folgten Tiere – Pflanzenfresser und Raubtiere, die ihrerseits den Pflanzenfressern nachstellten. Wiederkehrende Kaltzeiten haben Pflanzen und Tiere dazu gezwungen, sich wie eine lebende Gezeitenströmung bald nach Norden, bald nach Süden zu bewegen.
Kaltzeiten sind von unterschiedlicher Intensität, und auch Warmzeiten sind nicht alle gleich. Die letzte Zwischeneiszeit, vor etwa 130.000 bis 115.000 Jahren, war im Allgemeinen wärmer als unsere gegenwärtige Zwischeneiszeit. Die Temperaturen lagen im Schnitt mindestens 2°C höher als heute, der Meeresspiegel lag etwa 5 Meter höher, und durch Europa stapfte die Sorte Tiere, die wir normalerweise mit Afrika assoziieren. Als Bauarbeiter Ende der 1950er Jahre am Trafalgar Square im Zentrum Londons Grabungsarbeiten durchführten, stießen sie auf die Überreste einer ganzen Reihe großer Säugetiere – Nashörner, Flusspferde und Elefanten sowie Löwen –, die alle aus dieser früheren Warmzeit stammen. Touristen, die heute im Schatten der Nelsonsäule stehen, schießen begeistert Selfies mit den bronzenen Löwenstatuen, die zu ihren Füßen Wache halten. Wie viele von ihnen wohl ahnen, dass sie sich in der letzten Warmzeit hier vor deren lebenden Vorbildern hätten vorsehen müssen?
Trotz dieser kurzen wärmeren Zeitabschnitte, die diesen Tieren eine Ausbreitung ermöglichten, ist das Quartär im Grunde eine lange Eiszeit; selbst während der Zwischeneiszeiten waren die Pole von dicken Eiskappen bedeckt. Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Vorgänge der jüngeren Erdgeschichte für dieses kalte, wechselhafte Klima verantwortlich sind. Das wiederkehrende Muster dieser Eiszeiten hat kosmische Ursachen: ein Umstand, der sich mit Veränderungen der Neigung der Erdachse im Verhältnis zur Sonne und in ihrer Umlaufbahn erklären lässt.
Himmlisches Uhrwerk
Wäre die Rotationsachse der Erde vollkommen senkrecht, gäbe es keine Jahreszeiten. Aufgrund der Neigung der Erdachse empfängt die Nordhalbkugel eine Hälfte des Jahres über mehr Wärme als die Südhalbkugel, weil sie sich der Sonne zuneigt – die hoch am Himmel erscheint, weil ihre Strahlen steiler auf die Erdoberfläche treffen –, was den Sommer hervorbringt. Sechs Monate später kehrt sich die Situation um: Auf der Nordhalbkugel bricht jetzt der Winter an, während auf der Südhalbkugel der Sommer Einzug hält. Die Erde umläuft die Sonne ferner nicht in einer vollkommenen Kreisbahn: Ihre Umlaufbahn ist leicht eiförmig zu einer Ellipse gedehnt. An einem Punkt in ihrem ein Jahr dauernden Umlauf ist die Erde der Sonne etwas näher, während sie sechs Monate später etwas sonnenferner steht.7