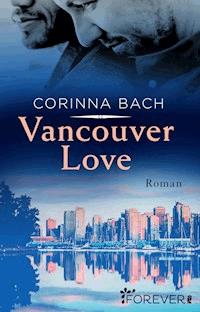
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die-Vancouver-Reihe
- Sprache: Deutsch
Peter und Jeremia sind frisch verliebt. Jedenfalls glaubt Jeremia das. Peter hingegen ist eher nur an kühlen Drinks und heißen Nächten interessiert. Schnell wird Jeremia klar, mit diesem Mann kann er nicht mehr zusammen sein. Es muss sich etwas ändern. Doch wie bald das Leben tatsächlich aus den Fugen geraten kann, erfahren die beiden schneller als geahnt, als Polizist Peter einer unglaublichen Tat bezichtigt wird. Beide müssen über ihren Schatten springen, um gemeinsam Peters Unschuld zu beweisen. Aber können sie auch für ihre Liebe kämpfen? Und kann diese Liebe die Wunden der Vergangenheit heilen? Von Corinna Bach sind bei Forever erschienen: Vancouver Hope Vancouver Love
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinCorinna Bach, geboren 1962, ist eines der Pseudonyme der Autorin Brunhilde Witthaut. Sie schreibt Krimis, historische Romane und Gay-Krimis, fand sich aber auch mit viel Schreibspaß ins Gay Romance-Genre ein. Sie veröffentlicht in diversen Verlagen. Mit ihrem Mann, dem letzten von drei Kindern sowie drei Hunden lebt sie ländlich in NRW und arbeitet in der Versicherungsbranche. Frankreich ist ihre zweite Heimat und viele ihrer Werke spielen dort. In ihrer Vancouver-Reihe jedoch agieren ihre Helden im fernen, faszinierenden Kanada.
Das Buch
Peter und Jeremia sind frisch verliebt. Jedenfalls glaubt Jeremia das. Peter hingegen ist eher nur an kühlen Drinks und heißen Nächten interessiert. Schnell wird Jeremia klar, mit diesem Mann kann er nicht mehr zusammen sein. Es muss sich etwas ändern. Doch wie bald das Leben tatsächlich aus den Fugen geraten kann, erfahren die beiden schneller als geahnt, als Polizist Peter einer unglaublichen Tat bezichtigt wird. Beide müssen über ihren Schatten springen, um gemeinsam Peters Unschuld zu beweisen. Aber können sie auch für ihre Liebe kämpfen? Und kann diese Liebe die Wunden der Vergangenheit heilen?
Von Corinna Bach sind bei Forever erschienen:
Vancouver HopeVancouver Love
Corinna Bach
Vancouver Love
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin April 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-109-0 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Kapitel 1
Jeremia rannte durch die Straßen von Downtown Vancouver. Der Asphalt brannte unter seinen Schuhen, es roch nach Teer und Abgasen. Immer wieder rempelte er Passanten an, doch er nahm ihre Proteste kaum wahr. Die Menschen sahen ihm nach, der gehetzten großen Gestalt mit dem wehenden schwarzen Haar. Egal, sein Geliebter war verletzt, das war ja wohl wichtiger.
»Eine Schussverletzung«, hatte die Frau in der Zentrale gesagt, nachdem er Peter telefonisch nicht hatte erreichen können. Vor lauter Entsetzen hatte er kaum den Namen des Krankenhauses im Gedächtnis behalten, das Vancouver General westlich des Stadtteils Mount Pleasant. Wenn Peter nun schwer verletzt war? Was sollte er denken, worauf sollte er hoffen? Mit aller Kraft wollte er zu ihm, sein Herz trieb ihn voran.
In letzter Sekunde hielt er an einer roten Ampel an, ruderte mit den Armen und wich vor einem Pick Up zurück, auf den er fast geprallt wäre. Mist, warum ging es denn nicht weiter? Er stand still, atemlos, verwirrt. Wie immer war es voll in den Häuserschluchten. Er wischte sich über die Stirn und sah zur Sonne hinauf. Die Ampel sprang auf grün. Sorge und Furcht trieben ihn weiter. Er lief um sein Leben. Denn Peter war sein Leben. Noch zwei Blocks, fünf hatte er bereits hinter sich. Noch einen Block, er sah einen Krankenwagen auf ein helles, großes Gebäude zu fahren. Hier war er richtig. Instinktiv hatte er sich auf seinen Orientierungssinn verlassen, obwohl er hier in der Großstadt war. Seit vier Wochen wohnte er in Mount Pleasant. Bei Peter Madison, dem gutaussehenden, blonden und jüngsten Detective des VPD, seinem Freund und Partner, der vielleicht mit dem Tod rang. Ein Schluchzer drückte sich durch seine Brust empor, alles in ihm zog sich zusammen.
Der Eingangsbereich, dann die glänzende Glastür. Er riss sie auf, stürzte hindurch. Der Verkehrslärm blieb zurück, hallende Schritte und dezente Musik waren zu hören. Alles ließ ihn völlig kalt. Seine Welt war im Ungleichgewicht, die Harmonie, die sonst durch sein Leben floss, war der puren Verzweiflung gewichen. Er konnte nicht glauben, dass er diese Gefühle empfand. Die Geister hatten ihm Coolness in die Wiege gelegt, und seine Freunde beneideten ihn um die Gelassenheit, die er ihnen immer gezeigt hatte. Doch nun hatte er Angst davor, seine Träume nicht ernst genommen zu haben. Peters Verletzung war eine Strafe für ihn selbst. Aber wofür? Dafür, dass er den Clan und die Familie verlassen hatte? Dafür, dass er an der Universität studierte?
Er strebte auf die Dame am Empfang zu, fühlte sein Herz rasen. Trotz des tiefen Atemzugs taten es ihm seine Worte nach: Sie sprudelten nur so aus ihm heraus.
»Bitte, Madam, mein Freund Peter Madison ist gerade mit einer Schussverletzung eingeliefert worden.«
Die Frau, die ihm einen halb misstrauischen, halb bewundernden Blick zuwarf, wies ihm den Weg zur Notaufnahme. Wie ein Roboter öffnete er Türen und lief lange Flure entlang. Grelles Licht brannte überall, trotz der Sonne. Der Krankenhausgeruch stieg ihm in die Nase, sodass ihm fast übel wurde. Die Hinweisschilder nahm er nur als verschwommene Umrisse wahr. Endlich gelangte er in einen Trakt, in dem Schwestern und Ärzte scheinbar ohne Plan und Verstand durcheinanderliefen. An einer Seite reihten sich Kabinen auf, die durch Vorhänge vor fremden Blicken geschützt waren. Hier musste er richtig sein. »Peter!«, rief er einfach und sah sich suchend um. Zwei Bankreihen waren voll besetzt mit wartenden Patienten. In einer der Kabinen schrie jemand laut auf. Peter hatte ihn gehört, oder? Er wollte gerade schon den Vorhang zur Seite schieben, als ihm eine Krankenschwester in den Weg trat und ihn missbilligend ansah.
»Sir?«
»Ich muss zu Detective Peter Madison, bitte.«
»Die Schussverletzung?«
Hastig nickte er und klammerte seinen Blick an ihr Gesicht.
»Warten Sie bitte.« Sie ging zum Tresen zurück. Was sollte das bedeuten? Wenn Peter nun tot war, würde sie es ihm sagen? Was, wenn sie jetzt den verantwortlichen Arzt herbei holte? Er schluckte und leckte sich über die Lippen. Ihm wurde ein wenig schwarz vor Augen, so dass er sich an der Wand abstützte. Peter, sein Peter, es durfte einfach nicht sein.
»Nummer sechs«, sagte sie, nachdem sie eine Liste auf dem Tresen eingesehen hatte. »Es geht ihm gut.«
Diese Nachricht warf ihn um. Erleichtert stöhnte er auf, er lehnte sich an die kühlen Fliesen. Die Krankenschwester lächelte und zeigte auf die Mitte der Kabinenreihe. Er ging darauf zu. Mit einem Ruck riss er den gummibeschichteten Stoff zur Seite und trat einen Schritt in die Nische.
Und da lag Peter. Er machte es sich auf einer schmalen Pritsche bequem, hatte einen Arm hinter den Kopf geklemmt und grinste ihn an.
Sein Oberkörper war nackt. An seinem Arm leuchtete ein Verband.
»Jeremia! Das ist aber nett, dass du mich besuchst.«
»Mensch, Peter!«
In die unglaubliche Freude mischte sich eine verhaltene Verärgerung. Da rannte er in Todesangst quer durch Vancouver, und sein Geliebter machte sich über ihn lustig.
»Peter, bin ich froh, dich zu sehen.« Sein Freund musste ihm seine Gefühle angesehen haben, denn er streckte ihm die Hand entgegen. »Komm her, Großer. Schön, dass du da bist. Es ist nur halb so schlimm.«
Jeremia umklammerte die Finger, als wollte er sie nie wieder loslassen. Peter zog ihn zu sich herunter. Die Nähe des geliebten Gesichtes, der lächelnde Mund, alles versetzte ihn in eine entspannende Trance. Er spürte Peters Lippen auf den seinen, er öffnete den Mund, wollte mehr von ihm als nur den kurzen süßen Geschmack. Peters Zunge war das Schönste, was er je gekostet hatte. Seine Hände wanderten um Peters Kopf, fuhren durch die kurzen hellen Haare, während ihre Zungen sich ausgiebig begrüßten. Er fühlte sich einfach wundervoll an. Sie waren einander so nah, doch dann drückte Peter ihm einen abschließenden Kuss auf die Lippen.
»Das habe ich jetzt gebraucht.«
»Du kannst mehr davon haben«, bot Jeremia sofort an.
»Nicht hier.« Peter atmete tief ein, das Heben und Senken der Brust brachte Jeremia zum Träumen.
»Wie hast du davon erfahren?«
Jeremia setzte sich auf einen kleinen Hocker neben die Pritsche, ließ aber Peters Hand nicht los. Sie war so warm und lebendig.
»Ich wollte dich anrufen. Die Frau in der Zentrale hat es mir gesagt, sie kennt mich ja. Oliver wollte mit uns ins West End. Er fühlt sich einsam, weil Ethan gerade auf einem Lehrgang ist.«
»Ist doch prima, gehen wir.«
»Mit einer Schusswunde? Du hast sie wohl nicht alle!« Jeremia tippte sich an die Stirn.
»Ich bin hier fertig, denke ich.« Peter richtete sich auf und sah sich nach seinem Hemd um. Es hing an einem Haken. Als Jeremia das Blut darauf sah, zuckte er zusammen. »Es ist der linke Arm«, murmelt er nachdenklich. Das Grauen packte ihn erneut. »Du hättest auch tot sein können.«
»Ist nur ein Streifschuss. Dieser blöde Idiot.« Peter winkte ab und stand etwas steif und unbeweglich auf, um das unbrauchbare Kleidungsstück kritisch zu begutachten. Jeremia legte ihm die Hand auf die Brust. Er musste seine Angst artikulieren, sonst brachte sie ihn um. Traum war Wirklichkeit, Wirklichkeit war Traum. Das hatte sein Großvater ihm beigebracht. »Warum tust du das? Ich habe so oft eine Scheißangst um dich.«
Peter lachte auf. »Du hörst dich an wie eine Ehefrau.« Er legte sich das Hemd lose um die Schulter.
»Im Ernst, Peter. Warum gehst du nicht in den Innendienst?«
Peter wollte gerade seine Geldbörse in die Hosentasche stecken, doch er hielt inne. Über sein Gesicht huschte ein verärgerter Ausdruck. »Jetzt bist du eine Ehefrau.« Unwirsch wandte er sich von Jeremia ab und winkte der Krankenschwester am Tresen zu.
Jeremia hob die Hände. »Okay, sorry, das war Blödsinn. Ich weiß, du willst das nicht.«
»Dann lass es auch.«
Ein Kloß setzte sich in Jeremias Hals fest, er starrte niedergeschlagen auf den Fußboden, der mit grauen PVC-Platten ausgelegt war. Gerade erschien ein Arzt und drückte Peter auf die Pritsche zurück, um ein letztes Mal den Blutdruck zu kontrollieren. Jeremia lehnte sich mit gekreuzten Armen an die Wand und wartete. Die Atmosphäre war angespannt, als lauerten überall kleinen Schatten. In seinen Träumen sah er immer wieder, wie Peter am Boden lag, umgeben von Rauch und Flammen, ein Szenario, das nicht ganz zu einem Schusswechsel passte. Und doch wäre das Ergebnis dieses Traumes fast Wirklichkeit geworden. Er wollte ihn warnen vor einer tödlichen Gefahr, doch Peter hielt seine Ansichten meist für überzogen und bestenfalls mystisch. Peter war klug und stark, er konnte auf sich aufpassen, prägte Jeremia sich immer wieder ein. Peter brauchte keine Träume, um sich gut zu fühlen, sondern schöpfte seine Zufriedenheit aus der Jagd. Leider nicht die Jagd nach Karibus und Elchen, das hätte Jeremia noch verstanden. Sondern nach Verbrechern, die bewaffnet waren.
Auch nachdem der Arzt sein Einverständnis zur Entlassung gegeben hatte und Jeremia seinem Freund zum Ausgang folgte, drückte die Missstimmung auf seine Seele. Draußen auf der Straße übernahm jedoch Jeremia die Initiative und winkte ein Taxi heran.
»Du musst dich ausruhen. Wir fahren heim, und West End heute Abend kannst du dir abschminken.«
»Jawohl, Mum«, gab Peter zurück. Jeremia hätte gern seine Sorgen erklärt, doch als Peter neben ihm kicherte, entspannte er sich wieder.
»Wie ist das denn passiert? Erzähl mir alles.«
Das ließ Peter sich nicht zweimal sagen. Das Taxi setzte sich in Bewegung. Haarklein berichtete Peter von der geplanten Verhaftung eines Hehlers in China Town. Leider war ein Kunde in dessen Haus anwesend, der beim Auftauchen der Beamten kalte Füße bekommen und die Waffe gezogen hatte. Nicht nur Jeremia, auch der Taxifahrer lauschte interessiert.
»Sir, da haben Sie aber Glück gehabt«, gab der Mann zum Besten und nickte.
»Was ist schon Glück?«, sagte Peter und seufzte.
»Das mit uns beiden ist Glück«, flüsterte Jeremia und schmiegte sich an ihn. Allmählich flutete wieder eine Welle der Zufriedenheit durch seinen Körper, der Misston war verklungen. Federleicht fühlte er sich. Peter strich ihm über das Haar, was ein erregendes Prickeln auslöste. Die Harmonie kehrte zurück, das Gefühl, dass alles um ihn herum wieder im Gleichgewicht war.
So fuhren sie weiter, wenn sie auch von einem Stau in den nächsten gerieten. Es bedurfte keiner Rush Hour, in der Innenstadt war es immer voll. Vancouver litt seit vielen Jahren unter quälenden Staus und wildem Gehupe. Die Infrastruktur der Stadt hatte mit dem Zuwachs an Bewohnern nicht mithalten können. Die Märzsonne stand schon im Westen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sie vor der Wohnungstür angekommen waren. Jeremia bezahlte den Fahrer und rechnete innerlich bereits aus, wie lange er Nudeln und Brot essen musste, um die Ausgabe wieder auszugleichen. Das Studium bezahlte Onkel Ben, doch seinen Unterhalt verdiente er selbst durch einige kleine Jobs.
Man sah Peter kaum an, dass er verletzt war, wäre der Verband nicht gewesen. Sie gingen die Treppe hinauf bis in den vierten Stock. Der Aufzug streikte mal wieder. Erst in der Wohnung fiel ihm auf, dass Peter keuchte und blass wie die Wand wurde.
»Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. War vielleicht doch alles etwas zu viel heute.«
»Peter, was ist denn?« Verdammt, dieser sture Hund hatte sich übernommen. Fürsorglich führte Jeremia ihn ins Schlafzimmer. Mit einem erleichterten Stöhnen ließ Peter sich auf das Bett fallen. Jeremia hatte kein Problem damit, den Pfleger zu spielen. Er zog ihn aus und deckte ihn mit der dünnen Wolldecke zu, obwohl stickige warme Luft den Raum erfüllte. Sofort stellte er das Fenster auf Kipp und drehte sich zu seinem Geliebten um. Peters Augen waren geschlossen. Draußen fuhr ein Lkw vorbei, er schloss das Fenster wieder und wippte dann auf den Zehenspitzen. Es war noch nicht mal 19 Uhr, aber der Abend war gelaufen. Er horchte, wartete, leckte sich über die Lippen.
»Danke, Großer. Kommst du zu mir?«, fragte Peter.
Gott sei Dank. Für einen beklemmenden Moment hatte Jeremia befürchtet, dass er in dieser Nacht auf dem Sofa übernachten musste. Doch jetzt durfte er sich behutsam an Peter schmiegen und seinen Herzschlag spüren. So würde er die Träume verhindern.
»Ja klar.«
»Vergiss die Kondome nicht«, hauchte Peter.
Jeremia schüttelte den Kopf und betrachtete das gleichmäßige Gesicht seines Freundes.
»Unverbesserlich. Nimmst du den Mund jetzt nicht etwas zu voll?«
Peter musterte ihn von oben bis unten und zog lasziv die Augenbrauen hoch. »Hm, ich nicht, aber vielleicht du.«
Mit einem lauten Lachen ließ Jeremia sich auf die Matratze fallen. Peter zuckte zusammen. »Au!«
***
Peter dachte nicht daran, sich wegen einer solchen Lappalie zurückzunehmen. Gut, er hatte ein wenig Fieber, aber das Antibiotikum würde schon noch anschlagen. Er war nicht geschwächt oder müde, nein, er war gut gelaunt. Seit zwei Tagen durfte er jetzt den Kranken geben. Jeremia fuhr voll auf seine pflegerischen Tätigkeiten ab, wobei die emotionale Betreuung einen immer größeren Anteil ausmachte. Peter grinste und schritt weiter aus. Er hatte Lust auf einen Drink in einem der Clubs oder Bars im West End, dem Mekka der schwulen Bewohner Vancouvers. Das »Gold Rush« kam in Sicht. Nein, dieses Etablissement passte nicht in sein Budget. Das »Mac Namara« zwei Blocks weiter war schon eher seine Preislage. Steve, der Lkw-Fahrer, würde da sein und lustige Geschichten erzählen. Vielleicht traf er auch auf Daniel, den großen Studenten, der mit Jeremia einen gemeinsamen Kurs belegte.
Jeremia – Peter seufzte lächelnd. Der Junge war einfach der Hammer. Ein Kerl wie ein Baum, dabei nicht grobschlächtig, sondern geschmeidig. Das Gesicht würde auf das Cover des GQ passen, gerade der Ausdruck des stolzen Natives machte ihn so schön und würdevoll. Dabei war Jeremia zurückhaltend, spöttisch und verbindlich zugleich, manchmal versonnen in seine Gedanken, die Peter hin und wieder nicht nachvollziehen konnte. Es tat Peter leid, ihm durch die verdammte Schießerei einen solchen Schreck eingejagt zu haben, aber an die tägliche Gefahr würden sie sich gemeinsam gewöhnen. Peter stutzte. Gewöhnung – wann trat sie ein? Wollte er das überhaupt? Vor der Bar angekommen, prüfte er den Inhalt der Geldbörse. Kreditkarte, Scheine, alles vorhanden. Es war 16 Uhr, die ersten Stammgäste würden schon da sein. Er trat durch die Glastür ein und gelangte in den Gastraum. Die Theke war verkleidet mit knorrigen Brettern, die Barhocker waren aus Holz und der Tresen aus glänzendem Zink. Alles ein wenig Old School, aber gemütlich. Hier und dort waren die Tische besetzt, Countrymusik erfüllte den Raum, als befände man sich in einer Truckerkneipe. Eine Gruppe junger Männer, die Peter vom Sehen kannte, winkte ihm zu. Mit großem Hallo wurde er begrüßt und sofort auf den Verband am Arm angesprochen. Daniel stand ebenfalls bei ihnen.
»Wo ist denn dein süßer Freund?«
»Er hat noch eine Vorlesung, dann kommt er«, gab Peter zurück und gab dem Barmann einen Wink. Ein kühles Bier würde jetzt gut passen. Die stickige Luft im Raum war nicht zum Aushalten. Seine Stirn war schweißbedeckt, als er sich über die Haut fuhr. Oder war es doch das Fieber?
»Schade, dass du ihn dir geschnappt hast. Er ist echt eine Sünde wert«, sinnierte Daniel und starrte in seine Cola. Die anderen jungen Männer nickten. Sofort fühlte Peter, wie der Stolz in seine Brust kroch. Man neidete ihm Jeremia, ein echt angenehmes Gefühl, das er jedes Mal genoss, wenn sie zusammen irgendwo auftauchten.
»Ihr lasst mal schön die Finger von ihm.« Das Bier lief süffig durch seine Kehle, im Nu fühlte er sich besser. »Das ist einzig und allein mein Kerl.«
»Ihr wohnt zusammen?«, fragte ein Mann, den er nicht kannte.
»Yepp.«
»Was Ernstes?« Dieser Typ kroch mit seinem Blick in Peters Kopf. Was wollte er von ihm? Ob etwas Ernstes oder nicht konnte dem doch egal sein. Unschlüssig zuckte er die Schultern und trank den nächsten Schluck.
»Wenn du ihn nicht mehr willst, also – hier gäbe es Bedarf an heißen Männern.« Daniel lachte auf und zwinkerte ihm zu.
Peter wurde etwas unbehaglich zumute. Er mochte Jeremia sehr und hatte nicht vor, ihn so schnell wieder abzuschießen. Aber etwas Ernstes? Immer wieder hallte die Frage des Fremden in seinem Kopf nach und entfachte eine Verwirrung, die er lange nicht mehr gespürt hatte. Ungute Erinnerungen, eine vertraute, verhasste Stimme meldete sich wieder. Schnell trank er das Bier leer und fragte in die Runde: »Was gibt es Neues?«
»Steve hatte einen Unfall, sein Laster ist schrott. Mit etwas Glück zahlt ihm die Versicherung einen neuen«, wusste Daniel zu berichten und erzählte, wie ein Trucker, der so wie Steve Schotter für den Bau einer Pipeline in die Wälder fuhr, ihm in die Seite gefahren war.
»Wo war denn das?«
»Da oben in Alberta, bei den Ölsand-Feldern.«
»Da freut er sich sicher über eine neue Karre.«
Sie fachsimpelten noch eine Weile über die Ölfirmen, die unentwegt neue Sandfelder erschlossen und dabei Milliarden scheffelten, Ölpreis hin oder her.
Die Tür öffnete sich. Im Gegenlicht tauchte ein großer Mann auf, dessen Silhouette Peter sofort erkannte.
»Jeremia!« Peter winkte ihn heran und bestellte sofort zwei weitere Bier.
»Hallo«, sagte Jeremia und lächelte schüchtern in die Runde. Daniel klopfte ihm auf die Schulter.
»Na, genug studiert heute?«
»Das Leben ist ein einziges Studium«, gab Jeremia zurück. Peter verdrehte die Augen. Wohl wieder eine indianische Weisheit. Die Gespräche nahmen ihren Fortgang. Mit Genugtuung bemerkte Peter, wie die Männer Jeremia immer wieder einen begehrlichen Blick schenkten. Demonstrativ küsste er Jeremia auf die Wange und hakte sich bei ihm ein. Sein glattes Haar war seit ihrer ersten Begegnung gewachsen, Jeremia hatte es in einem kleinen Knoten, der auf seinem Hinterkopf klebte, gebändigt. Das war gerade modern, doch bei Jeremia sah es einfach natürlich aus. Überhaupt sah Jeremia heute wieder super aus in der engen Jeans und dem Leinenhemd. Wieder ging die Tür und Oliver schneite herein, offensichtlich erfreut, die Sehnsucht nach Ethan ein wenig vergessen zu können. Sie umarmten sich brüderlich und setzten sich ein wenig von der Gruppe ab, um ungestört reden zu können.
»Wann kommt Ethan zurück?«
»Heute Nacht.« Olivers Augen funkelten und sein Grinsen wurde immer breiter. Er konnte es sicher kaum erwarten, seinen Freund in die Arme zu schließen. Peter seufzte unwillkürlich. Alles um ihn herum prangte in eitel Sonnenschein. Turteltäubchen, wohin das Auge auch blickte. Zufriedene Paare in der Shopping Mall, verliebte Blicke an den Stränden von Vancouver, Küsse und Händchenhalten waren an der Tagesordnung. Frühling in Vancouver eben. Warum fühlte er sich ausgeschlossen? Es war doch alles gut. Jeremia war der beste Liebhaber, den er sich wünschen konnte. Seine Verwirrung war Unsinn, eine Einbildung, das Fieber war schuld. Sein Leben war völlig in Ordnung.
»Wie geht es deinem Onkel Ben?«, fragte Jeremia an Oliver gewandt.
»Gut. Er ist mit dem Wohnmobil runter nach Kalifornien.«
Peter wusste, dass Ben Jeremia das Studium bezahlte. Der Holzfäller, der einen gut laufenden Betrieb führte, hatte Gefallen an Jeremia gefunden, der aus dem gleichen Nest inmitten der kalten Rockies stammte wie Ben selbst. Ben war Olivers Onkel, ein netter Kerl, so einer, wie Peter ihn gern zum Vater gehabt hätte. Seine Stimmung rutschte erneut ab. Seine eigene Familie war es nicht wert, sich ihrer zu erinnern. Warum hingen in den letzten zwei Tagen so düstere Gedanken in seiner Seele fest? Womit und wann hatte es angefangen? Schon vor sechs Wochen, als sie gemeinsam beschlossen hatten, dass Jeremia bei ihm einziehen würde? Es war ihm praktisch erschienen. Jeremia hatte das Studium in Edmonton abgebrochen und es in Vancouver fortsetzen wollen. Nun konnte er studieren und sich in Ruhe eine eigene Wohnung suchen. Oder hatte Peter da etwas falsch verstanden? Etwas Ernstes? Erneut erklang die Stimme von vorhin in seinem Kopf. Und dann hörte er Jeremias Stimme in seinen Erinnerungen: »Ich habe so oft eine Scheißangst um dich.«
Ehefrau! Unbehagen, Abwehr! Das war es, was seine Stimmungsschwankungen herbeigeführt hatte. Eine Ehefrau war etwas Ernstes. Nichts Lustiges, Heiteres, Unverfängliches. Ja, er hatte Angst davor, dass Jeremia den Status einer nervenden Ehefrau annahm. Sein lieber, verführerischer, schöner Jeremia. Das durfte er nicht zulassen. Es durfte einfach nichts Ernstes werden, denn damit wäre die Unbeschwertheit ihrer Beziehung gestorben. Diese Erkenntnis kam so plötzlich, dass er einen Fluch ausstieß. »Fucking son of a bitch!«
Als Jeremia und Oliver zusammenzuckten, kam Peter zu sich. »Oh, sorry, das war nur so dahingesagt.«
»Alles gut bei dir? Hast du Schmerzen?«
Jeremias mitfühlender Ausdruck war zu viel. Ehefrau, Ehefrau! Peter stellte das Bier ab und warf dem Barmann einen Schein auf den Tresen. »Nein, schon gut. Ich geh schon mal heim. Bis dann!«
Er winkte kurz zum Abschied und floh regelrecht aus der Bar. Mit Mühe verschloss er seine Ohren, als er Jeremias Ruf hörte: »Peter, was ist denn?«
Folgten ihm Schritte? Nein, zum Glück nicht. Hastig ging er die Straße entlang, in Richtung Wohnung. Die Sonne schien hell und kräftig. Die Wände strahlten die Wärme des Tages ab, in jedem Geschäft standen die Türen weit auf, sodass die wechselnde Musik als eine Kakophonie von Klängen auf ihn einhämmerte. Was war nur in ihn gefahren? In seiner Verwirrung hatte er sich unmöglich benommen und musste Jeremia gleich Rede und Antwort stehen. Musste er das? Er wischte sich über die Augen. Nein, er brauchte niemandem Rechenschaft über seine Gefühle zu geben, selbst Jeremia nicht. Ihm am allerwenigsten. In diesem Moment schien sein Herz zu zerreißen. Er stöhnte auf, trat gegen einen Mülleimer und ging weiter.
In seiner Wohnung angekommen, öffnete er das Fenster und genoss die einsetzende Kühle. Es war vielleicht nur das Fieber, das ihn zu diesen verrückten Gedanken trieb. Wenn er sich jetzt zu einem Nickerchen hinlegte, würde es ihm sicher bald wieder besser gehen. Das Schlafzimmer war halb abgedunkelt, das Laken empfing ihn mit einer glatten Kühle, die ihm gut tat. Nur ein bisschen die Augen schließen, nur ein bisschen raus aus diesem Gedankenlabyrinth.
Als er erwachte, spürte er warme Lippen an seinem Hals. Instinktiv stöhnte er auf und hob die Hand. Er roch den Duft und ertastete den Haarknoten.
»Hey.« Sie küssten sich, Jeremia streichelte seine Stirn, die Wangen, die Nase, dann griff er in sein Haar und löste den Knoten. Die dunkle Flut fiel bis in Peters Gesicht. Er wollte diesen Mann, das wusste er so deutlich wie nie zuvor. Behutsam zog er ihn an seine rechte Seite, denn die Wunde am linken Arm tat immer noch etwas weh. Jeremia bettete den Kopf an Peters Schulter und legte die Hand auf seine Brust.
»Geht es dir gut?« hörte er ihn flüstern.
»Mit dir geht es mir immer gut.« Das klang abgedroschen, war aber hier und jetzt genau das, was er fühlte. Draußen dämmerte es, der Schlaf hatte ihn erfrischt. Jeremias Atem kitzelte seine Haut, die Hand auf seiner Brust blieb natürlich nicht still liegen, sondern wanderte weiter zum Knopf der Jeans. Peter half ihm, die Hose zu öffnen. Sofort krabbelten Finger über seine Härte und umfassten sie. Wohlig ließ sich Peter in die warme, prickelnde Geborgenheit fallen. Stundenlang wollte er so da liegen und sich streicheln lassen. Nur nicht rühren, keine hastige Bewegung, sich ohne Worte fallenlassen in die liebgewonnene Erregung, die seinen ganzen Körper durchströmte. In ein dichtes Kissen aus duftenden Gänsefedern getaucht, so fühlte er sich. Er hörte nicht den Verkehrslärm, alles war gedämpft und mild. Er vernahm nur Jeremias gurrendes Stöhnen, fühlte, wie er das Becken an seine Hüfte drückte, und strich ihm über die Lippe, auch wenn er seinen Arm ja gar nicht bewegen wollte. Der Mund öffnete sich, ließ den Finger ein. Die warme Zunge, die süßen Lippen gaben ihm ein Vorgeschmack auf das, was unumgänglich war. Seine Lust stieg und verdrängte die wohlige Schlaffheit seiner Glieder. Er drehte sich auf die Seite und küsste die glatte kühle Haut des Geliebten, ohne den Finger aus Jeremias Mund zu ziehen, der jetzt auf Teufel komm raus saugte und zugleich den Druck auf Peters Glied verstärkte. Die zarte Wölbung der Brustmuskeln schmeckte so gut, Peters Zunge glitt über jede Pore und kam an der Brustwarze an. Als er leicht hinein biss, krallte sich Jeremia in sein Haar. Dann ging alles ganz schnell, als wäre plötzlich jede Vorsicht und Zartheit gewichen. Peter sah auf, Jeremia löste den Griff, zog ihn zu sich und küsste ihn atemlos. Ihr Zungenspiel beschleunigte sich, ihre Becken klebten aneinander. Sie stöhnten und keuchten, was pure Erregung in ihm auslöste. Er wollte mehr schmecken, mehr besitzen und nie mehr loslassen. Mit wenigen Handgriffen öffnete er Jeremias Jeans und rutschte zu seinem Unterleib. Das pralle Glied kam ihm bereits entgegen, denn Jeremia schob die Hüfte vor. Wie ein Verhungernder umschloss Peter die Erektion mit seinen Lippen und bemühte sich, nicht zuzubeißen. Seine Sinne waren auf den herben Geschmack ausgerichtet und auf den Duft nach Duschgel, den Jeremias Schamhaar verströmte. Sein Geliebter stieß ihm mit einem Aufschrei das Glied so fest in den Rachen, dass er beinah gewürgt hätte. Doch er wollte nicht loslassen, Jeremia gehörte ihm allein und er konnte ihn mit seinen Lippen beherrschen wie ein Instrument. Peter fühlte Jeremias Hand auf seiner Arschbacke und rückte ein wenig näher an ihn heran. Sein Geliebter wühlte sich bis zu Peters Geschlecht vor und keuchte vor Verlangen. Immer heftiger wurden die Bewegungen. Peter hatte die Augen längst geschlossen und ritt auf der Welle der Lust, die Jeremia ausgelöst hatte. Die Welt um ihn herum löste sich auf. Sein Geliebter schrie auf, dann schoss heiße Glut in Peters Mund und er löste sich von ihm, um mit der Hand das Werk zu vollenden, das seinen Geliebten in ein willenloses Geschöpf verwandelt hatte. Dann spürte auch er den Höhepunkt kommen und ergoss sich in Jeremias Hand.
Zwei Minuten später lagen sie eng umschlungen im Bett und fühlten sich einander so nah wie selten zuvor. Und doch spürte Peter, dass da etwas in seinen Gefühlen existierte, das nicht richtig war.
***
»Ich gehe zum Dienst.«
Jeremia sah von der Kaffeetasse auf. Erschrocken registrierte er, wie Peter sein etwas abgeschabtes Lieblingsjackett inspizierte, so, wie er es immer machte, wenn er aus dem Haus ging. Das war bereits ein Ritual: Polizeimarke polieren, Dienstwaffe kontrollieren und in den Holster stecken, Holster umschnallen, Jackett anziehen.
»Du bist verrückt. Ruh dich doch noch aus.«
»Ach, ich langweile mich ja zu Tode hier, wenn du gleich zur Vorlesung gehst.« Peter winkte ab. Jeremias Herz machte einen gewaltigen Satz. Peter sprach ein Wort aus, das er nicht aussprechen durfte. Es war tabu, er durfte nicht vom Tod sprechen, sonst würde er ihn herbei beschwören. So wie sein Onkel Abe, der ständig etwas vom Schwimmen lernen gefaselt hatte und dann während einer Überschwemmung des Kispiox River ertrunken war. Wenn man viel von einer Sache redete, konnten sich die Geister genötigt fühlen, Schabernack mit einem zu spielen.
»Sag das nicht, bitte!« Jeremia sah seinen Geliebten ernst an, doch Peter lachte nur.
»Jetzt hör mal auf mit deinem Aberglauben, Jeremia. Mir passiert nichts. Weil ich nämlich in den Innendienst gehe, bis ich wieder richtig fit bin.«
Jeremia atmete auf.
»Zufrieden?«, schmunzelte Peter und nahm – wieder ein Ritual – seine Geldbörse zur Hand, um den Inhalt zu prüfen.
»Du bist der Beste.« Jeremia stand auf, um Abschied zu nehmen. Sie umarmten sich, Peter küsste ihn auf die Lippen und steckte die Börse in die Hosentasche.
»Ich warte auf dich«, sagte Jeremia und versuchte, den Duft von Peters Aftershave festzuhalten. Er hielt Peter noch immer fest. Plötzlich spürte er, wie sein Freund sich ein wenig steif machte.
»Äh, Jeremia, hör mal, du musst nicht auf mich warten. Du kannst tun und lassen, was du willst.«
Warum sagte Peter das? Jeremia tat doch meistens, was er wollte. Er schwieg, überrascht von diesen Worten.
»Also, wenn du Termine für Wohnungsbesichtigungen hast, kein Problem. Ich bin jetzt nicht der Typ, der abends eine warme Mahlzeit erwartet«, erklärte Peter.
»Aber ich koche doch, weil es mir Spaß macht.« Jeremia schüttelte den Kopf. »Und Termine habe ich gerade nicht. Ich dachte …«
Er biss sich auf die Lippe. Sie hatten nie darüber gesprochen, wie lange er hier wohnen durfte. Es war eher ein Instinkt, der ihm befahl, entspannt zu grinsen. »Gut, dann kochst du heute Abend. Und wenn ich eine Wohnung gefunden habe, laden wir uns gegenseitig zum Essen ein.«
Peters Augen blitzten plötzlich auf, in einer Mischung aus Betroffenheit und Erleichterung, so kam es Jeremia vor.
»Deal!« Peter hielt die Fingerknöchel hin, Jeremia stieß die seinen davor. »Bis dann, Jeremia.«
Ein letzter kurzer Kuss, der irgendwie eine Versöhnung signalisierte, dann schloss sich die Wohnungstür. Peter pfiff eine Melodie, als er die Treppe hinunter ging. Doch ein dicker Kloß setzte sich in Jeremias Hals fest. Es war klar: Peter erwartete, dass er sich eine eigene Wohnung suchte.
Er schluckte und setzte sich an den Tresen, wo sie beide gefrühstückt hatten. Die offene Küche war in warmen Holzfarben gehalten und strahlte eine Natürlichkeit aus, die Jeremia immer wieder beeindruckte. Peter hatte große Topfblumen in den Ecken des Salons stehen. Auf dem kleinen Balkon blühte gerade ein üppiger Kaktus. Andere Sukkulenten prangten in hübschen Keramiktöpfen, und in einem Kübel stand sogar eine kleinwüchsige Waldkiefer. Wenn Jeremia die Augen schloss, konnte er sich sogar einbilden, das Plätschern des Wassers stamme von den Klippen des Kispiox und nicht von dem neuen Zimmerbrunnen, der sich dezent in die Einrichtung einfügte. Er fühlte sich wohl hier. Es war, als hätte sich die Natur seiner Heimat in dieser Wohnung manifestiert. Als hätte er einen Seelenverwandten getroffen.
Jeremia lächelte und versank in Erinnerungen. »Wow«, hatte Peter ausgestoßen, als sie sich zum ersten Mal gesehen hatten. Jeremia wusste, dass er gut aussah und eine gewisse Ausstrahlung auf Männer hatte. Doch dieses Wow hatte ihn spüren lassen, dass da etwas Grundlegendes geschehen war. Sie hatten innerhalb von drei Minuten ein Date klargemacht und waren am gleichen Tag noch im Bett übereinander hergefallen. Gut, das kam auch bei anderen Männern vor, doch tief in Jeremias Inneren hatte etwas zufrieden geseufzt und sich wohlig geschüttelt. Die Geister meinten es gut mit ihm, das hatte er immer gedacht. Er war so zufrieden gewesen und hatte sich glücklich gefühlt, nein, er hatte sogar hin und wieder mit Peter über seine Gefühle gesprochen. Logisch, dass die Geister da auf ihn selbst aufmerksam geworden waren. Was planten sie noch außer dem Senden von bösen Träumen?
Jeremia stand auf und ging zur Balkontür, um auf die Straße zu sehen. Dieses Haus war eines der wenigen mehrstöckigen Gebäude an der südlichen Main Street und den umliegenden Stadtvierteln. Er konnte spielend über Hunderte von Hausdächern hinweg sehen. Jeremia wusste die Annehmlichkeiten des Stadtlebens durchaus zu würdigen. Kinos, Clubs, Theater, das Studium, interessante Ausstellungen und viele Freizeitangebote – mehr ging nicht. Doch er vergaß nie seine Herkunft. Er war einer der First Nations. Ihnen gehörte der Boden, auf dem Vancouver gebaut worden war. Die Weißen hatten sich alles genommen, was ihren Clans und Stämmen gehört hatte. Sie hatten die Kultstätten zerstört und überbaut, ihr Land überbaut, ihnen vorgeworfen, dass sie rückständig und abergläubisch seien. Sie hatten den Natives den Sinn des Lebens gestohlen.
Jeremia versuchte stets, das Gleichgewicht zwischen seiner Herkunft und dem neuen Leben zu halten. Er durfte sich nicht verlieren, das Pendel durfte nie zu weit zu einer Seite ausschlagen. Manchmal klappte es und er spürte, dass die Geister ihm gewogen waren. Manchmal klappte es nicht und er fühlte sich alleingelassen und einsam in einer fremden Welt.
Der Himmel war so nah. Nicht weit entfernt ragte ein Kirchturm auf. Götter, Geister – sie nahmen einen wichtigen Platz ein in seinem Denken. Peter machte sich manchmal darüber lustig. Er war sämtlichen Göttern gegenüber respektlos, das hatte Jeremia schon gemerkt. Was fehlte ihm nur, dass er niemals die Mitte fand? Peter lebte in vollen Zügen. Er lebte ganz und gar, nahm alles mit, was er kriegen konnte. Sex, Freunde, Spaß, seine Arbeit, die ihn zu beflügeln schien. Nie ruhte er aus. Er war nicht einmal imstande, eine längere TV-Dokumentation zu verfolgen. Immer wieder zappte er sich durch die Kanäle, dann stand er auf und zog ihn mit sich, um in eine der Eckkneipen zu gehen. Peter schien den Duft der Nacht zu lieben, den Geruch der Straße und des Betons. Arm in Arm zusammen auf der Sonnenliege ruhen und die Sterne betrachten – das ging nicht, eine innere Unruhe blieb. Irgendetwas fehlte ihm, das spürte Jeremia ganz genau. Es war nicht gut, das Gleichgewicht zwischen Mensch und Geist zu ignorieren, und schon gar nicht, es zu verletzen. Diese Schussverletzung war vielleicht ein Omen gewesen. Wenn Peter weiterhin darüber lachte, würden sich die Geister rächen. Was sollte er tun? Er konnte Peter doch nicht alleine lassen, wenn die Geister ihn auf dem Kieker hatten. Der Kampf war ungleich, er musste ihm helfen. Da konnte er ihn doch nicht verlassen und sich eine andere Wohnung suchen.
Er ging zum Tresen zurück. Ein wenig unschlüssig nahm er die Vancouver Sun von gestern zur Hand und schlug die Kleinanzeigen auf. Eine Wohnung in dieser Stadt – wie sollte er das bezahlen? Wie er es auch drehte und wendete, er konnte nicht innerhalb eines Monats ausziehen, so wie Peter es sich offenbar wünschte. Er legte die Zeitung zur Seite und seufzte. War Peter seiner schon nach so kurzer Zeit überdrüssig geworden? Genau zu dem Zeitpunkt, an dem Jeremia begonnen hatte, ihn wirklich zu lieben. Eine solche Angst, wie er sie im Krankenhaus empfunden hatte, wollte er nie wieder spüren. Diese Sache hatte ihm die Augen geöffnet. Peter war sein Leben geworden, er wollte ihn nicht verlassen. Vielleicht gelang es Jeremia, ganz behutsam das Gleichgewicht zwischen Peter und den Geistern auszutarieren. Dann würde er sich wohler fühlen und Jeremias Liebe akzeptieren. Eine Wohnung suchen? Keine Chance, Peter Madison, dachte Jeremia und holte konzentriert Luft. Nur eine kurze Trance, nur ein wenig Ruhe finden. Verdammt, er würde zu spät zur Vorlesung kommen. Er schloss die Augen und nach wenigen Atemzügen tauchte er tief in sein Inneres hinab.
***
Peter nahm den Bus, der ihn wie so oft von der Main Street zur Boundary Road bringen würde. Er fand sogar noch einen Sitzplatz. Dieser Morgen, der ihn draußen mit einer überraschend kühlen Windböe überrascht hatte, stimmte ihn zufrieden. Ob die Frühlingswärme nun ein paar Tage pausierte und einem frischen Westwind Platz machte? Er fühlte sich besser, wenn er nicht ständig schwitzte. Der Bus nahm seine Fahrt auf.
Endlich sah er seine Kollegen wieder und konnte ein paar Schwätzchen halten. Hoffentlich war der Murray-Fall noch nicht gelöst. Er hatte sich als so kniffelig herausgestellt, dass Peter höchstpersönlich für die Überführung des mordenden Betrügers sorgen wollte. In der Abteilung für Kapitalverbrechen gab es genügend zu tun. Nicht alle Fälle waren eine Herausforderung. Manchmal konnte man nur staunen, wie dumm sich Täter anstellten. Doch hin und wieder biss man sich beinahe die Zähne aus. Peter liebte und hasste diese Fälle gleichermaßen. Er hasste es, wenn Verdächtige schlauer waren als er, und er liebte es, ihnen letztendlich doch erfolgreich etwas entgegensetzen zu können.
Der Bus bremste an der gefühlten zehnten Haltestelle, fuhr wieder an, weiter über die Busspur, die es ihm ermöglichte, ungeschoren an den meisten Staus vorbei zu gelangen.
Jeremia suchte tatsächlich nach einer Wohnung. Es gefiel Peter, dass er sich nicht als Klette entpuppte, die sich bei ihm festsetzte. Peter war trotz all der Leidenschaft und Sympathie, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte, froh, dass er keine feste Beziehung eingehen würde. Er konnte es einfach nicht. Er hatte in den letzten Tagen intensiv darüber nachgedacht. Nur mit Mühe hatte er hinnehmen können, dass Jeremia sich Sorgen um ihn gemacht hatte. Das war lieb von ihm, aber Peter war allein stark genug. Er brauchte keine guten Ratschläge und keine ängstlichen Blicke des Partners. Wo blieb denn sein Stolz als schwuler Single? Er hatte Jeremia verdammt gern, aber jeder Gedanke an eine weitergehende Beziehung wurde von Tag zu Tag mehr zu einer Belastung. Beziehung, was war schon eine Beziehung? Jeder Dummkopf hatte eine Beziehung. Sie konnten sich trotzdem treffen, Sex und Spaß haben. Sich mögen und vertrauen, das ging doch auch ohne Beziehung. Als er vor sich hin nickte, sah ihn sein Sitznachbar verwundert an. Doch da hielt der Bus schon an seiner Haltestelle, die Werbetafel eines Autohauses leuchtete in der Sonne. Er stieg aus und ging die Gravely Street entlang. Das hohe Gebäude mit der blauen Glasfassade erhob sich nicht weit entfernt. Der Alltag konnte beginnen.
Tina in der Zentrale winkte ihm zu, die Kollegen sprachen ihn auf seine Verletzung an und hielten ihn immer wieder auf. Endlich in seinem Büro angekommen, empfing ihn sein Partner Jack mit großem Hallo. Sein Deputy Chief Cooper, der ihn hin und wieder seine Vorurteile spüren ließ, nickte ihm nur gleichgültig zu. Peter ließ sich seufzend in den Bürostuhl fallen, dessen Sitzfläche schon eine gerissene Naht aufwies. Die unfreiwillige Pause hatte ihn verdammt genervt. Es war schön, wieder hier zu sein, in dem Büro mit den grauen Wänden, den dreckigen Fenstern und dem grellen Neonlicht. Telefone klingelten, Drucker ratterten, Zeugen saßen zur Befragung an den Tischen. Ja, er freute sich umso mehr, denn er hatte gehört, dass der Murray-Fall noch nicht abgeschlossen war.
Er würde ihn abschließen, in kurzer Zeit. Nicht so wie der Fall David Jefferson, Olivers Freund, dessen Mörder er erst nach einem Jahr und nur mit Hilfe seiner Freunde hatten stellen können.
Der Tag verging wie im Flug. Um 18 Uhr machte er Feierabend, kehrte heim, kochte für sich und Jeremia. Als es 22 Uhr war, stand er mit Jeremia auf der glitzernden Tanzfläche eines Schwulenclubs und tanzte eng umschlungen mit ihm. Er wusste, dass fast jeder anwesende Mann den Blick auf sie gerichtet hatte. Auf ihn und seinen Jeremia. Was für ein schöner Tag.
***
»Was ist denn los?« Peter hielt ihn am Arm fest, doch Jeremia wollte nur noch weg aus diesem Club.
»Was los ist?«, fauchte er zurück. Es reichte ihm. »Hast du mich jetzt genug herumgezeigt und vorgestellt? Was soll das eigentlich? Willst du mich als Strichjungen an den Mann bringen?«
Jeremia machte sich los und ging den spärlich beleuchteten Flur entlang, der zum Hinterausgang führte. Am Haupteingang war es brechend voll, daher mied er diesen Weg hinaus. Nur keine Menschen mehr sehen, keine neugierigen oder verlangenden Blicke, die an seinem Körper klebten, kein laszives Grinsen mehr.
»Was meinst du damit?« Peter riss ihm fast den Arm aus, als er ihn zurück hielt. Jeremia blieb stehen. »Na, du gibst mit mir an. Sag mir nicht, dass du das ohne Absicht machst.«
»Aber darf ich das denn nicht?«
Da stieß er Peter zurück und rammte ihn an die Wand. Es tat ihm gut, ihn unter Kontrolle zu haben. Peters verständnisloser Blick überzeugte ihn einmal mehr davon, dass er gar nicht wusste, was er tat. Nein, Peter war nicht mit sich selbst im Gleichgewicht. Und Jeremia hatte seine Coolness vergessen, ja, er war stinksauer, weil Peter wie ein Glücksschweinchen grinste, sobald ihm jemand bestätigte, wie toll sein neuer Freund sei.
»Reicht dir meine Zuneigung nicht? Brauchst du die Bestätigung der anderen, um dich glücklich zu fühlen? Dann tust du mir leid.«
»Jetzt komm mir nicht mit deinem esoterischen Zeug.« Peter zappelte unter seinem Griff, doch dann schien er sich ganz wohlzufühlen in Jeremias Umklammerung. Die Luft war stickig und warm, Lichtblitze drangen aus dem Clubraum in den Flur hinein, sodass ihm Peters lüsterner Blick nicht entging. Peter schob die Zungenspitze ein wenig hervor und sah ihn abwartend an. Wenn er jetzt dachte, Jeremia würde ihn küssen, dann hatte er – richtig getippt. Die Triebe meldeten sich heftig zu Wort, ja, sie lachten über Jeremias Empörung. Es war das Bier, Alkohol machte ihn verrückt. Er drückte sich an Peters Körper, umfasste sein Gesicht und küsste ihn tief und fest. Peter schnaufte verlangend und entspannte seinen Körper. In der gleichen Sekunde tauchten sie wieder ein in die die altbekannte, wundervolle Leidenschaft, die jeder von ihnen in gleicher Stärke und Spannung zu spüren schien. Innerhalb ihrer Lust waren sie eins, unzertrennlich, verschmolzen und von einander abhängig. Sie schnappten kurz nach Luft, dann küssten sie sich wieder. Die Umgebung existierte nicht mehr, sie hatten nur noch sich.
Plötzlich spürte er einen Stoß in den Rücken. »Sorry«, murmelte jemand, der sie in dem engen Schlauch angerempelt hatte. Ein Hauch von Alkohol waberte vorbei, der Typ war besoffen.
»Hey, Großer«, hauchte Peter verlangend, doch der Zauber war gebrochen.
»Nein«, sagte Jeremia und löste sich von ihm. »Sag mir erst, was in dich gefahren ist.«
Peter stellte sich aufrecht hin und rückte seine Kleidung zurecht. »Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Dein seliges Gesicht, wenn die anderen uns sehen. Du stellst dich an wie ein Promi, der seine junge Geliebte ausführt. Mit mir protzen, das tust du. Und das finde ich ziemlich abtörnend.«
»Das habe ich aber gerade nicht gemerkt«, gab Peter zurück und griff ihm sanft in den Schritt.
»Finger weg! Ich habe auch meinen Stolz.« Er schlug ihm auf die Hand, doch Peter ergriff sie und zog ihn mit einem groben Ruck wieder nah an sich heran. Ein verärgerter Blick durchdrang Jeremia.
»Hör zu, wenn du so eine Pussy bist, dann brauchst du nicht mehr mitzugehen. Klar?« Mit diesen Worten schüttelte Peter ihn durch. Jeremias Herz raste durch seine Brust. Was Peter hier abzog, war reinste Schikane. Aus heiterem Himmel. Doch er sollte bekommen, was er forderte.
»Klar!«, gab er zischend zurück und riss sich von ihm los. »Schönen Abend noch.«
Er wandte sich ab. Mit großen Schritten ging er den Flur entlang. Die Tür war nur diffus beleuchtet. Er stieß sie auf und stand auf der Straße. Immer noch atmete er so heftig, als wäre er gelaufen. Dieser Mistkerl! Was war nur mit ihm los? Jeremia schüttelte den Kopf, auch, um seine Tränen zu unterdrücken. Tränen der Wut, Tränen des Schmerzes, der ihn durchdrang. Er ging die Straße entlang, hielt wieder an, um zu lauschen. Nein, keine Schritte hinter ihm. Er war allein. Die Frage, was sein nächstes Ziel war, kam hart und unerbittlich auf ihn zu. In Peter Wohnung zu gehen verbot ihm sein Stolz. Die Option, dort seine Sachen zu packen und ein paar Tage bei Zac, Ethans Bruder, zu schlafen, war nicht die schlechteste. Er hatte sich immer gut mit Zac verstanden, sie trafen sich gelegentlich. Diese Möglichkeit erleichterte ihn. Peter, dieser Idiot, der geliebte, wunderschöne Blödmann. Er seufzte tief und trottete an den Gebäuden entlang. Es roch nach Frühling und guter Laune, überall erklang Musik, fröhliche Paare zogen vorbei. Nicht weit entfernt glitzerten die Bürotürme von Downtown. Umso einsamer fühlte er sich. Hatte er Peter verloren? War er wirklich eine Pussy? Nein, das war es nicht. Sein Stolz war es, der Stolz eines Natives, der keinen Bock darauf hatte, wieder einmal ausgebeutet zu werden, auf eine voyeuristische Art und Weise. Ein Bus fuhr an ihm vorbei – Mist, den hätte er jetzt nehmen können, doch er war gedankenverloren an der Haltestelle vorbei gegangen.
Da hörte er plötzlich rennende Schritte. Er hielt inne. War das Peter? Nein, nicht umdrehen, das sah blöd aus. Langsam ging er weiter. Ein Park kam in Sicht, er wusste jetzt gar nicht, wo er sich genau befand. Er lauschte, hörte heftiges Atmen.
»Warte doch!«
Ein Stein fiel ihm vom Herzen, als er die wohlbekannte Stimme hörte. Er hielt inne, drehte sich aber nicht um. Peter schloss zu ihm auf, und mit einem Mal spürte Jeremia zwei Arme, die sich um seine Taille schlangen. Ein Kuss in den Nacken, dann riss Peter ihn herum und drückte ihn an sich.
»Jeremia, oh Gott, es tut mir so leid. Verzeih mir. Ich habe das nicht böse gemeint. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Es war wundervoll, diese Worte direkt an seinem Ohr zu hören und den warmen Körper zu spüren. Peters Brust hob und senkte sich, Lippen suchten sich ihren Weg von seinem Ohrläppchen den Kiefer entlang bis zum Mund. Ein Kribbeln lief durch seinen Körper. Stürmisch küsste Peter ihn auf die Lippen und umfasste mit einer Hand Jeremias Kinn. Dann sah sein Geliebter ihn an. Jeremia erschrak über den fast panischen Ausdruck auf seinem Gesicht. »Peter, es ist alles gut, keine Angst.«
»Bist du mir sehr böse?«
»Ja, ein wenig.«
»Oh Jeremia, ich bin ein Idiot. Ich habe nicht an deine Gefühle gedacht. Kannst du mir verzeihen?«
Sollte er es ihm so einfach machen? Tief in seinem Inneren war Jeremia immer noch traurig über die schmähliche Behandlung. Er war doch kein exotisches Tier. »Naja, ich fing schon an zu glauben, es sei bei Schwulen gerade hip, sich einen Native zu halten.«
»Unsinn. Jeder will dich haben, aber du bist bei mir. Und wir beide als Paar, du, so dunkel und geheimnisvoll, ich, der blonde Hüne, darauf sind die anderen abgefahren, einfach so. Auf uns war ich stolz, verstehst du?«
Ob Peters Erklärung so ganz und gar der Wahrheit entsprach, wollte Jeremia jetzt nicht prüfen. Er war froh, dass der Streit beigelegt und das Gleichgewicht wieder hergestellt worden war.
»Ja, kapiere ich gerade noch. Es ist gut, Peter.«
»Oh Mann, hatte ich Angst …«, murmelte sein Geliebter und umklammerte seinen Kopf, um da weiterzumachen, wo sie vorhin unterbrochen worden waren. Sie küssten sich. Jeremia spürte die Vehemenz, mit der Peter ihn umwarb, er spürte die Dringlichkeit seines Kusses, die ihn aufhorchen ließ. Was fehlte Peter nur, dass er von einem Extrem ins andere schwang? Er gab den Kuss behutsam zurück, eine seltsame Scheu hatte ihn erfasst. Er kannte diesen Mann gar nicht so richtig, das war ihm jetzt klar geworden. Er kannte seinen Körper, seine Launen, sein Lächeln und jetzt auch seine Schärfe. Doch er wusste nichts über seine Vergangenheit, nichts über seine Absichten oder Zukunftspläne. Peter war nicht komplett. Der Mann ohne Unterleib, wie er früher auf Jahrmärkten gezeigt wurde – dieses Bild schoss in seinen Kopf. Er musste wider Willen grinsen.
»Was hast du?«, flüsterte Peter und sah ihn verwundert an.
»Ach, nichts, du verdammter Idiot. Küss mich.«
Was Peter sofort tat. Es tröstete ihn und verwischte den flüchtigen Gedanken daran, dass er einen Fremden liebte.
***
Es wurde immer schlimmer. Peter fühlte sich zerrissen wie nie zuvor. Sobald er in der Wohnung war, musste er wieder raus. Weg aus diesen vier Wänden, die ihn einsperrten, weg aus der Enge seiner Gedanken, weg von Jeremia, den er doch so sehr brauchte. Es war total verrückt. Vor zwei Stunden hatte er sich gefürchtet, am nächsten Tag ohne seinen Freund aufzuwachen. Und jetzt stand er auf dem Balkon und rauchte mal wieder eine Zigarette, was er nur tat, wenn er sich überfordert fühlte. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er mit diesem Kerl umgehen sollte, der jetzt so arglos auf seiner Seite des Bettes lag, nackt und durchgevögelt. War Sex alles, was sie noch zusammenhielt? Er konnte nicht mit ihm leben und nicht ohne ihn. Peter setzte sich auf den Klappstuhl und lauschte dem nächtlichen Verkehr. Die Luft war kühl, aber nicht kalt. Wenn er nach Norden sah, konnte er die Linien der Berge im mondhellen Nachthimmel sehen. Diese Stadt war wunderschön. Seine Freunde waren treue, verlässliche Menschen. Die Arbeit machte ihm immer noch Spaß, was nach fünf Dienstjahren nicht selbstverständlich war. Nur in der Liebe hatte es nie geklappt. Es war mehr als offensichtlich, dass er eine Beziehungsphobie mit sich herum schleppte.
Er stieß den Rauch der Zigarette aus. Die weißen Schleier kräuselten sich in der Luft und stiegen empor. Die Sterne leuchteten, doch die Schönheit der Nacht tröstete ihn nicht. Unten auf der Straße war ein Grölen zu hören, tiefe Stimmen von betrunkenen Männern, die wohl nicht mehr jung waren.
Jeremia musste bald eine Wohnung finden und ausziehen, sonst würden sie trotz der Enge einander noch fremder, als sie es schon waren. Jeremia war richtig böse geworden. Das war so unerwartet gewesen, dass ihm immer noch ein Schauder über den Rücken lief. Jeremia war beleidigt gewesen und hatte ihn verlassen, war einfach gegangen. In dem Moment hätte er kotzen können vor Angst. Verschwunden war das Hochgefühl, das ihn in den Clubs immer ergriff. Hartnäckig hatte er gewartet auf das Gefühl, dass ihm der Streit nichts ausmachte. Jeder stritt sich mal, das war doch nicht schlimm. Doch vergebens – je länger Jeremia fort war, umso kälter wurde es in seinem Herzen. Also hatte er seiner Furcht nachgegeben. Sie hatten sich versöhnt, durch Küsse, durch einen langen Spaziergang Arm in Arm nach Hause, durch wundervollen Sex, der ihn jedes Mal umwarf. Aber es war anders gewesen als sonst. Immer wieder – außer beim Sex – hatte Jeremia ihn forschend angesehen, als wolle er ihn studieren. Wahrscheinlich war das eine Retourkutsche für sein Protzen vor den anderen. Peter sollte sich wohl ebenso unwohl fühlen wie Jeremia im Club. Da konnte er aber lange warten.
Die Stimmen der Betrunkenen wurden lauter. Fast hätte man glauben können, dass Peters Vater da unten vor sich hin brabbelte. Peter stand auf und ging zur Brüstung des kleinen Balkons. Konnte das wirklich sein? Er warf einen Blick hinunter, kniff die Augen zusammen. Sein Vater? Nein, bitte nicht! Doch es war zu spät!
»Haha, da oben steht er ja, mein Herr Sohn.« Eine Stimme voll Hass und Abscheu – kein Zweifel, das war er. Hastig trat Peter einen Schritt zurück und floh in den Schutz der Blumen.
»Ja, lauf ruhig weg, das kenn ich ja schon. Du Schwuchtel!« Gelächter hallte herauf. Peter brach der Schweiß aus.
»Du Versager!«
Wenn er vor etwas Angst hatte, dann vor dieser Stimme. Ohne es zu bemerken, war er zurückgewichen und spürte jetzt die Wand im Rücken. Noch einmal brandete Gelächter auf, dann versickerte es im Lärm des Verkehrs. Sein Puls war hochgeschnellt auf Marathon-Modus. Er rutschte an der Wand hinunter, hockte sich auf den Boden und barg den Kopf in den Armen. Einatmen, ausatmen, ganz langsam. Er kann dir nichts tun, nie wieder wird er dir etwas tun, dachte er beschwörend. Sein Dad war der Versager, nicht er selbst. Er hatte die Familie im Stich gelassen, als Peter sich mit 16 Jahren geoutet hatte. Peter hatte gedacht, dass er stark genug wäre für das Drama, das auf seine Mitteilung hin eintreten würde. Doch er war im Krankenhaus gelandet, mit zwei gebrochenen Rippen und Prellungen am ganzen Körper.
Ein Druck setzte sich in seiner Brust fest und verwehrte ihm das Atmen. Seine Nerven vibrierten, ihm schwindelte, doch es kam keine Luft in seine Lungen. Den Mund geöffnet, hockte er da und spürte, wie ihm Tränen über die Wangen liefen. Hecheln, japsen, schlucken – dann brach es aus ihm heraus. Er sprang auf, hastete zur Brüstung und schrie aus voller Kehle: »Du Scheißkerl!« Er zitterte vor Wut und war zugleich beschämt über seine Feigheit.
Die Nacht verschluckte seinen Schrei, nichts passierte, niemand nahm Notiz von seinem Befreiungsschlag. Immerhin funktionierte seine Lunge wieder. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, dann ging er hinein und holte eine Dose Bier aus dem Kühlschrank. Auf dem Rückweg lauschte er an der Tür zum Schlafzimmer, die einen Spalt offenstand. Jeremia schlief weiter. So viel zum guten Gehör der Natives, dachte er bemüht witzig, dann seufzte er tief. Mit einem Zischen entwich die Kohlensäure aus der Dose, seine Hände bebten immer noch. Verdammt, er war ein Mann von 29 Jahren. Wie konnte er immer noch diese unwürdige Angst empfinden? Er war doch nicht traumatisiert oder so. Traumatisierte Menschen hatte er oft genug während seiner Einsätze gesehen. Er selbst war stark und vernünftig. Das Bier und der Sternenhimmel verwandelten ihn wieder in den Menschen, den er kannte, und als er nach einer halben Stunde hineinging und die Balkontür auf Kipp stellte, freute er sich auf das leise Schnarchen seines Freundes. In seinen Armen konnte er vergessen, dass er im Grunde genommen ein Schlappschwanz war.





























