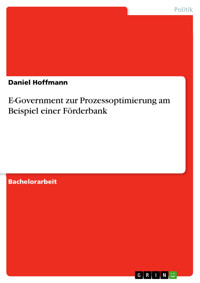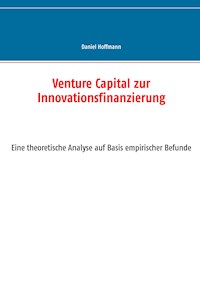
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Innovationen erzeugen wirtschaftliche Dynamik und geben einer Volkswirtschaft die erforderlichen Entwicklungsimpulse, die sie zur Aufrechterhaltung und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb benötigt. Von radikalen bzw. disruptiven Innovationen, welche völlig neue Produkte oder Technologien erfolgreich am Markt durchsetzen, gehen die bedeutsamsten volkswirtschaftlichen Effekte aus. Denn derartige Innovationen schaffen nicht nur neue Wertschöpfungsfelder, sondern heben eine Volkswirtschaft auf ein neues und höheres Entwicklungsniveau. Infolgedessen spielt die Innovationsfinanzierung eine entscheidende Rolle für die Erzeugung volkswirtschaftlicher Prosperität. In der vorliegenden Dissertationsschrift ist das der wesentliche Grund dafür, sich mit der Innovationsfinanzierung detailliert und wissenschaftlich fundiert zu beschäftigen. Durch eine umfassende theoretische Analyse auf Basis einer umfangreichen Empirie wird das Ziel erreicht, einerseits zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen und andererseits daraus bedeutsame Implikationen für die Praxis abzuleiten, von denen sowohl Kapitalgeber als auch –nachfrager gleichermaßen profitieren. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Venture Capital, Private Equity und Kapitalmarkttheorie sowie an Investment Manager und Führungskräfte in Venture Capital-Gesellschaften und kapitalsuchende, innovative Unternehmensgründungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inaugural - Dissertation
zur
Erlangung der wirtschaftswissenschaftlichen Doktorwürdedes Fachbereichs Wirtschaftswissenschaftender Philipps-Universität Marburg
eingereicht von:
Vorwort
Es kann in Theorie und Praxis als anerkannt gelten, dass wirtschaftliche Entwicklungsprozesse davon abhängen, inwieweit Finanzsysteme Innovationen, insbesondere innovative Neugründungen, zu finanzieren vermögen. Dabei ist mit Herrn Daniel Hoffmann auf der Grundlage Joseph Schmupeters Überlegungen zur fundamentalen Rolle von Finanzsystemen im Entwicklungsprozess davon auszugehen, dass zukunftsorientierte Finanzsysteme als unverzichtbare institutionelle Bedingung wirtschaftlicher Dynamik zu begreifen sind. Unter der in der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden Finanzierungsform Venture Capital werden, wie in der Literatur üblicherweise definiert, Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel verstanden, die von jungen innovativen Unternehmen eingesetzt werden. Entsprechend der frühen Phase der Firmenexistenz sowie der Neuartigkeit der beabsichtigten Unternehmensaktivität ist die Unsicherheit des Erfolgs der Investition sehr hoch. Vor dem Hintergrund dieses Problems einerseits, der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung von unternehmerischen Innovationen andererseits, stellt sich für Wagniskapitalgeber die Frage nach Methoden zur Beurteilung der Finanzierungswürdigkeit konkreter Innovationsprojekte. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, hierzu einen Beitrag zu leisten; zugleich werden so Gründern, also Kapitalnehmern, Implikationen für Ihre Projektgestaltung und ihr Verhalten gegenüber Kapitalgebern angedeutet. Auf dem Weg dahin werden in umfassender Weise theoretische und empirische Aspekte von Innovationen beleuchtet, und zwar auf mikro- wie auf makro-ökonomischer Ebene.
Schumpeter betont die Bedeutung von Krediten im Entwicklungsprozess. Der Unternehmer ist der „typische Schuldner“. Erst „durch den Kredit wird den Unternehmern der Zutritt zum volkswirtschaftlichen Güterstrom eröffnet“ (Schumpeter: Theorie der wirtschafltichen Entwicklung, S. 148). Diese Sichtweise ist jedoch, so der Kerneinwand des Verfassers, weder theoretisch noch empirisch mit der Realität von Entwicklungsprozessen in Einklang zu bringen. Schumpeter scheint Opfer eines theoretischen Defizits geworden zu sein, welches in der Zeit, als er seine Überlegungen konzipierte, noch nicht so gravierend gewesen sein mag, weil Finanzinstitute zu jener Zeit, noch über Aktionsparameter verfügten, die Schumpeter im nachhinein – fälschlicherweise – als notwendig für die Finanzierung junger Unternehmen (Frühphasenfinanzierung) betrachtet. In diesem Zusammenhang wird von einem „Schumpeterproblem“ gesprochen: die Betonung der Endogenität von Entwicklungsprozessen einerseits, andererseits die Behauptung, Finanzkapital müsse von außen, exogen, aus der Umwelt des Innovationssystems zugeführt werden.
Der Verfasser arbeitet diese Überlegungen detailliert heraus. Der Schwerpunkt seiner Überlegungen ist jedoch, wie dieses Schumpeterproblem theoretisch und handlungspraktisch, also zum Nutzen von „jungen Unternehmen“, welche Innovationen durchsetzen wollen, überwunden werden kann.
Aus der schumpeterschen Sicht geht es um die Frage, ob Kredite, sogar Finanzkapital allgemein, endogene Komponenten des Innovationssystems darstellen. Wie finanzieren sich also „junge Unternehmen“, was auch chronologisch ältere Menschen als Gründer einschließen kann und damit den Herausforderungen des demographischen Wandels gerecht wird?
Der Verfasser widmet sich theoretisch, empirisch und entscheidungsökonomisch dem skizzierten Problem in sieben Kapiteln.
Das 1. Kapitel widmet sich Fragestellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.
Im 2. Kapitel stellt der Autor den theoretischen Rahmen seiner Überlegungen vor. Wissen, Innovation und die Wellendynamik von Entwicklungsprozessen werden erläutert. Hierbei handelt es sich offensichtlich um schumpetersche Kategorien. Sie werden jedoch unter Bezug auf neuere theoretische (Er)Kenntnisse dargelegt. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Konzept impliziten Wissens (tacit knowledge nach Polanyi), weil damit bereits die im 3. Kapitel ausführlich dargestellte Problematik der Finanzierung von Vorhaben angedeutet ist, die auf nicht übertragbarem und quantifizierbarem Wissen fußen und damit potentielle Finanziers mit der Herausforderung konfrontieren, wie sich Vorhaben finanzieren lassen, deren Wissensbasis nur in Grenzen nachvollziehbar ist. Den empirischen Test dieser Überlegungen (dieser erfolgt, auch quantitativ, in den Kapiteln 4 ff.) kann jedermann sofort nachvollziehen, der einen Gründer auf einem Besuch bei einer Bank, aber auch einer etablierten Venture-Capital-Firma, begleitet.
Die Überlegungen zur Wissensproblematik werden vertieft durch die Wissensspirale von Nonaka und Takeuchi sowie die Überlegungen zum Knowing-doing-gap. Diese Überlegungen münden folgerichtig in die Frage, wie ein Unternehmer sein Wissen, auch wenn es in Teilen patentiert sein sollte, in Wertschöpfung umsetzen kann, wenn das Wissen für Dritte nur in Teilen kommunizierbar ist und eine Wissenslücke daher zwischen Unternehmer und potentiellem Finanzier nicht zu schließen ist. Die Antwort des Verfassers: er muss über innovative und evolutorische Fähigkeiten verfügen oder diese erwerben, er muss also, wie Schumpeter sagt, über eine „unternehmerische Persönlichkeit“ verfügen.
Das 3. Kapitel ist der theoretische Kern der Arbeit. Die hier vorgestellten Überlegungen sind aus meiner Sicht unverzichtbar, weil sie darlegen, wie ökonomische Entwicklung und die Finanzierungsproblematik verknüpft sind. Offensichtlich bedarf es hierzu, wie der Autor aufzeigt, eines Rückgriffs auf theoretische Einsichten, die in den sich als zuständig betrachtenden wissenschaftlichen wie praxisverbundenen Konzepten nur noch selten oder überhaupt nicht reflektiert werden. Dies gilt auch für Bereiche, in deren Mittelpunkt sog. Entrepreneurship steht. Der Verfasser spricht hier mehrfach von „Erklärungsdefiziten“.
Die dann folgenden Kapitel 4, 5 und 6 übersetzen diese Einsichten in die Finanzierungsproblematik. Welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen überhaupt und lassen sich entwicklungspraktisch verwirklichen, wenn sie jenseits der Erklärungsdefizite angesiedelt sind?
Das 4. Kapitel durchleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten von Venture Capital im Hinblick auf die Innovationsfinanzierung im Sinne Schumpeters. Betonen möchte ich den Hinweis des Autors in Abschnitt 4.3.1.1 (Seedphase) auf die Persönlichkeit des Gründers. Diese entscheidet mit, ob eine Gründung überhaupt in spätere Phasen fortschreiten kann. Bereits Schumpeter hat in seinem Frühwerk zur Entwicklung (1912) die Persönlichkeit als entscheidenden Erfolgsfaktor genannt. Die jüngere Persönlichkeitsforschung (etwa das Big Five Modell) bestätigt diese Sichtweise, nachdem die Entrepreneurshipforschung über Jahrzehnte hinweg keine überzeugenden Argumente Pro und Kontra, von der Leistungsmotivationsforschung abgesehen, vorlegen konnte. Wie der Autor später zeigt, ist die Persönlichkeitsnähe von Unternehmer und Finanzier ein Schlüsselfaktor für den Erfolg einer Finanzierung. Diese Nähe ist oftmals eine gefühlte, intuitiv wahrgenommene („Selbstähnlichkeit“), dennoch für die Entscheidung mit ausschlaggebend. In der Finanzierungspraxis, auch in der Beratung von Gründern, geht diese Sichtweise oftmals unter.
Das 5. Kapitel widmet sich einer „finanzierungstheoretischen Zuordnung von Venture Capital“. Hervorzuheben ist dabei die differenzierte Darstellung der neoklassischen Finanzierungstheorie. Der Verfasser begründet im Detail, warum diese Sichtweise aus der Problemlage „junger innovativer Unternehmensgründungen“ als unzureichend einzustufen ist.
Im Abschnitt 5.2 beschäftigt sich der Autor mit neoinstitutionalistischen Ansätzen (Property Rights, Agency, Transaktionskosten). Der Transaktionskostenansatz ist theoretisch überzeugend, empirisch und in der quantitativen Forschung trifft er allerdings auf Vorbehalte, so dass diesem Ansatz für die Praxis jenseits einer gedanklichen Strukturierung von auftretenden Problemen zwischen Gründer und Finanzier nur eine geringe Relevanz zukommt. Die Quintessenz der theoretischen Überlegungen ist, dass lediglich sog. Business Angels frühphasentauglich operieren können. Gelingt es dem Gründer nicht, an diese Anschluss zu finden, die Gründe hierfür werden erläutert und im 6. Kapitel anhand zentraler Erfolgsfaktoren vertieft, bleibt lediglich der Weg über die Selbstfinanzierung in „Interaktionssystemen“ (Luhmann) durch Familie, Freunde, Bekannte usw. gangbar.
Das 6. Kapitel zeigt die Möglichkeiten und Schwierigkeiten auf, Investitionskriterien zu konzipieren und in der Praxis anzuwenden, welche rationale Investitionsentscheidungen für Venture Capital-Gesellschaften vor allem in den frühen Phasen einer Gründung nahezu unmöglich machen. Aufgrund der hierzu im 4. Kapitel herausgearbeiteten Gründe bestimmen in der Folge oftmals qualitative Kriterien bis hin zu intuitiven Entscheidungen das komplexe Entscheidungsprozedere derartiger Finanziers. Der Verfasser begründet, warum eindeutige Antworten zur Auswahl und Anzahl von Kriterien zur Finanzierungsentscheidung schwierig herzuleiten sind und die Dominanz des Kriteriums Gründer bzw. Gründungsteam (sozusagen die Schumpetersche Persönlichkeitslogik) in der Praxis vorherrscht. In Abschnitt 6.2 stellt der Verfasser eigene praktische Vorschläge für das Bewertungsproblem vor, dem sich institutionelle Venture Capital-Geber bei der Auswahl zwischen alternativen Investitionsprojekten (d. h. Kapitalanfragen junger innovativer Unternehmen) gegenübersehen. Ziel ist es, Analyseinstrumente für die Praxis bereitzustellen, welche die Komplexität der Bewertung der Projekte reduzieren und die Transparenz bei der Entscheidungsfindung erhöhen. Insbesondere sollen dabei nicht nur quantitative Merkmale, wie z. B. das Umsatzpotenzial in Mio Euro, sondern auch sog. weiche Kriterien einbezogen werden, etwa die Problemlösungskompetenz des Gründers. Wesentlich ist zudem, dass ein für alle Projekte einheitliches und nachvollziehbares Auswahlsystem etabliert wird, in welchem die – notwendigerweise – subjektiven Bewertungen nicht nur der einzelnen „harten“ und „weichen“ Kriterien fest- und offengelegt werden, sondern auch die Präferenzen der Entscheider, wie sie sich in der Gewichtung der Kriterien niederschlagen. Im Ergebnis ergibt sich dann eine für alle Entscheidungsteilnehmer nachvollziehbare Hierarchie der zur Auswahl stehenden Venture Capital-Projekte. In Abschnitt 6.2.1 stellt der Verfasser als erste Methode die sog. Nutzwertanalyse vor. Es gelingt ihm nicht nur, deren Wesen in abstrakter, methodischer Hinsicht zu präsentieren; vielmehr wird dem Leser das Verständnis durch eine ganze Reihe anschaulicher Beispiele aus der Praxis von Venture Capital-Gesellschaften erheblich erleichtert. In Abschnitt 6.2.2 analysiert der Autor die sog. Multi-Attributive Nutzentheorie als zweites Verfahren zur Bewertung von Gründungsprojekten durch Venture Capital-Gesellschaften. Er verdeutlicht einerseits die geschlossene nutzentheoretische Fundierung, andererseits die damit verbundenen strengen Voraussetzungen für die sinnvolle Anwendbarkeit. Insbesondere müssen die Projektmerkmale kardinal messbar sein. Zur Illustration des Konzepts werden wieder numerische Beispiele eingeschoben. Im Anschluss an die Darstellung beider Verfahren zur Unterstützung der Investitionsentscheidung (Abschnitt 6.2) erläutert der Verfasser sodann im Detail deren Vor- und Nachteile für die praktische Anwendung.
Abschließend vermag der Autor den theoretischen und empirischen Nachweis zu liefern, dass „die Finanzierung von Veränderungen der Produktionsfunktionen“, also von Innovationen, „die stärkste Triebfeder der Investitionen“ (Schumpeter an seiner Kritik an Keynes) darstellt. Er überwindet dabei auf der Ebene der Theorie und empirisch überzeugend nachgewiesen, auch das „Schumpeterproblem“ selbst. Er weist die Endogenität der Finanzierung von neuen, jungen, Unternehmen in marktwirtschaftlichen Systemen als eine notwendige Bedingung der Entwicklung nach. Der Autor gibt einen umfassenden theoretischen und empirischen Einblick in die Problematik der Finanzierung junger Unternehmen, primär Start ups. Seine Überlegungen sind vielfältig theoretisch fundiert. Die jüngste Literatur ist ausgewertet und durch eigene Überlegungen nicht nur ergänzt, sondern weitergeführt. Die Ausführungen lassen sich, wie generell in der Unternehmerforschung, nicht der konventionellen Unterscheidung von betriebs- und volkswirtschaftlicher Betrachtung zuordnen. Dies zeigt auch die umfangreiche literarische Basis der Arbeit, in welcher sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftliche Autoren parallel ausgewertet werden. Die interessanten Ergebnisse dieser Arbeit bringen sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis entscheidend voran. Insofern ist ihr der breite Leserkreis zu wünschen, den sie verdient.
Prof. Dr. Jochen Röpke
Marburg, November 2014
Danksagung
Für
meine Eltern und Jenny
Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Venture Capital zur Innovationsfinanzierung – eine theoretische Analyse auf Basis empirischer Befunde“ wurde als Inaugural-Dissertation am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Universität Marburg angenommen.
Allen, die zu dieser Arbeit beigetragen und mich unterstützt haben, möchte ich auf diesem Weg herzlich danken. Besonders danken möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Jochen Röpke für den mir gewährten wissenschaftlichen Freiraum und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei hat er mich stets durch unsere konstruktiven Gespräche unterstützt. Die Integration seiner theoretischen Konzepte in meine Arbeit hat maßgeblich zur Erarbeitung von sowohl theoretischen als auch praktischen Lösungsansätzen zu Fragestellungen der Innovationsfinanzierung beigetragen. Mein herzlicher Dank gilt ebenso meinem Zweitgutachter Prof. Jan Franke-Viebach, der mich insbesondere durch seine theoretische Offenheit und sein besonders hervorzuhebendes Engagement vorbildlich unterstützt hat. Mein besonderer Dank gilt auch Prof. Wolfgang Kerber für die Übernahme des Vorsitzes der Prüfungskommission und die sehr angenehme sowie wissenschaftlich anregende mündliche Prüfung. Frau Meyer-Bairam aus dem Dekanat hat sich stets mit besonderer Unterstützung für mich eingesetzt. Dafür danke ich Ihr herzlich.
In meinem privaten Umfeld möchte ich besonders Prof. Katrin Löhr danken, die meine thematische Reflektion durch ihr konstruktives Denken gefördert hat. Danken möchte ich ebenso Dr. Olaf Stiller für die Möglichkeit, umfassende praktische Erfahrungen im Gründungsgeschehen sammeln zu dürfen, die mein besonderes Interesse an der Anfertigung dieser Arbeit zusätzlich verstärkt haben. Des Weiteren gilt mein Dank meinen Freunden und meiner Familie, die mich alle auf Ihre ganz eigene Art und Weise unterstützt haben.
Mein größter Dank gilt schließlich meinen Eltern und Jenny Steinhausen, die mich in größtmöglichem Maße unterstützt haben und immer hinter mir standen. Aus diesem Grund widme ich ihnen diese Arbeit.
Daniel Hoffmann
Köln, November 2014
Inhaltsübersicht
Vorwort
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Fragestellungen und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Wirtschaftliche Entwicklung durch Innovationsdynamik
2.1 Wissensmanagement in den Wirtschaftswissenschaften
2.2 Wissensmanagement im Innovationsprozess
2.3 Innovationsdynamik auf Basis der Theorie der langen Wellen
2.4 Zwischenfazit
3. Theoretische Grundlagen wirtschaftlicher Entwicklung und das Erklärungsdefizit bei der Gründungsfinanzierung
3.1 Wachstumstheoretische Erklärungsansätze und -misstände
3.2 Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Unternehmers
3.3 Bedeutung des Finanzkapitals - Implikationen zur Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen
3.4 Zwischenfazit
4. Innovationsfinanzierung durch Venture Capital
4.1 Grundlegende Definitionen, Begriffsabgrenzungen und Erläuterungen
4.2 Erscheinungsformen von Venture Capital und deren Relevanz für die Innovationsfinanzierung
4.3 Segmentierung des formellen Venture Capital-Marktes nach Finanzierungsphasen zur Effektivitätsbeurteilung für die Innovationsfinanzierung
4.4 Volkswirtschaftliche Entwicklungsimpulse durch Venture Capital
4.5 Zwischenfazit
5. Finanzierungstheoretische Zuordnung von Venture Capital
5.1 Gegenstand und Analyse der neoklassischen Finanzierungstheorie
5.2 Perspektive und Beurteilung der Relevanz der neoinstitutionalistischen Ansätze
5.3 Zwischenfazit
6. Analyse zentraler Erfolgsfaktoren bei der Investitionsentscheidung durch Venture Capital-Gesellschaften
6.1 Selektion der Investitionskriterien
6.2 Modelle und Analysen zur Evaluierung des Investitionskriteriums Unternehmer/Gründungsteam
6.3 Zwischenfazit
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Danksagung
Inhaltsübersicht
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Fragestellungen und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Wirtschaftliche Entwicklung durch Innovationsdynamik
2.1 Wissensmanagement in den Wirtschaftswissenschaften
2.1.1 Erzeugung von Wissen
2.1.2 Wissen – Definition und terminologische Abgrenzungen
2.2 Wissensmanagement im Innovationsprozess
2.2.1 Formen der Wissensumwandlung
2.2.2 Der Knowing–Doing-Gap
2.3 Innovationsdynamik auf Basis der Theorie der langen Wellen
2.3.1 Kondratieffwellen
2.3.2 Bedeutung von Basisinnovationen
2.3.3 Der Kondratieff-Zyklus
2.4 Zwischenfazit
3. Theoretische Grundlagen wirtschaftlicher Entwicklung und das Erklärungsdefizit bei der Gründungsfinanzierung
3.1 Wachstumstheoretische Erklärungsansätze und -misstände
3.1.1 Neoklassische Wachstumstheorie
3.1.2 Endogene Wachstumstheorie
3.2 Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Unternehmers
3.2.1 Der Begriff Unternehmer
3.2.2 Funktionale und typologische Differenzierung verschiedener Unternehmersysteme
3.2.2.1 Der Routineunternehmer - Neoklassik
3.2.2.2 Der Arbitrageur - Österreichische Schule
3.2.2.3 Der innovative Unternehmer - Schumpeter
3.2.2.4 Der evolutorische Unternehmer - Evolutorische Ökonomik
3.3 Bedeutung des Finanzkapitals - Implikationen zur Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen
3.3.1 Paradigma der Kreditfinanzierung durch Geschäftsbanken als Ursache für die Existenz der Finanzierungsproblematik
3.3.2 Finanzierungsmöglichkeiten in der Gründungsphase zur Schließung der Eigenkapitallücke
3.4 Zwischenfazit
4. Innovationsfinanzierung durch Venture Capital
4.1 Grundlegende Definitionen, Begriffsabgrenzungen und Erläuterungen
4.2 Erscheinungsformen von Venture Capital und deren Relevanz für die Innovationsfinanzierung
4.2.1 Informelles Venture Capital
4.2.1.1 Informelle Investoren
4.2.1.2 Typologisierung von Business Angel Investoren
4.2.1.3 Zur Rolle von Business Angels in der Gründungsfinanzierung
4.2.2 Formelles Venture Capital
4.2.2.1 Öffentliches Venture Capital
4.2.2.2 Corporate Venture Capital
4.3 Segmentierung des formellen Venture Capital-Marktes nach Finanzierungsphasen zur Effektivitätsbeurteilung für die Innovationsfinanzierung
4.3.1 Frühphasenfinanzierung
4.3.1.1 Seed-Phase
4.3.1.2 Start-up-Phase
4.3.2 Wachstumsphasenfinanzierung
4.4 Volkswirtschaftliche Entwicklungsimpulse durch Venture Capital
4.4.1 Effekte auf die Beschäftigungsentwicklung
4.4.2 Effekte auf das Wirtschaftswachstum
4.4.3 Implikationen zur Innovationsdynamik
4.5 Zwischenfazit
5. Finanzierungstheoretische Zuordnung von Venture Capital
5.1 Gegenstand und Analyse der neoklassischen Finanzierungstheorie
5.2 Perspektive und Beurteilung der Relevanz der neoinstitutionalistischen Ansätze
5.2.1 Property Rights-Theorie
5.2.2 Agency-Theorie
5.2.2.1 Asymmetrische Informationsverteilung vor Abschluss des Beteiligungsvertrages
5.2.2.2 Asymmetrische Informationsverteilung nach Abschluss des Beteiligungsvertrages
5.2.3 Transaktionskostenansatz
5.3 Zwischenfazit
6. Analyse zentraler Erfolgsfaktoren bei der Investitionsentscheidung durch Venture Capital-Gesellschaften
6.1 Selektion der Investitionskriterien
6.1.1 Investitionsentscheidung als dynamischer und evolutorischer Prozess
6.1.2 Bedeutung und Kategorisierung der Kriterien
6.1.3 Konfliktpotentiale der Kriterien
6.1.4 Theoretisch und empirisch fundierte erfolgsrelevante Kriterien
6.1.5 Implikationen zur herausragenden Dominanz des Kriteriums Management für Venture Capital suchende junge innovative Unternehmen
6.2 Modelle und Analysen zur Evaluierung des Investitionskriteriums Unternehmer/Gründungsteam
6.2.1 Nutzwertanalyse
6.2.1.1 Methodik
6.2.1.2 Zusammenfassende Bewertung der Prämissen und Konsequenzen für die praktische Anwendung
6.2.2 Multi-Attributive Nutzentheorie
6.2.2.1 Methodik
6.2.2.2 Zusammenfassende Beurteilung der Einsatzmöglichkeit in der Praxis
6.2.3 Nutzwertanalyse und Multi-Attributive Nutzentheorie im Vergleich
6.3 Zwischenfazit
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die Wissenspyramide
Abbildung 2: Die Wissensspirale
Abbildung 3: Kondratieffzyklen
Abbildung 4: Quellen der Gründungsfinanzierung in den USA in den Jahren 1997 und 2007
Abbildung 5: Finanzierungsquellen junger technologieorientierter Unternehmen in Abhängigkeit des Unternehmenslebenszyklus
Abbildung 6: Venture Capital - Definition
Abbildung 7: Strukturierung des Venture Capital-Marktes anhand seiner Akteure
Abbildung 8: Investoren nach Finanzierungsphasen
Abbildung 9: Business Angels: Definition
Abbildung 10: Typologisierung von Business Angels
Abbildung 11: Akteure auf dem formellen Venture Capital-Markt
Abbildung 12: Das Funktionsprinzip einer Venture Capital-Finanzierung
Abbildung 13: Corporate Venture Capital (CVC)
Abbildung 14: Segmentierung des Venture Capital-Marktes
Abbildung 15: Entwicklung der Investitionen nach Finanzierungsanlass (in% zum Gesamtvolumen in Mio. Euro - Marktstatistik)
Abbildung 16: Anzahl und Anteil aller durch Venture Capital finanzierten Unternehmen (arithm. Mittel der Marktstatistik)
Abbildung 17: Investitionen des Finanzierungsanlasses Seed prozentual zum Gesamtvolumen in Euro (arithm. Mittel der Marktstatistik)
Abbildung 18: Typischer Verlauf einer Wachstumsfinanzierung durch formelles Venture Capital
Abbildung 19: Investitionsvolumen in Abhängigkeit der Finanzierungsphase in Europa
Abbildung 20: Vergleich der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate
Abbildung 21: Vergleich der Beschäftigungsentwicklung nach Branchen in Venture Capital-finanzierten Unternehmensgründungen
Abbildung 22: Beschäftigungsentwicklung Venture Capital-finanzierter Unternehmen nach Gründungsart
Abbildung 23: Die neoinstitutionalistischen Ansätze
Abbildung 24: Zweistufige Prinzipal-Agent-Beziehung bei indirekter Venture Capital-Finanzierung
Abbildung 25: Zeitliche Struktur verschiedener Ausprägungen der Informationsasymmetrie
Abbildung 26: Entscheidungsrelevante Agency-Kosten
Abbildung 27: Investitionsprozess einer Venture Capital-Gesellschaft
Abbildung 28: Kategorisierung der Selektionskriterien
Abbildung 29: Verfahrensschritte der Nutzwertanalyse
Abbildung 30: Beispiel eines Kriterienkataloges
Abbildung 31: Diskrete Transformationsfunktion am Beispiel des Zielkriteriums „Problemlösungskompetenz des Unternehmers"
Abbildung 32: Stückweise-konstanteTransformationsfunktion am Beispiel des Zielkriteriums „Sättigungsgrad des Marktes"
Abbildung 33: StetigeTransformationsfunktion am Beispiel des Zielkriteriums „Umsatzpotential in Mio. Euro"
Abbildung 34: Verfahrensschritte der Multi-Attributiven Nutzentheorie
Abbildung 35: Ergebnisprofile zweier Alternativen mit vier Attributen
Abbildung 36: Messung eines Attributes durch ein anderes
Abbildung 37: Bestimmung der Wertfunktion
Abbildung 38: Bestimmung der Skalen- bzw. Gewichtungsfaktoren
Abbildung 39: Zur Interpretation der Skalen- bzw. Gewichtungsfaktoren
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Inklusion und Transzendenz im Unternehmertum
Tabelle 2: Komparative Vorteile von Business Angels
Tabelle 3: Differenzierungsmerkmale zwischen Business Angels und Venture Capital-Gesellschaften
Tabelle 4: Öffentliche Förderprogramme zur Finanzierung von Unternehmensgründungen durch Venture Capital
Tabelle 5: Seed Phase
Tabelle 6: Start-up Phase
Tabelle 7: Annahmen der neoklassischen Finanzierungstheorie
Tabelle 8: Stufen der Informationseffizienz auf Kapitalmärkten
Tabelle 9: Relevante Agency-Effekte bei Venture Capital-Finanzierungen
Tabelle 10: Studien zu Beurteilungskriterien von Venture Capital-Gesellschaften im Investitionsentscheidungsprozess
Tabelle 11: Investitionskriterium Management
Tabelle 12: Investitionskriterium Produkt bzw. Markt
Tabelle 13: Investitionskriterium Finanzen
Tabelle 14: Aggregationsvorschrift bei ordinal skalierten Teilnutzwerten (Copeland - Regel)
Tabelle 15: Einsatzmöglichkeiten von Multi-Attributive Nutzentheorie und Nutzwertanalyse
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
Die Prosperität einer Volkswirtschaft hängt in erheblichem Maße von der Effektivität der Verbindung zwischen der Real- und der Finanzwirtschaft ab. Die unmittelbare Wechselwirkung beider Sphären geht bereits aus den Begriffen hervor. Der Begriff Realwirtschaft impliziert, dass neben einer wirklichen, d. h. einer realen, eine vermeintlich andere fiktive Wirtschaft existieren muss, welche in diesem Fall die Finanzwirtschaft adressiert. Die wechselseitige Beziehung beider Teilsysteme führt aufgrund ihres dynamischen Charakters zu einem hohen Maß an Komplexität.
Bezugnehmend auf die Interdependenzen beider Teilsysteme kommt die grundlegende Frage auf, welche Parameter die wechselseitigen Kausalitäten des Zusammenspiels so determinieren, dass hierdurch wirtschaftliche Entwicklung induziert wird. Aus realwirtschaftlicher Perspektive liefert Schumpeter einen grundlegenden Erklärungsbeitrag zur Beantwortung dieser Fragestellung. Denn auf ihn geht das erste gesamtheitliche Modell zur industriellen Evolution zurück. Mit seinem Buch „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ legt Schumpeter das Fundament für seine Theorie der Innovation sowie der Industrieevolution.1 Aus diesem Grund gilt Schumpeter in den Wirtschaftswissenschaften nicht nur als Wegbereiter der evolutorischen Theorie der Industrieentwicklung, sondern zugleich als maßgeblicher Begründer der Innovationsforschung. Innovationen nehmen in seiner Theorie zur industriellen Evolution die entscheidende Rolle ein. Schumpeter zufolge geben Innovationen den zentralen Impuls für wirtschaftliche Entwicklung.
1.1 Fragestellungen und Zielsetzung
Die Entstehung von Innovationen ist immer eingebettet in einen spezifischen Kontext und erfolgt auf Basis eines Innovationsprozesses.2 Infolgedessen bietet zunächst die Analyse der Innovationsentstehung nicht nur einen äußerst interessanten Untersuchungsgegenstand, sondern ist für das Verständnis der daraus resultierenden, weitreichenden Folgen für die Innovationsfinanzierung unerlässlich. Weiterhin ist die Beschreibung des Konzepts der Innovation nach Schumpeter wegen der differenzierten Betrachtung von der Erfindung einerseits und der Durchsetzung derselben andererseits aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders relevant, da erst die Durchsetzung wirtschaftliche Entwicklung induziert.
Schumpeter unterscheidet explizit zwischen statischen und dynamischen ökonomischen Theorien und rückt dynamische Aspekte in den Fokus seiner Arbeiten. Aus makroökonomischer Sicht sieht er in diskontinuierlichen Veränderungsprozessen auf Basis vollkommen neuer Innovationen eine wesentliche Ursache für die Entstehung wirtschaftlicher Entwicklungsdynamik. Zur Durchsetzung von Neukombinationen ordnet er der Funktion des Unternehmers die zentrale Rolle zu. Aus mikroökonomischer Sicht liefert der Unternehmer entscheidende Impulse für die dynamische Entwicklung einer Volkswirtschaft.
Schumpeters dynamische Theorieansätze bzw. Entwicklungstheorien greifen zudem Aspekte aus der Evolutionstheorie auf, indem sie wirtschaftliche Entwicklungsprozesse analog zu biologischen Evolutionsprozessen abbilden. Schumpeter legt mit seiner klaren Differenzierung zwischen statischen und dynamischen ökonomischen Theorieansätzen und der Modellierung seiner Entwicklungstheorie ein maßgebliches Fundament für die evolutorische Ökonomik, deren Perspektive bis heute in der volkswirtschaftlichen Innovationstheorie ein Paradigma darstellt. Ausgehend von dieser evolutionstheoretischen Sichtweise, welche auf die Abbildung des dynamischen Wandels der Wirtschaft mittels Referenzkonzepten aus der (Evolutions-) Biologie und der Naturwissenschaft abzielt, modifiziert Röpke das Konzept des Schumpeter Unternehmers und entwickelt es weiter.3
Aus realwirtschaftlicher Betrachtungsweise lässt sich festhalten, dass wirtschaftliche Entwicklung durch endogenisierten Wandel mit Hilfe der Einführung von Innovationen induziert wird, wobei der Funktion des Unternehmers bei deren Umsetzung im Wirtschaftsgeschehen die zentrale Bedeutung zukommt. Bedingt durch die wechselseitigen Kausalitäten des Zusammenspiels von Real- und Finanzwirtschaft drängt sich die Frage auf, welche Rolle die Finanzwirtschaft bei der Finanzierung von Innovationen aus heutiger Sicht spielt.
Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist somit die Innovationsfinanzierung. Denn eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung der Innovationsfinanzierung im theoretischen Bezugsrahmen Schumpeters besitzt in theoretischer und praktischer Hinsicht eine hohe Relevanz. In praktischer Hinsicht liefert eine tief gehende Analyse der Innovationsfinanzierung bedeutsame Erkenntnisse, von denen sowohl Kapitalnachfrager als auch – geber profitieren. Während für kapitalnachfragende Innovatoren die hohe Praxisrelevanz des Themas aus der schwerwiegenden Zugangsproblematik zu Finanzkapital hervorgeht, werden im gleichen Zuge die enormen Schwierigkeiten für kapitalanbietende Investoren bei deren Investitionsentscheidung deutlich. Aus theoretischem Blickwinkel ist eine Untersuchung der Innovationsfinanzierung aus heutiger Sicht relevant, um Schumpeters ursprüngliche Finanzierungsthesen einer kritischen Theorieprüfung zu unterziehen. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt es zu klären, ob auf dem Gebiet der Innovationsfinanzierung theoretischer Forschungsbedarf existiert und falls dies der Fall ist, wie den identifizierten Defiziten mit einer theoretischen Neuorientierung entgegengewirkt werden kann.
Aus der wissenschaftlichen Zielsetzung der vorliegenden Arbeit lassen sich drei Forschungsfragen ableiten:
(1) Welche Einflussfaktoren determinieren die Innovationsfinanzierung hinsichtlich der in Betracht kommenden Kapitalgeber?
(2) Welche Kapitalgeber finanzieren Innovatoren in den frühen Unternehmensentwicklungsphasen, d. h. von der Forschungsidee über die Markteinführung bis hin zur Wachstumsphase?
(3) Welcher besonderen Problematik unterliegen institutionelle Kapitalgeber (Venture Capital-Gesellschaften) bei der Investitionsentscheidung, und wie lässt sich diese verringern, so dass davon beide Seiten profitieren?
Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt durch eine systematische theoretische Analyse der Innovationsfinanzierung auf Basis empirischer Befunde. Ein elementarer Bestandteil dieser Arbeit ist die Einbeziehung untersuchungsrelevanter Erkenntnisse aus der Finanzierungstheorie, die zur Identifikation und Erklärung der in der Praxis vorherrschenden Probleme bei der Innovationsfinanzierung herangezogen werden.
Allgemein betrachtet, leistet die vorliegende Arbeit in theoretischer Hinsicht einen Beitrag zur weiteren Erforschung der Innovationsfinanzierung. Darüber hinaus verfolgt sie das Ziel, einen neuen Erkenntnisgewinn für die Praxis zu schaffen, indem aus den Ergebnissen der Analysen praktische Handlungsempfehlungen sowohl für kapitalsuchende innovative Gründungen als auch für Investoren abgeleitet werden sollen, um beide Seiten bei ihren Vorhaben zu unterstützen.
1.2 Aufbau der Arbeit
Nachdem aus der eingangs geschilderten Ausgangssituation der Untersuchung die der Arbeit zugrunde liegenden zentralen Fragestellungen und die daraus resultierende wissenschaftliche Zielsetzung abgeleitet worden sind, wird in diesem Abschnitt auf den Aufbau der Arbeit eingegangen. Die Vorgehensweise ist so gewählt, dass zentrale Erkenntnisse in einem Zwischenfazit am Ende eines jeden Kapitels zusammengefasst werden.
Im zweiten Kapitel werden die für das Verständnis der Problemstellung der Arbeit notwendigen begrifflichen Grundlagen erläutert und die relevanten Definitionen geliefert. Den Ausgangspunkt bildet die wissenschaftlich weitgehend unbestrittene Auffassung, dass wirtschaftliche Entwicklung in hohem Maße durch Innovationen induziert wird. Um die bei der Finanzierung von Innovationen auftretenden Schwierigkeiten besser erfassen zu können, wird die Chronologie ihrer Entstehung detailliert herausgearbeitet. Da Wissen die Grundlage von Innovationen bildet, erfolgt in Abschnitt 2.1 eine Auseinandersetzung mit der Thematik Wissensmanagement in den Wirtschaftswissenschaften. Dabei wird zunächst die Entstehung von Wissen erörtert, woran sich entsprechende Begriffsdefinitionen sowie terminologische Abgrenzungen anschließen. Abschnitt 2.2 dient dazu, die aus dem neu generierten Wissen hervorgehende Komplexität für den Innovationsprozess aufzuzeigen. Die Vorstellung unterschiedlicher Wissensdimensionen wird ein Verständnis dafür schaffen, mit welcher folgenschweren Investitionsentscheidungsproblematik Kapitalgeber bei der Einschätzung personenbezogenen Wissens des Gründers konfrontiert sind. Aus der Dimensionierung verschiedener Wissensformen wird ein wesentlicher Grund für die Beurteilungsproblematik neu generierten Wissens hervorgehen, welche genauso für Gründer bei deren Kapitalsuche ein schwerwiegendes Problem darstellt. Aufgrund der für die volkswirtschaftliche Entwicklung so wichtigen Umwandlung von inventivem in anwendbares Wissen, d. h. in kommerzialisierbare Innovationen, endet der Abschnitt mit einer Auseinandersetzung zum Knowing-Doing-Gap. Das Kapitel schließt mit der Darstellung der auf empirischen Beobachtungen basierenden Theorie der langen Wellen, welche zur Differenzierung verschiedener Innovationstypen mit ihrem jeweiligen volkswirtschaftlichen Entwicklungsbeitrag verwendet wird. Analog zum Faktor Wissen wird die Art der Innovation im weiteren Verlauf der Arbeit eine weitreichende Bedeutung bei sämtlichen Fragestellungen zur Finanzierung haben.
Im dritten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dieser Arbeit vorgestellt, der zur Untersuchung der Forschungsfragen verwendet wird. In Abschnitt 3.1 werden zunächst ausgewählte Theorien präsentiert, die regelmäßig zur Bearbeitung von Fragestellungen im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Entwicklung herangezogen werden. Basierend auf den Erkenntnissen der vorgestellten Theorien hinsichtlich ihres Beitrags zur Erklärung wirtschaftlicher Entwicklung rückt in Abschnitt 3.2 die Person des Unternehmers in den Fokus der Betrachtung. Im Zentrum wird dabei die Frage stehen, welche volkswirtschaftliche Bedeutung dem Unternehmer zukommt. In Anlehnung an die unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Denkrichtungen erfolgt hierzu eine funktionale und typologische Differenzierung verschiedener Unternehmersysteme. In einem ersten Schritt erfolgt damit die Übertragung der im zweiten Kapitel gewonnenen Erkenntnisse auf die Fragestellung, welcher Unternehmertypus dank seiner spezifischen Charakteristika neues Wissen über die Erzeugung hinaus in kommerzialisierbare Innovationen umwandeln kann, die zur Entwicklung und dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft beitragen. Im zweiten Schritt wird darauf aufbauend die Verbindung zwischen der theoretischen Basis und dem konkreten Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit vorgenommen. Zu diesem Zweck wird in Abschnitt 3.3 die realwirtschaftliche Ebene verlassen und der zentralen Fragestellung nachgegangen, welche Rolle das Finanzkapital bei der Aufrechterhaltung volkswirtschaftlicher Entwicklungsdynamik auf Basis von Innovationen spielt. Ausgehend von der theoretischen Fundierung dieser Arbeit wird unter Zuhilfenahme empirischer Befunde die alte Frage theoretisch frisch aufbereitet, welche Kapitalgeber unter den Gegebenheiten heutzutage innovativen Unternehmern bei deren Gründungsvorhaben welche Finanzierungsinstrumente bereitstellen und warum.
Im vierten Kapitel werden die bisherigen Erkenntnisse über die Herkunft von Gründungskapital für den in dieser Arbeit zugrunde liegenden Unternehmertypus weiter vertieft. Aus diesem Anlass beinhaltet das Kapitel eine umfassende Auseinandersetzung mit der Analyse der Finanzierungsform Venture Capital zur Innovationsfinanzierung. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist die Identifikation des passenden Kapitalgebers zur jeweiligen Finanzierungsphase einer innovativen Gründung, wobei sich das Analysespektrum auf die Finanzierung der frühesten Unternehmensentwicklungsphasen bis einschließlich der Wachstumsphase erstreckt, denn gerade in diesen Entwicklungsstadien existiert eine für beide Seiten (Kapitalnachfrager und –geber) besonders folgenschwere Finanzierungsproblematik. Nachdem in Abschnitt 4.1 die begrifflichen Grundlagen und die für das weitere Verständnis notwendigen Definitionen geliefert werden, stellt Abschnitt 4.2 die wesentlichen Erscheinungsformen von Venture Capital vor und beurteilt sie im Hinblick auf ihre Wirksamkeit bei der Innovationsfinanzierung. Dies erfolgt anhand einer grundlegenden Differenzierung zwischen informellem und formellen Venture Capital. Aus den konstitutiven Differenzierungsmerkmalen beider Erscheinungsformen werden Aussagen zur Effektivität für die Finanzierung innovativer Gründungen im Sinne der vorliegenden Arbeit getroffen. Zur Beurteilung des Investitionsverhaltens informeller Kapitalgeber wird lediglich eine als marginal einzustufende empirische Datenbasis vorliegen, denn die überwiegende Anzahl aller wissenschaftlichen Arbeiten zum informellen Marktsegment ist bislang konzeptioneller Natur. Nichtsdestotrotz können aus den vorwiegend deskriptiven theoretischen Forschungsarbeiten eindeutige Schlussfolgerungen zur Relevanz und Wirkungsweise informeller Investoren abgeleitet werden. Für das formelle Marktsegment wird hingegen eine aussagekräftige empirische Datenbasis zur Verfügung stehen, so dass in Abschnitt 4.3 eine isolierte Betrachtung der Investitionsaktivitäten formeller Akteure durchgeführt wird. Basierend auf der Zerlegung des Venture Capital-Marktes nach Finanzierungsphasen, die eine präzise Untersuchung des Investitionsverhaltens institutioneller Kapitalgeber ermöglicht, wird nach den Gründen gesucht, welche die empirischen Befunde zur Relevanz dieser Kapitalgeber bei der Innovationsfinanzierung erklären können. Das Kapitel endet mit der Beantwortung der Frage, welche volkswirtschaftlichen Entwicklungsimpulse durch Venture Capital induziert werden.
Im fünften Kapitel werden die bisherigen Erkenntnisse über die vorherrschende Problematik bei der Finanzierung innovativer Neugründungen in den frühen Unternehmensentwicklungsphasen theoretisch fundiert, indem Venture Capital aus finanzierungstheoretischer Perspektive betrachtet wird. Im Zentrum wird die Frage stehen, welcher theoretische Ansatz die Existenz des Phänomens Venture Capital erklären kann und auf theoretischer Basis die kausalen Faktoren für die Ursache der Finanzierungsproblematik liefert. Hierzu erfolgt in Abschnitt 5.1 zunächst die Darstellung und Analyse der neoklassischen Finanzierungstheorie, woran sich die Vorstellung und Untersuchung der neoinstitutionalistischen Ansätze zur Finanzierungstheorie in Abschnitt 5.2 anschließt.
Gegenstand des sechsten Kapitels ist die Analyse der zentralen Erfolgsfaktoren bei der Investitionsentscheidung aus der Sicht institutioneller Kapitalgeber. Als Reaktion auf die in Kapitel 5 theoretisch zu begründenden empirischen Befunde zum finanziellen Engagement institutioneller Kapitalgeber in den frühen Unternehmensentwicklungsphasen (Früh- und Wachstumsphase) wird in Abschnitt 6.1 deren Investitionsentscheidungsprozess untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Investitionskriterien, welche formelle Kapitalgeber bei ihrer Entscheidungsfindung heranziehen. Die Identifizierung der erfolgsrelevanten Investitionskriterien erfolgt mit dem Ziel, darauf aufbauend eine methodische Basis zu schaffen, die eine effektivere Investitionsentscheidung ermöglicht. Hintergrund ist die hohe Bedeutung, die formellen Kapitalgebern bei der Finanzierung der an die Frühphase unmittelbar anschließenden Wachstumsphase zukommt, wenn das finanzielle und zeitliche Engagement informeller Kapitalgeber zumeist erschöpft ist und noch keine anderweitigen Finanzierungsalternativen zur Verfügung stehen, so dass eine Finanzierungslücke droht. Ausgehend von der schwerwiegenden Einschätzungsproblematik, der formelle Kapitalgeber bei der Beurteilung qualitativer Investitionskriterien unterliegen, werden in Abschnitt 6.2 geeignete Analysemethoden zur Verbesserung der Investitionsentscheidung im Hinblick auf die Beurteilung des Investitionskriteriums Unternehmer/Gründungsteam vorgestellt, von der nicht nur Kapitalgeber, sondern auch kapitalsuchende Unternehmer profitieren.
1 Vgl. Schumpeter, J.A. (1912).
2 Die Entstehung von Innovationen wird zudem durch u.a. politische, rechtliche, soziale Rahmenbedingungen bestimmt.
3 Vgl. Röpke, J. (2002).
2. Wirtschaftliche Entwicklung durch Innovationsdynamik
Eine positive Korrelation zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Einführung von Innovationen ist weitgehend unbestritten, wobei die ökonomische Nutzung neuen Wissens den eigentlichen Innovationserfolg determiniert. Sowohl die Erfindung neuer Technologien als auch die Einführung neuer Produkte am Markt und darüber hinaus die Diffusion neuer Techniken im wirtschaftlichen Geschehen können unter dem Begriff Innovation subsumiert werden. Die Fähigkeit der kontinuierlichen, wirtschaftlichen Applizierung von Innovationen stellt die Grundvoraussetzung für den Erhalt der technologischen Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft dar. Gerade im globalen Wettbewerb der Volkswirtschaften untereinander spielt die Kommerzialisierung neuer Technologien eine entscheidende Rolle zur Schaffung neuer Wertschöpfungsfelder. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive stellt sich die Frage nach den zentralen Determinanten für eine dauerhafte Entwicklung der Wirtschaft.
Zur Beantwortung dieser Frage wird in den Abschnitten 2.1 – 2.3 der volkswirtschaftliche Entwicklungsprozess anhand seiner Chronologie dargestellt und interpretiert. Der Prozess beginnt mit der Erzeugung neuen Wissens, welches Voraussetzung für die Entstehung innovativer Produkte und Technologien ist. Für die Mobilisierung volkswirtschaftlicher Entwicklung reicht Wissensgenerierung alleine nicht aus, sondern erst deren Umwandlung in anwendbare Innovationen. Erst im Wirtschaftssystem kommerziell nutzbare innovative Produkte bzw. Dienstleistungen geben dem volkswirtschaftlichen Entwicklungsprozess positive Impulse. Im Idealfall sollte daher die Wissensgenerierung mit der Applikation neuen Wissens im Wirtschaftssystem positiv korrelieren. Dies stellt jedoch in der Realität eine gewaltige Herausforderung dar, denn die Handlungskomponente „Doing“ kommt nicht mit der Zunahme der Wissenskomponente „Knowing“ mit und gerät in Rückstand. Findet also neues Wissen („Knowing“) keine Anwendung („Doing“), gehen daraus keine Innovationen hervor, so dass eine Blockade des Entwicklungsprozesses vorliegt. Auf die Existenz dieses als Knowing-Doing-Gap bezeichneten Phänomens wird in Abschnitt 2.2.2 eingegangen. Zur Lösung dieser Problematik werden Ansätze aufgezeigt, da nur durch die Überwindung dieser Problematik eine Stagnation des volkswirtschaftlichen Systems langfristig vermieden werden kann.
Wirtschaftliche Entwicklung hängt in hohem Maße davon ab, ab wann eine Volkswirtschaft in neuen innovativen Bereichen präsent ist, da speziell in frühen Marktphasen eines Produkt- oder Technologielebenszyklus extrem hohe Wachstumsraten erzielt werden können. Diese Erkenntnis wird in Abschnitt 2.3 exemplarisch anhand der Theorie der langen Wellen erläutert, welche die herausragende Bedeutung von Innovationen in Abhängigkeit unterschiedlicher wirtschaftlicher Zeitabschnitte darstellt. Wie sich zeigen wird, beeinflussen verschiedene Typen von Innovationen den Entwicklungsprozess auf unterschiedliche Art und Weise. Die Theorie der langen Wellen bietet einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Untersuchung wirtschaftlicher Entwicklung und Dynamik, der im 3. Kapitel um die entwicklungstheoretischen Ansätzen Schumpeters und Röpkes erweitert wird. Zunächst erfolgt eine Einordnung des Untersuchungsgegenstandes Wissensmanagement in die Wirtschaftswissenschaften.
2.1 Wissensmanagement in den Wirtschaftswissenschaften
Die enorme Bedeutung von Wissen gilt in den Wirtschaftswissenschaften als allgemein anerkannt. Die Erzeugung neuen Wissens sowie die Investition in Humankapital dominieren als zentrale Faktoren für wirtschaftliche Prosperität4 den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Wohlstand.5
„Wissen ist der elementare Treibstoff für das Zünden einer Wohlstandsrakete. Armut besteht immer dann, wenn es nicht gelingt, Wissen effizient zu nutzen.“6
Heutzutage findet das Leben in einer Wissensgesellschaft statt, welche als ein neues ökonomisches Paradigma einzustufen ist. Unabhängig von jeder existierenden Institution (Unternehmen, Hochschulsysteme oder öffentliche Einrichtungen) wird Wissensmanagement als zentraler Indikator für Erfolg angesehen. Diese These gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer permanenten weltwirtschaftlichen Unsicherheit, in der Wissen wesentlich zur Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen beiträgt.7 Auch die stetige Zunahme an wissenschaftlichen Publikationen ist ein Indikator für die stetige und überproportionale Zunahme der Wissensquantität.8 Wissen wächst exponentiell in einem derartigen Ausmaß, dass die Wissensbasis im Jahr 2020 ca. 10.000 mal größer sein wird als im Jahr 2001 und 300 Millionen mal größer als im Jahr 1700.9 Heute wird davon ausgegangen, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Zeitspanne von lediglich 18 Monaten verdoppeln, wobei diese Spanne im Bereich von Innovationen (neue Technologien und Produkte) als noch kürzer anzunehmen ist. Beispielsweise wird in der Biotechnologie vermutet, dass sich die Wissensbasis innerhalb von sechs bis neun Monaten verdoppelt.10 In diesem Kontext ist nicht alleine die Zunahme der Geschwindigkeit relevant, sondern vielmehr die absolut eklatante Erweiterung der Wissensbasis. Dies impliziert bei fortschreitender Entwicklung sowohl eine Zunahme der Wissensintensität als auch der Wissensspezifität. Vor diesem Hintergrund stellen sich nachfolgend die zu beantwortenden Fragen, welchen Ursprung Wissen hat und welche Voraussetzungen für dessen Entstehung gegeben sein müssen.
2.1.1 Erzeugung von Wissen
Die Generierung neuen Wissens gilt in der vorliegenden Arbeit als entscheidende Prämisse und Basis für Innovationen (qualitative Veränderungen) mit dem Ziel, volkswirtschaftliche Entwicklung anzuregen.11
Ausgehend von der immensen Vielfalt theoretischer Denkrichtungen und Definitionen in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur folgt die Argumentation hier einer konstruktivistischen Sichtweise mit einer radikalen sowie einer praktischen Komponente. Im Fokus der Betrachtung steht die wirtschaftliche Relevanz des Faktors Wissens nach dem volkswirtschaftlichen Entwicklungsparadigma Schumpeters und Röpkes.
Dem Wissensverständnis des radikalen Konstruktivismus12 zufolge können Umweltzustände nicht trivial erfasst werden, sondern müssen vom Subjekt konstruiert werden. Dies erfolgt unter der Grundannahme, dass Menschen (Subjekte) als autonome Einheiten angesehen werden, die nicht in offenem Kontakt zu ihrer Umwelt stehen. Die Umwelt wird nicht objektiv wahrgenommen oder abgebildet, sondern wird durch das individuelle System selbst erschlossen, d. h. die Umwelt ist nicht einfach objektiv gegeben, sondern wird geschaffen bzw. konstruiert. Beim praktischen Konstruktivismus wird dem Subjekt bzw. Individuum zugestanden, dass es sich seine eigene Konstruktion der Realität schafft. Daher wird die subjektive Meinung jedes Einzelnen für ihn selbst zur objektiven Wahrheit, mit der ein System von außen interpretiert wird.13 Innerhalb des praktischen Konstruktivismus kann die Realität nicht als allgemeingültiges Muster verstanden werden, da jedes Individuum gegebene Sachverhalte unterschiedlich interpretiert. Bezogen auf das Wissen und seine Entstehung liefert Rassidakis die zutreffende Feststellung, indem seiner Ansicht nach Werte, Ziele etc. als ein Produkt eigener Überlegungen und aufgrund von Entscheidungen entstehen, die aus dem persönlichen, subjektiven Wirklichkeitsempfinden resultieren.14
Aufbauend auf diese allgemeine Klassifizierung des Wissensbegriffs aus der Perspektive des radikalen bzw. praktischen Konstruktivismus wechselt die anschließende Betrachtung hin zu einer detaillierteren subjektiven Ebene und erläutert die zentralen Terminologien des Wissens.
2.1.2 Wissen – Definition und terminologische Abgrenzungen
Bereits eine Vielzahl ökonomischer Arbeiten hat sich mit der Terminologie zum Thema Wissen auseinandergesetzt, den Wissensbegriff in verschiedenste Denkmuster bzw. Typologien klassifiziert und zeigt damit die Subjektivität seiner Interpretationsmöglichkeiten.15 Nach der Auffassung von Probst/Raub und Romhardt bezeichnet Wissen die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen.16 Wissen stützt sich dabei auf Daten und Informationen, womit eine grundlegende Differenzierung zwischen Daten, Information und Wissen zu treffen ist. Daten werden als Rohmaterial für Informationen verstanden. Weiter herunter gebrochen bestehen Daten aus Zeichen. Zeichen wiederum sind Ziffern, Buchstaben oder alle darüber hinaus existierenden Sonderzeichen. Im Einzelnen oder in einer sinnvollen Folge bilden Zeichen Daten. Die Wahrnehmung eines bestimmten Datums durch den Betrachter macht diese noch nicht zu einer Information. Erst wenn Daten einem Problem oder einem Ziel zugeordnet werden können, entstehen aus ihnen Informationen.17
Der Informationsbegriff lässt sich vielseitig differenzieren und wird in der Nachrichtentechnik18, der Sprach-19, der Kultur-20 und der Naturwissenschaft21 sowie der Kybernetik22 verwendet. Elementar für das Verständnis von Informationen ist deren Entstehung aufgrund subjektiver Interpretation eines Datums. Die entstandenen Daten werden als Gegebenes vom Individuum subjektiv interpretiert, verarbeitet und in einen Kontext gebracht. Die subjektive Interpretation findet in Form einer operativen Verarbeitung statt, bei der ein Signal bzw. ein Datum in eine Information transformiert wird.23 Falls die Wahrnehmung des Datums zu einer differenten Beurteilungssituation führt, entsteht für das Individuum eine Information.24 Nach Röpke hängt das Interpretationsmuster des Individuums wiederum von ihm selber, seinen Theorien, Konzeptionen und Ideologien ab.25
Informationen basieren somit nicht auf der Wahrnehmung externer Realität, sondern sind das Resultat eigener Sinne, die durch ein stimulierendes Ereignis zu einer komplexen Reaktion führen.26 Damit im Folgenden aus Informationen Wissen generiert wird, müssen sie auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet und miteinander vernetzt werden.27 Demzufolge sind nach Wittmann zielgerichtete Informationen zweckbezogenes Wissen, das dazu dient, Entscheidungen oder Handeln vorzubereiten.28
Deutlich wird dieser Zusammenhang nachfolgend, indem aus erlangtem Wissen Entscheidungen für die Herstellung und Entwicklung neuer Produkte und Technologien getroffen werden. In der Folge sind neue Produkte und Technologien (in der Abbildung zur Wissensspirale als Value bezeichnet) das Resultat neuen Wissens, wobei deren Kommerzialisierung die Grundlage für eine prosperierende Volkswirtschaft schafft.
Abbildung 1: Die Wissenspyramide29
Ausgehend von der Abgrenzung der zentralen Terminologien des Wissensbegriffs und der in dieser Arbeit getroffenen Annahme, dass das Wissensverständnis einem subjektiven Konstruktivismus unterliegt, beleuchtet der nächste Abschnitt die Komplexität des Wissensmanagements speziell auf den Innovationsprozess bezogen.
2.2 Wissensmanagement im Innovationsprozess
Aus innovationslogischer Perspektive liegt die zentrale Problematik nicht in der Generierung von Wissen, sondern in dessen ökonomischer Applikation. Diese Problematik ist durch die besonderen Charakteristika des Wissens begründet (Abschnitt 2.2.1), deren immense Relevanz in den Wirtschaftswissenschaften allgemein und speziell bei Fragestellungen zur Innovationsfinanzierung (ab Kapitel 4) nur unzureichend erkannt wird. Dabei stellt die Applikation neuen Wissens die Basis für qualitative Veränderungen einer Volkswirtschaft dar. Erst durch die zielgerichtete, wirtschaftliche Nutzung neuen Wissens in Form innovativer Produkte bzw. Technologien, welches von Kapitalgebern bei deren Investitionsentscheidung adäquat eingeschätzt werden muss, kann volkswirtschaftliche Entwicklung induziert werden.
In diesem Abschnitt stellt sich daher die notwendige Frage nach der Wissensverwertung. Sowohl aus der Makro- als auch der Mikroperspektive ist fraglich, unter welchen Prämissen Volkswirtschaften und junge Unternehmen in der Lage sind, ihr generiertes Wissen in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln respektive dieses Wissen zu kommerzialisieren. Gerade aus volkswirtschaftlicher Sicht entstehen zu Beginn des Kommerzialisierungsprozesses bei der Erstkommerzialisierung multiplikative Effekte extrem hoher Wertschöpfung. Heute und in der Zukunft werden die maßgeblichen Herausforderungen für Wissensgesellschaften nicht nur darin liegen, ein Fundament an stetig neuem Wissen bereit zu halten, sondern dieses Wissen auch ökonomisch zu nutzen. Neben der sich abzeichnenden weiteren Zunahme der Komplexität des Innovationsprozesses aufgrund von z. B. kulturellen Faktoren, der Legitimation unternehmerischen Handelns durch die Gesetzgebung etc., rückt immer mehr die Personengebundenheit neuen Wissens in den Vordergrund. Das in der Person implizit verankerte Wissen in Form neuer Produkte, Technologien bzw. Neukombinationen (Abschnitt 2.2.1) lässt dem Individuum damit eine immer entscheidendere Rolle innerhalb des Innovationsprozesses zukommen.
Das Wissen generierende Individuum kann seinerseits dieser Herausforderung mit individueller Evolution bzw. Selbstevolution begegnen, denn Evolution ist die Grundlage von Inventionen. Wird eine Invention transformiert und am Markt durchgesetzt, kann von einer Innovation gesprochen werden.30 Die Zunahme des an Personen gebundenen Wissens erfordert strukturelle Kopplungen zwischen den Know-how-Trägern und dem ökonomischen System sowie dem Finanzsystem. Fragestellungen zu unterschiedlichen Finanzsystemen und deren daraus resultierenden Erfolg bzw. Misserfolg für die Finanzierung von Innovationen rücken als zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ab Abschnitt 3.3 in den Fokus der Analyse.
Die nachfolgenden Ausführungen geben zum besseren Verständnis einen Einblick über die in der Praxis vorherrschenden verschiedenen Formen der Wissensumwandlung, bevor in Abschnitt 2.2.2 auf die bereits angesprochene Problematik der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln als Innovationsblockade (der Knowing–Doing-Gap als vorherrschendes Paradigma) näher eingegangen wird.
2.2.1 Formen der Wissensumwandlung
Die in der Literatur anzutreffende Vielfalt unterschiedlichster Definitionen und Typologien zur Thematik Wissen zeigt bereits die Schwierigkeit bei dem Versuch, Wissen in Dimensionen zu manifestieren, ohne sich dabei überhaupt der Komplexität bei der Wissensapplikation im Innovationsprozess angenähert zu haben. Ungeachtet der zum Teil stark divergierenden Ansichten in der Ökonomik stützt sich Wissen häufig auf die Schaffung, Kommunikation sowie Anwendung und wird als zu entdeckende Ressource angesehen. Die nachfolgende Differenzierung verschiedener Wissensarten inklusive einer Wissensklassifikation kann die in der Realität auftretende Problematik im Umgang mit dieser Ressource gut abbilden.
Ähnlich der diffizilen Frage nach dem Wissensursprung verhalten sich die Möglichkeiten, Wissen in Worte zu fassen. Wissen stellt sich in unterschiedlichsten Facetten dar: beispielsweise von undokumentierbar bis hin zu dokumentierbar sowie von schwer artikulierbar bis einfach artikulierbar.31
Nonaka und Takeuchi illustrieren ein interessantes Beispiel zu geographisch bedingten Unterschieden im Wissensmanagement. Ihren Erkenntnissen folgend herrschen zwischen westlichen und östlichen Kulturen grundlegende Differenzen im Umgang mit der Ressource Wissen. Nach der Sichtweise des westlichen Managements wird Wissen als eindeutig quantifizierbar und formal angesehen. Demgegenüber steht die Sichtweise des östlichen Managements, wonach eine permanente Weiterentwicklung neuen Wissens zur Reaktion auf veränderte Kundenwünsche, Etablierung neuer Märkte und Entwicklung neuer innovativer Produkte erfolgsdeterminierend ist.32 Das Hauptdifferenzierungsmerkmal der östlichen, in diesem Fall japanischen Sichtweise, geht von einer Wissensgenerierung aus, die nicht nur – wie bei der westlichen Sichtweise - durch eine subjektive Verarbeitung von objektiven Informationen stattfindet, sondern implizite und subjektive Einblicke einzelner Individuen mit einbezieht.33 Als Folge lassen sich unterschiedliche Dimensionen der Wissensschaffung konstruieren.
Den frühesten wissenschaftlichen Ansatz zur Klassifikation von Wissen lieferte Polanyi mit seiner Aussage „We can know more than we can tell“.34 Polanyis These stammt aus dem Bereich der kognitiven Psychologie und unterstellt eine differente Form des Wissens von derjenigen, die sich einfach vermitteln oder kommunizieren lässt. Aus dieser Erkenntnis heraus differenziert er zwischen explizitem und implizitem Wissen, wobei beide Wissensformen in einer komplementären Beziehung zueinander stehen.35
Implizites Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es persönlich, kontextspezifisch und schwer kommunizierbar ist. Es vereint sowohl technische Elemente (know how) als auch kognitive Elemente (mentale Modelle zur Erzeugung von Analogien). Zum besseren Verständnis kann ein Beispiel herangezogen werden, bei dem sich ein Lernender neues Wissen durch Beobachtung und anschließender Imitation aneignet. Da sich das zu erlernende Wissen nur schlecht oder gar nicht in Worte fassen lässt, kann es folglich am besten ohne Sprache mittels Nachahmung aufgenommen werden.36
In Anlehung an Polanyis ersten Ansatz zur Existenz impliziten Wissens entwickelten sich konträre Denkschulen zum Thema Wissensproduktion, und die Materie fand in der ökonomischen Diskussion zunehmende Beachtung. Die Folge waren konträre wissenschaftliche Ansichten, aus denen zwei Denkschulen zur Wissensgenerierung hervorgingen; die Denkschulen der sogenannten „algorithmic models“ sowie der „enculturation models“.37
Die Erkenntnis über die Existenz impliziten Wissens, welches in nicht formaler Form vorliegt, nicht vermittelbar sowie nicht transferfähig ist, führte aufgrund dieser spezifischen Charakteristika zu einer Vielzahl an Kritikpunkten der in der ökonomischen Theorie einschließlich der Neoklassik weit verbreiteten algorithmischen Ansätze, da sich diese Dimension des Wissens nicht bzw. nur unzureichend in mathematischen Modellen abbilden lässt. Die einflussreichen Arbeiten von Nelson und Winter führten schließlich zu einer allgemeinen Anerkennung der Existenz sowie der enormen Bedeutung impliziten Wissens in den Wirtschaftswissenschaften. Deutlich wird dies anhand ihrer Aussage: „The knowledge that underlies skillfull performance is in large measure tacit knowledge, (…),38 die auch mit Polanyis Interpretation impliziten Wissens (tacit knowledge) als nicht artikulierbar übereinstimmt. Nelsons und Winters Umschreibung zeigt, dass ein großer, wenn nicht sogar der überwiegende Anteil des Wissens, nicht vermittelbar und damit nicht transferfähig ist.39 Daneben war auch Hayek die Problematik bzw. die Herausforderung impliziten Wissens bewusst. Seiner Ansicht nach existiert das Dilemma dieser Wissensdimension maßgeblich aufgrund der Gebundenheit an Personen, so dass ein Transfer als unmöglich erscheint.40 Im Hinblick auf das Ziel einer stetigen wirtschaftlichen Entwicklung kommt implizitem Wissen eine besondere Bedeutung zu, da die Nutzbarmachung dieser Wissensform in hohem Maße positiv mit der Entfaltung von Innovationsdynamik sowie der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft korreliert, wie sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit zeigen wird.41
Neben den wissenschaftlichen Arbeiten von Osterloh und Frey zu den Unterschieden zwischen implizitem und explizitem Wissen trugen die Untersuchungen von Nonaka und Takeuchi entscheidend zum Verständnis von explizitem Wissen bei.42 Nach Nonaka/Takeuchi ist explizites Wissen im Gegensatz zum impliziten formal und kann in systematischer Sprache ausgedrückt werden.43 Folglich ist explizites Wissen zwischen Personen durch Kommunikation direkt übertragbar, kann relativ leicht erlernt und genutzt werden. Demnach liegt das Wissen in eindeutig formal-quantifizierbarer Form mit universeller Gültigkeit vor. Der Wert des Wissens lässt sich daher anhand von quantitativen Größen wie Kosteneinsparungen, Effizienzzunahme oder Return on Investment unmittelbar bestimmen.
Insofern verwundert es nicht, dass explizites Wissen der Hauptuntersuchungsgegenstand des organisatorischen Wissensmanagements ist. Das Paradigma des klassischen Wissensmanagements mit dem primären Fokus auf der Dimension des expliziten Wissens führt aufgrund der unzureichenden Beachtung von „tacit knowledge“ zu immanenten Problemen, die sowohl bei der Implementierung von Innovationen (Abschnitt 2.2.2) als auch insbesondere bei finanzierungsrelevanten Fragestellungen, wie etwa bei der Beurteilung eines Innovationsvorhabens durch einen Finanzier (Abschnitt 3.3