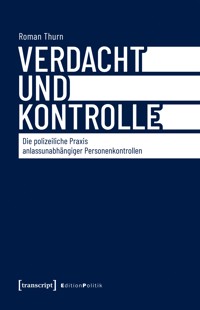
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Politik
- Sprache: Deutsch
»Guten Tag, Personenkontrolle« – für viele Angehörige marginalisierter Gruppen gehört diese polizeiliche Begrüßung zum Alltag. Roman Thurn analysiert anlassunabhängige Kontrollen vor dem Hintergrund praxistheoretischer und ethnomethodologischer Überlegungen als Interaktionsrituale, die auf eine Stigmatisierung der Betroffenen hinauslaufen. Er rekonstruiert die Genese des polizeilichen Verdachts als einen Prozess der In-/Kongruenz, in dem nicht nur Racial Profiling eine tragende Rolle spielt. Dabei zeigt sich: Die soziale Identität der Betroffenen wird im Zuge der Kontrolle im Sinne Erving Goffmans beschädigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 802
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft
und die Open Library Community Politik 2024 – einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr-Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Roman Thurn
Verdacht und Kontrolle
Die polizeiliche Praxis anlassunabhängiger Personenkontrollen
Zugleich Dissertation an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, abgegeben am 20. April 2023 und verteidigt am 28. Februar 2024.
Die Erstellung der Dissertation wurde durch ein Promotionsstipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Lizenz (BY-NC-SA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium zu nicht-kommerziellen Zwecken, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Um Genehmigungen für die Wiederverwendung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an [email protected]
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 im transcript Verlag, Bielefeld
© Roman Thurn
Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen
https://doi.org/10.14361/9783839475775
Print-ISBN: 978-3-8376-7577-1
PDF-ISBN: 978-3-8394-7577-5
EPUB-ISBN: 978-3-7328-7577-1
Buchreihen-ISSN: 2702-9050
Buchreihen-eISSN: 2702-9069
Interviewer: »You’ve given a lot of audiences shock sitting in the stalls, you’ve frightened me to death with Psycho. What frightens you?«Alfred Hitchcock: »Policemen«.
Inhalt
Lesehinweise
I.Die anlassunabhängige Kontrolle
1.Gefährliche Orte in Deutschland: Bestandsaufnahme
2.Rechtliche Unbestimmtheit & Räumlicher Ausnahmezustand
3.Fetischismus der Sicherheit & Kontrollsucht
II.Methoden & Reflexion
1.Felder & Feldzugänge: Die Akteure Gefährlicher Orte
2.Datenkorpus & -erhebung
3.Auswertung
4.Reflexion: Die eigene Positionierung im Feld
III.Subjektive Sicherheit: Anwohner- & Unternehmerbeschwerden
IV.Objektive Sicherheit: Die Positivierung der Kriminalität
1.Deliktfelder
2.Die Effizienz verdachtsunabhängiger Kontrollen
V.Verdachtsmoment: Die Auswahl des zu Kontrollierenden
1.Die Konstruktion polizeilichen Verdachts als In-/Kongruenzprozess
2.Die polizeiliche Berufs- und Lebenserfahrung
3.»Also so ist der Bürger dann, ne?«: Polizeiliche Mythen & Figurationen
Exkurs: Figurationen der ›Asozialität‹ & postnazistische Kontinuitäten
4.Aspekte der In-/Kongruenz: Verdachtsmomente
5.»Warum will der mir jetzt so eine Lügengeschichte aufbinden?«. Verdacht während der Kontrolle
6.Neutralisierung des Verdachts
7.Zwischen Prävention und Repression: Der bekannte Verdächtige
8.Synthese der In-/Kongruenz: Figurationen kriminogener Milieus
VI.Degradierungszeremonien: Die Kontrolle von Identität und Sachen
1.Ansprache & Legitimation der Kontrolle
2.Interaktive Verdachtskonstruktion: Datenbankabfragen & Gespräche als Interaktionsrituale
3.Konfrontation & Kooperation
4.Durchsuchung
5.Eskalationsdynamiken: Provokationen, Körper- & Materialeinsatz
6.Die Mitnahme zur Dienststelle: Erkennungsdienstliche Behandlung
7.»Das kommt drauf an, wer kommt«: Der polizeiliche Habitus
8.Umstehende als Verkörperung des Generalisierten Anderen: Intervention in die Maßnahme
9.Control Junkies: Die Doxa der Personenkontrolle
VII.Das Stigma anlassunabhängiger Kontrollen
1.Illegitimität proaktiver Kontrollen: Jenseits der Verfahrensgerechtigkeit
2.Affektueller Ausnahmezustand
3.Un-/Rechtsbewusstsein: Der laienhafte juridische Habitus
4.Das Stigma anlassunabhängiger Personenkontrollen
Exkurs I: Negativerfahrungen Betroffener mit der Polizei außerhalb von Kontrollen
Exkurs II: Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen außerhalb der Polizei
5.Beschädigte Praxis? Die alltäglichen Folgen des Stigmas
VIII.Polizeiliche Identitätskonstruktion
XI.Zusammenfassung: Drei Argumente zu anlassunabhängigen Personenkontrollen
Literaturverzeichnis
Lesehinweise
Zur besseren Lesbarkeit wurden Nachweise im Fließtext, die sich auf im Rahmen dieser Arbeit erhobenes empirisches Material beziehen, entfernt. In Zitaten wurden »äh« und ähnliche Füllwörter gestrichen. Ansonsten erfolgten keine grammatikalischen oder orthographischen Anpassungen. Im Wissen, dass wissenschaftliche Monographien selten von Anfang bis Ende gelesen werden, wurden manche Zitate in unterschiedlichen Kapiteln wiederholt aufgegriffen und unter je unterschiedlichen Aspekten diskutiert. Für etwaige Redundanzen für diejenigen, die das Buch »covert to cover« lesen, möchte ich mich hierfür entschuldigen.
Es wurde versucht, eine möglichst geschlechtsneutrale Sprache zu verwenden. Da das Gendern im Singular und bei in Hinblick auf das Geschlecht anonymisierten Sprechenden das Lesen unverhältnismäßig erschwert, wurde die ›maskuline‹ Form für alle (analog zur Streichung der Nachsilbe -ess infolge der Durchsetzung eines geschlechtergerechten Englisch) verwendet.
I.Die anlassunabhängige Kontrolle
1.Gefährliche Orte in Deutschland: Bestandsaufnahme
»Was haben Sie denn jetzt für ein Problem mit einer polizeilichen Standardmaßnahme?«(FP_Autoethnographie, Pos. 10)
Am 04. Januar 2014 erklärte die Hamburger Polizei weite Teile Altonas zum Gefahrengebiet. Der Begriff des Gefahrengebiets rückte damit erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit – jenseits der politisch und wissenschaftlich interessierten Milieus. Heribert Prantl (2014) nannte die Einrichtung des Gefahrengebiets in der Süddeutschen Zeitung etwa einen ›kleinen Ausnahmezustand‹. Über die Demonstrationen während der Ausrufung des Gefahrengebiets, das den Wohnraum von etwa 80.000 Personen (Assall und Gericke 2016: 62) umfasste, berichtete auch die Tagesschau (2014b): Betroffene kommen zu Wort, deren Alltag erheblich durch die Kontrollen eingeschränkt würde, aber auch von Ausschreitungen im Rahmen der Proteste ist die Rede. Der Anlass zur Ausrufung des Gefahrengebiets war ein vermeintlicher Angriff auf die Davidwache in Hamburg, Sankt Pauli. Doch auch die Proteste im unmittelbaren Vorfeld dieses vermeintlichen Angriffs, wie die gegen die Räumung der Roten Flora und den Abriss der Esso-Häuser, sowie die Proteste Geflüchteter (Lampedusa in Hamburg, die bereits zuvor von anlassunabhängigen Kontrollen betroffen waren), schufen aus Perspektive der Polizei die sozialen und politischen Voraussetzungen für die Ausrufung des Gefahrengebiets (Madjidian 2014: 80; Schröder 2014: 59). Die Demonstrationen gegen das Gefahrengebiet wurden von Spaziergängen Protestierender begleitet: Anwohnende bewegten sich gezielt in das Gefahrengebiet, um dort polizeiliche Kontrollen zu provozieren und die Beamten vorzuführen – etwa, indem die Spaziergänger absurde Gegenstände bei sich führten, die die Polizisten bei Durchsuchungen entdecken sollten. Die Klobürste, die ein Protestierender sich in die Rückseite der Hose gesteckt hatte, wurde zum Symbol des Hamburger Protests, nachdem ein Video hiervon im Nachtmagazin der ARD am 07. Januar 2014 ausgestrahlt wurde. Am 9. Januar verkleinerte die Polizei Hamburg das Gefahrengebiet und beschränkte es auf das Gebiet um drei Polizeiwachen, ehe sie es am 13. Januar gänzlich aufhob (Assall und Gericke 2016: 62). Hamburgs damaliger Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), nun Bundeskanzler, verteidigte die Einrichtung der Gefahrengebiete gegen Kritik. Im Nachtmagazin der ARD nannte der Sprecher der Hamburger Polizei Mirko Schreiber die Gefahrengebiete einen Erfolg (Tagesschau 2014a).
Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Produktion eines sozialen Stigmas durch polizeiliche anlassunabhängige Personenkontrollen an sogenannten Gefährlichen Orten. Im Folgenden stelle ich die deutschsprachige Diskussion um anlassunabhängige Personenkontrollen an Gefährlichen Orten dar. Dabei sollen vornehmlich wissenschaftliche, doch auch zivilgesellschaftliche Beiträge Berücksichtigung finden. Damit soll sowohl der Stand der Forschung als auch der Stand der politischen Diskussion (zunächst nur) in Deutschland abgebildet werden. Ich werde dabei bereits einigen meiner Thesen, die in späteren Kapiteln ausführlich diskutiert werden sollen, vorweggreifen, um die Stoßrichtung der Arbeit kenntlich zu machen.
In Deutschland steht es der Polizei1 offen, an bestimmten Orten Personen ohne einen konkreten Anlass aufzuhalten und ihre Identität festzustellen. Diese Orte sollen im Folgenden Gefährliche Orte genannt werden.2 Diese Kontrollen erfolgen auf Grundlage des Gefahrenabwehrrechts und nicht des Strafprozessrechts. Ein konkreter Verdacht, im Sinn der Strafverfolgung, ist also nicht notwendig: Die Kontrolle erfolgt noch bevor eine Straftat im Begriff ist, begangen zu werden. Sie erfolgt anlassunabhängig, proaktiv und präventiv.3 Mit dem Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz brachte die Innenministerkonferenz diese Möglichkeit auf den Weg. In den 1990er und 2000er Jahren implementierten die Länder den Entwurf. Die Voraussetzungen unterscheiden sich in den jeweiligen Bundesländern nur marginal (siehe ausführlich Keitzel 2020): Grundsätzlich besagen die jeweiligen Gesetzestexte, dass die Polizei befugt ist, dort Personen ohne konkreten Anlass zu kontrollieren, wenn sie über Kenntnisse verfügt, dass an diesen Orten Straftaten verübt oder geplant werden. Im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz Art. 13 Abs. 1 S. 2 heißt es diesbezüglich zum Beispiel:
(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen […] 2. wenn die Person sich an einem Ort aufhält, a) von dem auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass dort aa) Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, bb) sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen, oder cc) sich Straftäter verbergen, oder b) an dem Personen der Prostitution nachgehen, oder c) der als Unterkunft oder dem sonstigen, auch vorübergehenden Aufenthalt von Asylbewerbern und unerlaubt Aufhältigen dient.
Die Bundespolizei verfügt ebenfalls über die Möglichkeit, nach § 22 Abs. 1a BPolG anlassunabhängig Personenkontrollen durchzuführen. Zudem sehen die Landespolizeigesetze fast aller Bundesländer mit einer Außengrenze, und aller Länder mit einer Ostgrenze, die Möglichkeit anlassunabhängiger Kontrollen in einem Bereich von bis zu 30 km bis zur Grenze vor. Diese als Schleierfahndung bekannt gewordene Form anlassunabhängiger Kontrollen ermöglicht nach dem Wegfall der europäischen Binnengrenzen mit dem Schengen-Abkommen polizeiliche Kontrolltätigkeiten (vgl. Thurn 2023; für die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Schleierfahndung Aden 2017: 57f.).
Die Kontrolle umfasst ein Maßnahmenbündel (Fährmann et al. 2023): Primär ist es der Polizei erlaubt, die Identität der kontrollierten Person festzustellen. Hierfür sichtet sie den Ausweis oder andere Dokumente der Betroffenen, die einen Hinweis auf deren Identität liefern. Daraufhin erfolgt in der Regel eine Abfrage verschiedener, insbesondere polizeilicher Datenbanken. Die Beamten können darüber hinaus die Betroffenen (bis hin zu ihren Körperöffnungen; Keller 2018: 20) und die von ihnen mitgeführten Sachen durchsuchen. Falls die Identität der Person bis dahin nicht festgestellt werden konnte, sind die Beamten zudem befugt, sie auf die Dienststelle zu bringen.
Die Polizei begründet die Einrichtung Gefährliche Orte mit der Bekämpfung verschiedener Delikte (wobei die diskursive Legitimation und die reale Praxis anlassunabhängiger Personenkontrollen sich nicht notwendig decken): Zentral ist die Bekämpfung des Konsums oder Handels illegalisierter Betäubungsmittel (Keitzel und Belina 2022: 14; Keller 2018: 20; Ullrich und Tullney 2012). Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht werden in einigen der Polizeigesetze als weitere Gründe für die Einrichtung Gefährlicher Orte genannt (ausführlich Keitzel und Belina 2022: 222ff.; Schröder 2014: 62ff.). Auch Orte, an denen der Prostitution nachgegangen wird, werden in einigen der Landespolizeigesetze angeführt (siehe oben; Keitzel und Belina 2022: 13f.; Künkel 2013, 2020) – wobei die Polizei in diesem Kontext vornehmlich Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht durch Sexarbeitende ahndet (Loick 2018: 22). »Diskotheken, Gaststätten, Spielhallen« (BayLT Drs. 17/19781, S. 3) sind, wie das Bayerische Innenministerium (StMI) verlautbart, ebenfalls potentiell Gefährliche Orte. Kleinkriminalität, wie etwa in Form von Diebstahl oder Trickbetrug (Keitzel und Belina 2022: 14f.), kann die Einrichtung Gefährlicher Orte ebenso legitimieren wie schwerere Gewaltkriminalität (Belina und Wehrheim 2011: 219) oder Wohnungseinbruchsdiebstähle (ebd.: 219). Letztere, sowie der Handel mit illegalisierten Betäubungsmitteln und Waffen und Prostitution werden häufig unter den Begriff der ›grenzüberschreitenden Kriminalität‹ subsumiert und als Gründe für anlassunabhängige Personenkontrollen in Grenzgebieten oder an Flughäfen und Bahnhöfen genannt (Thurn 2023). Im Vorfeld oder Nachgang von Fußballspielen ruft die Polizei bisweilen ebenfalls Gefährliche Orte aus, um Fußballfans proaktiv kontrollieren zu können (Belina und Wehrheim 2011: 219). Wie bereits angeführt, können auch politische Proteste für die Polizei einen hinreichenden Grund darstellen, Personen ohne konkreten Anlass kontrollieren zu wollen (Madjidian 2014; Petzold und Pichl 2013; Schröder 2014: 65). Im Kontext des »protest policing« muss auch die polizeiliche Begründung verortet werden, durch proaktive Personenkontrollen (Auto-)Brandstiftungen verhindern zu wollen (Belina und Wehrheim 2011: 219; Schröder 2014: 65). Politische Wohnprojekte oder Kulturzentren, wie die Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain (Belina 2018b: 127; Zech und Jennissen 2016), das Conne Island in Leipzig (Ullrich und Tullney 2012) oder auch Räume, in denen generell (politische) Subkultur gepflegt wird, wie etwa am Connewitzer Kreuz in Leipzig (Ullrich und Tullney 2012), sind häufiger als Gefährliche Orte deklariert. In Bayern sind seit dem 01. Januar 2017 die Unterkünfte und Orte des Aufenthalts Asylsuchender und Geflüchteter per seGefährliche Orte (Ziyal 2017, 2018; Thurn 2022): Neben der Bekämpfung von Betäubungsmittel- und Gewaltkriminalität zielt dies auch auf die Verfolgung einer spezifischen Form des Hausfriedensbruchs – des sogenannten ›Fremdschlafens‹.4
Diese Liste spiegelt hauptsächlich die diskursive Legitimation der jeweiligen Einrichtung von Gefährlichen Orten wider. Die verschiedenen Delikte und Deliktfelder führen Polizei und Politik regelmäßig an, um die Ausrufung Gefährlicher Orte zu begründen. Die praktischen Ziele der Kontrollen weichen aber bisweilen von den genannten Zielen ab. Der Hamburger Senat erklärte etwa bei der Novellierung des Hamburger Polizeigesetzes in der Gesetzesbegründung, dass neben Einbruchsserien oder besonderen Ausprägungen von Gewaltdelikten auch der Menschenhandel oder der Schmuggel von Waffen über den Hamburger Hafen anlassunabhängige Kontrollen notwendig mache. Tatsächlich führt die Hamburger Polizei kaum proaktive Kontrollen durch, die darauf zielen, diese Delikte zu bekämpfen (Assall und Gericke 2016: 61; Madjidian 2014: 80). Zudem bestehen lokale Varianzen hinsichtlich der Zielsetzungen, die die Polizeien mit der Einrichtung Gefährlicher Orte je verfolgen. Je nach Lageerkenntnis können unterschiedliche Delikte, und damit auch unterschiedliche Personengruppen, im polizeilichen Fokus stehen (Assall 2014: 78).
Damit ist die Schwierigkeit benannt, über Gefährliche Orte im Allgemeinen zu sprechen. Diese Schwierigkeit ist aber keine Unmöglichkeit. Es zeigt sich bereits an diesem Punkt, dass Polizei und Politik Formen der Kriminalität, die eine ›Gefahr‹ im alltagssprachlichen Sinn bedeuten – also insbesondere eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit, wie Gewaltdelikte – in der diskursiven Legitimation proaktiver Kontrollen mit Delikten vermengen, die für Dritte keine unmittelbare Gefahr darstellen (Keller 2018: 20). Prostitution, Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht oder der Handel und Konsum illegalisierter Betäubungsmittel (wobei insbesondere der Konsum das ›opferlose Verbrechen‹ par excellence ist) gefährden Dritte, wenn überhaupt, allenfalls mittelbar. Gefährliche Orte sind also nicht per se ›gefährlich‹.5 Peter Ullrich und Marco Tullney sehen den Grund für die Bekämpfung des Handels (und Konsums) illegalisierter Betäubungsmittel weniger in der Bekämpfung etwaiger (nicht rechtlich zu verstehender) Gefahren, sondern im Versuch der Wiederherstellung des (verloren geglaubten) staatlichen Gewaltmonopols in einem bestimmten Raum (Ullrich und Tullney 2012). Dieser Befund lässt sich auch auf andere ›opferlose‹ Deliktfelder übertragen.
›Opferlose‹ Verbrechen generieren bisweilen den Unmut der Öffentlichkeit, etwa, wenn sie das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl von Anwohnenden, Passanten, Touristen oder anderen beschwerdemächtigen Personengruppen beeinträchtigen. Die ›Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls‹ begründet die Verfolgung opferloser Verbrechen (Assall und Gericke 2016: 68). Die Milieus der Betroffenen werden dabei diskursiv – von Behörden, Medien und kommunaler Politik – »aus der Anwohner/innenschaft herausgerechnet« (Ullrich und Tullney 2012). »Incivilities«, also Verletzungen der öffentlichen Ordnung,und die Bekämpfung von »quality of life crimes« rücken in den Blick: Neben den genannten Deliktfeldern sind auch das »Sprühen von Graffiti, das Abspielen lauter Musik oder das Schwarzfahren« (Perthus 2016: 42) »incivilities«, die kommunal bekämpft werden sollen. Gegen Teile der genannten »incivilities« kommen anlassunabhängige Personenkontrollen zum Einsatz, und wieder andere bekämpfen die kommunalen Sicherheitsbehörden durch die Einrichtung kommunaler Ordnungsdienste oder lokaler Gefahrenabwehrverordnungen, die das Trinken oder Betteln im öffentlichen Raum reglementieren oder verbieten (Thurn 2020, 2021).
Die Bekämpfung von »incivilities« ist Teil einer sicherheitspolitischen Reorientierung: Seit den 1990er Jahren können verstärkte punitive Tendenzen in der (nicht nur) kommunalen Sicherheitspolitik beobachtet werden (Belina und Wehrheim 2011: 217f.; Feeley und Simon 1992; Garland 1996, 1997, 2001; Wacquant 2009). Diese zielen auf die Kontrolle marginalisierter und armer, häufig auch rassifizierter Bevölkerungsgruppen.6 Die Punitivität, das Bedürfnis zu strafen, ist nicht allein reaktiv. Es zielt also nicht bloß auf die Verfolgung einer bereits begangenen Straftat. Vielmehr artikulieren die Behörden, ebenso wie Teile der Bevölkerung, eine Vorfeldorientierung, in der sie potentielle Straftaten, im Sinn einer kriminogenen Potentialität, bestimmten Bevölkerungsgruppen zurechnen, die sie deshalb proaktiv und präventiv in bestimmten Räumen zu bekämpfen wünschen (für den Präventionsgedanken vgl. stellvertretend für viele Opitz 2012: 315ff., für die Implikationen für Gefährliche Orte ebd.: Fn. 273).
Bernd Belina und Jan Wehrheim unterscheiden zwei Typen gefährlicher Räume: Erstens kategorisiert die Polizei solche Räume als Gefährliche Orte, die in ihrer jeweiligen Normalität als gefährlich gelten, wie etwa bekannte Umschlagplätze für illegalisierte Betäubungsmittel oder Orte, an denen Sexarbeit angeboten wird. Der zweite Typus Gefährlicher Orte sind Räume, deren Normalität durch das abweichende Verhalten einer bestimmten Gruppe von Personen als gefährdet gilt, wie etwa bestimmte Bahnhöfe oder Parks (Belina und Wehrheim 2011: 217; Ullrich und Tullney 2012). Welcher Ort durch welche Gruppe gefährdet wird, und welche Orte gerade in ihrer Normalität als gefährlich gelten, hängt dabei von den verschiedenen Delikten ab, die Polizei und Anwohnende dort erwarten oder vorfinden.
Entsprechend der erwarteten Deliktfelder variieren die Merkmale, anhand derer die Polizei die verdächtige bzw. verdächtigte Klientel identifiziert. Ausschlaggebend sind gemeinhin das Alter, das Geschlecht und die Haut- und Haarfarbe (also die unterstellte ›Ethnizität‹, die Polizeibeamte auch an anderen Charakteristika wie der Physiognomie, bestimmter Kleidung oder auch dem KFZ-Kennzeichen identifizieren7) sowie die Kleidung, die hauptsächlich als Indikator des sozioökonomischen Status identifiziert wird (vgl. pars pro toto Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling – Gefährliche Orte abschaffen 2018; Belina 2018b; Belina und Wehrheim 2011; Fährmann et al. 2022b; Jobard et al. 2012; Jobard und Lévy 2013; Keller und Leifker 2017; Keller 2018; Thurn et al. 2023; Thurn 2023). Wer sich an diesen Orten aufhält und dabei verdächtige Merkmale aufweist, der läuft Gefahr, kontrolliert zu werden. Dieser Generalverdacht ist, wie Svenja Keitzel betont, paradoxer- und notwendigerweise selektiv, und trifft insbesondere marginalisierte Bevölkerungsgruppen (Keitzel 2020: 5). Die Polizei darf zwar jeden aufhalten und kontrollieren, sie wählt jedoch nur Angehörige einer spezifischen Gruppe, je nach Ort und vermutetem Deliktfeld, für Kontrollen aus. Die Polizei selektiert dabei bisweilen nicht bloß eigenmächtig: In bestimmten Bereichen ist sie durch den Gesetzgeber aufgefordert, sozial selektiv zu kontrollieren (Keitzel und Belina 2022; Tomerius 2019).
An Gefährlichen Orten ist das Verhalten der jeweils Betroffenen, wie Carolyn Tomerius anmerkt, gerade nicht das entscheidende Kriterium für die Auswahl zu einer Kontrolle. Daher müssen sich die Beamten mit einer gewissen Zwangsläufigkeit an äußeren Erscheinungsmerkmalen orientieren (Tomerius 2017: 1405; Tomerius 2019: 1586). Allerdings ist, wie ich zeigen werde, das Verhalten der Betroffenen für die Konstitution eines Verdachts keineswegs irrelevant. Nur werden an Gefährlichen Orten jene Verhaltensweisen verdächtig, die in anderen Kontexten als ›normal‹ und unauffällig, oder wenigstens als kaum hinreichend für eine Kontrolle gelten würden.
Besonders jene Polizeigesetze, die Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, eine unerlaubte Einreise oder einen unerlaubten Aufenthalt zum Anhaltspunkt zur Ausrufung Gefährlicher Orte machen, legen RacialProfilingnahe. Racial Profiling8vollziehen die Polizeibeamten in diesen Fällen im Sinn einer Selektion entlang von Kriterien, die irgend nur eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit indizieren (Keitzel und Belina 2022: 11). Hierbei knüpfen die Polizeibeamten in der Praxis, auch, wenn dies de jurenicht erlaubt ist, an der zugeschriebenen ›Ethnizität‹ (also insbesondere der Haut- oder Haarfarbe) der Betroffenen an. Auch im Zusammenhang mit anderen Delikten, wie etwa Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Keitzel und Belina 2022: 14) oder Diebstahlsdelikten (Tomerius 2019: 1588), ist dies der Fall. In besonderem Maße gilt dieser Befund für die bayerische Regelung, welche die Unterkünfte Geflüchteter zu Gefährlichen Orten macht (Keitzel und Belina 2022: 12; ausführlich Thurn 2022: 251ff.). Durch die Vorgabe des Gesetzgebers ist der Rassismus institutionalisiert.
Diese institutionalisierte Zwangsläufigkeit des Racial Profilingwurde bereits in Bezug auf die Schleierfahndung konstatiert (Herrnkind 2000, 2014b; für die weitere Verdachtskonstruktion im Grenzgebiet siehe Thurn 2023). Wie der akj-berlin zeigt, würde (für einige Juristen) aus einer »vermeintlich verfassungskonformen Auslegung der Befugnisnormen« (akj-berlin 2013: 15) folgen, dass, um dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem Übermaßverbot zu entsprechen, nicht alle Personen im Grenzgebiet kontrolliert werden dürften. Vielmehr könnten nur jene kontrolliert werden, bei denen ein Bezug zum polizeilichen Auftrag, nämlich der »Bekämpfung der grenzüberschreitenden (organisierten) Kriminalität« zu erkennen sei. Allgemeine Kontrollen würden stattdessen den Charakter von Grenzübertrittskontrollen annehmen, die explizit gegen das Schengener Abkommen verstoßen würden (ebd.: 15f.). Aufgrund des so gesetzlich institutionalisierten Rassismus säßen die Beamten (und erst recht die Betroffenen) in der »Diskriminierungsfalle« (ebd.). Gerade weil nicht jeder kontrolliert werden dürfe (oder könne), würden die Beamten bei ihrer Auswahlentscheidung an die äußere Erscheinung; an Haut- und Haarfarbe der Betroffenen anknüpfen (ebd.: 17; vgl. auch Aden 2017: 63).
Die (rassistische) Selektionspraxis ist auch Gegenstand einer zivilgesellschaftlichen Kritik. Sie beschränkt sich allerdings nicht bloß auf die Selektion zur Kontrolle, sondern rückt auch die Praxis und Interaktion der Kontrolle selbst in den Fokus (Autor*innenkollektiv Gras & Beton 2018; Kampagne für Opfer Rassistischer Polizeigewalt 2016). Die Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling – Gefährliche Orte abschaffen (2018) bezeichnet die vermeintlich anlass- oder verdachtsunabhängig stattfindenden Kontrollen an Gefährlichen Orten als demütigend für die Betroffenen. Im Sinn einer aktivistischen Forschung sammelte die Kollaborative Forschungsgruppe Racial Profiling (2019) Erfahrungsberichte von Betroffenen von Kontrollen und Racial Profiling. Sie berichten ausführlich von den Demütigungs- und Degradierungserfahrungen im Kontext von (wiederholten) Personenkontrollen – die langfristige Folgen auf ihre psychische Gesundheit und ihren lebensweltlichen Alltag haben. Diese Aussagen werden in Deutschland wissenschaftlich gestützt. Svenja Keitzel und Bernd Belina (2022) beschreiben die Kontrollen an Gefährlichen Orten in einer postkolonialen Perspektive als »strange encounters«: Durch die Kontrollen reproduziere die Polizei in der unmittelbaren Begegnung mit den Betroffenen de factoeine Ungleichheit, welche de jureabgeschafft scheint.9
Kritische humangeographische und raumsoziologische Arbeiten machten darüber hinaus auf die Fetischisierung vermeintlich kriminogener Räume aufmerksam (Belina und Wehrheim 2011; Belina 2018b). Durch die Konstruktion gefährlicher Räume wird das Labelingabweichender Gruppen verdinglicht (Perthus 2016: 39; Fejge 2019): Die Zuschreibung einer normativen Abweichung erscheint als eine Eigenschaft des Raums selbst. Dieser Raumfetischismus (Belina 2017a) intensivierte sich in den letzten Jahren durch Technologien des »crime mapping« (Belina und Wehrheim 2011: 212f.; Straube und Belina 2018) oder Predictive Policing(Egbert 2018b; Thurn und Egbert 2019). Die Konstruktionsleistung des Raums als verdächtig verschwindet in der Blackboxder Algorithmen.
Generell stellten und stellen Gefährliche Orte eine Blackboxdar. In den meisten Bundesländern und Städten sind die genaue Zahl der Gefährlichen Orte und ihre genaue Lage nicht bekannt (Ullrich und Tullney 2012; wobei sich in den letzten Jahren an deren Befund nur wenig verändert hat). In Berlin werden die ›Kriminalitätsbelasteten Orte‹ (KbO) seit dem 7. Juni 2017 bekanntgegeben (Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling – Gefährliche Orte abschaffen 2018: 187). Wie groß diese jedoch tatsächlich sind, und wo die Grenze zwischen Gefährlichen und ›Ungefährlichen‹ Orten verläuft, gibt die Berliner Polizei aber nicht bekannt (vgl. Zech und Jennissen 2016 – an deren Befund zur Größe von KbOs hat sich auch nichts geändert). Lediglich in Bremen sind die ›Besonderen Kontrollorte‹ online explizit ausgewiesen (Arzt und Wiese 2021: 264). In Bayern wiederum gab das StMI an, über Zahl und Ort der Gefährlichen Orte keine Angabe machen zu können (BayLT Drs. 18/363).
Doch nicht nur die genaue räumliche Lage der Gefährlichen Orte ist für die Zivilbevölkerung opak. Auch das institutionelle Zustandekommen Gefährlicher Orte ist undurchsichtig (Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling – Gefährliche Orte abschaffen 2018: 187; Ullrich und Tullney 2012). Wer entscheidet über die Gefährlichkeit eines Orts? Im Fall des Altonaer Gefahrengebiets im Januar 2014 war offenkundig nicht einmal der Polizeipräsident über dessen Ausrufung informiert (Madjidian 2014: 81). Zweifelsfrei steht lediglich fest, dass die Festlegung von Gefährlichen Orten in der Regel nicht durch den Gesetzgeber, sondern die Polizei erfolgt (Pichl 2014: 255). Nur in Bremen ist zumindest eine Ausrufung von Besonderen Kontrollorten ohne Einvernehmen des Senators für Inneres nicht mehr möglich (Bremen_Erlass 17.08.2021). Ausnahmen hierzu sind diejenigen landes- und bundespolizeilichen Regelungen, die anlassunabhängige Kontrollen im Grenzgebiet, an Bahnhöfen und Flughäfen, den Unterkünften Geflüchteter oder Orten, an denen der Prostitution nachgegangen wird erlauben. Hier sind die Gefährlichen Orte vom Gesetzgeber selbst festgelegt, und bedürfen daher keiner weiteren polizeilichen Entscheidung.
Darüber hinaus kritisierten verschiedene Autoren die Ineffizienz anlassunabhängiger Kontrollen (Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling – Gefährliche Orte abschaffen 2018: 187; Belina 2018b: 126; für verschiedene Hamburger Gefahrengebiete in den 2000er Jahren Belina und Wehrheim 2011): Da proaktive Kontrollen an kein sichtbar strafbares Verhalten anknüpfen, kann bereits ein vager polizeilicher Verdacht hinreichend für eine Maßnahme sein. Der Prozentsatz von Folgemaßnahmen im Anschluss an Identitätsfeststellungen an Gefährlichen Orten, die darauf schließen lassen würden, dass die Kontrolle einen ›Treffer‹ gezeitigt hat, liegt zumeist im einstelligen Prozentbereich. Bei den ›Treffern‹ selbst ist außerdem fraglich, ob nicht bereits Kontrollen nach der Strafprozessordnung zulässig gewesen wären, da das Verhalten der Betroffenen bereits für eine reaktive Kontrolle hinreichend auffällig gewesen ist und einen konkreten Anlass gegeben hätte. Für Grenzkontrollen der Bundespolizei zeigt sich, dass über 99 % der durchgeführten Kontrollen im Jahr 2020 keine ›Treffer‹ erzielt haben (Keitzel und Belina 2022: 13). Als gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen dienen proaktive Kontrollen aber nicht allein der Aufdeckung etwaiger Straftaten, sondern auch ihrer Vorbeugung und Prävention, sodass das Ausbleiben von ›Treffern‹ im engeren Sinn noch nicht notwendig einen Misserfolg indiziert. Der Erfolg von Prävention ist jedoch schwer zu messen: Retrospektiv lässt sich nie mit Bestimmtheit sagen, ob ein (vermeintlich) verhindertes Ereignis auch stattgefunden hätte, wenn man nicht eingegriffen hätte. Einer Beantwortung dieser Frage kann man sich lediglich in der Theorie annähern. Allerdings ist in Hinblick auf anlassunabhängige Personenkontrollen schwer zu begründen, wie die Aufhebung der Anonymität potentieller Straftäter diese effektiv von der Begehung von Straftaten abhalten solle (so auch Aden 2017: 60); oder wie die festgestellten Identitäten im Nachgang etwaiger Straftaten bei der Ermittlungstätigkeit dienlich sein sollten (Assall und Gericke 2016: 65f.; so auch das OVG Hamburg am 13.05.2015, 4 Bf – 12/226; vgl. Tomerius 2019: 1584, 1586).
Neben dem Sammeln von Indizien und der Aufhebung der Anonymität Betroffener verfolgt die Polizei auch das Ziel, eine bestimmte Klientel von Gefährlichen Orten des zweiten Typs (s.o.) zu verdrängen (Keller 2018: 23f.). Dieses Ziel verfolgt die Polizei bisweilen mit Erfolg. Für Leipzig konstatierten Peter Ullrich und Marco Tullney (2012), dass die Verdrängung von Betäubungsmittelkonsumierenden so erfolgreich war, dass die Angebote der aufsuchenden Sozialen Arbeit von den Betroffenen nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Die Verdrängung einer als unliebsam gelabelten Klientel dient damit nicht zuletzt der Gentrifizierung, also der Aufwertung bestimmter urbaner Viertel (Belina 2018a: 5; Ullrich und Tullney 2012). In diesen Vierteln zeigt die Polizei zudem ›Präsenz‹: Sie suggeriert nicht nur der betroffenen Klientel, dass sie im Fokus der polizeilichen Aufmerksamkeit steht, sondern auch der beschwerdemächtigen Klientel, dass ihre Sorgen und Beschwerden ernstgenommen werden.
Daher kommen an Gefährlichen Orten auch weitere Maßnahmen zum Einsatz: Neben den bereits genannten Gefahrenabwehrverordnungen oder der Einführung kommunaler Ordnungsdienste, die die Polizei bei der Verfolgung von »incivilities« entlasten, installieren die Kommunen an bestimmten Gefährlichen Orten Videokameras (Perthus 2016: 41f.; für München BayLT Drs. 18/363). Bisweilen bauen die Kommunen zurück, um für eine als unliebsam erachtete Klientel den Aufenthalt an bestimmten Orten unattraktiv zu machen. Dies bedeutet etwa den Rückbau von Parkbänken oder bspw. des sogenannten ›Schwammerls‹ (Bairisch für Pilz), des einstigen Vordachs am Münchner Hauptbahnhof, unter welchem sich häufiger ›Stammsteher‹, eine Szene von Alkohol Trinkenden, aufhielten. In öffentlich zugänglichen Toiletten installieren deren Anbieter hin und wieder blaues Licht, um den intravenösen Konsum von Betäubungsmitteln zu erschweren. Nicht zuletzt beschallen die Kommunen bestimmte Orte, wie Bahnhofsvorplätze oder U-Bahnhöfe, in einer womöglich nicht beabsichtigten Reminiszenz an die Folterszenen aus Clockwork Orange, mit klassischer Musik, um Obdachlose daran zu hindern, dort zu schlafen (Nagel 2017).
In dieser kurzen Darstellung der deutschsprachigen Diskussion zeigt sich bereits, dass die Produktion subjektiver oder objektiver Sicherheit durch anlassunabhängige Kontrollen fragwürdig ist, während sie politisch kontrovers diskutiert werden. Ich werde im Verlauf dieser Arbeit daher drei Thesen entwickeln:
1. Die Polizei wählt die zu kontrollierenden Personen durch einen In-/Kongruenzprozess (vgl. Sacks 1972) aus, der sich durch eine figurative Kombinatorik verdächtiger und unverdächtiger Merkmale auszeichnet. Die Polizisten hegen einen Verdacht, wenn verdächtige und unverdächtige Merkmale einer Person, des Orts und der Zeit inkongruent sind, also nicht zusammenpassen, oder wenn verdächtige Merkmale einer Person, des Orts und der Zeit kongruent sind, also in ihrer Verdächtigkeit zusammenpassen. Die Typisierungen der Polizisten von Normalität und Abweichung haben ihren Grund in ihrer Berufs- und Lebenserfahrung. Diese nimmt die Form eines generalisierten Verdachts an: Bestimmte Personen erscheinen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten per se als verdächtig.
2. Die darauf folgende Personenkontrolle ist ein Interaktionsritual mit dem Charakter einer Degradierungszeremonie (Garfinkel 1956), innerhalb derer die Beamten die Betroffenen praktisch unterordnen. Die anlassunabhängige Personenkontrolle bringt die Betroffenen in eine der Polizei unterlegene bzw. unterworfene Rolle, weshalb die Kontrollen auch als Autoritätsaufrechterhaltungs- (Alpert und Dunham 2004) oder Ehrerbietungsrituale (Goffman 1967) charakterisiert werden können. In der Personenkontrolle konstituieren die an ihr beteiligten Personen praktisch soziale Identitäten. Der Rahmen der Interaktion ist die Adressierung der Betroffenen als potentiell Verdächtige, die sich dieser Adressierung bewusst sein bzw. werden sollen. Dies spiegelt sich auch in den verschiedenen Gründen, die die Polizisten in Interviews für die Durchführung anlassunabhängiger Kontrollen anführen. Während der Kontrolle bestehen Handlungsspielräume, sodass es keineswegs nur zu Konfrontationen und antagonistischen Interaktionen, sondern auch zu Kooperationen und (gegenseitigen) Ehrerbietungen kommen kann. Dies hängt davon ab, ob die Betroffenen im Verlauf der Interaktion weiterhin in der Figuration des Gegenübers adressiert werden, und ob und wie sie diese Rolle in der Interaktion annehmen.
3. Die Betroffenen erleben diese Identifikation als einen Prozess der Stigmatisierung, der ihre Selbstwahrnehmung so formt, dass ihnen soziale Teilhabe erschwert wird. Dies verschärft sich, wenn die Betroffenen eine Diskriminierung in Bezug auf Häufigkeit, Dauer, Zeit und Ort der Kontrolle und (fehlende Nennung von) Gründe(n) wahrnehmen. Sie artikulieren Scham, Angst und Wut, die aus der Ablehnung der Identifikation resultieren. Diese Affekte (de)motivieren ihre weitere Praxis, die häufig in zynische Resignation, bisweilen aber auch in politische Tätigkeit mündet.
2.Rechtliche Unbestimmtheit & Räumlicher Ausnahmezustand
Die polizeiliche Praxis der Ausweisung Gefährlicher Orte hat Implikationen für die Kritik der politischen Theorie liberal verfasster Staatlichkeit. Die Polizei erhält durch die Befugnis, Gefährliche Orte zu deklarieren, einen Grauen Scheck (Brodeur 1984; Fährmann et al. 2022b; Fährmann et al. 2023; Thurn et al. 2023). Es handelt sich nicht um einen Blankoscheck: Die Polizei ist durch die rechtlichen Vorgaben, dass »tatsächliche Anhaltspunkte« oder ähnliche Erkenntnisse über das Kriminalitäts- und Beschwerdeaufkommen in einem bestimmten Gebiet vorliegen müssen, ehe sie es als Gefährlichen Ort deklarieren kann, relativ gebunden. Sie kann, zumindest de jure, nicht nach Gutdünken Personenkontrollen durchführen. De factobesteht Unklarheit darüber, was »tatsächliche Anhaltspunkte« konkret sein sollen: Wie hoch etwa das Aufkommen von Beschwerden sein muss, ehe anlassunabhängig kontrolliert werden darf, ist nicht klar definiert. Die Anhaltspunkte liegen in der Regel in Form von Anzeigen oder, als Ergebnisse der eigenen Kontrolltätigkeiten, in Form der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)10 vor. Diese konstituieren sogenannte »Lagebilder« oder »Lageerkenntnisse« (Assall und Gericke 2016: 67f.).11 Die Grundlage für die Ausrufung Gefährlicher Orte ist damit ein spezifisch polizeiliches Wissen, womit die Legitimationspraxis selbstreferenziell ist (Assall und Gericke 2016: 64f., 67f.; Belina 2018b: 121): Die Polizei erhebt und schafft, zunächst weitgehend ohne äußere Kontrolle durch Gerichte, Datenschutzbeauftrage oder ähnliche, ihre eigene Ermächtigungsgrundlage. Das gilt besonders, wenn sie sogenannte Kontrolldelikte als Legitimation zur Ausrufung Gefährlicher Orte heranzieht. Kontrolldelikte werden erst durch eine polizeiliche Kontrolle als Straftaten registriert. Hierunter fallen insbesondere Delikte im Bereich illegalisierter Betäubungsmittel (Belina und Wehrheim 2011: 222; Ullrich und Tullney 2012). Ohne eine Kontrolle würden diese Delikte nicht auffallen. Durch verstärkte Kontrolltätigkeiten an bestimmten Orten registriert die Polizei damit eine höhere Zahl an Kontrolldelikten – die weitere anlassunabhängige Kontrollen legitimiert. Stephanie Schmidt beschreibt einen Fall, bei welchem ein Dienstgruppenleiter der Polizei gezielt durch verstärkte Kontrolltätigkeiten die Grundlage für die Aufrechterhaltung eines Gefährlichen Ortes zu schaffen versuchte (Schmidt 2022: 23; für eine Zusammenstellung insbesondere US-amerikanischer Studien, die ähnliche Praktiken der bewusst koordinierten Selbstlegitimation beschreiben vgl. Belina und Wehrheim 2011: 213ff. m.w.N.). Die anlassunabhängigen Kontrollen erweisen sich damit als selbsterfüllende Prophezeiungen (Belina und Wehrheim 2011: 214; Fejge 2019: 50; Ullrich und Tullney 2012). Dies gilt auch für die Aufnahme von Beschwerden und Anzeigen: Auch hier fungiert die Polizei als ein Filter dafür, wessen Beschwerden zur Kenntnis genommen werden und wessen nicht (Belina und Wehrheim 2011: 210). Delikte, bei denen die Anzeigebereitschaft relativ gering ist (wie etwa häusliche Gewalt), fallen zudem häufig aus der PKS und werden daher nicht zur Markierung Gefährlicher Orte herangezogen (Fejge 2019: 50). Trotzdem setzt die Polizei die Gefährlichen Orte bisweilen so fest, dass sie von den in der PKS als kriminalitätsbelastet geführten Orten abweichen (Belina und Wehrheim 2011: 219).
Die Polizei kann durch diese Regelung potentiell auch eigeneZwecksetzungen verfolgen (Assall und Gericke 2016: 68f.). An der Ausrufungspraxis zeigt sich, dass die Polizei nicht lediglich das Organ der rechtserhaltenden Gewalt ist, sondern, in gewissem Umfang, dazu befähigt ist, selbst Recht zu setzen: »Der polizeiliche Gefahrenbegriff erhält seine Materialität vor allem in der Konstruktion von ›gefährlichen Räumen‹« (Pichl 2018: 113). In den letzten Jahren bezogen sich daher verschiedene Kritiker der Polizei (Assall 2014: 77; Dopplinger und Kretschmann 2014: 19; Loick 2018: 17f.; mit einer kritischen Einschränkung Pichl 2014: 263ff.; Schmidt 2022: 18ff.) auf Walter Benjamins Kritik der Gewalt und dessen Feststellung, dass es das »Schmachvolle einer solchen Behörde« sei, »dass in ihr die Trennung von rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt aufgehoben ist« (Benjamin 2007: 96). »Die Behauptung, dass die Zwecke der Polizei mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden wären, ist durchaus unwahr« (ebd.). Die Polizei eröffnet sich vielmehr selbst, durch die Produktion Gefährlicher Orte, einen Raum des Ausnahmerechts. Wie Maximilian Pichl allerdings richtig bemerkt, ist es nicht so, dass die Polizei Recht im engeren Sinn setzt: Vielmehr operiert sie mithilfe des oben genannten Grauen Schecks. Sie »nutzt vielmehr Lücken des Rechtes aus und füllt diese mit ihren eigenen Zwecken« (Pichl 2014: 265) – weshalb auch der Begriff des Ausnahmezustands den Sachverhalt nicht recht trifft.
In diesem Raum kann die Polizei in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, weitgehend ohne äußere Kontrolle, eingreifen (Pichl 2014: 257). Sie spricht eine Form der »Ortshaftung« aus (Assall und Gericke 2016: 67; Tomerius 2017: 1402; vgl. auch Keitzel und Belina 2022: 7f.): Wer sich an einen Gefährlichen Ort begibt, gibt automatisch Teile des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ab. Dies legitimiert die Polizei durch ›Lageerkenntnisse‹, die ihrerseits jedoch häufig selbstreferenziell sind. Daraus schloss das OVG Hamburg (Urteil vom 13.05.2015 – 4 Bf 226/12; insb. Rn. 57), dass entsprechende Regelungen zur Ausrufung von Gefahrengebieten nach § 4 Abs. 2 HmbPolDVG nicht verfassungskonform seien (der Artikel besteht allerdings in unwesentlich veränderter Form in § 13 Abs. 1 S. 2 HmbPolDVG fort). Verschiedentlich sprachen Kritiker dieser Regelungen daher von einem Ausnahmezustand, der in den jeweiligen Polizeigesetzen institutionalisiert sei (Assall 2014: 78f.; Assall und Gericke 2016: 62; Keller und Leifker 2017). Aufgrund der Gefahr der »Inflationierung und Banalisierung des Begriffs« (Kretschmann und Legnaro 2018: 472) des Ausnahmezustands, auf die Andrea Kretschmann und Aldo Legnaro mit Recht aufmerksam machen, wäre dieser besser als Ausnahmezustand zweiter Ordnung (ebd.) charakterisiert.12 Diese Ausnahmeregelung im Polizeirecht unterminiert die Rationalität des Rechts, indem die der Polizei gestattet, eigene Zwecksetzungen entlang eigens definierter Kriterien durchzusetzen.
Die Grenzen des Rechts (Opitz 2012) erodieren durch die Möglichkeit Gefährlicher Orte nicht nur aufgrund der Selbstreferenzialität ihrer Begründung, sondern auch durch die Verlagerung der polizeilichen Maßnahme in das (weite) Vorfeld der Gefahren (Assall 2014; Schröder 2014: 60). Eine klassische Orientierung an Tatbestandsmerkmalen, also, wie bereits dargestellt, an einem bestimmten Verhalten, ist nicht mehr notwendig – aber auch nicht mehr möglich (Assall und Gericke 2016: 68). Stattdessen ist es der Polizei vielmehr geboten, sich an außerrechtlichen Normen – an polizeilichen Mythen (s. Kapitel V. 3.) – zu orientieren (Assall 2014: 78; Dopplinger und Kretschmann 2014: 19). Eine legislative, aber insbesondere eine judikative Eingrenzung ist damit nicht mehr oder nur noch unzureichend möglich (Assall und Gericke 2016: 68f.; Pichl 2014: 264f.; Belina und Wehrheim 2011: 207ff.; zur Judikative siehe Fährmann et al. 2023).
3.Fetischismus der Sicherheit & Kontrollsucht
»Many policemen and narcotics agents are precisely addicted to power, to exercising a certain nasty kind of power over people who are helpless. The nasty sort of power – white junk, I call it – rightness; they’re right, right, right – and if they lost that power, they would suffer excruciating withdrawal symptoms.«William S. Burroughs; Interview in The Paris Review, 196513
Warum halten Polizei und Politik an einer proaktiven Kontrollpraxis fest, die nicht nur politisch kontrovers und aus einer juristischen Perspektive fragwürdig ist, sondern sich auch, am eigenen Maßstab gemessen, regelmäßig als ineffizient erweist? Warum treiben Polizei und Ordnungsdienste die Konsumenten illegalisierter Drogen von Ort zu Ort (eine Praxis, die als Junkie Jogging bekannt wurde), statt ihnen langfristige Möglichkeiten eines Aufenthalts zu geben? In den letzten Jahrzehnten gab die Kritische Kriminologie hierauf zwei unterschiedliche Antworten: Die erste orientiert sich an der Ideologiekritik Karl Marx’ und Georg Lukacs’ (1968), und beschreibt die Produktion von Sicherheit als ein fetischistisches Verhältnis. Die zweite Antwort orientiert sich an der Kritik der Kontrollgesellschaft, wie sie Gilles Deleuze am Anfang der 1990er Jahre formulierte. Trotz ihrer epistemologischen Differenzen liefern beide Stränge wichtige Ansätze zu einer Erklärung des Wiederholungszwangs, mit welchem sicherheitspolitische Akteure immer wieder mit demselben Mittel – der Degradierungszeremonie der proaktiven Kontrolle – auf soziale Probleme reagieren. Die Ideologiekritik arbeitet heraus, dass die Kriminalitätspolitik im Spätkapitalismus auf einer Verkehrung von Wesen und Erscheinung des Unsicherheitsgefühls beruht. Die Kritik der Kontrolle zeigt, dass unter neoliberalen Voraussetzungen Kriminalität gar nicht mehr ›bekämpft‹, sondern nurmehr ›gemanaget‹ wird.
Die ideologiekritische Erklärung fokussiert auf die Verkehrung von Wesen und Erscheinung: Der Sicherheitsfetischismus (Kern 2016) verdinglicht soziale Probleme zu abstrakten14 ›Gefahren‹ (vgl. Schmidt und Thurn 2019: 160), denen mit den Mitteln des Strafrechts, und vor allem: des Strafvollzugs begegnet werden müsse. Die Spezifika der einzelnen sozialen Probleme, von Phänomenen der Gewalt über psychische Krankheit bis zur Obdachlosigkeit, erscheinen, unterschiedslos, als Probleme der »security« – und nicht der »safety«.15 Die Gründe liegen in der »strukturellen Ohnmacht« (Kern 2016: 112) der Produzierenden, die keine Kontrolle über die Gestaltung der Produktion verfügen und die Ängste vor Exklusion und sozialem Abstieg haben (Nachtwey 2016) – bei einer gleichzeitigen Internalisierung einer für den Kapitalismus notwendigen Arbeitsmoral (vgl. für die neoliberale Arbeitsmoral bspw. Bröckling 2007). Die »Skandalisierung von ›Kriminalität‹ ist Bestandteil einer (jeweils phasenspezifisch geprägten) Politik der ›Arbeitsmoral‹« (Cremer-Schäfer und Steinert 2014: 81): Mit dem Wandel der Arbeitsmoral in den jeweiligen kapitalistischen Phasen transformieren sich zwar die diskursiven Beschreibungen von Kriminalität und Gefahr (ebd.: 91ff.). Der Begriff der Kriminalität als einem »super-summary-symbol« (ebd.: 98) erlaubt es aber im Allgemeinen, verschiedene Formen (vermeintlich) abweichenden Verhaltens zu skandalisieren. Die realen Abstiegsängste artikuliert das postbürgerliche Konkurrenzsubjekt als Moralpaniken über Drogenabhängige, Bettelnde, arabische ›Clans‹ oder Geflüchtete (vgl. Nachtwey 2016); also insbesondere diejenigen, die als unproduktiv erscheinen. Das Framing des Zivilen Ungehorsams der Protestierenden der Letzten Generation, deren Mitglieder sich etwa an Autofahrbahnen festkleben, als Terrorismus16, ist ein weiteres Beispiel für die von Ideologiekritikern beschriebenen Moralpaniken.
Der Fetisch der Sicherheit verkehrt »Wesen und Erscheinung in der Sicherheitsproduktion« (Kern 2016: 113), indem er das Bedürfnis nach »safety« in das nach »security« übersetzt. Cremer-Schäfer und Steinert diskutieren diese Verkehrung von Wesen und Erscheinung unter dem Begriff der »Institution ›Verbrechen und Strafe‹« (Cremer-Schäfer und Steinert 2014). Auf der organisationalen Ebene sind unter dem Begriff die Behörden der Strafjustiz und der Sicherheit subsumiert. Auf Ebene der subjektiven Ideologie bietet diese Institution den Einzelnen einen semantischen Rahmen, innerhalb dessen sie Moralpaniken, ein Bedürfnis zu Strafen oder auch Schutzphantasien (wenngleich als Klischees) artikulieren können. »Verbrechen und Strafe« stellt soziale Probleme wesentlich personalisiert dar: Kriminalität sei ein Problem, das zuvorderst durch Kriminelle verursacht würde. Für die so verdinglichten Probleme stellt die Institution individualisierte Problemlösungen bereit: Straftaten werden je Einzelnen zugerechnet, welche als Einzelne verfolgt und, sofern die Verfolgung Erfolg hatte, verurteilt werden (ebd.: 31ff.). Sie setzt auf der Ebene der unmittelbaren Erscheinung an und lässt die die Erscheinung vermittelnden Momente gerade noch am Rand zu – bspw. als mildernde Umstände in einem Gerichtsverfahren, oder als Gründe für Kulanz bei der Abwägung im Rahmen des Opportunitäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips bei den verschiedenen Sicherheitsbehörden. Die abweichenden Subjekte werden für das Wesen des Problems genommen. An ihnen verfolgen Staat und Gesellschaft die sozialen Probleme strafend, statt die Ursachen sozialer Probleme zu bekämpfen. Strafverschärfungen waren in den letzten Jahrzehnten die Regel; Strafmilderungen die Ausnahme (Drenkhahn et al. 2020). Die Polizei ist dabei ein wesentlicher Akteur der Institution »Verbrechen & Strafe«: Da sie das Gewaltmonopol innehält ist sie die Instanz, die die Verfolgung und Bekämpfung von Verbrechen und Verbrechern ›auf der Straße‹ leistet. Ihr Vorgehen ist personalisierend: Es zielt mit Notwendigkeit auf ›Störer‹, ›Gefährder‹ und ›Straftäter‹; und bisweilen auch auf ›Ausländer‹ und ›Migranten‹, wie insbesondere der institutionalisierte Rassismus der Diskriminierungsfalle Schleierfahndung zeigt. Es handelt sich um ein Bewusstsein, das ideologisch, also, im Sinn der Institution »Verbrechen und Strafe«, zwar richtig, aber zugleich unwahr ist: »thought true to a false situation« (Eagleton 2007: 104). Die Abweichenden trifft die ideologische Straflust (Cremer-Schäfer und Steinert 2014) umso mehr, als sie die Möglichkeiten des Verfalls und/oder sozialen Abstiegs, des ›unternehmerischen‹ Risikos, repräsentieren. Die ideologische Leistung besteht darin, die allgemeine Tendenz der Verelendung der Abstiegsgesellschaft (Nachtwey 2016) als subjektives Versagen und Nichteinhaltenwollen der Spielregeln zu rahmen und an den Depravierten zu verfolgen.17
Die Kritik der Kontrolle schließt (explizit oder implizit) an die Beobachtung Gilles Deleuze‹ an, dass die von Michel Foucault (2017) beschriebenen Disziplinargesellschaften im Verschwinden begriffen sind. Die Disziplinargesellschaft zielte primär auf die Einschließung (nicht nur) der gefährlichen Klassen – in der Familie, der Schule, der Fabrik oder dem Gefängnis. Mit neuen Formen der Produktionsweise und der Ablösung der Fabrik durch das Unternehmen in westlichen Gesellschaften, verdrängt die Kontrolle (mit »freiheitlichem Aussehen«; Deleuze 2017: 255) die Disziplinierung. Während die Disziplinierung auf Ein- und Ausschluss, auf die Bearbeitung eines binären Widerspruchs (etwa zwischen Kapitalisten und Arbeitern in den Tarifstreitigkeiten; vgl. ebd.: 256) setzte, erfolgt die Kontrolle durch das, was Deleuze »Modulationen« nennt: Sie erzeugen »Verhältnisse permanenter Metastabilität« (ebd.), innerhalb derer die Konkurrenzsubjekte sich in einem Wettstreit zueinander befinden, in dem die alten Binaritäten sukzessive verschwinden: »Working from home, homing from work« (Fisher 2004).
Wie unter anderem Mark Fisher in Anschluss an Deleuze festhält, wird die externe Überwachung in diesem Modus der Vergesellschaftung zusehends durch die interne Überwachung – »internal policing« (ebd.) – ersetzt. In der kommunalen Sicherheitspolitik treten nicht nur Formen des »community-«, sondern gar des »self-policing« verstärkt auf den Plan, die die Kontrolle durch staatliche Akteure durch eine gegenseitige Kontrolle ergänzen (Schlepper et al. 2011).18 Dies ist umso mehr der Fall, als die Politik durch neoliberale Reformen die Institutionen, die ein Stück weit soziale Sicherheit garantierten, demontierte (vgl. Garland 2001: 156f.). Ähnliche Entwicklungen beschreiben David Garland (1996, 2001) sowie Malcolm M. Feeley und Jonathan Simon (1992): Sie identifizieren in den 1990er Jahren neue Kulturen der Pönologie, die die Punitivität, das herkömmliche Strafen, zwar nicht ersetzen (im Gegenteil lässt sich, darauf verweist Garland mehrfach, eine Ausweitung des Gefängnissystems und punitiver Gesetzgebung beobachten; Garland 2001: 131ff.), aber ergänzen.19 Garland identifiziert etwa einen neuen Kriminalitätsdiskurs, innerhalb dessen abweichendes Verhalten nicht mehr als ein zu behebendes Problem gerahmt wird, sondern als ein (insgesamt unvermeidbares, für den Einzelnen aber zu kalkulierendes) Risiko (Garland 1996: 450ff.).
Daraus folgt, dass die Kriminalitätsbekämpfung langsam dem Kriminalitätsmanagement Platz macht. Feeley und Simon machen diese Entwicklung etwa daran fest, dass das Phänomen der Rückfälligkeit von Straffälligen immer seltener für die Evaluation von Maßnahmen des Strafvollzugs herangezogen würde. Sie schließen daraus: »The new penology is neither about punishing nor about rehabilitating individuals. It is about identifying and managing unruly groups« (Feeley und Simon 1992: 455). Kriminalität soll nicht mehr an ihrer Wurzel bekämpft werden, wie dies in der Disziplinargesellschaft noch der Fall war, in der man Straftäter durch die Gefängnisstrafe zu rehabilitieren hoffte. Vielmehr geht es nurmehr darum, die Opportunitätsstrukturen kriminellen Handelns zu minimieren, und »hot spots« – als ›gefährliche Orte‹ im weiteren Sinn – zu bereinigen:
Where an older criminology concerned itself with disciplining delinquent individuals or punishing legal subjects, the new approach identifies recurring criminal opportunities and seeks to govern them by developing situational controls that will make them less tempting or less vulnerable. Criminogenic situations, ›hot products‹, ›hot spots’—these are the new objects of control. (Garland 2001: 129; Herv. RT)
Deleuze schlägt daher vor, diese Gesellschaften nicht mehr als Disziplinar-, sondern, unter explizitem Verweis auf William S. Burroughs, Kontrollgesellschaften zu nennen (Deleuze 2017: 255).20 Burroughs beschreibt in seinen literarischen Werken die Kontrolle als eine Form der Sucht. Der Kontrollsüchtige ist nicht allein süchtig nach Kontrolle, sondern vielmehr, im Sinn einer kybernetischen Erweiterung des Organismus, besessen von ihr (Fisher 2004). In diesem Zustand der Sucht ist die Kontrolle, das Management, Selbstzweck: »In the latter stages of addiction, you want to consume the drug, but it is improbable that you will also like jacking up« (Fisher 2018: 696): Die (Kontroll-)Sucht genügt sich selbst. Das Junkie Jogging, welches zugleich die weiterhin fortbestehenden punitiven Tendenzen im Neoliberalismus befriedigt (indem es die als ›Asozial‹ Etikettierten diversen Strafen und Ersatzstrafen zuführt), ist der unbegrenzte Aufschub (Deleuze 2017: 257): Die Polizisten bekämpfen nicht die Sucht der Marginalisierten. Sie ziehen selbst, auf der Suche nach dem nächsten Aufgriff, überspitzt: nach dem nächsten »fix«, ruhelos durch die Gefährlichen Orte. Die Polizisten stellen punktuell, an bestimmten Orten, zwar die soziale Ordnung der respektablen Mittelschicht wieder her, indem sie etwa die Junkies von den Bahnhofsvorplätzen vertreiben. Im Großen und Ganzen betrachtetwerden die Konflikte und sozialen Probleme aber bloß, zeitlich wie räumlich, verschoben, sodass auch immer wieder dieselben Personen in den polizeilichen Fokus rücken: »[D]ie meisten Leute kennt man« (MEDIAN_Gruppe4, Pos. 95).
Ideologie- als auch Kontrollkritik erklären, auf je unterschiedlichen Ebenen, worin der Wiederholungszwang der proaktiven Kontrolle besteht: Die Ideologiekritik erklärt, dass die Punitivität, also das Strafbedürfnis, ihren bzw. seinen objektiven Grund in der Verkehrung von Wesen und Schein der Unsicherheit hat. Die ideologischen Momente der Verdachtskonstruktion sollen im weiteren Verlauf der Arbeit genauer dargestellt werden. Die Kritik der Kontrollgesellschaft wiederum hält fest, dass das als deviant erscheinende Verhalten nicht mehr nur bekämpft wird, sondern vielmehr Objekt eines Sicherheitsmanagements ist. Daher läuft eine Kritik an proaktiven Kontrollen fehl, die sie am präventiven oder repressiven Zweck messen. Ihre Ineffizienz stellt vielmehr zusätzlich unter Beweis, dass es gerade nicht darum geht, Verbrechen zu bekämpfen oder zu verhindern. Das ›Aus der Anonymität Holen‹, das ›Präsenzzeigen‹, das ›Junkie Jogging‹ ist bereits der Zweck. Erst, wenn man die proaktiven Kontrollen als Degradierungszeremonie begreift, die sich selbst genügt, ist verständlich, warum an dieser Maßnahme, in all ihrer vermeintlichen Ineffizienz, festgehalten wird.
1 Ab und zu wenden Forschende zur und Praktiker der Polizei ein, die Polizei gebe es nicht. Um dieser Kritik proaktiv zu begegnen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit unter die Begriffe Polizei, Polizisten und Beamte diejenigen Teile der polizeilichen Organisation gefasst werden, die Personenkontrollen durchführen. Dazu zählen die Schutzpolizeien der Länder, auch deren Bereitschaftspolizeien, sowie die Bundespolizei. Die verschiedenen Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt bleiben in der Darstellung ebenso unberücksichtigt wie die Polizei des Bundestags.
2 Je nach Bundesland unterscheiden sich die Begriffe für diese Kontrollorte. Svenja Keitzel und Bernd Belina (2022: 212f.; Fn. 1) haben eine Liste der verschiedenen Begrifflichkeiten zusammengestellt, wobei je nach Bundesland teilweise unterschiedliche Begriffe verwendet werden: »Gefährlicher Ort« (Bayern, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen), »verrufener Ort« (Hessen und Nordrhein-Westfalen), »Gefahrenort« (Saarland), »Kriminalitätsbrennpunkt« (Saarland, Sachsen und Baden-Württemberg), »Kriminalitätsschwerpunkt« (Sachsen), »kriminalitätsbelasteter Ort« (Berlin, Brandenburg und Niedersachsen) und »besonderer Kontrollort« (Bremen). Keitzel und Belina schlagen vor, die genannten Begriffe unter die Bezeichnung »Gefahrenort« zu subsumieren. Nachdem der »Gefährliche Ort« der am weitesten verbreitete Begriff ist, soll in dieser Arbeit für alle Gefahrenorte der Begriff »Gefährlicher Ort« verwendet werden. Lediglich im Fall regionaler Besonderheiten werde ich die jeweils regional gebräuchlichen Begriffe verwenden.
3 Juristisch wird gemeinhin zwischen zwei Aufgabenfeldern der polizeilichen Tätigkeit unterschieden: Prävention und Repression. Die Prävention erfolgt auf Grundlage des jeweiligen Polizeirechts und im Gefahrenvorfeld, um eine Straftat zu verhindern, während die Repression auf Grundlage der Strafprozessordnung und erst im Nachgang einer Straftat erfolgt, um diese zu verfolgen.
4 Das Bayerische Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration konstatierte in einer Antwort auf eine Schriftliche Anfrage, dass die Kontrollen nicht anlasslos durchgeführt würden. Vielmehr würde »anhand tatsächlicher Anhaltspunkte für die örtliche Gefährdungssituation einer jeden Asylbewerberunterkunft mittels Lageauswertung, Auswertung von Delikts- und Einsatzzahlen sowie Hinweisen« (BayLT Drs. 18/6902, S. 3) über eine Kontrolle der Unterkünfte entschieden. Wie dieser Entscheidungsprozess verläuft, und wie hoch die Schwelle für einen Anlass im engeren Sinn ist, bleibt jedoch offen. Da das BayPAG eine proaktive und damit anlassunabhängige Kontrolle prinzipiell ermöglicht, werde ich in dieser Arbeit auch in Bezug auf die Unterkünfte Geflüchteter von anlassunabhängigen Kontrollen sprechen.
5 Wobei dieses Missverständnis auch daher rührt, dass der polizeirechtliche Begriff der Gefahr und der Gefahrenbegriff im alltäglichen Gebrauch voneinander deutlich abweichen. So hielt etwa das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 1973 für den polizeilichen Gefahrenbegriff fest: »Nach allgemeiner Auffassung liegt eine ›Gefahr‹ vor, wenn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen wird« (BVerwG, Urteil vom 26.02.1974 – I C 31.72; Rn. 31). Dabei umfassen polizeilich geschützte Rechtsgüter bspw. auch die Öffentliche Ordnung.
6 Die Kriminalisierung von Armut ist dabei kein grundsätzlich neues Geschäft der Polizei: Es waren insbesondere die Armen als auch das erstarkende Industrieproletariat, denen die polizeiliche Aufmerksamkeit insbesondere im 19. Jahrhundert galt (Neocleous 2018). Da auch das Proletariat im Zuge des wachsenden materiellen Reichtums durch die Industrieproduktion selbst in den Genuss einiger ›Luxusgüter‹ (wie Alkohol und dem Glücksspiel) kam, geriet darüber hinaus der Genuss genau dieser Güter als unsittlich und lasterhaft ins polizeiliche Visier (Neocleous 2018: 66f.). Die Verfolgung von Genussmitteln hat häufig einen politischen Gehalt; vgl. auch Kap. IV. 2.1.
7 Identifikation soll nicht als ›korrekte Bestimmung‹ objektivistisch fehlgedeutet werden. Sie ist vielmehr eine alltagspraktische, und damit im engeren Sinn ideologische und fetischistische Form identifizierenden Denkens (Adorno 2003: 139ff.): Der Polizeibeamte setzt das Objekt der Anschauung – den Betroffenen – mit einem begrifflichen Moment, der unterstellten ›Ethnizität‹, gleich. Aus dem zufälligen Ort der Geburt oder einer zufälligen Struktur der Haare schließt der Beamte auf eine wesenhafte Form seines Verhaltens. Dieses verdinglichende Denken soll in dieser Arbeit jedoch nicht (allein) dadurch kritisiert werden, dass es als ›konstruiert‹, als subjektive Zuschreibung von definitionsmächtigen Polizeibeamten entlarvt wird. Dies wäre ein subjektivistischer Rückfall in den bürgerlichen Idealismus, vor dem schon Theodor W. Adorno warnte: »Solcher philosophische (sic!) Subjektivismus begleitet ideologisch die Emanzipation des bürgerlichen Ichs als deren Begründung. Seine zähe Kraft zieht er aus fehlgeleiteter Opposition gegen das Bestehende: gegen seine Dinghaftigkeit. Indem Philosophie (oder Soziologie; Anm. RT) diese relativiert oder verflüssigt, glaubt sie, über der Vormacht der Waren zu sein und über ihrer subjektiven Reflexionsform, dem verdinglichten Bewusstsein« (ebd.: 190). Das Stigma der Marginalität tragen die proaktiv Kontrollierten nicht zufällig oder allein aufgrund der dezisionistischen verstandenen Definitionsmacht der Beamten. Der objektive Grund liegt aber weder in ihrer Hautfarbe, noch primär in ihrem Konsum von Betäubungsmitteln oder anderen devianten Verhaltensweisen, sondern darin, dass sie, wie auch immer vermittelt, als unproduktiv erscheinen: In der warenproduzierenden Gesellschaft erscheint ihre Arbeitskraft als entwertet und deklassiert, weshalb sie, als menschliche Behälter der Arbeitskraft, als (relativ) wertlos und damit Objekt von Sicherheitsbedenken erscheinen. Der objektive Grund dafür, dass Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz auf größeren und kleineren Baustellen, Verstöße gegen das Umweltschutzgesetz in Industriegebieten oder der Konsum teurer Betäubungsmittel (wie Kokain) in bestimmten Vierteln die Polizei nicht dazu motivieren, dort (zumindest temporär) Gefährliche Orte auszurufen, liegt nicht nur in der hohen Beschwerdemacht der dann potentiell Betroffenen, sondern in der kapitalistischen Produktionsweise selbst, innerhalb derer die entwertete Arbeitskraft als ›asozial‹ oder rassifiziert erscheint (grundlegend für die Differenzierung zwischen »blue collar« und »white collar criminality« vgl. Sutherland 1983). Die Ineffizienz einer solchen Maßnahme in der Bekämpfung von »white collar criminality«, die nicht bloß Wirtschaftskriminalität umfasst,ist kaum eine geeignete Erklärung dafür, warum die Polizei nicht anlassunabhängige Kontrollen von besser gestellten Personen und Betrieben durchführt, da sie in Hinblick auf »blue collar criminality« kaum größere Erfolge erzielt.
8 In einigen Publikationen wird der Begriff des Ethnic Profiling verwendet. Der Grund hierfür ist wohl – eine explizite Erklärung habe ich nicht gefunden –, dass der Begriff »racial« das reale Vorhandensein von »race« voraussetzen würde und damit rassistische, grundlegend falsche Annahmen reproduziere. Mir scheint aber der Begriff der ›Ethnizität‹ nur wenig unproblematischer zu sein als der der ›Rasse‹: In ersterem vermengen sich nicht nur essentialistische Annahmen über den Konnex von Biologie (i.e. die Farbe von Haut und Haaren) und ›Kultur‹ (in Fragen des lebensweltlichen Alltags dürften die kontrollierten Jugendlichen den Polizisten näher sein als es Exponenten der, selten kontrollierten, biodeutschen Oberschicht sind). Der Wandel von »race« zu »ethnicity« impliziert zudem, der Begriff müsse vom Objekt des Profiling, vom Verdächtigten und Geprofilten her bestimmt werden. Auch wenn dem Ressentiment immer irgendetwas vom Objekt entgegenkommt, muss das Vorurteil doch primär vom Subjekt und seiner Konstruktionsleistung her bestimmt werden; so wie Jean-Paul Sartres über den Antisemitismus festhielt: »Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden« (Sartre 2010: 12). Denn es ist weniger die Selbst- als die Fremdbeschreibung, die zugeschriebene ›Ethnizität‹, die ein Alarmzeichen in der Wahrnehmung der Beamten auslöst. Konsequent wäre daher eigentlich von Racist Profilingzu sprechen. Nachdem der Begriff des Racial Profilingaber etabliert ist, und um nicht noch mehr Neologismen einzuführen, soll er hier weiterhin verwendet werden.
9 Keitzel und Belina nähern sich damit aus einer anderen Richtung meiner Analyse von anlassunabhängigen Personenkontrollen als Degradierungszeremonien an.
10 Diese bildet nicht die ›tatsächlich auftretende‹ Kriminalität ab, sondern lediglich diejenige, die die Polizei registriert. Die PKS ist daher korrekt als polizeilicher Tätigkeitsbericht zu interpretieren.
11 Ohnehin ist der Begriff der Lage im polizeilichen Kontext ein leerer und frei flottierender Signifikant: So ziemlich jede Situation bezeichnet im polizeilichen Jargon eine Lage. Die Beamten sprechen von Einsatz-, Trainings- oder Übungslagen (vgl. Schmidt 2022: 269), Lageberichten und Stimmungslagen (ebd.: 111; 299), Großlagen (ebd.: 80; 302), Bedrohungslagen und Lagebereinigungen (ebd.: 318), sodass, zumindest in Bezug auf die polizeiliche Sprache, gesagt werden kann, Polizisten sind tatsächlich die »Herren der Lage« (ebd.: 162; ausführlich zum durch hegemoniale Männlichkeit geprägten Selbstbild der Polizeibeamten als »Herren der Lage« siehe Herrnkind 2014a: 158f.).
12 Seit Giorgio Agambens Homo Sacer (2002) erfreut sich der Begriff des Ausnahmezustands wieder einiger Beliebtheit in den Sozialwissenschaften. Einige der Kritiker der Gefährlichen Orte beziehen sich unmittelbar auf Agambens Rechtskritik. Nimmt man diese jedoch ernst, erweist sich die von ihm entwickelte Konzeption des Ausnahmezustands, die er ahistorisch im Recht und dessen »Bann« selbst verortet, als unzureichend, da letztlich alles Recht seine Geltung aus der politischen Souveränität (verstanden im Sinn Carl Schmitts) gewinnt. Vor dem Hintergrund dieses »legal nihilism« (Buckel und Wissel 2010: 45) lassen sich die juristischen Auseinandersetzungen und deren Rationalitätsgewinne nicht adäquat beschreiben. Eine Kritik der Transformation des Rechts hin zu verstärkten ausnahmerechtlichen Normierungen (grundlegend Neumann 1986; Frankenberg 2010; als Kritik des counter-law bei Ericson 2008; systemtheoretisch-dekonstruktivistisch bei Opitz 2012) ist durch diese existenzialistische Konstruktion verstellt (vgl. Ladeur 2016: 63ff.). Die politischen Statements Agambens während der COVID19-Pandemie überraschten daher auch nicht weiter.
13 Knickerbocker 1965.
14 Hier nicht zu verstehen im juristischen, gefahrenabwehrrechtlichen Sinn, sondern im Sinn Hegels: Dieser versteht das Abstrakte als ein ›Getrenntes‹. Abstrakte Begriffe sind demnach solche, die die inneren Widersprüche der Sache nicht in sich reflektieren (vgl. Hegel 1986: 50f.).
15 Im Deutschen verschwimmen diese beiden Aspekte im Begriff der Sicherheit.
16 Pars pro toto seien hier die Auslassungen des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt erwähnt, der die Letzte Generation als »Klima-RAF« bezeichnete (Langenstraß 2022).
17 Volkmar Sigusch erörterte dies am Beispiel der Konsumierenden von Heroin: »Die Fixer sind für den gesunden Menschenverstand so provozierend, weil sie individuell etwas schonungslos praktizieren, was generell zu dieser Gesellschaftsformation gehört wie das Amen in der Kirche; weil sie sich und andere preisgeben, wie einen Stoff behandeln, zu dem die Gesellschaftsmitglieder mindestens der objektiven Tendenz nach schon lange geworden sind. Fixer bedrängen, ähnlich wie sexuell Perverse, allgemeine Mystifikationen, was den Hass derer, die den Mystifikationen nicht widersprechen, aber ahnen, dass es Mystifikationen sind, in einer Hinsicht erklärt« (Sigusch 1989: 692).
18 »A functioning police state needs no police« (Burroughs 2001: 31).
19 Keiner der drei Autoren bezieht sich dabei jedoch, nach meiner Kenntnis, explizit auf Gilles Deleuze. Ihre Argumentationsfiguren sind jedoch so nah an der Beschreibung, wie sie Deleuze im Postskriptum der Kontrollgesellschaften vornimmt, und zeitlich so nah dran, dass es naheliegt, diese hier gemeinsam abzuhandeln.
20 Zumindest in der deutschsprachigen Diskussion blieb dieser Literatureffekt (Ortmann 2022a) bislang unbeachtet. Für den Einfluss Burroughs’ auf Deleuze, und auch Foucault, siehe Gontarski 2020.
II.Methoden & Reflexion
Die Wahl des Gegenstands erfolgte vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen: Bevor ich begann, an der Arbeit zu schreiben, war ich siebenmal (zumindest weitgehend) anlassunabhängig von der Polizei kontrolliert worden. Im Vergleich zu den meisten von mir befragten Betroffenen ist das eine geringe Zahl. Im Vergleich zu großen Teilen meines Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreises ist die Zahl zumindest so hoch, dass sie mich motivierte, anlassunabhängige Personenkontrollen zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung zu machen. Diese Positionierung im Raum zwischen eigener Betroffenheit und sozialwissenschaftlicher Forschung macht eine Reflexion auf die eigene Positionierung im Feld zwingend erforderlich. Weder handelt es sich um eine aktivistische oder partizipative Forschung (vgl. Unger 2020), die insbesondere durch die Beteiligung und Integration von Akteuren des Feldes als Co-Forschende definiert wäre, noch um eine Forschung ohne transformatorischen Anspruch: Anlassunabhängige Personenkontrollen sind nicht lediglich ein wissenschaftlich beforschbares Phänomen unter vielen, sondern stellen für die Betroffenen ein akut lebensweltliches (und für die Gesellschaft ein politisches) Problem dar.
Vor dem Hintergrund der eigenen Kontrollerfahrungen und den politischen und wissenschaftlichen Debatten ab dem Jahr 2014 waren für mich drei Fragen wissenschaftlich relevant: Was konstituiert für die Polizei einen hinreichenden Verdacht, jemanden ohne konkreten Anlass für eine Kontrolle auszuwählen? Was genau passiert während der Kontrolle und wie gestaltet sich die Interaktion zwischen Beamten und Betroffenen? Und welche Folgen haben die Kontrollen für die Betroffenen – und zwar auch und gerade dann, wenn sie ›ergebnislos‹ bleiben?
1.Felder & Feldzugänge: Die Akteure Gefährlicher Orte
1.1 Die Betroffenen anlassunabhängiger Personenkontrollen
Als Betroffene von Personenkontrollen definiere ich diejenigen, die einer Maßnahme der Identitätsfeststellung durch die Polizei sowie etwaiger Folgemaßnahmen ausgesetzt sind. Der Begriff des Betroffenen ist damit synonym mit dem im polizeilichen Jargon sogenannten ›Adressaten der Maßnahme‹. Das heißt, der Begriff ist wertneutral: Er impliziert keine rechtlich, politisch oder moralisch zu verstehende ›Unschuld‹ oder ›Sympathie‹, weshalb auch die Mitglieder von Rockergangs oder gar Anhänger der Reichsbürgerideologie Betroffene in dem genannten Sinn sein können. Die beiden letztgenannten Gruppen tauchen jedoch nur mittelbar, in den Erzählungen von Polizeibeamten, in meinem Material auf. Ich suchte stattdessen den Kontakt zu den Angehörigen von Milieus, die mir aufgrund eines theoretischen Vorwissens und entsprechenden Präkonzepten (Breuer et al. 2019: 140ff.) über Gefährliche Orte als besonders von Kontrollen betroffen schienen. Dies waren etwa Personen, die entweder selbst Migrations- oder Fluchterfahrung hatten oder denen weiterhin, aufgrund einer familiären Migrationsgeschichte, eine migrantische Identität zugeschrieben wird. Daneben suchte ich auch den Kontakt zu Personen, die illegalisierte Drogen konsumieren. Den Kontakt zu Interviewees stellte ich entweder persönlich oder mithilfe eines Schneeballsystems her. Für letzteres kontaktierte ich verschiedene zivilgesellschaftliche Institutionen, die entweder etwa einen antirassistischen Arbeitsschwerpunkt hatten, sich in der Geflüchtetenhilfe oder in der Beratung für Personen engagierten, die von rechtsradikal motivierter Gewalt betroffen waren. Aber auch Freunde und Bekannte, die in ihrer Praxis der Sozialen Arbeit oder wiederum in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Personen kannten, die von (wiederholten) anlassunabhängigen Kontrollen betroffen waren, vermittelten mir den Kontakt zu Interviewpartnern. Durch eine sozialarbeiterische Organisation der Suchtberatung wurde mir zudem ein Interview mit einem Substitutionspatienten und ehemaligen Konsumenten illegalisierter Betäubungsmittel vermittelt.
Die Interviews und Gruppendiskussionen behandeln auch die Erfahrungen von Kontrollen, die entweder reaktiv erfolgten, oder bei welchen nicht eineindeutig festzustellen ist, ob die Polizei einen konkreten Anlass für die Kontrolle hatte oder nicht. Ich berücksichtige diese Erfahrungen insofern im empirischen Material, als sie Aufschluss geben über den generellen Ablauf von Kontrollen: Die Gruppendiskussion B_Gruppe_4 behandelt etwa einen konkreten Anlass, nämlich eine Beschwerde wegen Ruhestörung bzw. Lärmbelästigung. Aufgrund des relativ geringfügigen Anlasses scheint es mir angemessen, die Interviewpassagen auszuwerten und in die Analyse eingehen zu lassen. Es zeigte sich nämlich, dass auch proaktive Kontrollen keineswegs zufällig oder anlassunabhängig im engeren Sinn erfolgen, sondern auch konkrete Verhaltensweisen, die sich auch als ›Belästigungen‹ beschwerdemächtiger Akteure beschreiben lassen, Kontrollen motivieren.
Mit Betroffenen führte ich zehn leitfadengestützte Einzelinterviews sowie vier Gruppendiskussionen, mit einer jeweiligen Beteiligung von zwei bis sieben aktiv sprechenden Personen. Die Interviews hatten starke narrative Anteile, bei welchen die Betroffenen Raum hatten, diejenigen Kontrollerfahrungen, die sie als besonders relevant erachteten, ausführlich zu schildern. Die Einzelinterviews führte ich mit einer unterstützenden Person aus der Geflüchtetenhilfe, die in Bayern im Umfeld einer Unterkunft für Geflüchtete kontrolliert wurde, einem Substitutionspatienten, vier Personen mit Fluchterfahrung, einer einmalig von einer Kontrolle betroffenen Person1





























