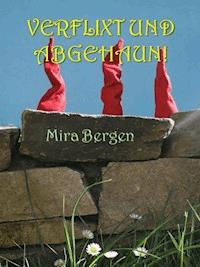Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite und (vorläufig) letzte Teil der Abenteuer von Constantin: Gerade hat er sich dran gewöhnt, der Weihnachtsmann zu sein, und schon gibt´s neuen Ärger. Dabei wollte Constantin doch nur in den Urlaub fahren. Doch aus der erhofften Erholung wird nichts – weder für ihn noch für seine Begleiter. Jemand hat´s auf den Weihnachtsmann abgesehen, und nicht nur auf ihn. Ungebetener Besuch sorgt auch in Zipfelbergen für Aufregung, ebenso bei den Wunderlichs. Und dann mischt auch noch die Liebe mit und macht das Chaos perfekt. Es wird – mal wieder – verfolgt, getrickst und sich versteckt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Nerven liegen blank. Am Ende geht´s um nichts Geringeres als Weihnachten. Wie gut, dass man einen Plan hat – doch dann läuft alles schief …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verflixt und ausgesperrt!
Mira Bergen
Impressum:
Verflixt und ausgesperrt!
Mira Bergen
c/o AutorenServices.de
König-Konrad-Straße 22
36039 Fulda
Copyright: © 2018 Mira Bergen
Copyright Coverdesign: © 2018 Mira Bergen
Published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN:
Prolog
Die Einsamkeit war unerträglich. Nicht mal Nachbarn, denen das Mehl ausgegangen war, oder Vertreter verirrten sich zu ihm.
Viel zu spät erkannte er seinen Irrtum.
Den größten Teil seines Lebens hatte er danach gestrebt, frei zu sein. Nichts erschien ihm wichtiger.
Nun war er es endlich – frei. Frei von Zwängen, Vorschriften und Aufgaben. Er konnte tun, was immer er wollte, und gehen, wohin es ihn trieb.
Es war schrecklich.
Denn er war auch frei von jeglicher Gesellschaft, und er musste erkennen, dass er sein Leben lang den falschen Zielen nachgejagt hatte. Jetzt war es zu spät.
Verzweifelt starrte er die kahle Wand an – eine von insgesamt vier kahlen Wänden in einem geschmacklosen Zimmer. Sollte er sich wirklich die Mühe machen aufzustehen? Und wenn ja: wozu?
Irgendwann würde er einfach aufhören zu leben. Wenn undurchsichtige biologische Prozesse, Insekten und vielleicht auch ein paar Mäuse ihre Arbeit verrichtet hatten, würde nichts mehr von ihm übrig bleiben. Nicht einmal eine Erinnerung.
Überwunden geglaubte Paranoia übernahm die Kontrolle und löste bereits bekannte Anzeichen aus – Schwitzen, Herzrasen und ein unangenehmes Zucken des linken Augenlids. Doch seine depressiven Gedanken ließen sich davon nicht aufhalten. Im Gegenteil. In allen Einzelheiten verweilten sie bei der Aussicht auf sein einsames Ableben.
Falls ihn ein verirrter Postbote noch vor seiner völligen Auflösung fand, stand dem eine unappetitliche Überraschung bevor. Mitleid regte sich. Vielleicht sollte er ein Warnschild an der Tür anbringen.
Oder auch nicht. Im Grunde war es egal. Er selbst existierte dann nicht mehr. Also musste ihm auch nichts mehr peinlich sein. Sich schon jetzt im Voraus zu schämen, erschien wenig sinnvoll. Wo auch immer er sich dann befinden würde – schlimmer als hier konnte es nicht sein.
Die Option zu sterben gewann an Reiz.
Er dachte an die gestrige Entdeckung. Was für ein entsetzlicher Tag. Gestern war er wider besseres Wissen doch aufgestanden und auf den Berg hinter seinem Haus gestiegen.
Er wusste nicht genau, was Menschen dazu trieb, auf Berge zu klettern. Man konnte dort nichts weiter tun, als herunterzuschauen und sich Sorgen zu machen, wie man wieder nach unten kam. Auf diesem Berg traf man noch nicht mal andere Menschen, da sie ihn aus unerklärlichen Gründen mieden.*
Aus einer seltsamen Laune heraus war er dennoch hinaufgestiegen. Er war nicht mehr der Jüngste, trotzdem hatte er sich unzählige Stufen, die vor längst vergessenen Zeiten mühsam in die Felsen geschlagen worden waren, hinaufgequält.
Als er endlich oben angelangt war, bot sich ihm nicht die erhoffte schöne Aussicht. Dicke Wolken wussten dies zu verhindern. Statt dessen fand er einen toten Zwerg. Einen echten Zwerg, ganz offensichtlich erschlagen – wie es aussah, mit seiner eigenen Axt.
Er fragte sich nicht, was dieser Zwerg ausgerechnet hier zu suchen hatte. Dafür waren seine deprimierten Sinne bereits zu abgestumpft. Aber die Tatsache, dass der Zwerg erschlagen wurde, bevor er ihn getroffen hatte, erschütterte ihn zutiefst.
Dabei sehnte er sich doch verzweifelt nach Gesellschaft.
Welcher Art auch immer.
***
Eine Tafel Schokolade wechselte den Besitzer. Frodewin und Lauritz machten es sich hinter dem Fernrohr bequem und nahmen zielstrebig das Haus der Wunderlichs ins Visier.
Nach der Rückkehr aus Glücksstädt erfreute sich dieses Objekt bei den Zwergen allergrößter Beliebtheit und es gab Wartelisten für den Wachdienst am Fernrohr. Geschickt ausgewählte Geschenke konnten zu spontanen Veränderungen der Reihenfolge der Anwärter führen, weshalb Lauritz jetzt schon den zweiten Tag nacheinander hier saß und Frodewin als Herr über die Listen (und das Fernrohr) über ein breiteres Sitzkissen nachdachte. Vielleicht war Schokolade doch keine so gute Idee. Erstaunlich, wie Lauritz es anstellte, immer an die beste Schokolade heranzukommen. Die von der Sorte, bei der man nicht aufhören konnte.*
»Und? Ist jemand zu Hause?«, fragte Frodewin mit vollem Mund. Sein gelangweilter Blick streifte einen großen, mit Tüchern verhangenen Gegenstand.
SUSI.
Nach den Ereignissen im Juli war die Benutzung der Transportmaschine strengstens verboten und ein großes Schloss angebracht worden. Doch das schien überflüssig. Es hätte sich kein Zwerg gefunden, der sich freiwillig diesem Risiko ausgesetzt hätte. Nicht nachdem alle mitansehen konnten, was SUSI aus Ken gemacht hatte.
»Hmm«, murmelte Lauritz und sah gebannt in das Fernrohr. »Alle beide.«
Letzteres bezog sich auf Herrn Wunderlich und Emily, denen in letzter Zeit ganz besonderes Interesse galt.
Anfangs war es auch noch rechtspannend gewesen, Frau Wunderlich zu beobachten. Das Eheleben der Wunderlichs war ziemlich unterhaltsam. Doch dann zog Emily probeweise ein und stellte das beschauliche Leben ihres neuen Versuchspapas auf den Kopf.
Herr Wunderlich war eindeutig überfordert. Vater zu werden hatte er sich irgendwie anders vorgestellt. Vor allem nicht so abrupt. Ein werdender Vater sollte während der üblichen Schwangerschaftsmonate zunächst einmal Gelegenheit erhalten, sich grundsätzlich mit der Tatsache der baldigen Vaterschaft anzufreunden. Ein erster Schritt. Der unvermeidlichen Geburt folgte dann normalerweise eine Phase, in welcher das Kind ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Mutter fiel und der Vater das Ganze aus sicherer Entfernung beobachten konnte. Herrn Wunderlich war zwar zu Ohren gekommen, dass die Väter von heute zunehmend Anspruch auf Einbeziehung erhoben, aber er bevorzugte die jahrtausendelang bewährte altmodische Methode, nach welcher der Vater gelegentlich ein frisch gebadetes und gefüttertes – vorzugsweise schlafendes – Kind in den Arm gelegt bekam, welches beim geringsten Anzeichen von Aktivität von der fürsorglichen Mutter wieder entfernt wurde.
Später ließ es sich zwar nicht vermeiden, dass Kinder zu sprechen begannen, doch auch das war eine längerfristige Entwicklung. Zumindest sollte es so sein.
Niemals, unter gar keinen Umständen, hatte er damit gerechnet, sofort mit einem halbwüchsigen Kind konfrontiert zu werden, das nicht nur fließend sprach, sondern dabei auch noch überraschend schlüssig und überzeugend argumentierte und bei jeder Gelegenheit widersprach.
Zu alledem musste er erkennen, dass er während seines schönen früheren Lebens auf männlichenNachwuchs programmiert gewesen war, der, wenn er sprechen und laufen konnte, mit ihm Fußball schaute und ihm als Verbündeter gegen seine Frau zur Seite stand.
Die Realität hatte ihn überrannt und zu Boden geworfen, und Herr Wunderlich fühlte sich noch immer zu schwach, sich zu erheben.
Emily hingegen hatte jene Kindheitsphasen, in welchen man seine Eltern vorbehaltlos liebte und ihnen alles fraglos abkaufte, ausgelassen und war in etwa an dem Punkt eingestiegen, an welchem einem Eltern peinlich waren. Das bedeutete selbst für jahrelang gewachsene Eltern-Kind-Beziehungen eine harte Belastungsprobe und für die heimlichen Zuschauer jede Menge Spaß und Unterhaltung.
Lauritz grinste in sich hinein, als Herr Wunderlich den Fehler beging, Emily hoffnungsvoll zu fragen: »Möchtest du nicht lieber wieder hochgehen und mit deiner Puppe spielen?«
Schon wieder. Manche lernten es echt nie.
***
Hinter einem Berg aus Büchern raschelte Papier und Manfred glaubte, ein Schniefen hören zu können. Constantins Kopf kam zum Vorschein.
»Bist du schon lange hier?« fragte der misstrauisch.
»Wieso?« erwiderte der Kobold und musterte Constantin. Es war nicht zu übersehen, dass es diesem gut ging. Die gesunde Gesichtsfarbe war vermutlich auf die frische Luft hier zurückzuführen, die dafür sorgte, dass sämtliche vorstehenden, unbehaarten Gesichtsteile die Farbe von Weihnachtsäpfeln annahmen. Doch es war nicht nur das. Constantins Ruhelosigkeit war verschwunden. Wie es aussah, hatte er mit seiner Situation Frieden geschlossen und zudem begonnen, sich mit seiner eigentlichen Bestimmung zu beschäftigen und zu lernen, der Weihnachtsmann zu sein. Er schien sogar Spaß daran zu finden. Wenngleich er das niemals zugegeben hätte.
Constantin wischte sich hastig über die Augen und hoffte, dass der Kobold die feuchten Stellen nicht bemerkte. Verwirrt fragte er sich, was in letzter Zeit mit ihm los war. So was passierte ihm neuerdings häufiger, obwohl es keinen Grund dafür gab. Vielleicht sollte er mal seine Augen untersuchen lassen.
Noch immer machte ihm das letzte Dreivierteljahr zu schaffen. Kein Wunder. Er war der Weihnachtsmann. Das konnte nicht jeder von sich behaupten.
Darüber hinaus hatte er so etwas Ähnliches wie Untertanen, auch wenn er sich niemals trauen würde, das laut zu sagen. Viele, äh, Wesen kümmerten sich um ihn und waren um sein Wohl besorgt. Etwas vollkommen Neues für ihn, und er genoss es. Fleißige Zwerge kochten und putzten, und irgendjemand legte ihm jeden Morgen frische Sachen raus.
Er hatte sogar Freunde, wenngleich diese mit seinen Knien sprachen, wenn sie vor ihm standen. Selbst in der richtigen Welt hatte er jetzt mehr Freunde als jemals zuvor. Und sie alle schrieben ihm Briefe.
Constantin hatte vorher nie Briefe bekommen. Jedenfalls keine freundlichen. Im Gegenteil. Post hatte früher immer etwas Bedrohliches an sich gehabt.
Erwin, Willi, Emily – selbst Frau Wunderlich hatte ihm einmal in der typischen Schönschreibschrift einer Grundschullehrerin eine förmliche Mitteilung übersandt und um Berücksichtigung der neuen Anschrift von Emily zum nächsten Weihnachtsfest gebeten. Außerdem enthielt der Brief ein dickes, rotes P.S.: Wenn ich herausfinde, dass ich von Zwergen beobachtet werde, ziehe ich den kleinen Rüpeln die Ohren so lang, dass keine Mütze mehr drüberpasst.
Noch etwas war neu für Constantin. Er hatte jetzt eine Aufgabe. Dazu eine, die Kinder glücklich machte. Jedenfalls die braven. Zumindest hoffte er das. Genau würde er es wohl erst nach dem nächsten Weihnachtsfest wissen.
Gerade eben hatte er den letzten Brief von Erwin zum dritten Mal gelesen und nachgedacht.
Er hegte den dringenden Verdacht, glücklich zu sein. Doch er war sich nicht sicher. Mit positiven Gefühlen kannte er sich nicht sonderlich gut aus.
Wenn er an die Dauer seiner unfreiwilligen Aufgabe dachte, befiel ihn noch immer Panik. Solange er diesen Gedanken verdrängte, fühlte er sich jedoch ganz wohl. Und gesünder, als er sich jemals zuvor gefühlt hatte.
Irgendein Zwerg hatte ihm das mal erklärt. Der Weihnachtsmann konnte nicht krank werden. Egal wieviel er aß und wie ungesund er lebte – um Dinge wie Cholesterin, Bluthochdruck oder Magengeschwüre musste er sich keine Gedanken machen. Gutes Essen und ein gewisser Körperumfang bei gleichzeitigem Wohlbefinden gehörten sozusagen zum Job.
Der Kobold hatte eine Weile lang interessiert zugeschaut, wie sich Constantin bemühte, gefasst auszusehen. Schließlich gab er sich einen Ruck. »Die neue Post ist da.«
Constantins Augen leuchteten auf, doch Manfred schüttelte den Kopf. »Diesmal leider nichts für dich persönlich. Nur allgemeine Wunschpost.«
Mist.
Constantin war verblüfft gewesen, wie viele Wunschzettel jetzt schon eintrafen. Welche Ausmaße würde das erst im Advent annehmen?
Normale Standard-Wunschzettel wanderten sofort in die Wunschpostsortierabteilung. Davon abweichende Briefe wurden jedoch dem Weihnachtsmann zur Durchsicht übergeben – also die mit außergewöhnlichen Schicksalen, Drohungen, Erpressungen – und die von penetranten Nörglern.
Constantin fragte sich, was aus solchen Kindern werden sollte, wenn sie erwachsen waren. Wer schon als Kind am Weihnachtsmann herummeckerte, hatte später entweder eine großartige Karriere als Politiker oder Filmkritiker vor sich, oder aber er besetzte Häuser und wurde zum Albtraum aller Therapeuten.
»Denkst du noch an die Versammlung?« erinnerte der Kobold, der gleichzeitig die Aufgaben des Postzwerges, Constantins persönlichem Assistenten und eines Kuriers für heimliche Geschäfte wahrnahm. Letzteres verdankte er seiner Fähigkeit, von jetzt auf gleich überallhin verschwinden zu können, was ihm einen dankbaren Kundenkreis bescherte.
»Welche Versammlung?« fragte Constantin zerstreut, während er argwöhnisch auf einen roten Umschlag starrte, auf dem in großen Buchstaben »AN DEN TYPEN IM ROTEN MANTEL – LETZTE WARNUNG« stand.
Offensichtlich gab es auch unter kleinen Kindern Terroristen.
Der Kobold verdrehte die Augen. »Die große Versammlung. Heute.«
»Bist du dir sicher? Gab es nicht erst eine Versammlung?«
»Sogar zwei. Und du warst jedes Mal dabei.«
»Äh, ja. Richtig. Allmählich verliere ich den Überblick«, seufzte Constantin. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund nahm das mit den Versammlungen in letzter Zeit überhand.
Zuerst gab es eine nach ihrer Rückkehr aus Glücksstädt. Constantin musste zugeben, dass die notwendig war, da weder Zwerg noch Mensch wusste, was jetzt eigentlich los war und wie es weiterging. Neben der Klärung derartiger grundlegender Angelegenheiten war Svante zum Zwerg des Monats gewählt worden. Das hatte zu interessanten Reaktionen geführt, insbesondere bei Wilbert.
Dieser nahm daraufhin den Kampf auf und berief eine weitere Versammlung ein, bei welcher er den verblüfften Zwergen eröffnete, Lehrgänge für Mitarbeitermotivation und -führung für unerlässlich zu erachten. Die jüngsten Ereignisse hätten das deutlich bewiesen. Darüber hinaus verpflichtete er sich, sofort die entsprechenden Themen auszuarbeiten und kurzfristig Lehrgangstermine bekannt zu geben, was bei den anderen Zwergen für einige Unruhe sorgte.
Und damit nicht genug.
Der Himmel wusste wie, aber Wilbert hatte irgendwo eine Broschüre über eine Lachtherapie in die Finger bekommen.
Sah man einmal von rätselhaften Ausnahmen wie Lauritz ab, lachten Zwerge ausgesprochen selten. Allenfalls lächelten sie, wenn es sich nicht verhindern ließ, was bei den meisten Zwergen einer Grimasse gleichkam.
Wilbert führte die kürzlichen Probleme auf das mürrische Grundwesen der Zwerge zurück und vertrat nun die Auffassung, dass häufigeres Lachen zu positiven Änderungen des Arbeitsklimas, Stressabbau und einer Verbesserung der Grundstimmung führen würde. Zumindest las er das aus seiner Broschüre heraus, die er so fest umklammert hielt, dass man meinen könnte, sie enthielt die Antwort auf die letzten großen Rätsel der Welt.
Wilbert kündigte an, mit den lachunfähigsten Zwergen zuerst anzufangen, was zu gequält grinsenden Gesichtern überall dort führte, wo Wilbert zufällig auftauchte.
Der Kobold musterte Constantin. »Diesmal hat Humbert die Versammlung einberufen, also scheint es um etwas Wichtiges zu gehen.«
Schon meldete sich wieder ein altvertrautes, flaues Gefühl in Constantins Magen. Wenn es etwas Wichtiges war, konnte es eigentlich nichts Gutes sein. Das hatte ihn seine jahrelange Erfahrung gelehrt.
Er hätte es kommen sehen müssen. In den letzten Tagen war es ihm viel zu gut gegangen, als dass dieser Zustand von Dauer sein könnte.
Er warf einen Blick aus dem Fenster und sah zu, wie sich dichter Nebel durch die tief verschneiten Häuser und Straßen wälzte. Sein Haus war aus anatomischen Gründen bedeutend größer als die der Zwerge und stand überdies auf dem höchsten Punkt der Stadt. Damit hatte er einen wunderbaren Ausblick. Außerdem war es so für die Zwerge einfacher, ihn im Auge zu behalten, argwöhnte er.
Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er eine schöne Aussicht. Wenn nur der ewige Schnee nicht wäre. Aber wenigstens war dieser hier weiß. Der traurige Schnee, den er von zu Hause aus früheren Wintern kannte, nahm zumeist in kürzester Zeit recht unappetitliche Farben an – dank wechselnden Temperaturen, Autos und der Tatsache, dass auch Hunde einen Stoffwechsel besaßen. Hier hingegen glänzte, glitzerte und knirschte der Schnee genauso, wie man es von ihm erwartete.
Constantin gab sich einen Ruck, griff nach den Briefen und begann zu lesen. Verwirrt hielt er inne und suchte den Umschlag nach einem Absender ab.
»Wie alt ist die noch mal?«
»Wieso?«
»Na…, die wünscht sich eine neue Gefriertruhe, ein Bügeleisen, das nicht pfeift, einen Haartrockner, aus dem keine Flammen schlagen, eine Matratze, die nicht piekst, und, äh…«, mit rotem Kopf zeigte Constantin auf ein kleines Bild.
Der Kobold musterte mit gerunzelter Stirn das Bild. »Was steht denn daneben?«
»Wo? Ach, hier. Warte..., etwas, das eine Frau mit Bedürfnissen braucht, wenn sich ihr Typ nur zu Weihnachten blicken lässt.« Ratlos starrte Constantin auf das Bild.
»Da unten steht noch was«, meinte Manfred und zeigte ans Ende des ungewöhnlichen Wunschzettels.
Constantin hielt den Brief näher ans Gesicht, um die winzige Schrift erkennen zu können. »Diese Dinge sind ja wohl das Mindeste, das du tun kannst. Schließlich zahlst du seit elf Jahren keinen Unterhalt und kümmerst dich nie um die Kleine (die paar Weihnachtsgeschenke gleichen das ja wohl kaum aus).«
»Oh.«
Constantin begann zu grinsen. »Nun…, damit wäre Erwins Frage wohl beantwortet. Er ist offensichtlich nicht der Einzige.«
***
Erwin schrieb schon wieder an Constantin, den ersten richtigen Freund, den er in seinem Leben gefunden hatte. Dass dieser auch noch der einzige echte Weihnachtsmann und deshalb immer weit weg war, spielte nur eine Nebenrolle.
Endlich gab es jemanden, dem er sein Herz ausschütten konnte. Und derzeit gab es sehr viel auszuschütten.
Erwins Briefe schwankten zwischen Euphorie und Verzweiflung, mitunter in ein und demselben Satz.
Seinen priesterlichen Beruf hatte er aufgegeben, was angesichts seiner wirren und etwas beängstigenden Begründung von seinem Arbeitgeber überraschend schnell und unbürokratisch akzeptiert wurde. Vielleicht hatte auch seine letzte Predigt zu der zügigen Entscheidung beigetragen. Erwin hatte es zum ersten Mal während seines priesterlichen Daseins geschafft, das Publikum zu fesseln. Eigentlich hatte er nur vorgehabt, über Dinge zu sprechen, die von Menschen nicht gesehen werden können und dennoch existieren. Als er etwas konkreter wurde und die Gesichter ihn gebannt anstarrten, ging es mit ihm durch. Euphorisch erzählte er, was ihm passiert war, und machte dabei auch vor Zwergen, Kobolden, dem Weihnachtsmann und seiner eigenen Herkunft nicht Halt.
Danach ging alles sehr schnell. Vermutlich war man froh, ihn so schnell und unproblematisch loszuwerden, ohne für einen teuren Therapieplatz aufkommen zu müssen.
Dafür gab es jetzt etwas Neues in seinem Leben – die Liebe. Und zwar in Person der Hippieladenverkäuferin, die den Namen Phoebe trug und drei Tage nach ihrem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen bei ihm einzog. Nicht dass er dabei etwas mitzureden gehabt hätte. Frauen ließen Männern wie Erwin in solchen Dingen nur selten eine Wahl.
Verwirrt hatte sie feststellen müssen, dass Erwin nicht allein, sondern bei seiner Mutter wohnte. Nach nicht ganz zwei Tagen hatte sie sich mit Erwins Mutter völlig überworfen – mit dem Ergebnis, dass sie Hals über Kopf nicht nur ihre, sondern auch Erwins Koffer packte und alles samt dem sprachlosen Erwin in ihre noch ungekündigte Einraumwohnung transportierte. Und dort saß er nun.
Er hatte bereits den Rat eines ausgebildeten Diplompsychologen eingeholt, dessen Telefonnummer in der Frauenzeitschrift seiner Mutter abgedruckt war, zusammen mit dem Versprechen, dass er in allen Lebenslagen kompetente und garantiert kostenlosen Hilfe anbieten konnte. Das Telefonat kostete Erwin dreiundzwanzig Euro und half ihm nicht im Geringsten weiter. Es bescherte ihm höchstens zusätzlichen Ärger, sobald Phoebe die nächste Telefonrechnung erhielt.
Er hatte es daraufhin mit der altbewährten Methode der Gegenüberstellung sämtlicher Für-und-Wider-Argumente versucht – mit dem Ergebnis, dass er auf beiden Seiten genau einunddreißig Punkte stehen hatte. Und ihm wollte einfach kein weiteres Argument einfallen.
So hatte er sich das nicht vorgestellt. Sicher, das Kribbeln im Bauch war ganz aufregend, und es gab durchaus sehr schöne – und für seine unerfahrene Männlichkeit überraschende – Momente. Doch manchmal fragte er sich, ob es wirklich den ganzen Ärger drumherum wert war.
Phoebe ihrerseits hatte eine eigene Theorie entwickelt.
Die Wohnung war zu klein. In einer Einraumwohnung begegnete man sich einfach zu oft.
In letzter Zeit hatte sie deshalb die kundenfreien Zeiten ihres Ladens genutzt, um in Zeitungen und Internet nach einer neuen, großen Wohnung zu suchen. Hatte sie etwas Vielversprechendes gefunden, schloss sie kurzerhand den Laden und holte Erwin zur Wohnungsbesichtigung ab. Das war bislang schon viermal passiert und Erwin hoffte inständig, dass er dieser Tortur nicht noch einmal ausgesetzt sein würde.
Die letzte Wohnung hatte gute Chancen, sein neues Zuhause zu werden. Immerhin plante Phoebe schon die Inneneinrichtung.
Frauen bei der Nestsuche waren unberechenbar und es schien praktisch unmöglich, sie zufrieden zu stellen. Diese Steckdose war zu weit links, die Tür zu weit rechts (da passt das weiße Schränkchen nicht hin, du weißt schon, dass mit der klappernden Schublade, die du schon längst reparieren solltest). Der eine Raum war nicht sonnig genug, im nächsten blendete die Sonne und das war nicht gut für die Pflanzen. Die Fliesen im Bad waren zu bunt, die weißen in der Toilette dafür zu einfallslos, und Sprossenfenster putzen zu müssen ging schon mal überhaupt nicht.
Erwin hatte probiert, ob die Toilettenspülung funktioniert, und war anschließend bereit gewesen, den Mietvertrag zu unterschreiben.
In der dritten Wohnung war dann ein Wort gefallen, das ihn erstarren ließ und irrationale Ängste hervorrief. Phoebe fragte den potentiellen Vermieter erwartungsvoll nach dem Kinderzimmer.
Kinder! Dieses Wort ließ Erwin die Haare zu Berge stehen. Der Gedanke, selbst welche in die Welt zu setzen, war ihm bislang überhaupt noch nicht gekommen, da dieses Thema bis vor kurzem auf der großen roten Strengstens-Verboten-Liste ganz oben stand. Außerdem war er nach seinen bisherigen Begegnungen mit Kindern zu der Erkenntnis gelangt, dass er diese nicht besonders gut leiden konnte.
Die Kontakte zu Kindern beschränkten sich in seinem früheren Leben auf die Kirche, wo sich Kinder während der Gottesdienste die Seele aus dem Leib brüllten und ihre Eltern von seinen aufwendig ausgearbeiteten Predigten ablenkten. Oder kicherten, wenn sie ihn sahen.
Täuflinge waren noch schlimmer. Bestenfalls schrien sie nur, wenn sie ihn erblickten. Besonders kritisch wurde es, wenn er das zu taufende Kind in den Arm gelegt bekam. Erwin fragte sich, was Eltern ihren Kindern vor einer Taufe zu essen gaben, dass es auf seiner Kleidung regelmäßig Kotzflecken verursachte, die nie wieder rausgingen.
Waren die Täuflinge größer und konnten schon sprechen und laufen, wurde es noch unberechenbarer, da die Kinder entweder peinliche Fragen stellten (Wieso hat der komische Onkel ein Kleid an?) oder ausrissen. Nicht selten hatte er mit wehenden Röcken und rotem Kopf hinterherrennen oder Antworten finden müssen, während die entzückten Eltern aufgeregt dafür sorgten, dass die Videokamera auch alles richtig aufzeichnete.
Eine Dreijährige hatte mal zu ihm gesagt: »Mein Kleid ist ja viel schöner als deins!«, und dabei stolz auf den Alptraum in rosa gezeigt, in den sie gehüllt war. Dafür hatte er sie dann mit dem Wasser besonders großzügig bedacht, sodass der rosa Alptraum tropfend mit wütenden Eltern hinausstapfte und heulte: »Mama, der hässliche Mann hat mich nass gemacht!«
Nein. Erwin konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, selbst ein Kind zu haben. Das gehörte in seiner Welt ganz klar zu den Plagen, die nur andere Leute befielen.
Zu schade, dass er nicht mehr Herr seiner eigenen Welt war.
***
Frau Wunderlich kam gerade rechtzeitig von ihrem Besuch bei der Kosmetikerin zurück, um die Eskalation des Streits um die Fernbedienung zwischen ihrem Mann und ihrer neuen Tochter zu verhindern.
Sie ging neuerdings regelmäßig zur Kosmetik und kränkte damit ihren Mann. Vor reichlich zwei Jahren hatte der ihr nämlich nach einem Tipp von jemandem, den er bis dahin für einen guten Freund gehalten hatte, einen Kosmetikgutschein geschenkt. Sein Stolz auf diese außergewöhnlich kreative Geschenkidee verflog nach Überreichen des Gutscheins recht schnell. Stattdessen musste er die folgenden drei Nächte auf dem unbequemen Sofa im Arbeitszimmer verbringen.
Herr Wunderlich rätselte noch heute, was an diesem Geschenk falsch gewesen sein sollte. Jeder hätte bei halbwegs objektiver Betrachtung zugestimmt, dass Frau Wunderlich eine solche Behandlung gut tun würde.
Jetzt kamen diese Zweifel erneut auf, zumal seine Frau nun gutes Geld dafür ausgab, den ebenfalls nicht billigen Gutschein jedoch achtlos verfallen ließ.*
Frau Wunderlich selbst wäre noch bis vor wenigen Wochen nicht im Traum darauf gekommen, sie könne eine kosmetische Behandlung benötigen. Aber zum einen musste sie erkennen, dass ihr die durch Ken verabreichte Verschönerungsaktion gut getan hatte (wenn man mal von der vielen Farbe absah), und zum anderen hatte sie jetzt eine Tochter. Das veränderte alles.
Es würde nicht lange dauern, bis diese alt genug war, dass sich junge, attraktive Männer nach ihr umdrehten. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen war, wollte Frau Wunderlich auf keinen Fall für Emilys Mutter, sondern allenfalls für ihre Schwester gehalten werden.
Als Frau Wunderlich das Haus betrat und durch lautes Rufen deutlich machte, dass sie jemanden zum Tragen der Einkaufstüten brauchte, warf Herr Wunderlich die bis dahin tapfer verteidigte Fernbedienung hastig auf den Tisch und eilte seiner Frau entgegen.
In letzter Zeit waren ihre Launen noch unberechenbarer geworden und er sollte sich nicht schon wieder ihren Unmut zuziehen. Außerdem hielt er es für ratsam, den Inhalt der Einkaufstüten überprüfen, um gegebenenfalls Vorsorgemaßnahmen ergreifen zu können. Denn …
Frau Wunderlich machte eine Diät. Und da sie das alleine niemals durchstehen würde, hatte sie ihren Mann ebenfalls auf Diät gesetzt. Seitdem hielt er sich häufig in der Garage auf, wo es Regale knapp unter der Decke gab, an die Frau Wunderlich nicht herankam.
Die Diät bereitete Frau Wunderlich große Schwierigkeiten, was auch ihre wechselhafte Laune erklärte. Sie kämpfte mit dem Problem der meisten Abnehmwilligen, dass Kopf und Magen an unterschiedlichen Fronten kämpften.
Knurrte der Magen und verlangte nach Eisbein und Sauerkraut oder Sahnetorte, konnte der Kopf seine appetitlich und übersichtlich angerichteten Salatblätter anpreisen wie er wollte – er kam damit nicht durch. Noch schlimmer wurde es, wenn sich auch die verschiedenen anderen Abteilungen des Kopfes auf die falsche Seite schlugen und der ohnehin nur kleine, für die Vernunft zuständige Bereich alleine dastand. So was hielt kein normaler Mensch durch.
Emily blieb von der Essensrationierung verschont, da sie noch ein Kind war und später groß und stark werden sollte. Gab es trotz sorgfältiger Planung einmal Reste, bekam Emily immer einen Nachschlag, während Herr Wunderlich in die Röhre guckte.
Trotzdem folgte Emily jetzt ihrem neuen Papa in den Flur, um zu sehen, ob Frau Wunderlichs Behandlung etwas gebracht hatte.
Als Frau Wunderlich Emily erblickte, machte ihr Herz Purzelbäume, wie häufiger in den letzten Wochen.
War das schön, ein Kind im Haus zu haben. Und dazu noch so ein hübsches und nettes. Tatsächlich überlegte sie bereits, noch ein zweites zu adoptieren, wenn endlich Emilys Adoption abgeschlossen war. Am besten einen kleinen Jungen. Damit würden sie dem Idealbild einer Familie entsprechen – Vater, Mutter, Tochter, Sohn und Einfamilienhaus. Fehlte nur noch ein Hund. Aber um das zu realisieren, musste erst die Katze sterben.
»Na mein Schatz? Wie geht es dir?«, fragte sie liebevoll an Emily gewandt, und Herr Wunderlich konnte sich nur wundern. Mit ihm hatte sie noch nie in diesem Tonfall gesprochen. Allenfalls ganz am Anfang ihrer Beziehung oder wenn sie angetrunken war und ihn für jemand anderes hielt.
»Gut. Du … du siehst toll aus«, behauptete Emily, womit sie meinte toll im Vergleich zu vorher. Und sie hatte sogar Recht, wie Herr Wunderlich plötzlich überrascht erkannte.
Die Diät zeigte erste Erfolge, da Frau Wunderlich sich zwischendurch nicht heimlich durch irgendwelche Notvorräte fraß. Außerdem schienen die preisintensive Pflege und das plötzlich erwachte Modebewusstsein Positives zu bewirken.
Natürlich konnte man keine Wunder erwarten, aber es gab deutliche Unterschiede zu vorher.
Geschmeichelt ging Frau Wunderlich in die Küche. »Hast du Lust, mit mir noch ein bisschen spazieren zu gehen?« fragte sie über die Schulter.
»Können wir machen. Gehen wir am Spielplatz vorbei?« antwortete Emily.
»Wenn du das möchtest, gerne. Dann zieh aber bitte nicht die gute Jeans an, ja?«
»Geht klar.« Eilig verschwand Emily nach oben, um sich umzuziehen.
Herr Wunderlich sah ihr konsterniert hinterher. Was war mit ihm? Fragte ihn etwa keiner? Und überhaupt. Seit wann ging seine Frau gerne spazieren?
Kleine Erinnerungsfetzen erwachten und füllten Lücken, die schon vor langer Zeit geschlagen worden waren.
Frau Wunderlich war tatsächlich einmal gerne spazieren gegangen und hatte ihn ständig dazu gedrängt, sobald kein Regen drohte. Und wenn sie ihn endlich überredet hatte, nörgelte sie unentwegt daran herum, wie er spazieren ging. Entweder ging er zu schnell. Oder er bummelte. Oder man konnte sich mit ihm nicht richtig unterhalten, oder er meckerte nur herum. Außerdem wollte er ständig umkehren oder abkürzen und war der Meinung, man sei jetzt genug spaziert.
Offensichtlich hatte sie nicht am Spazieren die Lust verloren, sondern daran, mit ihm spazieren zu gehen.
Vielleicht sollte er etwas guten Willen zeigen und mitkommen. Das konnte nicht schaden. Schließlich wohnte jetzt Konkurrenz im Haus.
***
Lautes Gemurmel erfüllte den großen Saal. Die Versammlung hätte bereits vor zehn Minuten beginnen sollen, aber bislang war noch kein redewilliger Zwerg erschienen. Niemand wusste, was heute drohte, und die Mienen waren skeptisch. Es hieß zwar, dass es um etwas Wichtiges ging, aber vielleicht tauchte auch nur Wilbert mit seinen verrückten Ideen auf.
Dieses Mal waren die Zwerge besser vorbereitet und hatten was zum Werfen mitgebracht. Jetzt mussten sie nur noch mit dem Problem fertig werden, dass sie keine guten Werfer waren.
Wieso das so war, wusste keiner. Es hatte vermutlich irgendetwas mit Anatomie zu tun. Vielleicht war auch in den Zwergenköpfen das dafür notwendige Programm vergessen worden. So was kam vor.
Als aus dem Gemurmel allmählich Gemurre wurde, betrat Humbert das Podium und fingerte nervös an einem Zettel herum. Schlagartig trat Stille ein.
Nach den kürzlichen dramatischen Ereignissen hatte sich Humbert besser erholt, als man es ihm in seinem Alter zutraute. Keine ahnte, dass die Angst vor einem angeordneten Ruhestand dabei eine wichtige Rolle spielte.
Die Zwerge wurden nun ebenfalls nervös, da ein angespannter Humbert meistens nichts Gutes bedeutete.
Dieser räusperte sich, entrollte umständlich den Zettel und warf einen kurzen hoffnungsvollen Blick darauf, da man nie wissen konnte. Vielleicht stand dort auf einmal etwas anderes. Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht. Humbert runzelte die Stirn.
»Liebe Zwerge«, begann er, unterbrach sich jedoch und inspizierte mit prüfendem Blick das Publikum. Doch alle waren da. Sogar Constantin und Grummelbert. Soweit so gut. »Vermutlich fragt ihr euch, weshalb schon wieder eine Versammlung einberufen wurde. Ihr könnt mir glauben, dass es mir lieber wäre, wenn das nicht sein müsste. Aber wir haben schon wieder Post von der magischen Aufsichtsbehörde bekommen.«
Ein kollektives Seufzen durchquerte den Saal und ließ sich wachsam nieder – jederzeit bereit, wieder aufzuspringen und sich zu Wort zu melden.
Das mit der ständigen Behördenpost hatte nach langen, ruhigen Jahren kurz vor dem Abgang des alten Weihnachtsmannes begonnen. Humbert argwöhnte, dass es eine Neubesetzung an der für sie zuständigen Stelle gab und sie das Pech hatten, an einen übereifrigen Beamten geraten zu sein. Nicht auszudenken, was so einer alles anrichten konnte.
»Wie es aussieht, herrscht weiterhin Sparzwang. Jedenfalls wurde, wie es hier heißt, aus Einsparungsgründen beschlossen, uns mit der Abteilung der Heinzelmännchen zusammenzulegen.«
So. Nun war es heraus. Humbert musterte die Zwerge, doch die meisten sahen sich nur ratlos an. Kaum einer wusste etwas über Heinzelmännchen außer dem üblichen Kram. Dass sie nachts bei Menschen einbrachen und dort aus unerklärlichen Gründen die Hausarbeit verrichteten. Außerdem lebten sie in ständiger Angst vor getrockneten Erbsen und davor, entdeckt zu werden.
Humbert räusperte sich erneut. »Bereits in drei Tagen wird eine größere Heinzelmännchendelegation hier eintreffen und sich alles anschauen. Dann soll auch beraten werden, wie die zukünftige Zusammenarbeit abläuft. Heinzelmännchen, die sich gerade nicht im Einsatz befinden, sollen bei den Weihnachtsvorbereitungen aushelfen.«
Humbert vermutete stark, dass die Heinzelmännchen darüber hinaus ein wachsames Auge auf die letzthin etwas außer Kontrolle geratenen Aktivitäten in Zipfelbergen werfen sollten. Aber das behielt er vorerst für sich.
»Außerdem steht hier, dass Heinzelmännchen naturgemäß freundlich, nett und hilfsbereit sind und es deshalb keine größeren Schwierigkeiten geben sollte. An die Küche ergeht der freundliche Hinweis, dass Heinzelmännchen gerne Obst und Gemüse essen und wir das beim Bekochen der Delegation berücksichtigen sollen. Äh … ja. Ich glaube, das war erstmal alles. Ach so, das hier habe ich noch für den Weihnachtsmann.«
Humbert eilte vom Podium und überreichte dem überraschten Constantin einen dicken, versiegelten Brief mit der unübersehbaren Aufdruck »Persönlich/vertraulich!«.
»Los, mach auf«, sagte der Kobold aufgeregt. Auch die Zwerge in seiner Nähe sahen Constantin erwartungsvoll an. Doch dieser hütete sich, den Brief vor Zuschauern zu öffnen. Falls wieder etwas Unangenehmes drin stand, brauchte er kein Publikum, das mit ansah, wie er weinte. Nicht dass er vorhatte zu weinen. Aber in letzter Zeit war ihm das häufiger passiert und er wollte kein Risiko eingehen.
Auf dem Podium tat sich etwas und Constantin deutete den Zwergen an, dass er leider kein Zeit für den Brief hatte, da die Versammlung fortgesetzt wurde.
Humbert sah resigniert auf die Zwerge herab. »So leid mir das auch tut. Aber es hat sich noch ein weiterer Redner gemeldet.« Eilig räumte er seinen Platz. Wilbert erschien und die Zwerge erstarrten. Die vorderen Reihen setzten ein verkrampftes Grinsen auf.
Wilbert sprang fröhlich hinter das Sprecherpult. »Nun, das sind doch ganz großartige Neuigkeiten. Ich habe schon lange überlegt, wie wir die geplanten Kurse gestalten können. Und wisst ihr, was ich denke?«
Keiner wollte es wissen, aber das half nichts.
»Ich denke, dass uns die Heinzelmännchen dabei wunderbar unterstützen können. Wie ihr gehört habt, sind sie freundlich, nett und hilfsbereit. Ich bin mir sicher, dass das daran liegt, dass sie viel lächeln und sich gesund ernähren, also von Obst und Gemüse. Sie bauen es sogar selbst an. Wir können bestimmt viel von ihnen lernen.«
Das Publikum murrte. Zwerge mochten Obst und Gemüse nicht sonderlich.
Lauritz fragte aufgebracht: »Und wenn wir gar kein Gemüsezeug essen wollen?«
»Na, ihr könnt es doch wenigstens mal versuchen. Vielleicht schmeckt es ja ganz gut.«
»Aber da krabbeln Tiere drauf herum.«
»Tiere?« fragte Wilbert verblüfft.
»Na, eklige Insekten und so.«
»Ja. Aber die krabbeln auch auf größeren Tieren und Getreide herum. Und Fleisch und Brot isst du doch auch, oder?«
»Natürlich. Das wird ja auch gebraten oder gebacken«, erwiderte Lauritz hitzig.
»Also, soweit ich weiß, kann man auch Gemüse und Obst kochen.«
»Aber dann wird es matschig.«
Wilbert hob beschwichtigend die Hände. »Also ich denke, ein Versuch kann nichts schaden. Auf jeden Fall können uns die Heinzelmännchen dabei helfen, öfters mal zu lachen. Außerdem habe ich gehört, dass sie viel und gerne singen. Auch das würde uns gut tun.«
Jetzt reichte es. Obwohl Lauritz keine Lachtherapie benötigte, zudem ganz gerne mal sang und mitunter selbst der Ansicht war, dass manche Zwerge mehr Spaß vertragen könnten.
Wütend kramte er seine Stinkbombe hervor, während er bemerkte, wie andere Zwerge bereits Maß nahmen und zielten. Und das lag gewiss nicht nur an Wilberts unglücklicher Rhetorik.
Er konnte die Heinzelmännchen schon jetzt nicht leiden.
***
Constantin hatte das Pech gehabt, aus der Menge der Zwerge herauszuragen und ziemlich weit vorn zu sitzen. Deshalb war er mehreren schlecht gezielten Geschossen im Weg gewesen.
Nachdem er gründlich gebadet hatte, holte er den Brief der Behörde hervor. Unschlüssig drehte er ihn hin und her. Was erwartete ihn nun wieder? Hatte es etwas mit der bevorstehenden Fusionierung zu tun? Und wenn ja: war das jetzt gut oder schlecht für ihn?
»So kriegst du nie raus, was drin steht. Dafür muss man einen Brief aufmachen«, bemerkte der Kobold.
Constantin warf ihm einen intensiven Weihnachtsmannblick zu, musste aber einsehen, dass Manfred Recht hatte.
Besorgt öffnete er den Umschlag und faltete den Brief auseinander, ohne auf die bunten Blätter zu achten, die dabei heraus fielen. Constantin begann zu lesen und seine Augen wurden immer größer. Schließlich versagte seine Kiefermuskulatur und sein Kinn klappte herunter.
»Was? Was ist?« drängelte Manfred. Doch Constantin war zu überrascht, um sprechen zu können. Wortlos zeigte er dem Kobold den Brief.
»Wir verreisen?« fragte dieser nach einer Weile angestrengten Lesens unsicher.
Constantin grinste irre. »Jawohl. In einer Woche schon. Also – das heißt, ich.«
»Aber – du nimmst mich doch mit, oder? Ich bin dein persönlicher Assistent!« Manfreds Blick bettelte.
»Schon gut. Meinetwegen. Nur darf dich keiner sehen.«
»Mich kann keiner sehen, schon vergessen? Außer Erwin, aber der kennt mich sowieso schon.«
»Wieso Erwin?« fragte Constantin mit gerunzelter Stirn.
»Hast du’s nicht gelesen? Hier unten steht, die Reise sei für zwei Personen und die zweite Person ist Erwin, der aber noch nichts davon w… «
»Zeig. Wo?« Hastig überflog Constantin den Brief, den er nur bis zur Hälfte gelesen hatte, bevor er von seinen Gefühlen überwältigt worden war.*
»Wie kommen wir eigentlich dazu?«
»Wozu?« fragte Constantin zerstreut, während er noch immer las.
»Na, zu dieser Reise.«
»Die gehörte zum Lottogewinn.«
Als Constantin vor über einem Monat aus der Zeitung von dem Lottogewinn erfuhr, hatte er in einem Anfall von Naivität an die magischen Behörden geschrieben und um Bewilligung der Reise gebeten. Was sollten seltsame Kapuzentypen sonst damit anfangen?
Bei objektiver Betrachtung musste er zugeben, dass es für die Behörden keinen Grund gab, ausgerechnet ihm etwas zu schenken. Das einzige Argument, auf das er sich stützen konnte, bestand darin, dass er den Lottoschein erworben hatte. Und das sogar auf legalem Wege. Doch Behörden hatten erfahrungsgemäß eigene Ansichten, wenn es darum ging, wem etwas gehörte.
Constantin rätselte, weshalb er Erwin mitnehmen sollte.
»Vielleicht als Aufpasser? Oder als dein Gewissen?« spekulierte der Kobold.
»Ja. Das wird’s vermutlich sein.« Nachdenkliches Schweigen folgte.
»Aber ich habe mich doch schon gebessert, nicht?« fragte Constantin zögerlich.
»Äh … ja. Natürlich. Ohne Zweifel«, beeilte sich der Kobold zu versichern und bemühte sich, glaubwürdig zu klingen. »Also … wie – wie geht’s jetzt weiter? Mit der Reise und so?«
»Ach ja. Warte … ah. Hier steht’s. Am ersten November, also morgen in einer Woche, werden wir mit dem Schlitten nach Glücksstädt geflogen. Dort sammeln wir Erwin ein und ich habe Gelegenheit, passende Kleidung zu kaufen. Ein Scheck ist beigefügt.« Constantins suchender Blick schweifte über die herausgefallenen Zettel, bis er schließlich an dem Scheck kleben blieb und mit den klein gedruckten Zahlen kämpfte.
»Oh, das ist ja echt großzügig«, stellte er verblüfft fest, bis er weiterlas und feststellte, dass das auch sein gesamtes Taschengeld für die Reise darstellte.
»Und wohin fahren wir?«
»Das steht nicht hier.«
»Nicht? Ist ja blöd.«
»Hm. Aber egal, Hauptsache warm. Du kannst schon mal die Badehose einpacken.« Constantin war sich ganz sicher. Auf dem Plakat, das ihn zum Ausfüllen des Lottoscheins verführt hatte, war ein Strand zu sehen gewesen. Mit Palmen und so.
»Wieso?« erkundigte sich der Kobold misstrauisch.
»Na, falls du baden willst.«
»Wieso soll ich dafür eine Hose anziehen? Die wird ja nass!«
»Aber du musst dir doch was anziehen, wenn du baden willst!«
»Warum?«
»Na, damit man nicht dein … äh …«, Constantin verstummte. »Wie vermehren sich Kobolde eigentlich?« fragte er unsicher.
»Das ist aber eine sehr unhöfliche Frage«, erwiderte der Kobold entrüstet und lief dunkelgrün an.
Constantin hob eine Augenbraue, bohrte aber sicherheitshalber nicht weiter nach. Stattdessen lehnte er sich zurück.
Urlaub.
Er konnte sich nur an einen einzigen Urlaub erinnern, als er noch klein war und sein Vater die Familie noch nicht verlassen hatte. Ein entsprechend verklärtes Bild pflegte Constantin von Urlauben. Urlaubsreisen waren für ihn so etwas wie eine Wundertüte, in die er die Erfüllung aller Träume projizierte.
Constantin gab sich dieser Illusion hin und träumte. Von der harten Realität des Urlauberalltags ahnte er nichts. Da waren die Betten zu hart, der Fernseher zu klein, der Strand überfüllt und die Klimaanlage zu laut. Das Essen war so beschaffen, dass man besser gleich ein Bad mit Fenster buchte, damit man wenigstens von der Toilette aus noch etwas von der viel gepriesenen Landschaft mitbekam. Wenn man Pech hatte oder einen das Hotelpersonal nicht leiden konnte, schaute man dabei aber nicht auf die Landschaft, sondern auf eine weitere Hotelwand mit Fenstern, hinter welchen frustrierte Urlauber hockten.
Mit wachsender Aufregung musterte Constantin den schmollenden Kobold. »Warst du schon mal im Urlaub?«
»Seit ich in der Flasche steckte, nicht mehr, nein. Aber vorher schon.«
»Ach. Und wo warst du?«
»Im Schlaraffenland.«
»Quatsch. Das gibt es gar nicht.«
»Na klar. Ich war doch dort.«
»Unsinn. Du veräppelst mich doch.«
»Mann. Wann verstehst du es endlich? Sobald sich das einer ausgedacht hat und es aufgeschrieben wurde oder jemand dran glaubt, gibt’s das auch.«
In Constantins Kopf arbeitete es. »Ach. Tatsächlich. Kann … kann ich da auch hin?«
»Glaubst du dran?«
»Äh, nicht so richtig.«
»Na, dann nicht.«
»Oh.«
»Ein Kumpel von mir wollte immer dort Urlaub machen, wo er seine Ruhe hatte. Weißt du, wo der überall Urlaub gemacht hat?«
»Nee…« murmelte Constantin zerstreut und grübelte über das zuletzt Gehörte nach.
»Einmal war er in einer Spendenbüchse in der Vorstandsebene einer Bank und einmal in einer Blumenvase in einer Junggesellenwohnung. Und einmal sogar …«
»Sag mal, stimmt das? Alles, woran einer glaubt, gibt es wirklich?« unterbrach ihn Constantin unruhig.
»Ja. Wieso?«
»Wegen der, äh… Kartoffelzombies.«
»Wie bitte?«
»Na… hast du schon mal Kartoffeln gesehen, die den ganzen Winter lang im Keller lagen?«
»Nein. Warum? Was ist damit?«
»Die werden zu Kartoffelzombies«, erklärte Constantin hilflos und kam sich ziemlich dumm vor.
»Wie das?« fragte der Kobold skeptisch.
»Die… die sehen ganz gruselig und schrumpelig aus. Und überall wachsen seltsame Tentakel raus.«
»Unsinn.«
»Doch, wirklich. Ich musste als Kind immer Kartoffeln aus dem Keller holen. Und gegen Ende des Winters begann dann die unheimliche Verwandlung. Ich fürchtete mich immer, weil ich dachte, die Kartoffeln hätten im Keller Kartoffelzombies ausgebrütet, die nachts nach oben schleichen und die Leute auffressen.«
»Mann, du hast eine echt kranke Phantasie!«
»Ich war noch klein und hatte eben Angst«, rechtfertigte sich Constantin.
»Okay. Ist ja gut. Also … glaubst du heute noch an, äh, Kartoffelzombies?«
»Natürlich nicht«, versicherte Constantin und bemühte sich, überzeugender zu klingen als er tatsächlich war.
»Und hast du’s irgendwo aufgeschrieben?«
»Nein!«, erwiderte Constantin entsetzt.
»Und denkst du manchmal noch dran?«
»Nein. Also, vielleicht … ab und zu. Wenn ich Kartoffeln sehe.«
»Oh. Ich denke, dann wird die Existenz nicht auszuschließen sein.«
»Äh, sind die gefährlich?« erkundigte sich Constantin angespannt.
»Glaubst du denn, dass sie gefährlich sind?«
»Äh, nein. Nicht mehr.«
»Na also. Dann gibt’s auch keine Kartoffelzombies. Zumindest nicht immer, und auch keine gefährlichen«, stellte der Kobold fest und war froh, dass nicht er unter einer derartigen Kreativität litt.
»Gut.« Erleichtert richtete Constantin seine Aufmerksamkeit wieder auf den Brief, in dem stand, dass man es ihm überließ, in welcher Form er Erwin über das bevorstehende Reisevergnügen informierte. Da Constantin aus Erwins Briefen herausgelesen hatte, dass dieser über seine Zeit nicht mehr frei verfügen konnte, sondern beinahe vollständig von seiner neuen Freundin verplant wurde, musste Constantin Phoebe zuvorkommen und Erwin schnellstmöglich Bescheid geben. Eilig griff er zum Briefpapier.
***
Im Allgemeinen war die Unterzeichnung eines Mietvertrages zusammen mit der neuen (und in Erwins Fall ersten) Freundin ein freudiges Ereignis.
Üblicherweise fand dieses Ereignis statt, nachdem man die Person, der man sich damit rund um die Uhr auslieferte, näher kennenlernen konnte. Phoebe hatte jedoch schon mehrere dieser Kennenlernphasen durchlaufen und hinterher jedes Mal allein dagestanden. Deshalb beschloss sie kurzerhand, dieses Mal darauf zu verzichten.
Erwin fiel das nicht weiter auf, da er sich mit derartigen Dingen nicht auskannte. Er hatte vorher noch nie eine Frau näher kennengelernt und war sich jetzt nicht mehr sicher, ob er dadurch etwas verpasst hatte oder ob ihm etwas erspart geblieben war.
Die einzige Frau in seinem bisherigen Leben war seine Mutter gewesen. Die jetzt nicht mehr mit ihm sprach.
Er war einer der wenigen Menschen, die fürs Kistenschleppen Dank empfanden. Denn dabei hatte er dem Krieg im Wohnzimmer seiner Mutter entkommen können. Die zwei einzigen Frauen in Erwins Leben fochten dort anfangs aus, ob Erwin nun ausziehen durfte oder nicht. Erwin hätte das nie für möglich gehalten, aber seine Mutter verlor. Das machte nicht unbedingt Mut für eine Zukunft an der Seite der Siegerin.
Aber damit nicht genug. Vom errungenen Sieg umnebelt, kämpfte Phoebe anschließend darum, was Erwin alles mitnehmen durfte. Es gab nicht viel, worum gestritten werden konnte, aber die Kämpfe wurden dadurch nur noch erbitterter. Als Phoebe darauf bestand, eine alte Vase mitzunehmen, die Erwins Mutter in sein tristes Zimmer gestellt hatte, um diesem die Illusion von Gemütlichkeit zu verleihen, mischte sich Erwin ein. Das konnte nur mit seinem Mangel an Erfahrung erklärt werden.
Augenblicklich richtete sich die Feindseligkeit beider Frauen gegen ihn und er geriet ins Kreuzfeuer der weiblichen Aggressionen.
Ihm war schon zu Ohren gekommen, dass sich mehr oder weniger friedliche Frauen in entsetzliche Ungeheuer verwandelten, wenn sie um einen Mann kämpften. Aber zum einen fand er derartige Geschichten maßlos übertrieben. Zum anderen hätte er es niemals für möglich gehalten, dass selbst ein Mann wie er Frauen in solche Abgründe treiben konnte.
An den folgenden Tagen hatte er mehrere böse Briefe seiner Mutter erhalten, die Phoebe sofort als Beweisstücke A bis D in einen Ordner heftete. Erwin war schlicht zu feige, seiner Mutter zu antworten oder ihr gar gegenüberzutreten. Vielleicht brachte die Zeit eine Lösung. Oder Entspannung.
Erwin hatte mit seiner Mutter noch immer nicht über seine Erlebnisse im Juli und die Erkenntnis, wer sein Vater war, gesprochen. Seine Mutter wusste deshalb auch nicht, weshalb er kein Priester mehr war. Sie glaubte, dass ausschließlich Phoebe dahintersteckte.
Anfangs hatte Erwin überlegt, wie er das Thema am besten ansprechen konnte. Dann zog Phoebe und damit das Chaos ein. Zunächst hoffte Erwin noch auf eine günstige Gelegenheit, doch die Lage spitzte sich weiter zu. Irgendwann würde er jedoch mit seiner Mutter reden müssen. Bald. Aber nicht zu bald.
Jetzt saß Erwin vor dem Mietvertrag. Seine Hand zitterte. Sollte er wirklich unterschreiben? War das ein Schritt in die Freiheit oder in den Abgrund?
Und was, wenn er seinen Anteil der Miete nicht bezahlen konnte?
Dummerweise war er abhängig von Phoebe. Denn da war noch das Problem mit Erwins ungeklärter Zukunft. Phoebe hatte Erwins Entscheidung, das Dasein als Priester aufzugeben, grundsätzlich begrüßt. Nicht zuletzt wegen der zölibatären Einschränkungen.
Allerdings musste für Erwin jetzt eine andere Beschäftigung gefunden werden, und das war nicht so einfach, wenn man außer priesterlichen Fachkenntnissen nichts vorzuweisen hatte.
Darüber hinaus fürchtete Phoebe, dass sie auf ihrer göttlichen Gut-und-böse-Liste Minuspunkte gesammelt hatte, weil sie einen gottgeweihten Mann vom rechten Weg abbrachte. Daher suchte sie für ihn eine Beschäftigung, bei der er Gutes tat. Das war schwerer als erwartet, da man selbst hierfür gewisse Qualifikationen vorweisen musste.
Das beim Juwelier Lehmann erbeutete Geld und Gut war zur Hälfte an verschiedene Wohltätigkeit versprechende Organisationen gespendet worden. Die andere Hälfte hatte Erwin dem Waisenhaus übergeben, aus dem Emily stammte. Phoebe hoffte, dass ihm das dort gewisse Türen für eine Beschäftigung öffnen würde. Aber derzeit klemmten die Türen noch.
Momentan war die einzige Tätigkeit, die Erwin ohne zusätzliche Ausbildung ausüben konnte, die eines Verkäufers oder Vertreters. Also half Erwin vorerst in Phoebes Geschäft aus, doch irgendwie war er dafür spirituell falsch ausgerichtet.
Ein leiser Knall ließ Erwin hochschrecken. Verwirrt sah er um sich und konnte gerade noch beobachten, wie Manfred in einer Rauchwolke Gestalt annahm und mit einem großen Briefumschlag kämpfte.
»Post für dich«, rief der Kobold und strahlte Erwin an.
***
Die Sonne schien auf Herrn Wunderlichs sorgfältig überkämmte Halbglatze herab. Darunter wälzten sich düstere Gedanken umher. Auf seine Ankündigung hin, mit spazieren gehen zu wollen, hatte seine Frau ihn zuerst verblüfft angesehen und dann mit den Schultern gezuckt. Hätte er dieses Zeichen mal besser richtig gedeutet. Doch gutwillig war er hinterhergetrottet. Den ganzen langen Weg bis zum Spielplatz. Selbst schuld.
Seine Frau ließ sich von Emily interessante Dinge erzählen wie Dann hat der gesagt, dass die Freundin von dem jemanden getroffen hat, der beobachtet hat, wie sich die mit dem gestritten hat. Herrn Wunderlichs Beitrag beschränkte sich auf verwirrte Blicke. Und mehr wurde auch nicht erwartet. Im Gegenteil. Er war Luft.
Auf dem Spielplatz wurde es noch schlimmer. Während Emily schaukelte, traf Frau Wunderlich ihre Nachbarin, Frau Krummel. Ein weiteres Mal zeigte Herr Wunderlich guten Willen und setzte sich dazu; bereit, die verbale Schlacht aufzunehmen. Und dann sprachen die Frauen ausgerechnet über Diäten. Als ob er das nicht schon oft genug ertragen musste. Jetzt sollte er auch noch darüber reden.
Frau Krummel zeigte sich beeindruckt von Frau Wunderlichs Durchhaltevermögen. »Ach?« hatte sie gemeint und neidisch geguckt. »Ich halte so etwas nie durch.«
»Und wie bleibst du dann so schlank?« fragte Frau Wunderlich (jetzt ebenfalls neidisch).
»Oh. Nun, Viren und Infekte machen immer so im Februar und März die Runde, also genau rechtzeitig vor der neuen Bikinisaison. Ich besuche dann alle Leute, von denen ich höre, dass sie einen Magen-Darm-Virus abbekommen haben. Jeder Infekt macht mich ungefähr ein anderthalbes Kilo leichter, richtig gute sogar zwei. Etwa fünf Infekte, und ich bin im Soll.«
Herr Wunderlich war sich sicher, dass er nie wieder Frau Krummel begegnen konnte, ohne daran zu denken, wie sie auf dem Klo saß. Beziehungsweise davor kniete.
Er machte sich Sorgen. Die Diät, die ständigen Kosmetik- und Friseurbesuche, Einkäufe, nicht zu vergessen die neue Tochter – irgendetwas war mit seiner Frau geschehen, als sie vor ein paar Wochen kurz verschwunden war. Wilma schwieg hartnäckig, wenn er sie fragte, wo sie gewesen sei und was zum Teufel mit dem ganzen Geld passiert war.
Für eine Weile hatte er angenommen, ihr sei etwas zugestoßen, da ihr linker Arm eine Art Verband trug. Aber irgendwann war der Verband plötzlich verschwunden und er sah einem grimmigen Zwerg ins Auge. Das machte alles noch seltsamer – zumal Frau Wunderlich sich auch hierzu weigerte, genauere Auskunft zu erteilen. Auf seine vorsichtige Frage, ob das wieder weggeht, antwortete sie mit einem kurzen, unmissverständlichen Nein. Und als er ihr Gesicht sah, traute er sich nicht, weitere Fragen zu stellen. Zum Glück schien sie selbst zu der Erkenntnis gelangt zu sein, dass ein Zwerg auf dem Arm nicht unbedingt vorteilhaft wirkte, und versteckte diesen unter Ärmeln, wenn sie sich der Öffentlichkeit präsentierte.
Emily schien mit den geheimnisvollen Vorgängen irgendetwas zu tun zu haben, doch auch aus ihr bekam er nichts heraus. Außerdem spukte in seinem Kopf noch immer der Gedanke herum, dass Frau Wunderlich etwas mit einem anderen Mann hatte. Gewisse Anzeichen schienen das zu bestätigen. Andererseits fragte er sich, wann sie sich auch noch um einen anderen Mann kümmern wollte, neben ihren ganzen Schönheitsterminen und der Zeit, die sie mit Emily verbrachte. Ständig gingen die zwei einkaufen oder spazieren. Und jetzt war es schon so weit gekommen, dass er mitging.
Aus den Augenwinkeln sah er, dass seine Frau das Zeichen zum Aufbruch erteilte.
Herr Wunderlich seufzte tief und hingebungsvoll. Er nahm sich vor, die Vorgänge weiter aufmerksam im Auge zu behalten. Irgendwann würde er schon noch dahinterkommen.
Er ahnte nicht, dass seine Frau die ganze Zeit über Ängste durchlebte, dass er etwas herausfinden könnte. Zum Beispiel darüber, dass sie einen Tag lang ein bärtiger Zwerg gewesen war. Das wusste noch nicht mal Emily, und Frau Wunderlich beäugte daher argwöhnisch die Korrespondenz Emilys mit den Zwergen und Constantin. Aber auch über die anderen Geschehnisse der zwei Tage im Juli schwieg sie. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, da sie keine Ahnung hatte, was ihr Körper in dieser Zeit alles erlebt und angestellt hatte. Es gab einige seltsame Bemerkungen von Frau Zipfel beim wöchentlichen Chortreffen, die Frau Wunderlich vorsichtshalber ignorierte. Und sie war beim Zwei-grüne-Daumen-Gartenverein in Ungnade gefallen. Doch ansonsten schien keiner etwas bemerkt zu haben. So weit, so gut. Jetzt musste sie nur noch die Tätowierung verstecken.
Zum Glück fiel es nicht weiter auf, wenn sie ihrem Mann aus dem Weg ging, da sie das auch vorher schon praktiziert hatte. Allerdings schien Herr Wunderlich das neuerdings ändern zu wollen. Jetzt ging er sogar schon mit spazieren. Frau Wunderlich fragte sich, wo das noch hinführen sollte.
Der Rückweg war für Herrn Wunderlich beinahe noch schlimmer als der bisherige Spaziergang, weil Emily Frau Wunderlich fragte, wann diese denn Geburtstag hatte. Schlagartig fiel ihm ein, dass das schon bald war. Sehr bald. Genau genommen in knapp drei Wochen. Lieber Himmel. Auch das noch.
Herr Wunderlich beneidete seinen Nachbarn, Herrn Krummel. Am Vorabend bestimmter Anlässe, welche eine Beschenkung der Gattin erforderlich machten, erkundigte sich Herr Krummel bei dieser: »Und? Was schenke ich dir dieses Jahr?« Und dann überreichte ihm Frau Krummel diverse Päckchen, die sie für ebendiesen Zweck besorgt hatte.
Von Herrn Wunderlich hingegen wurde Eigeninitiative erwartet, was ins Auge gehen konnte. In seltenen Fällen äußerte Frau Wunderlich einen konkreten Wunsch und überließ ihrem Mann nur noch die Besorgung. Meistens jedoch erwartete sie eine Überraschung, und zwar eine freudige.
Die wenigsten Überraschungsgeschenke kamen bei Beschenkten wirklich gut an. Das lag in den meisten Fällen nicht etwa daran, dass sich die Geber keine Mühe gaben. Im Gegenteil. Aber oftmals waren die Geschmäcker von Schenkendem und Beschenktem eben einfach zu verschieden. Schenkende neigten häufig zu der Annahme, dass dem Beschenkten zweifellos das gefiel, worüber sie sich selbst freuen würden. Damit lagen sie in der Regel daneben. Je unterschiedlicher der Geschmack, desto größer die Enttäuschung und anhaltender das betretene Schweigen. Am schwierigsten waren daher Menschen zu beschenken, die einen außergewöhnlichen Geschmack hatten oder unter zu hohen Erwartungen litten.
So gewöhnlich Wilma Wunderlichs Geschmack auch war – ihre Erwartungen überstiegen jedes für normale Männer erreichbare Maß.
Doch dann sagte Emily etwas, das Herrn Wunderlich hoffen ließ. Aufgeregt drehte sie sich zu ihm um: »Da müssen wir uns aber schnell was einfallen lassen!«
Ja! Endlich wusste er, wofür eine so große Tochter gut war. Er musste nur noch die Bedienungsanleitung finden, um damit klarzukommen.
***
Es folgte die Zeit des Wartens.
Die Zwerge warteten auf die Heinzelmänner, Constantin auf seine Reise, Erwin ebenfalls auf die Reise (von der er Phoebe noch immer nichts gesagt hatte, weil er nicht wusste, wie), Phoebe auf ihren Umzug, Herr Wunderlich auf Vatergefühle und Frau Wunderlich auf Jugend und Schönheit.
Die meisten der erwarteten Dinge sollten tatsächlich eintreten – ob das nun gut war oder nicht.
***
Zeit ist eines der seltsamsten Phänomene, die es gibt. Jemand scheint das Tempo der Zeit mit einer ordentlichen Portion Niedertracht willkürlich festzulegen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass schöne Erlebnisse wie im Zeitraffer dahineilen, alle Schrecklichkeiten sich jedoch wie Kaugummi dehnen und kein Ende nehmen.
Noch nie hatte es jemand geschafft, die Zeit auszutricksen. So erklärte es sich, dass die Tage bis zur Ankunft der Heinzelmännchen und damit bis zu angeordneter Höflichkeit und Frohsinn praktisch nicht existierten.
Für Constantin hingegen, der den Besuch der Heinzelmännchen nur als Randerscheinung während der Wartezeit bis zum Beginn seiner Reise wahrnahm, zogen sich die Tage endlos dahin.
Die Zwerge bemühten sich, die Vorbereitungen hinter sich zu bringen, ohne allzu oft über das Bevorstehende nachzugrübeln.
Es war wie immer, wenn man auf fremde Veranlassung hin dazu gezwungen wurde, jemanden einzuladen, den man nicht kannte und der eine unberechenbare Größe* darstellte.
Man schwankte zwischen Neugier und Argwohn. Die negativen Gefühle überwogen, da bei Zwergen Optimismus mit Unreife gleichgesetzt und entsprechend selten praktiziert wurde.
Es herrschte allgemeine Unsicherheit und kaum einer erhoffte sich etwas von dem Besuch (wenn man einmal von Wilbert absah).
Die ernsteren Zwerge (also solche, die zum Lachen zwei Finger zur Hilfe nehmen mussten), fürchteten sich vor ansteckender Fröhlichkeit, welche zu irreparablen Schäden der Gesichtsmuskulatur führen konnte.
Auch in der Küche zerbrach man sich den Kopf. Gemüse essender Besuch stellte die Köche vor ungewohnte Herausforderungen. Am Ende beschloss man, für die Gäste Kaninchen zu grillen, welche sich immerhin mal von Gemüse ernährt hatten. Für das Dessert waren Bratäpfel geplant. Das schien ein erträglicher Kompromiss zu sein. Notfalls konnte man später noch Gummibärchen und Kaugummis mit Fruchtgeschmack verteilen.
Keiner hatte es für nötig gehalten, den Zwergen mitzuteilen, wie lange die angeordnete Belagerung durch die Heinzelmännchen dauern sollte. Sicher schien nur, dass sie nicht gleich nach dem Kaffeetrinken wieder verschwinden würden. Die Ankündigung der Fusionierung der Abteilungen ließ im Gegenteil befürchten, dass man diese Personen nie wieder loswerden würde. Es wäre also taktisch unklug, negativ aufzufallen, da man riskieren würde, zu den Heinzelmännchen strafversetzt zu werden und Menschen ihren Dreck nachräumen zu müssen.
Und wo würden die überhaupt wohnen? Es gab zwar ein Gästehaus, aber das bot allenfalls vier, fünf Zwergen Platz, die gelegentlich zur Aushilfe eintrafen.
Der Missmut unter den Zwergen nahm stetig zu, was man ihnen nicht verdenken konnte. Wer bekam schon gerne Besuch, der zwanghaft fröhlich war, unmögliche Ansprüche ans Essen stellte und nicht sagte, wann er wieder ging?
Alles in allem verbrachte man die Tage in Panik, bis der Moment gekommen war.
Die Zwerge Oben und Unten waren schon vor einigen Stunden mit dem Rentierschlitten losgeflogen. Jetzt deuteten Geräusche hinter dem Stall darauf hin, dass sie zurückgekehrt waren. Nun gut. Also würde man den unabwendbaren Tatsachen tapfer ins Auge blicken und hoffen, dass man anschließend nicht schielte.
Draußen trafen die Zwerge auf ein Grüppchen von mehr als zwanzig Heinzelmännchen, die sich neugierig umsahen. Vor einer unsichtbaren Linie kamen die Zwerge plötzlich zum Stehen und musterten die Neuankömmlinge argwöhnisch.
Die Heinzelmännchen waren kleiner als die Zwerge und hatten etwas kürzere Bärte. Die Gesichter waren faltiger, was vermutlich vom vielen Lachen kam. Doch ansonsten waren sie den Zwergen gar nicht so unähnlich. Wenn man einmal vom Gesichtsausdruck absah.
Die Last der Verantwortung zwang Humbert schließlich, das Schweigen zu brechen. »Wir heißen euch hier in Zipfelbergen herzlich willkommen und hoffen, dass ihr euch bei uns wohl fühlt.«
Die Heinzelmännchen nickten freundlich und sahen Humbert erwartungsvoll an. Der hatte den einzigen offiziellen Satz, der ihm für diese Situation eingefallen war, bereits gesagt und fragte sich, was man wohl jetzt von ihm erwartete. Keiner der Zwerge schien gewillt zu sein, ihm hilfreich zur Seite zu stehen. Und da man befürchten musste, dass Wilbert seine Drohung wahr machte, die Gäste mit einem fröhlichen Lied aufzumuntern, sprach er verzweifelt weiter.
»Vielleicht, äh, sollten wir euch erst einmal alles zeigen. Oder habt ihr einen bestimmten Wunsch, was ihr jetzt tun wollt? Also … wir könnten dann auch essen, ich müsste nur vorher noch kurz in der Küche Bescheid ge…«
Ein Heinzelmännchen schob sich nach vorn und hob die Hand. »Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Wir…«
Das Heinzelmännchen verstummte abrupt und warf entsetzte Blicke auf eine Stelle irgendwo hinter den Zwergen. In die Gruppe kam Bewegung. Im nächsten Augenblick waren sämtliche Heinzelmännchen hinter dem Schlitten verschwunden.
Verblüfft beobachteten die Zwerge das seltsame Gebaren und drehten sich schließlich fragend um, in der Hoffnung, die Erklärung hierfür zu entdecken.
Constantin stand allein und ratlos im niedergetrampelten Schnee und betrachtete stirnrunzelnd den Schlitten. »Komme ich ungelegen? Ich … ich kann auch gerne wieder gehen«, bot er hoffnungsvoll an.
Wenn es nach ihm ginge, wäre er gar nicht erst hergekommen. Doch man hatte ihn darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Höflichkeit sein Erscheinen notwendig war. Schließlich war er bald der Chef dieser kleinen Wichte.
Humbert räusperte sich und ging auf den Schlitten zu. »Gibt es irgendein Problem?«
»Ja. Da steht ein Mensch!« ertönte es hinter dem Schlitten.
»Äh … das ist richtig. Ich meine, das ist der Weihnachtsmann. Der wohnt hier«, erklärte Humbert und fragte sich, was die wohl erwartet hatten.
»Das mag ja sein. Aber wir dürfen uns keinem Menschen zeigen«, heulte eine verzweifelte Stimme. Die fröhliche Stimmung war vorerst zum Teufel, wie es schien.
»Ach was.«
»Nein, nein. Auf gar keinen Fall!«
»Aber – das wird so nicht funktionieren. Der Weihnachtsmann gehört nun mal hierher. Er ist … sozusagen der Grund für all das. Außerdem ist er, wie es aussieht, bald euer Vorgesetzter. Oder so was in der Art. Da sollte er euch schon sehen können, oder?«
»Warum?«
Aus Sicht eines Untergebenen eine durchaus berechtigte Frage. Wer träumte nicht von einer Arbeit, bei welcher ihn der eigene Chef niemals beobachten durfte? Da Chefs die Sache naturgemäß anders sahen, übernahm dieser jetzt das Wort.
»Um Anweisungen zu erteilen zum Beispiel. Oder Berichte anzuhören. Oder so.« Constantin hatte noch nie jemandem Anweisungen erteilt, aber vielleicht sollte er es mal versuchen.
Hinter dem Schlitten war Getuschel zu hören.
»Geht das nicht auch schriftlich? Also, tut uns leid, aber wir können wirklich nicht …«
»Schon gut.« Constantin winkte ab. »Dann geh ich eben wieder. Hab sowieso zu tun. In drei Tagen mache ich Urlaub und bin erstmal weg. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr hier bleibt, aber vielleicht können wir uns so aus dem Weg gehen.«
Um Wilberts Frohmut war es geschehen. »Wieso kriegt der eigentlich Urlaub und ich nicht?« Aufgebrachtes Zischen brachte ihn zum Schweigen.
Hinter dem Schlitten tuschelte es erneut. »Nun, das müsste gehen. Erstmal.«
»Na bestens.« Erleichtert machte Constantin kehrt, gefolgt von neidischen Blicken verschiedener Zwerge.
Die Stille wurde von einem der Heinzelmänner unterbrochen. »Also gut. Dann würden wir jetzt gerne unsere Quartiere sehen. Und bei der Gelegenheit können wir uns gleich vorstellen. Ich heiße Gutlieb«, fügte er hinzu und lächelte liebenswürdig.
Auch die anderen Heinzelmännchen wurden vorgestellt, und sie trugen Namen wie Flinkerich, Redegut, Hummelfleiß, Hilfgut, Blumerich, Lächelviel, Laufschnell, Singgut, Putzflink, Pfiffig und Strickviel. Die Zwerge kamen aus dem Kopfschütteln nicht heraus.
Es gab nur eine Ausnahme. Die Vorstellung war bei einem Heinzelmännchen angelangt, das nicht nur größer war als die anderen, sondern auch beinahe mürrisch guckte.
Die Gesichter der Zwerge hellten sich auf. Potentielle Heinzelmännchenhauswirte drängelten sich nach vorn. Endlich ein halbwegs vertrautes Wesen.
»Nagut«, stellte sich der Heinzelmann missmutig vor.
»Na gut, was?« fragte Svante verwirrt.
»So heiße ich«, erklärte Nagut und verdrehte die Augen.
»Wie bitte? Aber … wieso?« fragte Svante konsterniert.
»Weil Gehtgeradenochso und Kannmannochgeltenlassen zu lang waren.«
»Was?«
»Sein Vater war ein Zwerg«, erklärte Gutlieb. »Wir kennen ihn nicht, weil … Nun ja. Immernett, also, seine Mutter, will den Namen nicht nennen«, ergänzte er und das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Aber nur kurz.
Aus der Mitte der Zwerge war ein heißeres Flüstern zu vernehmen. »Immernett?«
Die Zwerge sahen sich verwirrt um.
Humbert trat mit versteinertem Gesicht nach vor. »Wie … wie alt bist du?« fragte er erschüttert.
»Äh, einhundertzwölf. Ist … ist das irgendwie wichtig?« antwortete Nagut misstrauisch.
Humbert bewegte stumm die Lippen und rechnete. Das Ergebnis verleitete ihn zu einem tiefen Seufzen und er suchte am Schlitten Halt. Die anderen Zwerge beobachteten ihn verblüfft, doch den schnelleren Denkern war schon bei der letzten Frage klar gewesen, worauf das hinauslief.
Humbert bedachte Nagut mit einem verzweifelten Blick. »Du kommst am besten mit zu mir. Ich glaube, wir sollten uns unterhalten.«
Entschlossen schnappte er sich den Rucksack des Heinzelmannes und stapfte davon, gefolgt von dem verblüfften Nagut.
»War ja klar. Der E