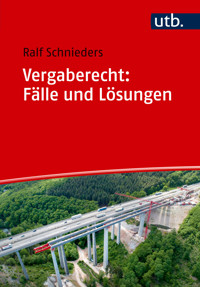
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
16 Fälle bereiten ideal auf die Prüfung vor Öffentliche Aufträge sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Vergabe solcher Aufträge ist an zahlreiche Regeln und Vorschriften gebunden. Ralf Schnieders stellt in seinem Buch 16 Fälle zum Vergaberecht vor – jeweils mit Fallbeschreibung und Falllösung. Er vermittelt auf diese Weise die Grundlagen des Vergaberechts fallbezogen und anschaulich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ralf Schnieders
Vergaberecht: Fälle und Lösungen
Prof. Dr. Ralf Schnieders lehrt Öffentliches Wirtschaftsrecht an der HTW Berlin.
Umschlagabbildung: © ollo · iStock
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838562957
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6295
ISBN 978-3-8252-6295-2 (Print)
ISBN 978-3-8463-6295-2 (ePub)
Inhalt
Vorwort
In den letzten zwanzig Jahren ist ein beträchtlicher Umfang vergaberechtlicher Fachliteratur entstanden, vielfach auch im Internet frei zugängliche. Dies gilt weniger für didaktische Darstellungen der Materie, erst recht nicht für fallbezogene Ausbildungsliteratur. Die vorliegende Fallsammlung will hier eine Lücke schließen. Wie überall in der juristischen Ausbildung wird die Materie am anschaulichsten fallbezogen unterrichtet. Die hier versammelten Fälle hat der Verfasser überwiegend in Vergaberechts-Kursen an seiner Hochschule im Masterstudiengang Wirtschaftsrecht behandelt.
Gerade die ersten Fälle sind nicht repräsentativ für die vergaberechtliche Rechtsprechung, sondern sollen Grundlagenprobleme veranschaulichen, die in der Spruchpraxis häufig vorausgesetzt und deshalb nicht oder nur in Ansätzen problematisiert werden. Die Fälle verfolgen einen didaktischen Ansatz und bauen aufeinander auf:
➲ Fall 1 und ➲ Fall 2 beschäftigen sich mit dem Auftraggeberbegriff (klassischer/funktionaler/Sektoren-Auftraggeber), ➲ Fall 3 mit der Anwendung von Vergaberecht im Zusammenhang mit öffentlichen Zuwendungen. ➲ Fall 4 problematisiert die Begriffe des öffentlichen Auftrags und der Konzession, ➲ Fall 5 und ➲ Fall 11 Besonderheiten für soziale und besondere Dienstleistungen. In ➲ Fall 6 ist die Berechnung des Auftragswertes und das Überschreiten des Schwellenwertes problematisch. ➲ Fall 7 hat die Nichtanwendbarkeit des Vergaberechtes bei sog. Inhouse-Vergaben und Verwaltungskooperationen zum Gegenstand. ➲ Fall 8 gibt ein Beispiel für Fallkonstellationen, in denen im Unterschwellenbereich Grundsätze der EU-Verträge Anwendung finden. ➲ Fall 9 illustriert die Bewertung des wirtschaftlichsten Angebots mittels einer Bewertungsmatrix. ➲ Fall 10 hat erstmalig – als erster von mehreren Fällen (12, 14 und 15) – die Prüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit eines Vergabe-Rechtsstreits vor einer Vergabekammer zum Inhalt und thematisiert materiell-rechtlich die Frage der zulässigen Vergabeverfahrensart in der Konstellation einer Notvergabe im Bereich der Daseinsvorsorge. ➲ Fall 12 behandelt die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Verhandlungsverfahren bei der Beschaffung eines bestimmten Software-Produktes und wiederum die Sektorenauftraggeberschaft. ➲ Fall 13 kombiniert Fragestellungen von Sektorenauftraggebereigenschaft, Abgrenzung des öffentlichen Auftrags zur Konzession, Bereichsausnahmen von der Anwendung des Oberschwellen-Vergaberechts und Zulässigkeit des Verhandlungsverfahrens. ➲ Fall 14 problematisiert neben der Sektorenauftraggebereigenschaft Fragen, die sich im Zusammenhang mit der E-Vergabe stellen können. ➲ Fall 15 hat die Aufhebung des Vergabeverfahrens durch den Auftraggeber und daraus entstehende Ansprüche der Bieter zum Inhalt. ➲ Fall 16 behandelt die lange diskutierte, inzwischen höchstrichterlich entschiedene Rechtsfrage, ob die Bewertung von Angeboten anhand von Schulnoten für die Bieter hinreichend transparent ist.
Für Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge ist der Verfasser dankbar unter: [email protected]
Berlin, Februar 2025
Ralf Schnieders
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. | am angegebenen Ort
Abs. | Absatz, innerhalb eines Paragraphen oder Artikels
AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG | Aktiengesellschaft
Aktz. | Aktenzeichen, Kennzeichen eines Falls bei Gericht oder Behörde
ANBest | Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen
Art. | Artikel
BAnz | Bundesanzeiger
Beschl. | Beschluss
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch
BGH | Bundesgerichtshof, höchstes Zivil- und Strafgericht in Deutschland
BHO | Bundeshaushaltsordnung
BMF | Bundesministerium der Finanzen
BVerfG | Bundesverfassungsgericht
BVerfGE | amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG | Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE | amtliche Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichts
CPV Code | Common Procurement Vocabulary, einheitliches Klassifikationssystem für öffentliche Aufträge in der EU
DB | Deutsche Bahn
EG | Europäische Gemeinschaft (in Paragraphenbezeichnungen: die Paragraphen des 2. Abschnitts insbesondere der VOL/A, VOB/A, VOF/A, die eine Umsetzung europäischer Richtlinien darstellen)
EU | Europäische Union (in Paragraphenbezeichnungen: die Paragraphen des 2. Abschnitts insbesondere der VOB/A, die eine Umsetzung europäischer Richtlinien darstellen)
EuGH | Gerichtshof der Europäischen Union
GG | Grundgesetz
GmbHG | Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)
Grds. | grundsätzlich
GWB | Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellrecht in Deutschland, Teil 4: EU-Vergaberecht)
i.d.F. | in der Fassung
i.E. | im Ergebnis
i.S.d. | im Sinne des
i.V.m. | in Verbindung mit
KG | Kammergericht (das Berliner Oberlandesgericht)
KonzVgV | Verordnung über die Vergabe von Konzessionen
LHO | Landeshaushaltsordnung
lit. | littera (Buchstabe)
m.w.N. | mit weiteren Nachweisen
Nr. | Nummer
OLG | Oberlandesgericht
ÖPNV | öffentlicher Personennahverkehr
RL | Richtlinie
RRL | Richtlinie zur Rückforderung von Zuwendungen bei schweren Vergabeverstößen
S. | Satz
s.o. | siehe oben
SektVO | Sektorenverordnung (Vergaberecht für Unternehmen in bestimmten Sektoren wie Energie oder Verkehr)
Urt. | Urteil
UVgO | Unterschwellenvergabeordnung (Regelungen für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte)
Verg | Vergabe (in Aktenzeichen)
VgV | Vergabeverordnung, umfasst Regelungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge
VK | Vergabekammer
VO | Verordnung
VOB/A | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A
VOL/A | Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A
vs. | versus (gegen, im Vergleich zu)
VwVfG | Verwaltungsverfahrensgesetz, gesetzliche Regelungen für Verwaltungsverfahren in Deutschland
Fall 1 | Funktionaler Auftraggeber: der Fall der städtischen Wohnungsbaugesellschaft O
Fall angelehnt an: OLG Brandenburg, Beschluss vom 06.12.2016, 6 Verg 4/16
🔗 https://gerichtsentscheidungen.brandenburg.de/gerichtsentscheidung/9413
1Sachverhalt
Die Wohnungsbaugesellschaft Oranienberg mbH (O) ist eine städtische GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die Stadt Oranienberg ist. Der Gesellschaftsvertrag bestimmt den Gesellschaftszweck folgendermaßen: „Zweck der Gesellschaft ist die sozial verträgliche Bereitstellung von Wohnraum zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern sie dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.“ Die O will an einem Standort 5 Stadtvillen neu errichten mit 47 Wohnungen, davon 27 Sozialwohnungen, mit einem Gesamtwert von 10 Mio. Euro. Die übrigen 20 Wohnungen sind höherwertig konzipiert und sollen im Gegensatz zu den Sozialwohnungen einen Gewinn erwirtschaften, mit dem dann die Sozialmieten subventioniert werden sollen.
O beauftragt das Bauunternehmen Baumeister AG (B) ohne öffentliche Bekanntmachung mit dem Gewerk Heizung und Sanitär im Gesamtwert von 1 Mio. Euro, nachdem O mit mehreren möglichen Vertragspartnern über die Leistungen verhandelt hatte. Das konkurrierende Bauunternehmen Construction GmbH (C) ist der Ansicht, es habe ein europaweites Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen und will hiergegen vorgehen. O meint, sie sei als Wohnungsunternehmen in einem wettbewerblichen Markt tätig und deshalb nicht als öffentlicher Auftraggeber anzusehen. Deshalb habe nicht nach den Vorgaben des europäischen Vergaberechts ausgeschrieben werden müssen.
Fallfrage: Hätte ein europaweites Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen?
2Lösungsskizze
Pflicht zur Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens?
A. O-GmbH als Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB
I. Sog. klassischer öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 1 GWB
„Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen“: Da als GmbH rechtlich selbständig (–)
II. Sog. funktionaler öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 2 GWB
1. „Andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts“
GmbH (+)
2. „Die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben … zu erfüllen“
Gesellschaftszweck der W: jedenfalls teilweise sozialer Wohnungsbau und -förderung, sog. „Infizierungstheorie“ (+)
3. „Nichtgewerblicher Art“
Indizien:
Kein Wettbewerbsmarkt:
Hier: Wohnungsbau grundsätzlich Wettbewerbsmarkt
Keine Gewinnerzielungsabsicht:
Hier: Tätigkeit nicht marktorientiert, Gewinne fließen dem Hauptzweck, der soizialverträglichen Bereitstellung von Wohnraum, zu
→ Nichtgewerblichkeit (+)
4. Staatsnähe durch Finanzierung oder Kontrolle
a. § 99 Nr. 2 lit. a) GWB
Überwiegende öffentliche Finanzierung
Hier: 100 % staatliche Anteilseignerschaft (+)
b. § 99 Nr. 2 lit. b) GWB
Stadt als Mehrheitsgesellschafter, vgl. §§ 45 ff., insb. § 51 a GmbHG (+)
c. § 99 Nr. 2 lit. c) GWB
§ 46 Nr. 5 GmbHG: Bestellung der Geschäftsführung durch die Gesellschafter. (+)
5. Ergebnis
Öffentlicher Auftraggeber (+)
B. Öffentlicher Auftrag i.S.d. § 103 GWB
Bauauftrag i.S.d. § 103 Abs. 3 GWB (+)
C. Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte, § 106 GWB
10 Mio. Euro > 5.538.000 Euro (+)
D. Keine Ausnahmen, §§ 107ff., 116ff., 132 GWB (+)
E. Gesamtergebnis
3Lösung
Ein europaweites Vergabeverfahren nach den Vorschriften des EU-(Oberschwellen-)Vergaberechts hätte durchgeführt werden müssen, wenn im vorliegenden Fall ein Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB einen öffentlichen Auftrag mit einem Auftragswert oberhalb der europäischen Schwellenwerte nach § 106 GWB vergibt, ohne dass eine Ausnahme von der Anwendung des europäischen Vergaberechts besteht.
A. D als Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB
Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB sind öffentliche Auftraggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB und Konzessionsgeber nach § 101 GWB.
I. Sog. klassischer Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB
O könnte sog. klassischer öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB sein. Dann müsste sie als „Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen“ anzusehen sein. Gebietskörperschaften sind der Bund, die Länder, Gemeinden und Kreise. Organe und Behörden handeln für die Gebietskörperschaft, der sie zugehören. Insbesondere bloße Verwaltungsuntergliederungen wie z. B. Ministerien und ihnen nachgeordnete Behörden sind keine eigenen Gebietskörperschaften, sondern Behörden derselben (Ziekow § 99 GWB, Rn. 28 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024). Sondervermögen sind von den Gebietskörperschaften mit organisatorischer und vermögensmäßiger Selbständigkeit, jedoch nicht mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestattete Verwaltungseinheiten. Beispiel hierfür sind insbesondere Eigenbetriebe (vgl. z. B. § 1 Berliner Eigenbetriebegesetz vom 13.07.1999, BlnGVBl. 1999, 374). Eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete juristische Person des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts kann hingegen kein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB sein. Folglich ist die O GmbH kein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB.
II. Sog. funktionaler Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB
O könnte als öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB, als sog. funktionaler Auftraggeber, anzusehen sein.
1. Juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts
Dann müsste sie eine „andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts“ als die Gebietskörperschaften nach Nr. 1 sein. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsträger, nämlich Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Als juristische Personen des Privatrechts werden neben den formal mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten juristischen Personen, wie eingetragene Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Aktiengesellschaften, bei der gebotenen funktionalen Auslegung auch die nichtrechtsfähigen Gesellschaften wie z. B. die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, angesehen (Ziekow § 99 GWB, Rn. 40 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024). Die O GmbH ist eine juristische Person des Privatrechts.
2. Aufgaben im Allgemeininteresse
Diese juristische Person muss „zu dem besonderen Zweck gegründet“ worden sein, „im Allgemeininteresse liegende Aufgaben (…) zu erfüllen“.
Zur Erfüllung des Kriteriums kommt es auf die tatsächliche Wahrnehmung der Tätigkeiten an, nicht in erster Linie auf den ursprünglich bei der Gründung verfolgten, satzungsmäßig dokumentierten Zweck (OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016, 6 Verg 4/16). Nicht erforderlich ist ebenfalls, dass der im Allgemeininteresse liegende Zweck ausschließlich verfolgt wird. Auch die nur teilweise Wahrnehmung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben erfüllt die Voraussetzungen des funktionalen Auftraggeberbegriffs (sog. Infizierungstheorie, vgl. OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016 – 6 Verg 4/16; EuGH Urt. v. 10.11.1998, C-360/96 Arnheim; Ziekow § 99 GWB, Rn. 74 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024, Gabriel/Krohn/Neun, Handbuch Vergaberecht, 3. Auflage 2021, Kap. 1 Rn. 68).
Die Bereitstellung günstigen Wohnraums für sozial schwache Bevölkerungsgruppen gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge und damit zu den im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben (vgl. EuGH Urt. v. 01.02.2001, C-237/99 Französische Sozialwohnungsbaugesellschaft, Rn. 47; OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016, 6 Verg 4/16). Dies wird auch aus den Vorschriften des Wohnraumförderungsgesetzes deutlich (OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016, 6 Verg 4/16). Neben dem Gesellschaftszweck lassen auch die bisherigen Geschäftsaktivitäten der O erkennen, dass sie in diesem Bereich zumindest teilweise tätig ist. Folglich wurde O zu dem Zweck gegründet, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen.
Aufgaben im Allgemeininteresse bei …
juristischen Personen des Privatrechts: ausdrückliche Feststellung erforderlich
juristischen Personen des öffentlichen Rechts: wird vermutet
3. Nichtgewerblicher Art
Die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe müsste „nichtgewerblicher Art“ sein. Die Nichtgewerblichkeit muss sich auf die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe beziehen, nicht auf die Gesamttätigkeit der juristischen Person – auch hier genügt, dass die Person zumindest teilweise im Allgemeininteresse liegende nichtgewerbliche Aufgaben ausführt. Erforderlich ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände (Ziekow § 99 GWB, Rn. 62 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024), die – gerade im Hinblick auf Wohnungsbauunternehmen – einzelfallabhängig unterschiedlich ausfallen kann (Ziekow § 99 GWB, Rn. 194 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024).
Hierbei sind insbesondere folgende Indizien heranzuziehen: Gewichtiges Indiz für Gewerblichkeit ist zunächst, dass die juristische Person die Aufgabe unter Wettbewerbsbedingungen ausübt (EuGH Urteil v. 22.05.2003, C-18/01, Korhonen; EuGH Urteil v. 10.04.2008, C-393/06, Aigner). Dazu gehört das Vorliegen eines entwickelten Wettbewerbes auf dem betroffenen Markt (Ziekow § 99 GWB, Rn. 61 in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Auflage 2024). Vorliegend geht es um den Markt der Wohnraumversorgung, und zwar im niedrigen Preissegment. Auf diesem Markt sind auch private Unternehmen aktiv.
Weiteres Indiz ist die Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens. Auch wenn der Markt durch private Anbieter mitgeprägt wird, schließt dies nicht aus, dass sich eine staatlich kontrollierte juristische Person von anderen als wirtschaftlichen Überlegungen leiten lässt (vgl. EuGH, Urteil v. 10.11.1998, C-360/96 – Arnhem). Vorliegend besteht ausweislich der Satzung der Gesellschaftszweck in der sozial verträglichen Wohnraumversorgung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Typischerweise verbinden heute im öffentlichen Eigentum stehende Wohnungsunternehmen die Tätigkeit eines an Marktmechanismen orientierten Wohnungsunternehmens mit der sozialen Wohnraumversorgung, um die soziale Wohnraumförderung durch die marktmäßig erzielten Gewinne zu finanzieren und diese Aufgabe effizient zu erfüllen (OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016, 6 Verg 4/16). Somit steht die Gewinnorientierung nicht im Vordergrund der Geschäftstätigkeit der O.
Bei einer Gesamtbewertung der Indizien ist damit im vorliegenden Fall von der Nichtgewerblichkeit der Aufgabe auszugehen.
Indizien für Gewerblichkeit:
Tätigkeit auf einem Wettbewerbsmarkt
Gewinnerzielungsabsicht
Risikotragung (oder staatlicher Verlustausgleich)
Arbeit nach Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten
Insolvenzrisiko
keine geographische Beschränkung des Geschäftsbetriebs
4. Öffentliche Finanzierung oder Kontrolle
Ferner muss eine besondere Staatsnähe bestehen, entweder aufgrund überwiegender Finanzierung durch die öffentliche Hand (lit. a), aufgrund staatlicher Aufsichtsbefugnisse (lit. b) oder aufgrund staatlicher Bestimmung der Mehrheit eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans (lit. c).
a. Öffentliche Finanzierung, § 99 Nr. 2 lit. a) GWB
Vorliegend könnte O bereits aufgrund der 100 % igen Anteilseignerschaft der Stadt Oranienberg – als Gemeinde ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB – als überwiegend von dieser finanziert angesehen werden.
Hierbei sind zwar alle Finanzierungsquellen zu berücksichtigen, über die die Einrichtung verfügt (vgl. EuGH, Urteil v. 3.10.2000, C-380/98, University of Cambridge, Rn. 14ff.). Eine staatliche 100-prozentige Anteilseignerschaft begründet aber im Regelfall bereits das Vorliegen einer überwiegenden staatlichen Finanzierung (vgl. OLG Brandenburg Beschl. v. 06.12.2016 – 6 Verg 4/16), weshalb die Voraussetzung mangels anderweitiger Informationen hier als erfüllt anzusehen ist.
b. Öffentliche Aufsicht über die Leitung, § 99 Nr. 2 lit. b) GWB
O könnte der Aufsicht durch Stellen nach Nr. 1–3 – hier der Stadt Oranienberg, eine Gebietskörperschaft i.S.d. 99 Nr. 1 GWB – unterliegen. Entsprechende Aufsichtsrechte könnten sich aus gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Einwirkungsmöglichkeiten ergeben (EuGH Urteil v. 27.2.2003, C-373/00, Truley, Rn. 72 f.). Als Alleingesellschafterin hat die Stadt die gesetzlichen Rechte nach §§ 45 ff., insbesondere das Auskunfts- und Einsichtsrecht nach § 51a GmbHG. Gemäß § 37 Abs. 1 GmbHG ist ein Geschäftsführer an Beschlüsse der Gesellschafter gebunden. Vorbehaltlich der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung, über die der Sachverhalt hier keine Angaben macht, ist hier von einer den Anforderungen des § 99 Nr. 2 lit. b) GWB genügenden Aufsichtsbefugnis auszugehen.
c. Öffentliche Bestimmung der Leitungsorgane, § 99 Nr. 2 lit. c) GWB
Ferner könnte die Mehrheit der Mitglieder eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der O durch eine Stelle nach § 99 Nr. 1 GWB bestimmt werden.
Gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG bestellen die Gesellschafter – das ist im vorliegenden Fall die Stadt Oranienberg, eine Gebietskörperschaft i.S.d. § 99 Nr. 1 GWB – die Geschäftsführung der O.
Auch dieses Merkmal ist somit erfüllt.
Die besondere Staatsnähe ergibt sich folglich aus § 99 Nr. 2 lit. a) und c) GWB.
5. Ergebnis
O ist funktionaler Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 2 GWB.
B. Öffentlicher Auftrag i.S.d. § 103 GWB
Es müsste sich weiterhin um einen öffentlichen Auftrag i.S.d. § 103 GWB handeln.
Bei der Durchführung der Gewerke Heizung und Sanitär handelt es sich um einen entgeltlichen Vertrag zwischen dem funktionalen Auftraggeber O und einem Unternehmen über Bauleistungen i.S.d. § 103 Abs. 3 Nr. 1 GWB, vgl. Nr. 45330000 Common Procurement Vocabulary, Anhang II RL 2014/24/EU, mithin um einen öffentlichen Auftrag.
C. Auftragswert oberhalb der Schwellenwerte, § 106 GWB
Fraglich ist, ob der für Bauaufträge einschlägige Schwellenwert von 5,538 Mio. Euro gemäß § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 4 lit. a RL 2014/24/EU i.d.F. Delegierte VO (EU) 2023/2495 überschritten ist.
Zugrunde zu legen ist gemäß § 3 Abs. 1 S. 1, Abs. 7 VgV nicht der Einzelauftragswert über die Gewerke Heizung und Sanitär von 1 Mio. Euro, sondern bei funktionaler Betrachtungsweise der Auftragswert der Gesamtbaumaßnahme von 10 Mio. Euro, sofern es sich um ein wirtschaftlich und technisch zusammenhängendes Bauvorhaben und damit um einen einheitlichen Auftrag handelt. Ein solcher Zusammenhang liegt bei der gleichzeitigen Errichtung der fünf Stadtvillen, die laut Sachverhalt ein wirtschaftliches Gesamtprojekt bilden, vor. Folglich ist maßgeblicher Auftragswert der Netto-Auftragswert der Gesamtbaumaßnahme in Höhe von ca. 10 Mio. Euro.
Damit überschreitet der Auftragswert den Schwellenwert.
D. Keine Ausnahmen, §§ 107ff., 116ff., 132 GWB
Vorschriften über Ausnahmen von der Anwendung des EU-Vergaberechts kommen vorliegend nicht in Betracht.
E. Gesamtergebnis
Im Ergebnis hätte O EU-Vergaberecht anwenden und ein europaweites Vergabeverfahren durchführen müssen.
Fall 2 | Sektorenauftraggeber: der Fall der öffentlichen Verkehrsbetriebe
Zur Auftraggebereigenschaft öffentlicher Verkehrsbetriebe vgl. BayObLG, Beschluss vom 05.11.2002, Verg 22/02; VK Düsseldorf, Beschluss vom 02.03.2007, VK – 05/2007.
Zu Fall a. vgl. den Sachverhalt aus: KG, Beschluss vom 20.03.2020, Verg 7/19.
1Sachverhalt
Die Berliner Verkehrsbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts (BVG) führt in Berlin den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen und Bahnen aus. Über die im Einzelnen zu erbringenden Verkehre hat sie einen mehrjährigen Vertrag mit dem Senat von Berlin geschlossen, der auch eine finanzielle Kompensation für nicht kostendeckende Verkehre (z. B. an Tagesrandzeiten oder in entlegenen Außenbezirken) vorsieht.
Die BVG will über einen Rahmenvertrag bis zu 1.500 neue U-Bahnen bestellen, davon als feste Bestellung mit sofortiger Auslieferung 600 Wagen mit einer Gesamtvergütungssumme von ca. 1,2 Mrd. Euro. Inwiefern ist sie dabei an Vergaberecht gebunden? Muss sie öffentlich ausschreiben oder kann sie den Auftrag im Verhandlungsweg vergeben?
Wie sieht es aus bei der Bestellung von Büromaterial im Wert von 500.000 Euro?
Die BVG will den Bau eines U-Bahnhofs im Wert von 6 Mio. Euro beauftragen. Sie will den Auftrag nicht öffentlich ausschreiben, sondern im Verhandlungsweg vergeben. Ist das zulässig?
§ 3 Berliner Betriebe-Gesetz (BlnBetrG) bestimmt:
„(2) Die Geschäfte der Anstalten sind nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung gemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte zu führen, soweit nicht durch dieses Gesetz oder andere Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. Die Anstalten sollen einen angemessenen Gewinn erzielen.
(4) Aufgabe der BVG ist die Durchführung von öffentlichem Personennahverkehr für Berlin mit dem Ziel kostengünstiger und umweltfreundlicher Verkehrsbedienung sowie aller hiermit in technischem und wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die BVG wird im Wesentlichen für das Land Berlin tätig.“
§ 5 BlnBetrG bestimmt:
„Gewährträger der Anstalten ist das Land Berlin. Das Land haftet uneingeschränkt für die Verbindlichkeiten der Anstalten, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalten zu erlangen ist. Das Land Berlin gewährt Ausgleich, soweit die Anstalten aus eigener Kraft zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht in der Lage sind.“
§ 3 Satzung der BVG bestimmt:
„Die Anstalt soll ihren Aufwand durch Erträge decken. Sie soll mindestens den Kostendeckungsgrad nach dem Richtwert des Deutschen Städtetages für Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs erreichen.“
2Lösungsskizze
A. Hinsichtlich U-Bahnen
I. Öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 1–3 GWB
1. § 99 Nr. 1
Keine Gebietskörperschaft oder deren Behörde, als Anstalt des öff. Rechts rechtlich selbstständig (–)
2. § 99 Nr. 2
a. „Andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts“
Anstalt des öff. Rechts (+)
b. „Die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben … zu erfüllen“
ÖPNV als Daseinsvorsorge, vgl. § 3 Abs. 4 BlnBetriebeG (+)
c. „Nichtgewerblicher Art“
Indizien:
Wettbewerbsmarkt? In Deutschland wohl (–)
Gewinnerzielungsabsicht? (–) § 3 Satzung BVG: nur Absicht der Kostendeckung mit Tarifen
Risikotragung? Verlustausgleich durch das Land: § 5 Abs. 1 S. 3 BlnBetrG
Geographische Beschränkung auf Berlin
Insolvenzfähigkeit? Gewährträgerschaft des Landes, § 5 Abs. 1 S. 2 BlnBetrG und § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO.
Im Ergebnis Nichtgewerblichkeit (+)
d. Staatsnähe durch Finanzierung oder Kontrolle, § 99 Nr. 2 lit. a), c) GWB
Vgl. §§ 10, 7 BlnBetrG (+)
II. Sektorenauftraggeber i.S.d. § 100 Abs. 1 Nr. 1 GWB:
1. Öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 1–3 GWB (+) s.o.
2. Sektorentätigkeit nach § 102 GWB: Abs. 4?
Verkehrsleistungen mit Bus, Straßenbahn (+)
Netz? Von Behörde bestimmte Leistungen? Festlegung der Strecken, Kapazitäten, Fahrpläne im Verkehrsvertrag mit Land Berlin (+)
III. Zusammenhang des Auftrags mit der Sektorentätigkeit
§ 136 GWB „zum Zwecke der Ausübung einer Sektorentätigkeit“, EuGH C-393/06 Aigner
U-Bahnen dienen gerade dem Betrieb des Verkehrsnetzes. (+)
IV. Öffentlicher Auftrag i.S.d. § 103 GWB (+)
V. Überschreiten des Schwellenwertes, § 106 GWB (+)
VI. Keine Ausnahmen, §§ 107ff., 132, 137ff. GWB (+)
→ Also Bindung an Sektorenauftragsvergaberecht, §§ 136ff. GWB und SektVO
VII. Ergebnis
Bindung an Sektorenauftragsvergaberecht, §§ 136ff. GWB und SektVO
→ Gemäß § 13 Abs. 1 SektVO ist Vergabe im Verhandlungsverfahren, allerdings mit vorausgegangenem Teilnahmewettbewerb grundsätzlich möglich.
B. Hinsichtlich Büromaterial
I. Öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 99 Nr. 1–3 GWB (+), s. o. A.I.
II. Sektorenauftraggeber i.S.d. § 100 Abs. 1 Nr. 1 GWB (+), s. o. A.II.
III. Zusammenhang mit der Sektorentätigkeit, s. o. A.III.
Da dienende Funktion (+)





























