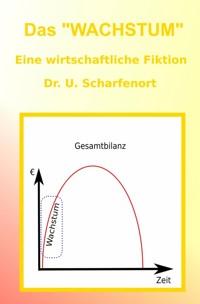Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als Teilnehmer am Straßenverkehr, habe ich oft gefährliche Situationen, aber auch potentiell gefahrvolle Stellen erlebt. Wenn man sich dann mit Behörden auseinandersetzt, stellt man schnell fest, dass diese zwar oft behaupten präventiv zu arbeiten, in Wirklichkeit allerdings eine höchst reaktive Einstellung haben. Mit anderen Worten: Abwarten bis es Tote und Verletzte gibt, bevor gehandelt wird und selbst dann oft nur zögerlich. Wie man es besser machen kann, soll dieses Buch verdeutlichen. Das Grundprinzip ist die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsschutzes auf den Straßenverkehr anzuwenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Ulrich Scharfenort
Verkehrsgefährdungsbeurteilung
Ein systematisches Vorgehen zur Reduzierung von Gefährdungen im Verkehr
Verkehrssicherheit
Impressum
Texte:
© 2023 Copyright Dr. Ulrich Scharfenort
Umschlag:
© 2023 Copyright Dr. Ulrich Scharfenort
Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. Ulrich Scharfenort
47226 Duisburg
Aktuelle Kontaktdaten unter:
https://ulrics.blog/about/
Druck:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Einleitung
Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit der Gefährdungsproblematik im Straßenverkehr, primär in Kommune Duisburg.
Im Dialog mit der Polizei und anderen Behörden (Duisburg, Land NRW) stellte und stelle ich fest, dass bezüglich der Gefährdungsproblematik dringender Handlungsbedarf besteht. Durch Unwissenheit und auch Unvermögen allein zum Thema Prävention werden erforderliche Maßnahmen nicht eingeleitet bzw. die Pflicht zum Handeln sogar unbekannt zu sein scheint.
Es ist der Eindruck entstanden, dass Gesetze und Verordnungen zu diesem Thema nicht gelesen, geschweige denn dazugehörige Gerichtsentscheidungen mit einbezogen werden.
So war die übliche Reaktion auf die Meldung von Gefahrenstellen oder gefährlicher Situationen im Straßenverkehr, der Hinweis, dass es sich nicht um Unfallschwerpunkte handelt.
Der Begriff Schwerpunkt deutet an, dass ausreichend Unfälle passieren müssen, damit die Behörden überhaupt aktiv werden. Im Gegensatz dazu steht in der Straßenverkehrsordnung (StVO) der Sicherheitsbegriff unabhängig von der Anzahl an Unfallereignissen an erster Stelle. Auch in der Verwaltungsvorschrift zur StVO steht die Sicherheit im Straßenverkehr direkt am Anfang unter dem Begriff VisionZero, also keine Unfälle. Daraus ergibt sich, dass unabhängig von der Anzahl der Unfallereignisse ein Handeln erfolgen MUSS.
Der häufig genutzte Begriff der Prävention wird meist von der Polizei oder anderen Stellen verwendet, um darauf hinzuweisen, wie man sich angeblich vor einem Gefahrenereignis schützen kann. Als Beispiel wird reflektierende Bekleidung bei Dunkelheit im Straßenverkehr genannt, nicht aber, wie das Gefahrenereignis an sich vermieden werden kann (z. B. geringere Geschwindigkeit bei Dunkelheit). Die überhöhte Geschwindigkeit oder auch Unaufmerksamkeit sind der Auslöser des Gefahrenereignisses, vor dem präventiv geschützt werden muss.
Aus meiner Sicht ist es symptomatisch für den Straßenverkehr, dass offensichtlich keine echte Prävention gelebt wird. Es wird also nicht im Vorfeld der Gefährdung angesetzt. Dazu im weiteren Verlauf dieses Buches mehr.
Um die Gefährdungen im Straßenverkehr ermitteln und beurteilen zu können ist es zunächst wichtig, das Konzept des Arbeitsschutzes zu erläutern. Ebenfalls wird erläutert, wie im Arbeitsschutz entsprechende Maßnahmen ergriffen und später, deren Wirksamkeit zu überprüft werden. Anschließend wird dieses Konzept auf den Straßenverkehr zu übertragen.
In Anbetracht der vielen Straßen wird es mit Sicherheit nicht über Nacht gehen, aber man muss endlich anfangen. Und ein Schild hier anbringen und woanders entfernen kostet auch nicht die Welt. Viele Gefährdungen lassen sich schon durch einfache Maßnahmen und mehr Nachdenken lösen.
"Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
durch Nachdenken, das ist der Edelste,
durch Nachahmen, das ist der Leichteste und
durch Erfahrung, das ist der Bitterste."
Konfuzius
Im Straßenverkehr wird zu oft der dritte Weg "beschritten".
Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz
Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die grundsätzliche Methode im Arbeitsschutz.
Arbeitsschutz ist ein extrem umfangreiches Gebiet mit vielen Teilgebieten, die unterschiedliche Qualifikationen benötigen. Im Arbeitsschutz sind Arbeitgeber die Hauptverantwortlichen aber alle Beschäftigten tragen eine Teilverantwortung. Im Straßenverkehr übernehmen Behörden sozusagen die Arbeitgeberverantwortung und alle Teilnehmenden haben eine Mitverantwortung. Die Behörden müssen für sichere Rahmenbedingungen sorgen, die Teilnehmenden sich so verhalten, dass sie weder sich noch andere gefährden.
Ein bereits lange praktiziertes Verfahren für die präventive Verhinderung von Unfällen und Gefährdungen gibt es im Arbeitsschutz. Die sogenannte Gefährdungsbeurteilung bedeutet, dass alle Gefährdungen betrachtet werden und mit Maßnahmen versucht wird diese Gefährdungen zu vermindern und wenn es geht sogar ganz verhindern. Eine ausführliche Beschreibung, wie im Detail eine Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsschutzes durchgeführt werden soll, findet sich zum Beispiel in der "ASR V3 - Gefährdungsbeurteilung". Diese ist im Internet herunterladbar.
In Kürze kann man eine Gefährdungsbeurteilung als ein systematisches Verfahren beschreiben, sich mit den Gefährdungen auseinanderzusetzen und diese ungefährlich zu machen. Der grundsätzliche Verfahrenszyklus ist wie folgt:
Ermitteln aller Gefährdungen
Beurteilen aller Gefährdungen
Ausarbeiten von Maßnahmen
Umsetzen der Maßnahmen
Überprüfen der Wirksamkeit
Die Punkte 1 bis 5 werden zyklisch durchlaufen. Gerade die Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen muss immer wieder erfolgen. Wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, wird der Zyklus erneut abgearbeitet. Für die Nachvollziehbarkeit ist es dabei wichtig das Ganze zu dokumentieren. Zudem hat man dadurch im Zweifel auch einen Beleg, dass man sich Gedanken gemacht hat. Etwa auch wenn sich jemand beschwert oder ein Verkehrszeichen vor Gericht landet.
Die nachfolgenden Unterkapitel sollen zur Veranschaulichung dienen und geben natürlich nicht den vollen Umfang im Arbeitsschutz wieder. Mit entsprechender Fachliteratur kann ein deutlich tieferer Einstieg in diese Thematik erfolgen.
Ermitteln aller Gefährdungen
Für eine zielgerichtete und umfassende Prävention müssen zuerst alle Gefährdungen sorgfältig erfasst werden. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Sowohl eine Aufteilung nach Tätigkeiten, wie auch nach Arbeitsbereichen ist denkbar. Wie man dies konkret gestaltet, hängt stark von den Rahmenbedingungen der Arbeitsplätze ab. Durch eine gut durchdachte Zusammenfassung kann der Aufwand reduziert werden.
Als Hilfestellung gibt es im Arbeitsschutz eine Unterteilung in 11 Gefährdungsfaktoren:
1. Mechanische Gefährdungen
2. Elektrische Gefährdungen
3. Gefahrstoffe
4. Biologische Arbeitsstoffe (Biostoffe)
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
6. Thermische Gefährdungen
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
9. Gefährdungen durch physische Belastung/Arbeitsschwere
10. Gefährdungen durch psychische Faktoren
11. Gefährdungen durch sonstige Einwirkungen
Die einzelnen Gefährdungsfaktoren werden systematisch für die Tätigkeit oder den Arbeitsbereich betrachtet und die Gefährdungen dann beschrieben. In einer Werkstatt sind die Gefährdungen natürlich anders, als im Büro oder in einem Labor. Auch damit keine Gefährdung übersehen wird, sind die Gefährdungsfaktoren von großer Wichtigkeit.
Die Gefährdungsfaktoren untergliedern sich noch detaillierter, es würde an dieser Stelle aber zu tief gehen. Wichtig ist die Aufteilung im Hinterkopf zu behalten.
Beurteilen aller Gefährdungen
Sind alle Gefährdungen erfasst, geht es an die eigentliche Beurteilung der Gefährdungen. Jede einzelne erfasste Gefährdung wird nach den Auswirkungen und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Es gibt Gefährdungen, die tödlich sein können und quasi sehr unwahrscheinlich sind, aber ebenso Gefährdungen mit häufiger Eintrittswahrscheinlichkeit, aber kaum Auswirkungen.
Teilweise gibt es hierzu auch Hilfestellungen in Regelwerken. So gibt es für bestimmte Gefahrstoffe Mengenschwellen, ab deren Überschreitung gehandelt werden muss. Auch gibt es für anderen Einwirkungen Grenzwerte, welche klarstellen, ab wann etwas getan werden muss. Diese Regelwerke haben den Charakter von Empfehlungen. Das heißt, dass man theoretisch davon abweichen kann, aber dann gleichwertigen Schutz sicherstellen muss. Gerade bei Gefährdungen, welche erst viele Jahre später sichtbar werden ist es wichtig, diese frühzeitig zu berücksichtigen. Ein Beispiel wäre hier Lärmschwerhörigkeit durch laute Maschinen. Dies muss man viele Jahre vor dem Eintritt von Schäden berücksichtigen.
Oft weiß man bereits aus persönlicher Erfahrung, dass etwas häufiger oder weniger häufig eintreten kann. Bei anderen Gefährdungen gibt es die oben erwähnten Hilfestellungen. Wenn eine Gefährdung schon häufiger eingetreten ist, kann man davon ausgehen, dass es wieder passieren wird, wenn man nichts tut. Der Eintritt der Gefährdung muss nicht unbedingt im eigenen Betrieb gewesen sein, sondern ist auch anderswo möglich.
Viele kennen zum Beispiel, sich mit dem Hammer auf die Finger zu schlagen.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen (Schadensschwere) lassen sich in einer Matrix auftragen. Diese sogenannte Risikomatrix ist nachfolgend dargestellt:
Als Ergebnis der Risikoeinstufung jeder Gefährdung ergibt sich ein Zahlenwert. Diese Zahlenwerte sind in Matrix farblich hinterlegt (mit steigenden Risiko) und nachfolgend zusammengefasst:
Gefahrenbereich/hohes Risiko (Risikowerte 5-7): Risikoreduzierung dringend erforderlich
Grenzrisiko/signifikantes Risiko (Risikowerte 3-4): Risikoreduzierung notwendig
Geringes Risiko (Risikowerte 1-2): Risiko akzeptabel
Natürlich sind auch die Rahmenbedingungen zu berücksichtigten, da diese sich zu einem gewissen Grad auch auf das Risiko auswirken können. Der hektische Arbeitsalltag ist etwas anderes, als in der Freizeit ohne Zeitdruck.
Die Erfahrungen, wie bereits eingetretene Unfälle, aber auch Beinaheunfälle, müssen in die Beurteilung mit einfließen. Gerade Beinaheunfälle sind ein wichtiges Indiz, dass es zwar nochmal gut gegangen ist, aber hätte schlimmer kommen können. Hier ist dann sogar akuter Handlungsdruck gegeben. Denn es kann jederzeit zu einem Unfall kommen.
Ausarbeiten von Maßnahmen
Im Arbeitsschutz kommen nach dem Erkennen und der Bewertung der Gefährdungen, die Ausarbeitung von Maßnahmen. Das heißt eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit mit eher geringen Auswirkungen (z. B. Schürfwunde) erfordert andere Maßnahmen, als etwas, was selten vorkommt, dafür aber tödlich enden kann (z. B. Stromschlag).
Bei der Ausarbeitung der Maßnahmen bedient sich der Arbeitsschutz einer sogenannten Maßnahmenhierarchie:
Gefährdung an der Quelle beseitigen (
S
ubstitution).
Gefährdung durch
T
echnische Maßnahmen reduzieren.
Gefährdung durch
O
rganisatorische Maßnahmen reduzieren.
Gefährdungen durch
P
ersonenbezogene Maßnahmen reduzieren