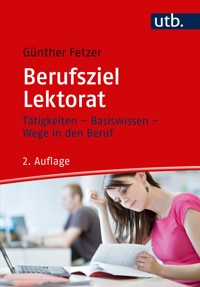Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verlage und ihre Geschichte sind ein wesentliches Segment der Buchwissenschaft. Man wird nicht von einer Publikationsflut in diesem Sektor sprechen können, doch wird es auch für den fachlich Interessierten schwer, alle Publikationen zu rezipieren. Daher sind Rezensionen hier ein wichtiges Orientierungsmittel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Arche Verlag
C. H. Beck Verlag
C. H. Beck Verlag
Bertelsmann
Deutscher Taschenbuch Verlag
Diederichs Verlag
Gmeiner Verlag
Kiepenheuer & Witsch
Kiepenheuer Verlage
März Verlag
Oldenbourg Verlag
Oldenbourg Verlag
Radius Verlag
Reclam Verlag
Rowohlt Verlag
Carl Schünemann Verlag
Schwabe Verlag
Südverlag
Suhrkamp Verlag
Suhrkamp Verlag
Ullstein Verlag
Ullstein Verlag
Ullstein Verlag
Vieweg Verlag
Wagenbach
Taschenbücher
Taschenbücher
Verlage im »Dritten Reich«
Literaturverzeichnis
Vorwort
Verlage und ihre Geschichte sind ein wesentliches Segment der Buchwissenschaft. So umfasst beispielsweise die Fachbibliothek des Instituts für Buchwissenschaft an der FAU Erlangen-Nürnberg über 850 einschlägige Schriften. Aber auch Verlage lassen ihre eigene Geschichte erforschen oder stellen sich selbst dar und dokumentieren dies in teils aufwendig gestalteten Büchern.
Nun wird man nicht von einer Publikationsflut in diesem Sektor sprechen können, doch wird es auch für den fachlich Interessierten schwer, alle Publikationen zu rezipieren. Daher sind Rezensionen hier – wie in vielen anderen Fällen – ein wichtiges Orientierungsmittel. Georg Jäger, einer der verdienstvollen deutschen Buchwissenschaftler unserer Zeit, hat in seinem leider viel zu wenig zur Kenntnis genommenen kurzen Aufsatz Von Pflicht und Kür im Rezensionswesen auf IASL online das Nötige und Bedenkenswerte gesagt. Für ihn ist die Berichtspflicht »Fundament und Ausgangspunkt des Pflichtenkatalogs einer wissenschaftlichen Rezension«. An zweiter Stelle folgen die »kritische Reflexion des methodischen Vorgehens« und die Quellenkritik. Die »Pflicht der Wertung« misst das zu besprechende Werk vor allem »an seinen eigenen Vorgaben (Zielsetzung, Hypothesen)«. Besonderes Augenmerk richtet Jäger auf die Rezension von Sammelwerken, die oft nur ›Buchbindersynthesen‹ sind. Soll hier Beitrag für Beitrag angesprochen werden? Hat der Rezensent die Aufgabe, nachträglich Struktur in ein Werk zu bringen, an der es diesem offenkundig mangelt? Und schließlich redet Jäger der sachgerechten und der »Ethik wissenschaftlicher Kommunikation« entsprechenden ›Feuilletonisierung‹ eindringlich das Wort, denn »das Schlimmste, was der Wissenschaft in der Innen- wie Außendarstellung widerfahren kann«, sei »die Verbreitung von Langeweile« (Jäger 2001).
Der Verfasser der hier versammelten Rezensionen hat sich bemüht, diesen Anforderungen zu genügen. In Fragen der Wertung hat er dabei Kritik geübt, die nicht unwidersprochen blieb (Wittmann 2015). Insgesamt finden sich in diesem Band 28 Rezensionen, die im Zeitraum zwischen 2012 und 2017 im Archiv für Geschichte des Buchwesens (als Sammelrezensionen) sowie auf IASL online und auf literaturkitik.de veröffentlicht wurden. Ein systematischer Anspruch liegt der Auswahl der besprochenen Werke nicht zugrunde; sie ist der jeweiligen Publikationslage geschuldet.
Die meisten der besprochenen Werke stellen entweder die Geschichte eines Verlags von seiner Gründung bis heute oder einen wichtigen Teil einer solchen Geschichte dar. Es dominieren die literarischen Verlage, Wissenschafts- und Fachverlage sind eher selten vertreten. Von Buchtypus und Darstellungsart her sind wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, Selbstdarstellungen der Verlage und Titel vertreten, die als Auftragsarbeiten entstanden sind. Letztere unterliegen den Restriktionen, die Monika Estermann plastisch beschreiben hat: »Die Verfasser sind in ihrem Aktionsradius beschränkt, sie liegen wie Hofhunde an der langen Leine.
Das muss nicht unbedingt negativ sein […]. Es kann also sein, dass der Autor im günstigsten Fall die Kette gar nicht spürt, im extremen Gegenteil aber von ihr stranguliert wird.« (Estermann 2007, S. 216) Autobiografische Blicke auf den jeweiligen Verlag sowie Arbeiten zu Taschenbuchverlagen runden die Palette des Dargebotenen ab.
Der Übersichtlichkeit halber wurden die Sammelrezensionen in Einzelbeiträge aufgelöst, die alphabetisch nach dem Verlagsnamen angeordnet sind. Dabei wurden geringfügige redaktionelle Anpassungen nötig. Die Beiträge aus IASL online und literaturkitik.de erscheinen unverändert.
Die erneute Publikation der Texte wurde in den beiden Lehrveranstaltungen Selfpublishing und Publizieren ohne Verlag im Rahmen des Studiengangs Buchwissenschaft an der FAU Erlangen-Nürnberg im Sommersemester 2017 vorbereitet. Der Verfasser dankt allen, die bei der Einrichtung der Texte und der Drucklegung mitgeholfen haben, vor allem Laura Baumgarten, Lena Buch, Annika Kirsch und Annekathrin Müller, Annika Kirsch für die Gestaltung des Umschlags.
Arche Verlag
Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche
Am 31. Dezember 1982 kauften die aus Oldenburg stammende Lektorin Elisabeth Raabe und die Schweizer Buchhändlerin Regina Vitali den Züricher Arche-Verlag. Dieser war seit dem Tod seines Gründers, Peter Schifferli, im Jahr 1980 verlegerisch verwaist gewesen. Am 1. Juli 2008 verkauften die Verlegerinnen den Arche Literatur Verlag an die Hamburger Verlagsgruppe Oetinger. Dazwischen liegen 26 Jahre verlegerischer Arbeit, die Elisabeth Raabe in ihren Erinnerungen Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche beschreibt.
Die neuen Inhaberinnen übernahmen einen traditionsreichen Verlag, für den Autoren wie Paul Claudel und Georges Bernanos, Hans Arp und Ezra Pound sowie Adolf Muschg und Friedrich Dürrenmatt standen. In der ersten Zeit zehrte das nun als Arche Verlag AG, Raabe + Vitali firmierende Unternehmen von der Verwertung der reichen Backlist, die Schifferli aufgebaut hatte. Rohbogen der Sammlung Horizonte wurden aufgebunden, Schätze der alten Reihe Kleine Bücher der Arche in der Neuen Arche Bücherei wieder aufgelegt, im Arche-Fundus vorhandene Texte erschienen als preiswerte Paperbacks. Doch: »Ein Neuanfang war in jeder Hinsicht mehr als notwendig. Programmatisch, vertrieblich und wirtschaftlich. Es war ein eingeschlafener Schweizer Kleinverlag mit kostbarem Gepäck, der bei Buchhändlern, Lesern und Kritikern von der Hoch-Zeit seiner Vergangenheit zehrte.« (S. 33) Vor allem musste der deutsche Markerschlossen werden, denn die heimische Schweiz hatte damals einen Anteil von 70 Prozent am Gesamtumsatz. Das sollte mit einer neuen Vertretermannschaft und mit der Aufgabe der eigenen Auslieferung und deren Übertragung in professionelle Hände gelingen. Doch das stellte sich als schwieriger als gedacht heraus, denn Ende der 1980er Jahre war »der Sprung über den Rhein auf den größeren westdeutschen Markt noch immer nicht gelungen«.
Das hing durchaus auch mit dem Programm zusammen. Die Verlagsrechte an Friedrich Dürrenmatt und Friedrich Glauser gingen verloren. Der Versuch, Ezra Pounds und Gertrude Steins Bücher zu neuem Leben zu erwecken und neue Titel zu verlegen, misslang. Die Arche-Editionen des Expressionismus, initiiert und herausgegeben von Raabes Bruder Paul Raabe, war »ökonomisch ein Desaster« (S. 89). Auch neue Autoren wie die Südafrikanerin Wilma Stockenström, die Niederländerin Anna Blamann sowie Barbara Strohschein konnte der Verlag nicht durchsetzen.
Wirtschaftliche Stütze war in dieser Zeit der Arche Literatur Kalender, der erstmals für das Jahr 1985 erschien und von dem insgesamt nach Angaben des Verlags über eine halbe Million Exemplare verkauft wurden. Später erweiterten die Verlegerinnen mit dem Arche Musik Kalender (1995) und dem Arche Küchen Kalender (2004) die Grundidee zur Produktfamilie. Beim späteren Verkauf des Verlags behielten die Verlegerinnen diesen Teil und führen ihn bis heute fort.
Ermutigt durch den Erfolg des Literaturkalenders wagte der Verlag mit dem Kauf des literarischen Teils des Luchterhand Verlags eine spektakuläre Expansion. Der Hermann Luchterhand Verlag in Neuwied als gemischter Verlag aus dem weitaus größeren juristischen Fachverlag und dem literarischen Verlag war 1987 an den niederländischen Kluwer-Konzern (heute Wolters Kluwer) verkauft worden. Das literarische ›Anhängsel‹ in Darmstadt war für den Fachbuch- und Wissenschaftsriesen nicht von Interesse, und so konnte Arche noch im selben Jahr den renommierten literarischen Teil mit Autoren wie Günter Grass, Peter Härtling, Gabriele Wohmann, Anna Seghers und Christa Wolf sowie der Taschenbuchreihe Sammlung Luchterhand zu einem vermutlich nicht allzu hohen Preis übernehmen, denn »wir suchten ein Standbein in der Bundesrepublik« (S. 102). Zu spät musste man feststellen, dass die Taschenbuchrechte für den neuen Roman von Grass, Die Rättin, kurz vor den Verhandlungen mit Kluwer zu einem hohen Vorschuss verkauft worden waren. Zudem stellte sich später heraus, dass die Verluste des literarischen Luchterhand Verlags über die letzten zehn Jahre hinweg nicht in der Bilanz auftauchten, weil man durch kreative Buchführung die Herstellkosten durch die hauseigene Druckerei nicht ausgewiesen hatte.
Die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 hatte für Luchterhand dramatische Folgen, denn der Verlag lebte in hohem Maß von den Lizenzen, die DDR-Verlage dem westdeutschen ›linken‹ Verlag Luchterhand übertragen hatten. Auf dem nun gesamtdeutschen Buchmarkt fielen die Rechte in der Regel an den lizenzgebenden DDR-Verlag zurück, allen voran an den Aufbau-Verlag mit Christoph Hein, Hermann Kant und Irmtraud Morgner.
Im Sommer 1991 siedelte der Verlag nach Hamburg über, weil die finanzielle Situation nach der Kündigung eines Bankkredits schwierig geworden war und der dortige Senat mit zinsgünstigen Krediten lockte: »Der Umsatz war bei gleichbleibenden Fixkosten dramatisch gesunken.« (S. 132f.) Weitere Maßnahmen, um den Verlag zu stabilisieren, waren notwendig. Die Vertriebsrechte und das Warenlager der Sammlung Luchterhand wurden an den Deutschen Taschenbuch Verlag in München verkauft, und das operative Geschäft von Arche, die noch immer in Zürich residierte, wurde nach Hamburg verlagert sowie Lektorat und Presse für die beiden Verlage dort zusammengefasst. Doch die Maßnahmen fruchteten nicht, so dass die Verlegerinnen schließlich ihre Anteile zum 1. März 1994 an den Münchner Wirtschaftsanwalt Dietrich von Boetticher verkaufen mussten, um »wenigstens unsere Arche, die kleine ›Mutter‹, zu retten« (S. 142). Ein Jahr später wurde auch der mit der Arche übernommene Verlag Sanssouci, »das heitere Beiboot« (S. 71), an den Carl Hanser Verlag in München verkauft, wo er lange Zeit erfolgreich geführt wurde: »Ich hatte keine Ader für Sanssouci« (S. 72), merkt Raabe selbstkritisch an.
Die Jahre zwischen 1995 und 2002 bezeichnet die Autorin als »Höhepunkte in unserem Verlegerinnenleben« (S. 153), und in der Tat erschienen in dieser Zeit wichtige und auch erfolgreiche Bücher von u. a. Jürg Amann, Maarten ’t Hart, Stéphane Hessel und Peter Stamm. Doch in allen Fällen »begann das übliche Endspiel« (S. 175), und die Autoren wechselten zugunsten lukrativer Vorschüsse zu großen Verlagen. Die Jahre bis zum Verkauf des Verlags an die Oetinger Gruppe nehmen nur wenige Zeilen in der »Kleinen Chronologie der verlegerischen Ereignisse« ein, die das Buch beschließt.
Das Buch ist der nach den jeweiligen Verlagsadressen in Zürich und Hamburg strukturierte Bericht über anspruchsvolle Projekte und Titel, über Misserfolge, über Kooperationen, über Mitarbeiter und Buchhandelsvertreter. Im Zentrum stehen aber die Begegnungen mit Autoren, Übersetzern, Erben, Nachlassverwaltern und Verlegerkollegen. Allerdings reiht sich zu oft Kleinporträt an Kleinporträt. Nur selten wird eine Person wie in dem liebevollen Porträt des Filmkritikers Karsten Witte wirklich plastisch beschrieben. Auch sprachlich rutscht das manchmal in dürre Beschreibungsprosa ab: »Der Autor Dürrenmatt erlebte in den nächsten fünf Jahren bis zu seinem Tod 1990 eine Phase neuer Produktivität und großer literarischer Ehrungen.« (S. 25) Dazu gehören auch die langen Aufzählungen der Personen, die bei einem Verlagsfest anwesend waren, wie etwa bei der Party anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Verlags im Jahr 1984.
Verlagshistorisch interessant wären einige Zahlen zur Ökonomie. Leider bleibt die oben zitierte Verkaufszahl vom Literaturkalender mehr oder weniger die einzige konkrete Angabe. Zwar kann man zu Recht keine Zahlen zu den Übernahmepreisen bei dem Kauf von Luchterhand oder dem Weiterkauf an von Boetticher oder dem Erlös aus dem Sanssouci-Deal mit Hanser erwarten, aber Umsatzzahlen sind heutzutage nicht mehr das Geheimnis, das hier aus ihnen gemacht wird.
Die Frage nach dem ökonomischen Hintergrund des Verlags und dem entsprechenden Engagement von Regina Vitale wird immer wieder charmant abgebogen, doch klar ist, dass Vitali vielleicht nicht »ganze Straßenzüge« (S. 104) in Zürich besaß (wie in der Branche kolportiert wurde), aber sie doch den Verlag mit zinslosen Darlehen und der sicher kostengünstigen Überlassung eigener Immobilien stützte, bis ihr Vermögen »aufgebraucht« und der Verlag auf die »großzügige Hilfe einer Hamburger Mäzenin« (S. 144) angewiesen war. Man hätte es ja nicht so unverblümt-unverschämt ausdrücken müssen, wie Peter Härtling das bei den Verhandlungen über das Luchterhand-Autorenstatut tat. Er fragte Vitali, »ob sie denn noch eine zusätzliche Wiese aus dem Erbe ihrer Mutter habe, wenn die Zeiten schlechter würden« (S. 104).
Das Buch ist im Eigenverlag Edition Momente erschienen und wurde von dem von Raabe hoch gelobten Max Bartholl gestaltet, der von Anfang als Buchdesigner und Typograf dabei war. Leider sind fast alle der rund 120 Schwarz-Weiß-Abbildungen nur wenig mehr als briefmarkengroß und kommen so im ohnehin kleinformatigen Buch nicht zur Geltung; zudem sind sie oft von schlechter Qualität. Die Bildunterschriften fehlen; die Informationen finden sich versteckt im Anhang. Neben den beiden Verlegerinnen ist Raabes um elf Jahre älterer Bruder Paul die am häufigsten abgebildete Person. Dies unterstreicht seine wichtige Rolle als Autor und Herausgeber, als Mentor und Ratgeber. Ihm ist, neben dem weiteren Bruder Wilhelm, das Buch gewidmet.
Raabe, Elisabeth: Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche. Edition Momente: Zürich/Hamburg 2016. 239 Seiten. ISBN 978-3-952-44331-6.
Die Rezension erschien zuerst auf literaturkritik.de, Nr. 2, Februar 2017.
C. H. Beck Verlag
Der juristische Verlag
Der Beck-Verlag gehört zu den ältesten, heute noch aktiven Verlagen. Er befindet sich nach sechs Generationen noch immer in Familienbesitz und wird von Familienmitgliedern geführt. Aus Anlass des 250-jährigen Gründungsjahrs hat der Verlag seine Geschichte von zwei renommierten Professoren aufschreiben lassen, von dem emeritierten Rechtshistoriker Uwe Wesel für den juristischen Verlag, von dem Berner Althistoriker Stefan Rebenich für den kulturwissenschaftlichen Verlag1. Bis zur Entwicklung eines dezidiert kulturwissenschaftlichen Programms durch Oskar Beck seit 1884 finden sich etliche Parallelen und Dubletten in den beiden Bänden.
Der Band über den juristischen Verlag umfasst knapp 600 Seiten; die Hälfte davon für den Zeitraum von 1763 bis 1970 stammt von Uwe Wesel, der Rest von Hans Dieter Beck, dem Verleger, sowie Mitarbeitern des Verlags, denn für Wesel »als einzigen Autor [war es] eine nicht mehr erfüllbare Aufgabe, den langen historischen Zeitraum von 250 Jahren zu erschließen und zugleich der großen Fülle der Werke aus der neueren Zeit gerecht zu werden. Deshalb haben Verlagslektoren bei der letzten Phase der Manuskripterstellung mitgewirkt und haben neuere Sachgebiete und Verlagswerke beschrieben« (S. 5f). Nicht weniger als 25 namentlich aufgeführte Lektoren wurden kurzfristig eingespannt, um das Weselsche Manuskript zu retten, das – wie die Presse berichtet – höchst lückenhaft war.
Um es vorwegzunehmen: Der neuere Teil besteht aus einer Aneinanderreihung von Beschreibungen einzelner juristischer (Standard-)Werke, die vom Handelsgesetzbuch über das Arztrecht bis zum Energierecht reichen und im Inhaltsverzeichnis aufgereiht sind. Der Informationsgehalt für den verlagsgeschichtlich Interessierten ist gering, wie das willkürlich herausgegriffene Beispiel aus dem Abschnitt zum Straßenverkehrsrecht zeigt: »Die aktuelle, 42. Auflage ist die erste, in der, bis auf das Straßenverkehrsgesetz, sämtliche Vorschriften gegenüber der Vorauflage neu gefasst worden sind, überwiegend mit inhaltlich und strukturell einschneidenden Rechtsänderungen. In den nur sieben Jahren seit Beginn ihrer Autorentätigkeit haben König und Dauer vollständige Neubearbeitungen des Kommentars in einem Umfang vornehmen müssen, den die Verfasser früherer Auflagen nicht in Jahrzehnten zu bewältigen hatten.« (S. 413) Zwischen solchen Ausführungen stehen kurze verlagshistorische Bemerkungen.
Was bietet der erste, von Wesel verfasste Teil des voluminösen Bands? Es ist die Geschichte des Verlags in den ersten zweihundert Jahren seines Bestehens. Die Zäsur wird in das Jahr 1970 gelegt. Der im sächsischen Erzgebirge geborene Carl Gottlob Beck (1733–1802) erwarb 1763 für die ansehnliche Summe von umgerechnet 300.000 Euro die Mundbachsche Druckerei und Buchhandlung in Nördlingen, wo die Becksche Druckerei noch heute ihren Sitz hat. Er verlegte Schul- und Gesangbücher, pädagogische Schriften, medizinische und volkswirtschaftliche Bücher und schon ein Jahr nach Übernahme der Firma ein erstes juristisches Fachbuch.
Sein Sohn Carl Heinrich Beck, nachdem der Verlag seither benannt ist, und dessen Witwe Catharina Magdalena führten das Werk fort; fast die Hälfte der steigenden Produktion waren theologische Schriften. Carl Beck, der 1846 die Leitung übernahm, machte die juristischen Bücher zum zweiten Standbein und publizierte erstmals juristische Fachzeitschriften, bevor dann Beck unter seiner Witwe und deren späterem zweiten Mann Ernst Rohmer nach der Reichsgründung 1871 neben Heymanns und Decker zu einem der führenden juristischen Verlage aufstieg.
1884 folgte der Sohn Carls, Oscar, der 30 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens blieb und dieses 1889 nach München übersiedelte. Er weitete die Produktion stark aus und fügte den kulturwissenschaftlichen Bereich mit Altertumswissenschaft, klassischer Philologie und Geschichte hinzu. Mit Der Wanderer zwischen beiden Welten von Walter Flex (1916) hatte er einen großen Verkaufserfolg.
Nach seinem Tod 1924 übernahm sein Sohn Heinrich auch formal die Firma, nachdem er während der Krankheit seines Vaters bereits Jahre vorher das Programm des Hauses bestimmt hatte. Er verlegte in »Abweichung von der Generallinie, die der Verlag bis dahin verfolgt hatte« (S. 84), Oswald Spengler (1922/1923), Albert Schweitzer (1923) und Egon Friedell (1927) und erzielte wie sein Vater mit nicht-juristischen Titeln hohe Umsätze, was die Bedeutung des kulturwissenschaftlichen Verlagsteils deutlich steigerte. Gleichzeitig gelang ihm 1931 mit der Erstveröffentlichung der Gesetzessammlung Schönfelder ein riesiger Erfolg. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erschienen 17 Auflagen, seit 1935 als Loseblattausgabe. Derzeit liegt die 168. Auflage vor.
Nimmt die bisherige 170jährige Geschichte des Verlags knapp 100 Seiten ein, so gehören die folgenden 90 Seiten der Entwicklung des Verlags zwischen 1933 und 1945 einschließlich des Entnazifizierungsverfahrens gegen Heinrich Beck (S. 111–199). Das Unternehmen wurde durch den Kauf des jüdischen juristischen Verlags von Otto Liebmann (Vertrag als Faksimile im Anhang) im Dezember 1933 zu einem »der größten juristischen Verlage in Deutschland« (S. 111). Diese »Arisierung« gehörte zu den vier ersten von juristischen Verlagen nach der Machtergreifung.
Der Liebmann Verlag, in Berlin 1890 gegründet, war einer der wichtigen juristischen Verlage; hier erschien u. a. seit 1896 die einflussreiche Deutsche Juristen-Zeitung (DJZ), die ab 1934 von Carl Schmitt herausgegeben wurde. Beck übernahm ungefähr 150 Titel des Verlags (S. 127; auf S. 138 ist von 350 Titeln die Rede). Wesel bezeichnet den Kaufpreis von 305.000 Mark als »ein angemessenes Entgelt« (S. 135). Die Entwicklung des Programms bringt er auf den Punkt: »Auf der juristischen Seite des Verlags sah man naturgemäß mehr Nationalsozialistisches als auf den anderen vom Verlag gepflegten Gebieten.« (S. 140) Vor allem die Gleichschaltung zweier Fachzeitschriften war »ein Trauerspiel« (S. 145).
Bei den Büchern sei die Situation anders gewesen: »Auch hier gab es viel Nationalsozialistisches, aber auch eine große Zahl von Neuerscheinungen rein juristischen Inhalts ohne ideologisches Beiwerk des Nationalsozialismus.« (S. 146); eine Liste der »Bücher mit NS-Recht« findet sich auf den S. 149–151. Wichtige einzelne Werke daraus werden im Anschluss daran ausführlich dargestellt (S. 156–180).
Im Entnazifizierungsverfahren wurde Heinrich Beck am 1. Oktober 1947 aufgrund von 20 »Persilscheinen« als Mitläufer der Gruppe IV eingestuft. Diese Mitläufer haben – so das sogenannte Befreiungsgesetz von 1946 – »nicht mehr als nominell am Nationalsozialismus teilgenommen« (S. 199). Der Kernsatz der sechsseitigen Begründung (als Faksimile im Anhang) lautet: »Sie [die Spruchkammer] hat aus dem Verhalten des Betroffenen als Verleger den Eindruck gewonnen, dass sich dieser auch während der Zeit des Dritten Reiches sehr wohl seiner Pflichten als demokratisch und liberal eingestellter Staatsbürger bewusst geblieben ist und dass er trotz schweren auf ihn ausgeübten Druckes mit Erfolg bestrebt war, seinen Verlag von nationalsozialistischen Einflüssen nach Möglichkeit freizuhalten und damit die Tradition seines international angesehenen Unternehmens im guten überlieferten Sinne hochzuhalten.« (S. 198)
Da ein Antrag auf Lizenzerteilung nach Ende des Kriegs wegen der Mitgliedschaft von Heinrich Beck in der NSDAP seit 1937 wohl keinen Erfolg gehabt hätte, verpachtete er das Unternehmen an seinen Vetter Gustav End, der eine Lizenz erhielt und den Verlag seit dem 1. September 1946 unter dem Namen Biederstein weiterführte, bevor dann ab 1949 wieder unter Beck publiziert werden konnte. Unter dem Label Biederstein wurde bis 1995 Belletristik verlegt; juristisch besteht die Firma noch heute.
Das Stichwort für die jüngere Geschichte des Verlags ist »Expansion«, nimmt man allein die Überschriften der entsprechenden Kapitel: »Beck wird größter juristischer Verlag« (S. 233) – »Expansion des Juristischen« (S. 309) – »Die Expansion wird noch größer« (S. 471). Die Erweiterung der Geschäftsaktivitäten ist die Leistung des ersten Sohns von Heinrich Beck; Hans Dieter Beck übernahm 1970 den rechtswissenschaftlichen Verlag, sein Bruder Wolfgang Beck 1972 den kulturwissenschaftlichen Verlag.
Expansion im juristischen Bereich heißt Expansion der Produktion (vgl. S. 235) von Büchern (Gesetzestexte, Kommentare, Lehrbücher) und Zeitschriften (Neue Juristische Wochenschrift); Expansion ins Taschenbuch als Teilhaber des Deutschen Taschenbuchverlags und Träger der Reihe Beck-Texte im dtv; Expansion durch Verlags- und Programmzukäufe (Franz Vahlen Verlag 1970; Helbing & Lichtenhahn 1998; Nomos 1999; der Programmbereich Recht vom Verlag Wiley-VCH 2001; Kommunal und Schul-Verlag 2002/2004; Lehrbuchliteratur der Verlage Carl Heymanns und Luchterhand 2010); Expansion ins Ausland (Polen und Tschechoslowakei 1993, Rumänien 1998, Slowakei 2010); Expansion in ein englischsprachiges Programm als Kooperation mit dem englischen Verlag Hart Publishing; Expansion in das Seminar- und Tagungsgeschäft (seit 2001 als selbständige Abteilung, seit 2009 als Beck Akademie Seminare); Expansion ins Internet mit den Online-Kommentaren (derzeit 28) und der Datenbank beck-online mit heute fast 100 Modulen (2001).