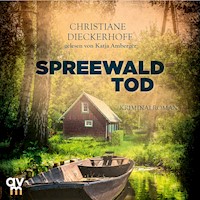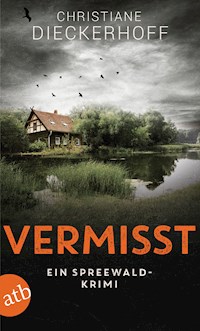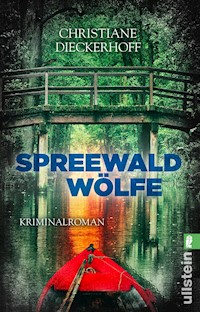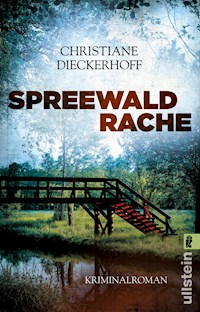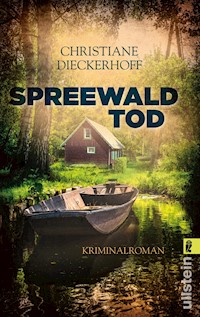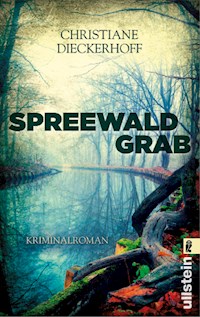Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ermittlungen im Spreewald
- Sprache: Deutsch
Tod einer Heimkehrerin.
Kommissarin Klaudia Wagner wird in ein Nobelhotel gerufen. Eine Touristin aus Dortmund wird von ihren beiden Kindern vermisst. Tage später wird die Vermisste, die offenbar aus dem Spreewald stammt, tot aufgefunden – neben einem Fahrradhelm, den Klaudia sofort erkennt. Er gehört dem Sohn ihres Kollegen Demel, doch was kann ein vierzehnjähriger Junge mit einem Mord zu tun haben?
Packend und hintergründig – der neue Spreewald-Krimi.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Kommissarin Klaudia Wagner freut sich auf ein paar ruhige Tage, doch dann geht eine Vermisstenmeldung ein. Zuletzt wurde Heike Thielmann, die aus Dortmund in den Spreewald gereist ist, betrunken in der Nähe eines Café gesehen. Als sie mit den Angehörigen spricht, hat Klaudia Wagner das Gefühl, dass sie ihr etwas verschweigen. Dann findet die Kommissarin heraus, dass die Vermisste ursprünglich aus dem Spreewald stammt, aber nach der Wende in den Westen gegangen ist, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ihre beiden Kinder hat sie zurückgelassen. Doch warum ist sie nun zurückgekehrt, und wer könnte schuld an ihrem Tod sein?
Über Christiane Dieckerhoff
Christiane Dieckerhoff lebt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Nach über dreißig Berufsjahren als Kinderkrankenschwester und ersten erfolgreichen Veröffentlichungen wagte sie 2016 den Sprung in die Freiberuflichkeit.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Spreewald-Krimis „Vermisst“ und „Verfehlt“ vor.
Mehr zur Autorin unter www.krimiane.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christiane Dieckerhoff
Verlassen
Ein Spreewald-Krimi
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Epilog
Zitate
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
1. Kapitel
Das Mädchen setzt sich im Bett auf. Der Mond scheint durchs Fenster. Es ist verwirrt, weiß nicht, was es geweckt hat. Pipi muss es nicht, und Matte schläft ganz still. Warm schmiegen sich seine Füße an seine Wade. Vielleicht hat er es getreten, das macht er manchmal im Schlaf. Das Mädchen reibt sich die Augen, sie jucken vor Müdigkeit. Schritte im Treppenhaus. Für einen Moment schlägt sein Herz schneller. Mutti kommt, denkt es. Doch dann entfernen sich die Schritte, die Haustür wird aufgezogen und schließt sich mit einem wimmernden Quietschen. Die Enttäuschung schmeckt nach Tränen. Das Mädchen legt sich wieder hin, dreht sich auf die Seite, spürt den warmen Atem des Bruders. Sein Körper riecht nach Babypuder und ein bisschen nach Pipi. Das tut er jetzt immer. Wenn doch nur Mutti hier wäre. Das Mädchen blinzelt die Tränen weg, tastet nach Teddy, schmiegt sein Gesicht an seinen Bauch und atmet seinen Duft ein. Teddy ist sein bester Freund, auch wenn er kahle Stellen im Fell hat und ihm ein Ohr fehlt. Es spielt auch eigentlich nicht mehr mit ihm, nur wenn es allein ist oder sich fürchtet. Es ist nämlich schon groß. Mutti verlässt sich auf sie. Aber manchmal ist es schwierig mit dem Großsein und dann braucht es seinen Teddy, wie Mutti ihre Pause braucht. Und bestimmt kommt sie heute zurück. Sie muss einfach, weil … Das Mädchen weiß nicht, was nach diesem »weil« kommen könnte. Es weiß nur, dass Mutti immer zurückkommt.
Vorsichtig schiebt es sich aus dem Bett. Der Linoleumboden ist kalt unter seinen Füßen. Hastig läuft es ins Bad. Hier ist es warm. Die Heizung bullert. Über dem Badewannenrand liegt die Strumpfhose ihres Bruders. Es riecht auch nach Pipi und nach Groß. Er ist noch zu klein, um zur Toilette zu gehen, und sie hat nicht aufgepasst. Also ist es passiert. Das Mädchen hat die Strumpfhose ausgewaschen, bis seine Hände ganz rot waren vom kalten Wasser, trotzdem sind noch Flecken zu sehen. Es legt die Hand auf den kratzigen Strick. Trocken ist sie auch noch nicht. Mutti wird schimpfen. Das Mädchen setzt sich auf die Toilette. Der Rand drückt kalt gegen seine Oberschenkel. Es beeilt sich, hat Angst, dass eine Ratte aus der Kanalisation hochklettert. Eine Nachbarin hat davon erzählt. Nicht dem Mädchen, sondern einer anderen Frau. Es hat es nur gehört, weil es am Fenster gestanden und auf Mutti gewartet hat. Das Mädchen hat das Fenster nicht öffnen können, es klemmt, und nur Mutti hat genug Kraft, um es aufzuziehen, aber die Scheiben sind dünn, und die Nachbarin hat laut gesprochen. Ganz aufgeregt war sie. Fröstelnd zieht das Mädchen ab. Das Wasser gurgelt in die Toilettenschüssel. Es lauscht angespannt, hat Angst, dass der Lärm seinen Bruder weckt. Er will immer nur zu Mutti und weint dann. Und dann muss es auch weinen, und das darf das Mädchen nicht, weil es doch die große Schwester ist, die auf ihn aufpassen muss. Und wenn man weint, kann man nicht gut aufpassen. Dann kommen die Schrecken aus den Ecken. Deshalb schlafen sie auch in Muttis Bett, da ist kein Platz für Ungeheuer, weil die Koffer unter dem Bett liegen. Außerdem riecht das Kissen nach ihr, wenn jetzt auch nicht mehr so doll. Der Bruder hat Pipi ins Bett gemacht.
Das Mädchen wäscht sich die Hände. Das hat es im Hort gelernt. Da achten die Erzieherinnen auf so etwas. Wegen dem Pipi wird Mutti wütend sein, das Mädchen weiß das. Es hätte besser aufpassen müssen, aber es hat geschlafen. Wenn man schläft, kann man auch nicht gut aufpassen. Das Mädchen geht in die Küche, seine nackten Füße schmatzen über das Linoleum. Es schiebt einen Stuhl ans Fenster, klettert hinauf, legt die Ellbogen auf dem Kissen ab, das auf der Fensterbank liegt, und drückt die Stirn gegen die kühle Fensterscheibe. Sein Atem malt Wolken auf das Glas. Hinter den Häusern ist der Himmel schon hell, vor den Häusern dunkel. Es regnet. Im Licht der Straßenlaterne sieht der Regen aus wie Feengarn. Glitzernde Fäden aus Wasser und Licht. Ein Windstoß wirbelt sie durcheinander. Das Mädchen kneift die Augen zusammen und wünscht sich ganz fest, dass Mutti jetzt in diesem Moment zurückkommt. Da hallen Schritte von der Straße herauf: eilig, ein bisschen ungleichmäßig.
Das Mädchen richtet sich auf. Es hat funktioniert. Sein Herz schlägt schneller. Hinter ihm knackt die Heizung, die Atemwolken nehmen ihm die Sicht. Ungeduldig wischt es sie fort. Seine Augen tränen vor Müdigkeit und auch ein bisschen, weil es Hunger hat. Selbst die Suppe aus dem Hort würde es jetzt essen, wenn es auch am liebsten Kartoffelpüree mit Ei und Kompott mag. Vielleicht kann es Kartoffeln kochen, das Mädchen weiß, dass in dem Korb unter der Spüle welche sind, aber die sind verschrumpelt und haben kleine Arme und Beine gekriegt: weiß und knubbelig wie Maden. Das Mädchen presst das Ohr gegen die Glasscheibe. Doch die Schritte entfernen sich, sind bald nicht mehr zu hören, egal, wie angestrengt es lauscht. Das Mädchen steigt vom Stuhl, läuft zur Wohnungstür, legt das Ohr ans Türblatt.
Im Treppenhaus ist es still. Das Mädchen stellt sich auf die Zehenspitzen und zieht die Klinke herunter, obwohl es weiß, dass Mutti die Tür abgeschlossen hat. Das macht sie immer, wenn sie fortgeht, damit ihnen nichts passiert.
»Männi«, jammert der Bruder. Er kann den Namen des Mädchens nicht richtig aussprechen, also sagt er ihn, so gut er eben kann. Dem Mädchen ist es egal, es hört auch auf »Balg«, »Kurze« und »Lass-mich‑in-Ruhe«.
Das Mädchen läuft ins Schlafzimmer zurück. Der Bruder soll nicht sehen, dass es auf die Mutter wartet, dann weint er nur wieder. Matte steht vor dem Bett, seine Schlafanzughose ist dunkel vor Nässe. Das Unglück muss gerade erst passiert sein. Seine Füße stehen in einer Pfütze.
Das Mädchen wäre jetzt am liebsten wieder ins Bett gegangen, hätte die Nase in Muttis Kopfkissen vergraben und die Augen fest zugekniffen. In Momenten wie diesen versteht es, dass Mutti eine Pause braucht. Ihm wird auch gerade alles zu viel. Wenn es wenigstens schaffen würde, dem Bruder die Gummihosen mit den weichen Windeltüchern anzuziehen, aber er will nicht, schreit und kreischt, wenn sie es versucht, bis die Nachbarin wieder gegen die Wand klopft. Das Mädchen geht zu dem Bruder, der zieht den Kopf zwischen die Schultern.
»Komm«, das Mädchen nimmt ihn an die Hand, führt ihn ins Bad. Dort hilft es ihm, sich die Hose von den nassen Beinen zu strampeln. Er klettert in die Wanne, landet auf dem Po, verzieht das Gesicht, als wollte er weinen, als das Mädchen das Wasser aufdreht.
»Kalt«, wimmert er.
»Geht schnell«, tröstet ihn Männi. Ein Badeofen steht neben der Wanne, aber das Mädchen weiß nicht, wie es ihn in Betrieb nimmt. Nur Mutti kann das, aber Mutti ist nicht hier.
Hastig seift es Matte ab, hilft ihm aus der Wanne. Er zittert jetzt, seine Zähne klappern und seine Lippen schimmern bläulich. Männi hüllt ihn in ein Handtuch. Das wenigstens ist warm, weil es über der Heizung gelegen hat. Wie die funktioniert, weiß Männi.
»Ich will Mutti«, jammert er.
»Mutti kommt bald«, tröstet sie Männi und schluckt dabei ihre Tränen herunter. Sie hat keine Ahnung, wie lange Mutti diesmal wegbleibt. Aber der Bruder spürt ihre Angst.
»Ich will Mutti«, wiederholt er und kreischt jetzt doch. Seine Schreie hallen von den Fliesen zurück. Männi schlägt ihm ins Gesicht, wie Mutti es macht. Der Schlag brennt in ihrer Handfläche. Den Mund zu einem erstaunten »Oh« geöffnet, starrt der Bruder sie an. Schnodder läuft ihm aus der Nase, seine Wange rötet sich. Männi sieht jeden einzelnen Finger ihrer Hand. Sie senkt den Blick, schämt sich. Der Bruder ist jetzt zwar ruhig, trotzdem fühlt sie sich nicht besser. Mit dem Handtuch wischt sie ihm den Schnodder weg.
»Tut mir leid«, murmelt sie. »Mir ist die Hand ausgerutscht.« Das sagt Mutti auch immer, und dann weint sie und schließt sich in ihrem Schlafzimmer ein. Das würde Männi jetzt auch gerne tun, aber dann würde der Bruder wieder kreischen. Also nimmt sie seine Hand und zieht ihn in das Zimmer, in dem sie schlafen, wenn Mutti nicht weg ist. Der Raum ist ein schmaler Schlauch, die Kinderbetten stehen hintereinander. Dazwischen der Schrank. Seine Türen stehen offen. Überall liegt Kleidung herum. Auch hier riecht es nach Pipi. Der Geruch kommt von der Matratze, die Männi zum Trocknen vor die Heizung geschoben hat. Es ist nicht so einfach, Ordnung zu halten. Männi findet eine trockene Strumpfhose und einen Pulli. Unterwäsche findet sie nicht. Aber das ist egal. In der Wohnung ist es warm.
Nachdem sie den Bruder angezogen hat, wischt Männi den Fleck vom Linoleum und wäscht die Schlafanzughose aus. Sie nimmt die gleiche Seife, mit der sie ihren Bruder gewaschen hat. Sie hat nichts anderes. Als sie fertig ist, schmerzen ihre Hände von dem kalten Wasser. Sie legt sie auf die Heizung.
»Hunger«, sagt ihr Bruder. Er kann noch nicht so gut sprechen, deshalb heißt sie ja Männi und er Matte.
Männi öffnet den Kühlschrank, nimmt die Margarine heraus, stellt sie auf den Tisch, dann zieht sie den Stuhl an den Küchenschrank und holt das Brot aus dem Kasten. Auch das legt sie auf den Tisch. Mutti hat es vorgeschnitten. Das tut sie immer, wenn sie eine Pause braucht. Männi darf das große Brotmesser, dessen Holzgriff locker ist, nicht anfassen. Deshalb liegt es oben auf dem Küchenschrank, da kommt sie nicht dran. Nicht einmal mit Stuhl. Aber sie braucht es auch nicht. Noch ist Brot da. Männi kann bis zwanzig zählen. Aber so viele Scheiben sind schon lange nicht mehr da, und das Brot ist auch schon sehr trocken. Man braucht ordentlich Spucke, um es zu kauen. Noch einmal klettert sie auf den Stuhl und nimmt den Schuber mit dem Zucker heraus. Zucker glitzert mehr als Salz, trotzdem leckt sie den Finger ab und tippt ihn in den Schuber. Es schmeckt herrlich süß, und für einen Moment fühlt Männi sich besser.
»Ich will Milch.« Ihr Bruder will immer Milch. Es steht auch noch eine Flasche im Kühlschrank, aber die sieht komisch aus und schmeckt bitter. Männi weiß, dass Milch sauer werden kann und kleine Kinder daran sterben können. Sie will nicht, dass Matte stirbt. Aber dann denkt sie, dass Mutti ohne ihn vielleicht keine Pause brauchen würde. Sie könnte selbst eine gebrauchen. Alles riecht nach Pipi und Aa, und ihr Hände sind schon ganz wund vom Waschen. Der Bruder hört nicht auf zu quengeln. Jetzt stampft er auch noch mit dem Fuß auf. Einen Moment hadert Männi mit sich, dann schenkt sie ihm Milch ein.
2. Kapitel
Klaudia stellte sich auf die Zehenspitzen und blickte sich suchend um. Schließlich sah sie Wibke. Sie saß allein an einem Tisch in der Außengastronomie des Flaggschiffs und winkte ihr. Klaudia bahnte sich ihren Weg an den Touristen vorbei. So voll hatte sie den Hafen das letzte Mal beim Spreewaldfest erlebt. Allein die Erinnerung ließ ihren Nacken kribbeln. Klaudia schüttelte sich, und ihr Blick wanderte unwillkürlich zu zwei uniformierten Kollegen, die über eine der Brücken schlenderten. Obwohl es März war, sahen sie aus, als wäre ihnen ziemlich warm in ihren Lederjacken. Allen Wettervorhersagen zum Trotz schien die Sonne von einem von zarten Schleierwolken überzogenen Himmel.
Du bist nicht im Dienst, erinnerte Klaudia sich selbst. Zumindest nicht so richtig. Sie war in freundschaftlicher Mission unterwegs. Schiebschick hatte sie engagiert, wenn auch nicht in ihrer Eigenschaft als Polizistin. Heute war die offizielle Eröffnung der Saison. Das sogenannte Anstaken war immer ein Spektakel mit feierlicher Rudelübergabe, schmetternder Musik vom Spielmannszug und humorigen Reden von Landrat und Bürgermeister, die umso länger wurden, je näher der Wahltermin rückte. An diesem Wochenende vor Ostern fanden vor allem Tagestouristen ihren Weg in den Spreewald.
Klaudia wäre lieber zu Hause geblieben und hätte eine Runde mit dem Kanu gedreht. Doch sie hatte es nicht übers Herz gebracht, dem alten Schiebschick, der so etwas wie ihr guter Geist war, einen Korb zu geben. Heute würde er das Rudel für den Großen Hafen entgegennehmen, und Klaudia hatte ihm versprechen müssen, Fotos zu machen. Als sie ihrer Freundin während der Spurensicherung an einem Einbruchsort davon erzählte, hatte die vorgeschlagen, sich dort zu treffen. Sie sei sowieso am Hafen, hatte sie gesagt. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Klaudia, dass Wibkes Lebensgefährte in seiner Freizeit nicht nur den Bass in einer Väter-Söhne-Band spielte, sondern auch Mitglied des örtlichen Trachtenvereins war, der ebenso wie der Spielmannszug des TSG Lübbenau für das Ambiente zuständig war. Lehrer schienen echt viel Zeit zu haben.
Klaudia drückte sich an den Touristen vorbei und setzte sich zu Wibke, vor der eine Berliner Weiße stand.
»Wie siehts aus?« Klaudia schob sich den Rucksack zwischen die Beine. Direkt am Anleger war eine kleine Holzbühne aufgebaut, gerade posierte die Trachtengruppe für Pressefotos. Klaudia erkannte den Redakteur der Lausitzer Rundschau, der am Fuß der Bühne mit dem Bürgermeister sprach.
»Hast du Schiebschick gesehen?«, fragte sie.
»Noch nicht. Willst du auch eine?« Wibke zeigte auf ihr Glas, und als Klaudia nickte, hob sie die Hand, um einen Kellner heranzuwinken.
»Ist wahrscheinlich oben im Genossenschaftsbüro«, meinte Wibke.
Unwillkürlich blickte Klaudia zur vorgelagerten Terrasse hoch. Uwe stand dort, er trug Uniform und sprach gerade in das Sprechfunkgerät, das auf seiner Schulter befestigt war. Als spüre er ihren Blick, drehte er den Kopf in ihre Richtung und nickte ihr zu. Klaudia nickte ebenfalls und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen auf der Bühne zu. Ihr Verhältnis zu ihrem ehemaligen Vermieter war kompliziert, seit er sich von seiner Langzeitfreundin getrennt hatte.
»Wo ist Horst?« Klaudia musterte die männlichen Mitglieder des Trachtenvereins. Manche trugen Gehröcke und Zylinder, andere preußische Uniformen und aufgemalte Bärte. In keinem von ihnen erkannte sie den Lebensgefährten ihrer Freundin.
»Hat er sich als Frau verkleidet?« Klaudia musterte nun auch die weiblichen Mitglieder des Vereins, auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, dass der eher kräftig gebaute Horst in eine der farbenprächtigen niedersorbischen Trachten passte. »Ich seh ihn gar nicht.«
»Horst flaniert durch die Altstadt.« Wibke zeigte auf ihr fast leeres Glas und hob zwei Finger. Offensichtlich hatte sie endlich die Aufmerksamkeit eines Kellners erregt. »Er ist so etwas wie ein Walking Act.« Sie schob sich die Sonnenbrille in die rotblonden Locken, die von einem schlichten Haarband zusammengehalten wurden.
»Klingt aufregend.« Klaudia fühlte sich immer etwas farblos neben der Freundin. Im Gegensatz zu ihr war sie eher so der mittelmäßige Typ. Mittelgroß, mittelblond, mit ersten grauen Haaren und mittelschlank, wobei Schiebschick behauptete, sie sei zu dünn.
»Nicht unbedingt. Aber weißt du, was aufregend ist?« Wibke beugte sich vor, doch in diesem Moment marschierte der Spielmannszug auf den Platz und machte jede weitere Unterhaltung unmöglich. Klaudia verließ Wibke, um die versprochenen Fotos zu machen. Doch sie musste erst noch die Reden des Bürgermeisters und des Landrats über sich ergehen lassen, bevor sie ihr Smartphone zücken konnte. Sie nahm es zur Hand, als sich die Vertreter der Kahngesellschaften in ihren bunten Westen vor der Bühne aufreihten. Kahnführerinnen in bunten Spreewaldtrachten trugen die mit Blumengirlanden geschmückten Rudel und das ebenso geschmückte Paddel auf die Bühne und überreichten sie an die Fährmänner. Schiebschick hielt sich sehr gerade, das Rudel fest in der Hand. Schmuck sah er aus, mit seiner dunkelblauen Weste, der Kapitänsmütze und den auf Hochglanz polierten Schuhen, in denen sich der Himmel spiegelte. Klaudia mochte den Alten, der sie seit ihrem ersten Einsatz im Spreewald begleitete, und für sie wie die Kähne zu Lübbenau gehörte. Applaus brandete auf, als die Fährleute die Bühne verließen. Der Spielmannszug spielte einen Tusch, und Klaudia kehrte zu Wibke an den Tisch zurück. Die Freundin war mittlerweile nicht mehr allein. Neben ihr saß ein Mann in einem höchst unbequem aussehenden Anzug mit Vatermörderkragen, die Haare mit Brillantine zurückgekämmt. Ohne seinen gepflegten grau melierten Bart hätte Klaudia ihn fast nicht erkannt. Für einen Moment wirkte Horst irritiert, sie zu sehen, dann nickte er ihr zu.
»Ist das dein Hochzeitsanzug?«, fragte sie und setzte sich zu den beiden an den Tisch. Sie hatte Wibkes Freund zuletzt im Dezember gesehen. Sie hatten sich an diesem Adventssonntag an einem Anleger abseits des großen Hafens getroffen und waren von dort zum Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Lehde gepaddelt.
»Wie kommst du darauf.« Horst griff nach Wibkes Berliner Weiße und trank hastig. Klaudia hatte das Gefühl, dass sich seine Wangen röteten.
»Hast du die Fotos?«, fragte Wibke.
»Ja.« Klaudia packte ihr Smartphone in den Rucksack. »Mission erfüllt. Ich hoffe, sie gefallen ihm.«
»Du kannst sie ja photoshoppen«, schlug Wibke vor.
»Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt«, wehrte Klaudia ab, »geschweige denn, wie man das macht.« Sie strich sich die Haare zurück. »Was wolltest du mir eigentlich gerade erzählen?«
»Ach ja.« Wibke beugte sich wieder vor. »Also …«
»Ihr wollt doch jetzt nicht über die Arbeit reden?« Horst zerrte an seinem Kragen.
»Nur ganz kurz«, beruhigte Wibke ihn. »Also«, setzte sie erneut an.
»Was haltet ihr davon, wenn wir ins Hofladencafé umziehen?«, fiel Horst ihr ins Wort. »Da ist es ruhiger.«
»Gleich.« Wibke brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Hast du das von Meinert gehört?«, fragte sie Klaudia.
»Meinert? Nein. Schieß los?« Neugierig beugte Klaudia sich vor. Mark Meinert war ein LKA-Kollege, mit dem sie im letzten Sommer eng zusammengearbeitet hatte. »Was ist mit ihm?«
»Ziemlich komische Sache.« Wibke runzelte die Stirn.
»Da ist was in deinem Glas.« Horst schob Wibke die Berliner Weiße zurück.
»Was?« Wibke hob das Glas gegen das Licht. Auf dem Grund des Glases schimmerte etwas, das aussah wie … »Ist das?« Wibke starrte ihren Freund an.
Ein Ring. Klaudia spürte, wie ihr Unterkiefer absackte. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Tischgruppe geradezu eingekreist war von Menschen in historischen Kostümen. Sie wünschte sich ganz weit weg. Bisher hatte sie Horst für einen Pragmatiker gehalten. Immerhin unterrichtete er Mathematik und Sozialkunde oder wie das Fach heutzutage hieß. Die romantische Ader, die er jetzt enthüllte, weckte sämtliche Fluchtinstinkte in ihr. Hastig blickte sie zu Wibke hinüber, die immer noch auf das Glas in ihrer Hand starrte. Ihre Mundwinkel zuckten, und dann lachte sie so laut, dass sich die Gäste an den anderen Tischen zu ihnen umdrehten. »Das ist jetzt nicht dein Ernst?«
»Doch«, entgegnete Horst. »Willst du meine Frau werden?«
»Du bist geschieden«, antwortete Wibke und stellte das Glas ab. »Weißt du, was die Definition von Wahnsinn ist?«
»Was hat das jetzt damit zu tun?« Horst schien in seinem Kostüm zu schrumpfen. So hatte er sich das Ganze wohl nicht vorgestellt.
Selbst Schuld, dachte Klaudia. Er lebte mit Wibke zusammen, wie konnte ihm entgangen sein, dass sie alles hatte, aber bestimmt keine romantische Ader. Als Kripobeamtin untersuchte sie Tatorte, pinselte Spurenpulver an Türen, dokumentierte Blutspritzer und durchsuchte die Schubladen von Tätern und Opfern. Diese intimen Einblicke, die sie ins Leben von wildfremden Menschen bekamen, reichten, um jegliche Romantik abzutöten.
»Immer wieder das Gleiche zu tun und trotzdem ein anderes Ergebnis zu erwarten«, gab Wibke ihm die Definition trotzdem.
»Ich liebe dich, und du bist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will«, beharrte Horst. So schnell gab er nicht auf. Wie musste er sich jetzt fühlen? Wie es aussah, waren eine Menge Leute eingeweiht. Klaudia blickte hinüber zu den verkleideten Menschen, die vergeblich versuchten, betont unbeteiligt zu wirken. Ach du Scheiße! Der Spielmannszug stellte sich jetzt auch noch hinter Wibke auf, die von alldem nichts mitbekam. Sie schien unter Schock zu stehen, schüttelte nur den Kopf, als könne sie es nicht fassen. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von leichenblass zur Farbe ihres Haares.
»Heißt das: Nein?« Horsts Stimme klang belegt, jetzt zerrte er geradezu an seinem Hemdkragen.
Irgendwo hatte Klaudia mal gelesen, dass diese Dinger durchaus tödlich gewesen waren, quasi das Pendant zur Wespentaille. Die Männer starben durch den mangelnden Blutfluss zum Gehirn. Und Horst sah aus, als könnte ihm das auch gerade passieren.
»Nein.« Wibke fischte den Ring aus ihrem Glas. Es war ein schmaler Goldreif. »Das heißt es nicht, du Idiot. Aber mach das nie wieder.« Sie zog den Reif über den Ringfinger ihrer linken Hand. Hinter ihr ertönte ein Tusch, der sie herumfahren ließ.
Sie zogen dann doch noch ins Hofladencafé um. Eigentlich hatte Klaudia sich an dieser Stelle verabschieden wollen, doch dann war auch noch Schiebschick aufgetaucht, ganz begeistert von der Idee, die Verlobung mit einem Stück Kuchen zu feiern.
Er hakte sich bei Klaudia unter, und ihr blieb nichts anderes übrig, als sich in ihr Schicksal zu fügen. Wibke wirkte merkwürdig überdreht, ganz offensichtlich stand sie unter Schock, und Horsts Grinsen reichte ebenso wie sein falscher Schnauzbart von Ohr zu Ohr.
Nicht alle Mitglieder des Trachtenvereins schlossen sich ihnen an, die meisten blieben noch auf dem Festplatz oder flanierten durch die Altstadt, nur ein Offizier mit Pickelhaube, ein Frackträger und zwei Frauen in Tracht blieben bei ihnen. Doch diese Eskorte reichte, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Klaudia wollte lieber nicht darüber nachdenken, auf wie vielen Instagram- und Facebook-Profilen ihr Bild heute online gehen würde.
Das Hofladencafé war ein mit viel Backstein, Pflanzen und Liebe zum Detail ausgebauter Hinterhof. Die für die Bebauung des Spreewaldes so typischen Nebengebäude waren ebenfalls umgebaut und beherbergten weitere Sitzgruppen und einen urigen Laden. Hier hatte Klaudia schon einmal Geschenke für ihre Schwestern gekauft, als sie wieder zu spät an den Geburtstag der Zwillinge gedacht hatte. Das war das Gute, wenn man in einer Touristenregion lebte, shoppen ging immer.
Im überdachten Bereich des Lokals war ein Tisch für sie reserviert.
Von langer Hand vorbereitet. Klaudia setzte sich so, dass sie Schiebschick auf ihrer »tauben« Seite hatte. Der alte Fährmann redete immer in einer Lautstärke, als müsste er einen Kahn bespaßen. Das war vielleicht etwas nervig, doch Klaudia half es, ihn zu verstehen.
Eine der Frauen, die eine niedersorbische Festtagstracht trug, wie sie Klaudia erklärte, setzte sich neben sie. Ihr Kopfputz war so ausladend, dass Klaudia näher an Schiebschick heranrückte, was dem alten Mann gut gefiel. Er tätschelte ihre Hand. »Hast du schöne Bilder gemacht?«, fragte er.
»Später«, antwortete Klaudia. Die Kellnerin, eine müde wirkende Blondine mit dunklem Haaransatz, brachte gerade Kannen mit Tee und Kaffee.
»Kuchen können Sie sich vorne aussuchen«, sagte sie.
»Machen wir«, sagte Horst. Mittlerweile hatte er seinen Kragen abgelegt und wirkte nicht mehr ganz so fremd.
»Ich kann für alle aussuchen«, bot Wibke an.
»Du wieder Eierlikörkuchen?«, fragte die Kellnerin Schiebschick. Der nickte. Offensichtlich kannte man ihn hier. Warum wundert mich das überhaupt?, dachte Klaudia. Jeder kannte Schiebschick, und vielleicht war die Blonde eine seiner zahlreichen Nichten.
»Okay«, sagte Wibke, als die Kellnerin sich entfernte. »Irgendwelche Extrawünsche?«
»Ich komme mit.« Klaudia schob ihren Stuhl zurück und folgte Wibke zur Kuchentheke.
»Alles klar?«, fragte sie.
»Kneif mich mal«, bat Wibke.
Klaudia tat ihr den Gefallen.
»Autsch«, zischte die Freundin. »Wir sind immer noch im Café.«
»Kein Traum«, bestätigte Klaudia. »Du hast dich gerade verlobt.«
»Wer hätte das gedacht.«
»Ja«, sagte Klaudia. »Und ist es das, was du willst?«, fügte sie hinzu.
»Keine Ahnung.« Wibkes Lachen klang leicht hysterisch. »Ich glaub, ich brauch erst mal viel Zucker.«
»Kriegst du ja gleich.«
»Und Sahne.« Gedankenverloren musterte Wibke die Kuchen in der Auslage.
Doch noch waren sie nicht an der Reihe. Eine Frau, die aussah, als hätte sie sich extra fein gemacht, ließ sich gerade die Inhaltsstoffe eines jeden Kuchens erklären und strapazierte damit nicht nur die Geduld der freundlichen Bedienung.
»Was wolltest du mir eigentlich eben von Meinert erzählen?«, fragte Klaudia, um die Wartezeit zu überbrücken. Außerdem war sie neugierig.
»Ach ja. Klar.« Wibke senkte die Stimme.
»Er hat einen Unfall gehabt.«
»Einen Unfall?«, hakte Klaudia nach. »Das ist ja schrecklich.«
»Ja«, bestätigte Wibke. »Gott sei Dank war er allein, als sich das Rad gelöst hat.«
»Es hat sich ein Rad gelöst?« Auf einmal sang Celine Dion I’m Alive in Klaudias Kopf, und dann kreischte Metall auf Asphalt, Funken sprühten. Noch einmal erlebte sie das Gefühl absoluter Hilflosigkeit, und dann explodierte wieder die Wolke, und sie bekam keine Luft mehr.
»Was ist los?« Wibke griff nach ihrem Arm.
»Nichts.« Klaudia schüttelte den Kopf. »Alles gut.«
»Wirklich?« Wibke musterte sie kritisch. »So siehst du aber nicht aus.«
»Ist Meinert schwer verletzt?«
»Ihm ist nichts passiert. Er hat Glück gehabt.«
»Das ist gut. Und …« Klaudia räusperte sich. »Weiß man, warum sich das Rad gelöst hat?«
»Wahrscheinlich hat jemand beim Reifenwechsel geschlampt. Die Sommerreifen waren gerade neu aufgezogen.« Sie musterte Klaudia. »Geht es dir wirklich gut? Du bist so weiß wie die Sahnetorte.«
»Ja«, wehrte Klaudia ab. »Alles gut. Ich geh mal eben für ›Große Mädchen‹.«
»Und welchen Kuchen willst du?«
»Egal.« Klaudia wollte nur noch weg. Ihre Ermittlerader wummerte knapp unterhalb ihres Zwerchfells. Dass Meinert exakt den gleichen Unfall wie sie gehabt hatte, konnte kein Zufall sein.
Sie verriegelte die Tür hinter sich und ließ Wasser über ihre Handgelenke laufen. Dann formte sie einen Trichter mit den Händen und tauchte ihr Gesicht in das kalte Wasser. Du siehst Gespenster, versuchte sie sich zu beruhigen, als sich die Türklinke senkte.
»Meinst du, sie ist es?«, fragte eine weibliche Stimme.
Klaudias Nackenhaare richteten sich auf. Sie fragte sich, wer ihr zur Toilette gefolgt sein konnte. Langsam richtete sie sich auf. Wasser tropfte von ihrem Kinn.
»Muss ja wohl«, antwortete eine männliche Stimme.
»Sie sieht so ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe.«
»Meinst du?«
»Findest du nicht?«, fragte die weibliche Stimme wieder.
»Keine Ahnung.« Der Mann klang, als zucke er mit den Achseln. »Ehrlich gesagt, habe ich mir gar nichts vorgestellt.«
»Müsste sie uns denn nicht irgendwie ähnlich sehen? Ich meine, immerhin ist sie unsere Schwester.«
Klaudia entspannte sich. Wer immer vor der Tür stand, sprach zumindest nicht über sie.
3. Kapitel
Klaudia bog in ihre Einfahrt ein und parkte ihren Peugeot neben dem Schuppen. Als sie den Motor ausstellte, verstummte Celine Dion. Zurück blieb das Pfeifen in ihrem rechten Ohr, das Klaudia die meiste Zeit ignorierte. Doch heute war es besonders laut. Die letzten Tage waren anstrengend gewesen, und Klaudia freute sich auf das lange Osterwochenende. PH, ihr Chef, hatte sie in eine Arbeitsgruppe zum Thema Opferschutz abkommandiert. Die letzten Tage hatte sie also statt im Büro in Cottbus verbracht, um dort mit anderen Kolleginnen und einem Kollegen – Opferschutz schien immer noch Frauensache zu sein – Konzepte zu entwickeln. Auch wenn das Thema wichtig war, hasste Klaudia diese Termine. Aber PH wollte, dass sie sich einen Namen machte. Er würde im nächsten Jahr pensioniert werden. Klaudia konnte sich die Wache ohne ihn überhaupt nicht vorstellen. Doch sie wusste, dass sie eine heiße Kandidatin für seine Nachfolge war. Was sie nicht wusste, war: Wollte sie das auch? Sie dachte an die Besprechung, aus der sie gerade kam. Wie immer waren zu viele Leute in dem schlecht gelüfteten Raum gewesen. Zu viele Stimmen, die es zu sortieren galt. Und wenn die Besprechungen schon anstrengend waren, so waren es die Pausen erst recht. Klaudia musste sich extrem konzentrieren, um den Gesprächen am Esstisch zu folgen. Schließlich durfte niemand merken, dass ihr rechtes Ohr nutzlos war. Erst letztens hatte sie von einem Kollegen erfahren, der nach einem Hörsturz in den Innendienst versetzt worden war. Nicht einmal einen Dienstwagen durfte er mehr fahren. Klaudia musste höllisch auf der Hut sein, damit ihr nicht das Gleiche passierte. Und meistens gelang es ihr auch. Doch nach Tagen wie diesem summte es in ihrem rechten Ohr wie in einem Wespennest. Sie griff nach ihrem Rucksack, der wie immer auf dem Beifahrersitz lag, und stieg aus. Sofort war Dickie bei ihr und schmiegte sich an ihre Beine. Er maunzte jämmerlich.
»Du warst abgängig«, erinnerte Klaudia ihn oder sie. So ganz genau wusste sie immer noch nicht, ob sie von einem Kater oder einer Katze adoptiert worden war. Sie bückte sich und kraulte Dickies Kinn. Verzückt schielte er sie an. »Nicht ich.« Drei Tage hatte sie den Kater nicht gesehen. Sie hatte sich schon Sorgen gemacht, doch was sollte sie tun? Dickie kam und ging, wie es ihm passte. Sie konnte ihn ja schlecht in Sicherungsverwahrung nehmen. Ihre Finger wanderten vom Kinn zu dem weichen Fell zwischen Dickies Ohren, und das vorwurfsvolle Maunzen wurde zu einem Schnurren. Männer, dachte Klaudia. Nicht mal mit Fell zu verstehen. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf, nicht nur über den Kater, sondern auch, um das Sirren loszuwerden.
Sie blickte zum Himmel hinauf: Zwar verschwand die Sonne immer wieder hinter Wolken, doch die sahen nicht so aus, als wollten sie in absehbarer Zeit ihren Inhalt über dem Spreewald entleeren. Klaudia brachte den Rucksack ins Haus und wechselte die Kleidung. Dann griff sie nach den Lederhandschuhen, die ihr Schiebschick zu Weihnachten geschenkt hatte. Die ganze Zeit strich der Kater um ihre Beine, maunzte und musterte sie mit vorwurfsvoll schielendem Blick. Du durftest mich streicheln, sagte dieser Blick, ich habe geschnurrt. Gib! Mir! Futter!
»Ich weiß.« Klaudia machte sich keine Illusionen darüber, was die Grundlage ihrer Beziehung war. Sie bückte sich und nahm eine Dose mit Katzenfutter aus dem Vorratsschrank, was Dickie mit steil aufgerichtetem und begeistert zitterndem Schwanz quittierte, und füllte auf dem Weg zum Anleger Dickies Futterschale.
Ihr Kanu lag kieloben auf der Wiese. Die letzten Tage hatte es zumeist geregnet, wenn sie abends nach Hause kam. Doch heute hatten sie früher Schluss gemacht. Schließlich sei bald Ostern, hatte die Kriminalrätin gemeint, die die Arbeitsgruppe leitete. Klaudia zog das Kanu zum Anleger, den Schiebschick vor zwei Wochen mit Holzschutzlasur gestrichen hatte. Noch immer hing der durchdringende Geruch über den Planken. Im Herbst wollte er die Fensterläden streichen. Klaudia fragte sich, woher der alte Fährmann nur die Energie nahm. Ohne ihn würde ihr Haus langsam, aber sicher verfallen. Klaudias handwerkliches Geschick beschränkte sich auf das Einschlagen von Nägeln. Sie stieg in ihr Kanu. Dickie blickte nur kurz auf, als Klaudia sich mit dem Ruderblatt vom Steg abstieß, dann senkte er seinen dicken Kopf wieder in die Futterschale. Heute würde sie wohl auf seine Gesellschaft verzichten müssen. Für einen Moment fragte Klaudia sich, ob es jetzt immer so sein würde. Mehr als fünf Jahre lebte sie nun schon allein, und sie hatte das Gefühl, dass sie mit jedem Jahr, welches sie hier in ihrem Haus lebte, verschrobener wurde. Alte Jungfer. Ein Begriff aus ihrer Kindheit. War sie das jetzt? Eine alte Jungfer.
Na ja, räumte Klaudia ein. Jungfer nicht gerade. Immerhin hatte sie lange mit einem Mann zusammengelebt. Also war sie wohl eher eine alte Schachtel. Das Sirren in ihrem Ohr wurde schriller und erinnerte sie daran, wem sie den Hörsturz verdankte. Lieber nicht an ihren Ex denken. Klaudia tauchte das Paddel mit mehr Kraft ein, und das Kanu glitt an moosigen Baumwurzeln und den Häusern vorbei, die ebenfalls an diesem Fließ lagen. Im Nachbarhaus wohnte eine alte Dame, die Dickie immer ein Schälchen Milch vor die Hintertür stellte. Das letzte Haus hatte lange leer gestanden. Von Schiebschick wusste Klaudia, dass ein Anwalt aus Berlin es gekauft hatte. Seitdem veränderte es sich täglich. Klaudia bremste die Fahrt ab. Der Garten war gerodet, und auf dem neu eingedeckten Dach waren Solarmodule installiert worden. Das Fachwerk verschwand hinter Dämmplatten. Klaudia wusste, dass das alles wahrscheinlich gute Maßnahmen waren, trotzdem passte ihr abgerocktes Haus besser zu ihr. Sie tauchte das Ruderblatt wieder mit mehr Schwung ins Wasser. Die Wolken spiegelten sich im Fließ und Wasserläufer flohen langbeinig vor der flachen Bugwelle.
Als vor Klaudia das Lehder Fließ auftauchte, verlangsamte sie die Fahrt. So kurz vor Ostern waren schon viele Touristenkähne auf den Fließen rund um Lübbenau unterwegs, und Klaudia hatte keine Lust, mit einem zusammenzuprallen. Sie lenkte ihr Kanu vorsichtig ans Ufer. Irgendwo hämmerte ein Specht und ein anderes Tier, wahrscheinlich eine Nutria, glitt ins Wasser. Im letzten Jahr hatte ein Pärchen in der Nähe von Klaudias Haus seine Jungen großgezogen. Vielleicht war das eines ihres Nachkommen. Klaudia legte den Kopf in den Nacken und blickte durch das noch spärliche Laub der Bäume. Sie vermisste den Kleiber, der sonst immer den Wald vor ihr gewarnt hatte. Hoffentlich hatte er den Winter überstanden.
Klaudia zog sich an dem trockenen Schilf vorwärts, bis sie das Lehder Fließ einsehen konnte, dann stieß sie sich wieder vom Ufer ab und tauchte das Paddel ins Wasser. Bevor ihr Kanu wieder Fahrt aufnehmen konnte, tschilpte ihr Smartphone wie eine Horde Spatzen auf Koks. Klaudia legte das Paddel vor sich ab und zog das Telefon aus der Jackentasche.
»Hallo, Peter«, begrüßte sie den Kollegen Demel, für den dieser Klingelton reserviert war.
»Bist du schon zurück?«
»Dir auch einen schönen Tag«, erwiderte Klaudia. »Was ist passiert? Ein Mord?«
»Wie kommst du darauf?«
»Du rufst mich an.«
»Und da denkst du gleich an Mord und Totschlag?« Demel schnaubte.
»Nun«, sagte Klaudia. »Du willst mich ja wohl nicht zum Ostereierfärben einladen?«
»Nicht so wirklich«, räumte Demel ein. »Allerdings hat es mit Ostern schon etwas zu tun.«
»Ich habe Weihnachten und Neujahr Kriminalbereitschaft gemacht«, erinnerte ihn Klaudia. Eigentlich war sie nur für Weihnachten eingeplant gewesen, doch dann hatte es Thangs Zwillingspärchen plötzlich eilig gehabt, und sie hatte seine Silvesterbereitschaft übernommen. Dafür war sie jetzt Patentante. »Und das war nicht vergnügungssteuerpflichtig«, fügte sie vorsichtshalber hinzu.
»Ich weiß.« Demel klang zerknirscht. »Ich würde dich ja auch nicht fragen, aber wo Thang im Mutterschaftsurlaub ist …«
»Das heißt Erziehungszeit«, korrigierte ihn Klaudia. »Und Urlaub ist das bei Zwillingen schon gar nicht.« Sie erinnerte sich an ihre Halbschwestern, die ebenfalls Zwillinge waren.
»Ich könnte das Marathon-Wochenende im April für dich übernehmen«, bot Demel an.
»Ich dachte, da läufst du mit?«
»Du verwechselst mich gerade mit dem Kollegen Rudnik.«
Stimmt, dachte Klaudia. Thang war der Sportler in ihrem Team, der regelmäßig beim Spreewaldtriathlon antrat.
»Das muss ja eine ganz heiße Braut sein«, schnaubte Klaudia. Eigentlich war sie schon fast bereit, dem Kollegen den Gefallen zu tun. Sie hatte Ostern nichts vor. Eine ihrer Halbschwestern hatte mit ihren Kindern in den Spreewald kommen wollen, doch Noah, ihr jüngster Sohn, hatte sich erkältet, und Anna hatte deshalb kurzfristig abgesagt.
»Keine Braut«, versicherte Demel. »Etwas Familiäres.«
»Warum fragst du nicht die Kollegen in Senftenberg?«
»Wer sagt dir, dass ich das nicht getan habe. Keine Chance. Die sind noch unterbesetzter als wir.«
»Also gut.« Klaudia unterdrückte einen Seufzer.
»Du hast was gut bei mir.« Demel klang erleichtert. »Ich sag gleich in der Leitstelle Bescheid. Aber bis jetzt ist alles ruhig.«
»Solange mich niemand zu einem Einbruch in eine Streusiedlung schickt«, murmelte Klaudia. Die Bemerkung war ein Insider und hatte schon einen ziemlich langen Bart. In ihrer ersten Woche in der neuen Dienststelle hatten die Kollegen Klaudia per Kahn zu einem vermeintlichen Einbruch geschickt. Dann war sie allerdings über eine Leiche gestolpert, und der Scherz war ziemlich nach hinten losgegangen.
»Es ist absolut tote Hose«, versprach ihr Demel. »Ach übrigens«, fügte er hinzu. »Meinert hat nach dir gefragt.«
»Was wollte er?« Klaudia spürte das rhythmische Klopfen unterhalb ihres Zwerchfells.
»Hat er nicht gesagt. Bis nächste Woche.«
Bevor Klaudia antworten konnte, war die Leitung tot. Meinert hatte mit ihr sprechen wollen. Sie konnte sich nur vorstellen, dass das mit seinem Unfall zusammenhing. Also doch keine Schlamperei. Klaudia ertappte sich dabei, dass sie mit den Zähnen knirschte. Obwohl sie eine sehr genaue Vorstellung davon hatte, wer damals die Radmuttern an ihrem Wagen gelockert hatte, hatte sie es nie beweisen können. Das ärgerte sie noch heute. Immerhin war der Typ wegen anderer Sachen in den Knast gewandert, und das hatte er Meinert zu verdanken. Leider war er da nicht allzu lange geblieben. Ich muss Uwe fragen, was Fiedler jetzt macht. Als Revierpolizist wusste Uwe fast so viel über die Lübbenauer wie Schiebschick. Unschlüssig drehte sie ihr Smartphone in der Hand. Sie könnte Meinert anrufen. Nein, dachte sie und steckte es ein. Nicht hier. Sie würde ihn anrufen, wenn sie wieder zu Hause war. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass sie Wände und eine Tür für dieses Gespräch brauchen würde.
Stimmen hallten über das Fließ. Klaudia lenkte das Kanu zurück ans Ufer. An dieser Stelle war das Fließ sehr schmal. Ein Kahn glitt an ihr vorbei. Die Kahnführerin tippte sich grüßend gegen die Mütze. Sie trug die grüne Weste des Kleinen Hafens. Schiebschick hatte Klaudia erzählt, dass eine Fährfrau dort jetzt das Team verstärkte. Sie griff nach dem Paddel und stieß sich vom Ufer ab, als ihr Smartphone wieder tschilpte.
»Hast du es dir anders überlegt?«, fragte Klaudia.
»Nein«, antwortete Demel. »Aber da ist gerade was reingekommen.«
4. Kapitel
Mutti ist wieder da. Sie hat Brot mitgebracht und frische Milch. Beides war aus. Den letzten Tag haben sie Margarine mit Zucker und Mehl gegessen. Das schmeckt wie Kuchenteig. Mutti war schrecklich müde und hat sich gleich in ihr Bett gelegt und geschlafen. Männi hat neben dem Bett gesessen und aufgepasst, dass Matte sie nicht stört.
Jetzt ist Mutti wach, aber noch nicht so richtig. Sie sitzt am Küchentisch, Schlafnester auf dem Hinterkopf, die Augen noch ganz schmal und verklebt. Sie steckt sich eine Zigarette an, bläst den Rauch Richtung Küchenlampe. Der Bruder sitzt unterm Tisch, schmiegt sich an ihre Beine. Er ist ganz still. Männi schiebt einen Stuhl an die Spüle, füllt ein Glas mit Leitungswasser und stellt es vor Mutti hin.
»Tee wäre mir lieber«, sagt die, trinkt aber doch und rülpst dann. Männi kichert. Keiner rülpst so laut wie Mutti. Sie ist einfach nur froh, dass Mutti wieder da ist. Sie ist auch froh, dass der Bruder die Milch ausgespuckt hat. Sie wollte ihn nicht vergiften. Sie wird es Mutti sagen. Sie weiß nur noch nicht, wann.
»Hier stinkt’s.« Mutti steht auf und öffnet das Fenster. Kalte Luft strömt herein. »Was habt ihr nur gemacht?«
Der Bruder verhält sich still. Er ist noch klein, aber er weiß natürlich, warum es stinkt.
»Wir hatten kein heißes Wasser«, rechtfertigt sich Männi.
»Ach so«, sagt Mutti und schnippt die Zigarette auf die Straße hinunter. Das macht sie nur, wenn es niemand sieht. Sie will keinen Ärger, sagt sie. Deshalb ist sie auch immer freundlich zu den Nachbarn, auch wenn sie alle für Stasiwichser hält. »War ein bisschen lang diesmal, oder?« Ihre Stimme klingt, als täte es ihr leid. Sie beißt sich auf die Unterlippe. Männi würde sie am liebsten trösten, aber Mutti schlingt jetzt die Arme um sich. Wenn sie das macht, will sie nicht angefasst werden.
»Aber du weißt, dass ich immer zurückkomme.« Mutti wiegt sich in ihrer eigenen Umarmung.
Wieder nickt Männi.
»Hat wer geklingelt oder an die Tür geklopft?«
Männi schüttelt den Kopf.
»Was machst du, wenn jemand klingelt?«
»Nichts«, sagt Männi hastig.
»Du bist ganz still.« Mutti legt einen Zeigefinger an die Lippen. »Weil du meine Große bist.«
Männi nickt wieder.
»Und du Kurzer?« Mutti bückt sich jetzt und hebt die Wachstuchdecke an. Sie nennt Matte immer nur Kurzer, und Männi ist die Große. Der Kurze und die Große. Nur im Hort werden sie bei ihren Namen gerufen, aber das fühlt sich so fremd an, dass Männi manchmal nicht reagiert. Dann heißt es, sie sei verstockt, und sie muss sich in die Ecke stellen und über ihre Verstocktheit nachdenken. Männi hat Mutti gefragt, was verstockt heißt. Mutti war dann böse. Sie will nicht, dass ihre Große und ihr Kurzer im Hort auffallen. Das gibt nur Ärger, sagt sie.
Matte hat die Beine angezogen und nuckelt am Daumen. Wenn das die Erzieherinnen im Hort sehen, schmieren sie ihm extrascharfen Senf auf den Daumen. Mutti bedankt sich dann bei ihnen. In Wirklichkeit ist es ihr egal, wenn er am Daumen nuckelt. Hab ich selbst getan, sagt sie und zeigt ihnen die Schrunden, so nennt sie die raue Haut, die ihre Zähne in den Daumen gefräst haben.
Auch der Bruder schüttelt den Kopf, dabei rutscht ihm der Daumen aus dem Mund.
»Weil«, sagt Mutti und hebt den Zeigefinger, wie es die Erzieherinnen immer tun. »Wenn ihr aufmacht, passiert was ganz Schreckliches.« Schwankend richtet sie sich auf und setzt sich wieder an den Küchentisch. »Und was passiert?«, fragt sie Männi.
»Die holen uns ab und stecken uns ins Heim.«
»Und das wollt ihr doch nicht, oder?«
Jetzt schüttelt Männi so heftig den Kopf, dass ihre Ohren rauschen. Mutti ist im Heim gewesen, und manchmal erzählt sie davon, und dann weint sie und muss von dem Musketierwasser trinken, das im Kühlschrank steht. Obwohl auch Männi und Matte zu den drei Musketieren gehören, dürfen sie nicht aus der Flasche trinken. Aber das ist nicht schlimm. Männi hat es mal probiert. Das Musketierwasser schmeckt scheußlicher als saure Milch, also muss es Medizin sein. Und es hilft Mutti auch.
Sie schmiegt sich an Mutti, und auch ihr Bruder kommt unter dem Tisch hervor. Männi spürt seine Knie in ihren Rippen, aber sie macht ihm keinen Platz.
Mutti ist erst müde und dann fröhlich. Wie immer, wenn sie zurückkommt. Dann hat sie graue Ränder um die Augen, und ihre Stimme klingt auch irgendwie grau. Aber am nächsten Tag ist sie wieder die Mutti, die Männi am liebsten mag. Sie singt und lacht viel und schimpft auch nicht wegen der Matratze, sondern stellt sie einfach nur einen Tag ans geöffnete Fenster. Am Abend hilft Männi ihr, die Matratze wieder auf die Sprungfedern zu wuchten. Mutti sagt, sie dreht sie um, doch auf der anderen Seite ist die Matratze ebenso fleckig. Mutti zeigt ihr auch, wie der Badeofen funktioniert. Damit ihr das nächste Mal Heißwasser habt, sagt sie. Doch Männi will gar nicht an das nächste Mal denken.
Sonntags gehen sie zum Hafen. Im Sommer hilft Mutti da am Gurkenstand vom Kombinat aus, oder sie setzt sich auf eine der Bänke und hält ihr Gesicht in die Sonne. Jetzt im Winter ist der Hafen verwaist. Die Kähne liegen kieloben auf den Wiesen oder sind im Fließ versenkt. Männi und ihr Bruder füttern Enten und rennen um die Wette. Männi friert und ist froh, als sie wieder nach Hause gehen. Im Sommer macht es einfach mehr Spaß. Dann machen die Kahnführer was her, mit den Kapitänsmützen und den blauen Westen, auch wenn sie vielleicht gerade von der Schicht im Kraftwerk kommen. Der Vati von ihrem Bruder ist auch ein Kahnführer, Mutti sagt aber nicht, welcher. Männis Vati sitzt. Mehr weiß sie nicht über ihn, nicht einmal seinen Namen, und eigentlich weiß sie auch nicht, was »sitzen« heißt. Es hat nur irgendwas mit Heim zu tun, so viel hat sie verstanden.
Die Kähne zu beobachten ist manchmal lustig, vor allem, wenn dicke Frauen einsteigen. Manchmal, wenn Gustav am Hafen ist, dürfen Männi und ihr Bruder mit zum Ruhebecken fahren. Er setzt Männi dann seine Kapitänsmütze auf, die ganz warm ist und ihr über die Ohren rutscht. Manchmal lässt er sie auch das Rudel halten. Das ist sehr schwer und sehr nass. Männi mag es eigentlich überhaupt nicht anfassen, traut sich aber nicht, das zu sagen, weil Gustav so nett ist. Ihr Bruder freut sich immer, wenn er das Rudel halten darf. Wenn er groß ist, will er Fährmann werden. Dann lacht Gustav, und Männi hat Mutti gefragt, ob er Mattes Papa ist. Aber die hat nur gelacht. Viel zu alt sei der, hat sie gesagt, und das hat Männi nicht verstanden, weil: Alle Erwachsenen sind alt.
Auch wenn Gustav nicht am Hafen ist, macht es Spaß, dort zu sein. Oft kriegt man was geschenkt. Meistens nur Bonbons oder saure Drops aus dem Konsum, die Männi nicht so gerne mag, doch manchmal sogar Westgeld. Weil: Wegen der Kähne kommen Leute aus dem Westen. Und denen sitzt das Geld locker in der Tasche, sagt Mutti. Männi erkennt sie sofort. Sie sind anders angezogen, und irgendwie riechen sie auch anders. Außerdem sind sie die Einzigen, die die Gurken kaufen, dabei sind sie am Hafen viel teurer als im Konsum. Mutti spricht gerne mit denen aus dem Westen. Vor allem mit den Onkeln. Wenn sie mit denen spricht, klingt ihre Stimme so, als würde sie ein Kätzchen locken.
Einer kommt immer wieder. Er ist Busfahrer, sagt Mutti. Wenn er da ist, geht sie oft mit ihm weg. Dann weiß Männi, dass sie am Hafen bleiben müssen, bis Mutti zurückkommt.
Aber er kommt nur im Sommer. Er ist größer als die anderen Männer, und sein Bauch wölbt sich über seinem Hosenbund. Er trägt eine Sonnenbrille und eine von diesen Männertaschen ums Handgelenk, wie sie nur Wessis tragen.
Männi wird das Herz schwer, wenn Mutti mit ihm geht. Sie schämt sich. Weil: »Die Wessis sind doch der Klassenfeind.«