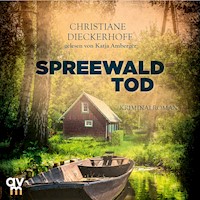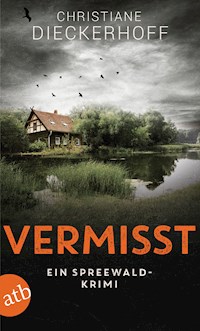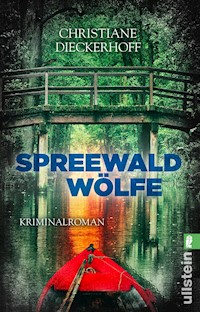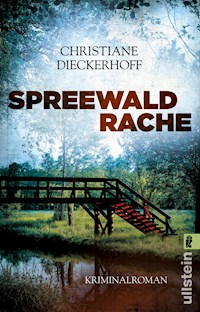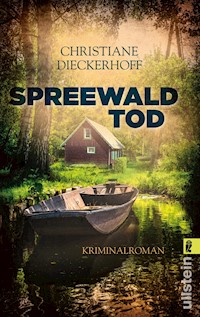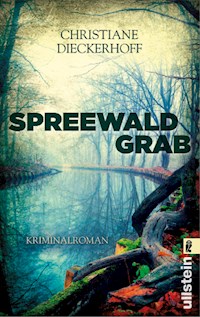5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter, die ihre Tochter zurücklässt – und eine Tochter auf der Suche nach ihrer Mutter. Eine Geschichte aus dem deutschen Herbst. Für alle Leser:innen von Susanne Abel und Carmen Korn
»Meiner Mutter?«, fragte Rabea fassungslos und sah hinüber zu Gabi, die sie mit besorgten Blicken musterte. »Aber …« »Ich rede nicht von Gabi Tenwinkel.« Schon wieder beendete Stolte ihren Satz. Das war schon schlimm genug, aber schlimmer noch war das Mitleid in seinem Blick. »Aber Sie haben doch …« Rabea starrte ihn an und ihr Magen verwandelte sich in einen Eisklotz.«
Bei der Beerdigung ihres Vaters erfährt Rabea von einem Journalisten, dass ihre Mutter nicht ihre leibliche Mutter ist. Zunächst glaubt sie ihm nicht, doch ein Gespräch mit ihrer Mutter nährt ihre Zweifel und sie bringt ihre Ziehmutter schließlich dazu, ihr die Wahrheit zu sagen. Ihre Mutter ist Veronika Maibohm, eine international gesuchte Terroristin der RAF. Schritt für Schritt folgt Rabea der Spur ihrer Mutter. Sie trifft Weggefährten ihrer Mutter, erfährt mehr über ihren Vater und identifiziert sich zunehmend mit ihren Eltern. Wie konnte aus der engagierten Gymnasiastin Veronika eine international gesuchte Terroristin werden und warum ließ sie ihre Tochter zurück?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Dieses Werk wurde gefördert mit einem Stipendium der VG WORT im Rahmen von NEUSTART KULTUR.
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Meine fremde Mutter« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Birgit Förster
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Alexa Kim »A&K Buchcover«
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Epilog
Geschichtlicher Rahmen
Danksagung
Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Vorwort
Nach dem viel zu frühen Krebstod meines Mannes wuchs in mir der Wunsch, unser gemeinsames Leben zu reflektieren. Vor allem, weil mein Mann zeit seines Lebens fest davon überzeugt war, unser Zusammentreffen habe sein Leben gerettet. Vielleicht war das zu düster gedacht, doch sicher ist, dass sein Leben einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn er nicht Ende der Siebzigerjahre sein Studium aufgegeben hätte und ins Ruhrgebiet zurückgekehrt wäre. In dieser Phase seines Lebens sind wir uns begegnet: in einer Kneipe, um genau zu sein. Er hat mich gefragt, ob ich immer so mürrisch aussehen würde, und wir sind ins Gespräch gekommen. Damals hat keiner von uns gedacht, dass unsere Unterhaltung über vierzig Jahre andauern würde. Mein Mann war kein Terrorist, aber er war ein Linker und hat viele Jahre seines Lebens mit Widerstandsgruppen sympathisiert. In seinem Nachlass fanden sich neben Briefen mit solidarischen Grüßen und der Bitte, noch den ausstehenden Anteil der Nebenkostenabrechnung zu bezahlen, auch die »Mao-Bibel« und Ausgaben der Kommunistischen Volkszeitung. Beides hat ihn geprägt, aber nicht beherrscht. Dieses Buch enthält viel aus unserem gemeinsamen Leben und dem Leben von Freunden und Bekannten, die bereitwillig ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben. Wir haben uns gefragt: Was wäre gewesen, wenn? Was hat Menschen aus unserem Umfeld radikalisiert? Warum ist uns das nicht passiert? Die Figuren in diesem Buch sind ebenso fiktiv wie die Handlung. Trotzdem gab es die Demonstrationen und die Auseinandersetzungen mit der Polizei, die auch uns geprägt haben. Die blutigen Sonntage sind keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Die Schüsse, denen drei Polizisten an der Startbahn West zum Opfer fielen, sind gefallen, auch wenn sie nichts mit meiner Protagonistin zu tun hatten.
Ich war siebzehn, als ich meinen Mann kennenlernte: ein bisschen vorlaut, mit einem ausgeprägten Unbehagen gegenüber Ungerechtigkeiten.
Mein Mann war fünfundzwanzig, sprach sechs Sprachen und hatte das gleiche Gerechtigkeitsempfinden. Doch im Gegensatz zu mir hatte er Erklärungen und Worte. Natürlich habe ich ihn bewundert, doch das war nicht die Basis unserer Beziehung. Er hat mir geholfen, meine eigenen Worte zu finden, auch wenn sie nicht die seinen waren. Wir haben es mal besser, mal schlechter geschafft, mit unseren Widersprüchen zu leben. Das war nicht immer einfach, aber es war immer die Mühe wert. Wir haben zwei wunderbare Kinder, die vielleicht zu früh gelernt haben, zu argumentieren. Aber wer sagt, dass das Leben immer leicht ist? Doch es ist immer lebenswert, wenn man liebt und geliebt wird. Ich hoffe, auch das zeigt dieses Buch.
1. Kapitel
2019
Rabea kannte sich aus mit Schmerz, auch wenn ihre eigenen Erfahrungen sich auf einen entzündeten Blinddarm und eine Mittelohrentzündung beschränkten. Doch durch ihre Arbeit im Frauenhaus hatte sie so viele Verletzungen gesehen, dass sie schon anhand der Körperhaltung sagen konnte, wo die Wut des Mannes eingeschlagen hatte. Selten war es so offensichtlich wie ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe. Meist versteckten sich die Prellungen und Brandwunden unter langärmeligen Shirts. Die Frauen taten alles, um den Schein zu wahren, doch ihre Körperhaltung verriet sie.
Also wusste Rabea, dass die Frau, die ihr gegenüber am Küchentisch saß, zumindest geprellte, wenn nicht sogar gebrochene Rippen hatte. Solche Verletzungen entstanden, wenn die Frauen bereits am Boden lagen. Rabea musterte die Frau mit den akkurat gezupften Augenbrauen und dem tränenverschmierten Lidschatten. Sie kannte ihre Geschichte, sie war nicht zum ersten Mal hier: Einzige Tochter, Studium, Jugendliebe geheiratet, Haus gebaut, Kinder bekommen. Alles geplant, keine Sorgen. Leben auf der Sonnenseite. Dann die erste Ohrfeige: ein Ausrutscher. Erschrecken, verzeihen, die Schuld bei sich suchen. Danach lange nichts und dann immer wieder. Irgendwann ballten sich die Finger zur Faust und die Frauen unterdrückten ihre Schreie, damit die Kinder nicht wach wurden. Was blieb, war die Scham, weil man auf einmal zu denen gehörte. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Rabea unterdrückte einen Seufzer. Es dauerte lange, bis die Frauen verzweifelt genug waren, ins Frauenhaus zu kommen.
Die Frau nippte an ihrem Kaffee. Er war stark und süß. Ein altbewährtes Mittel gegen den Schock. Ihre Kinder lagen im letzten freien Zimmer. Obwohl es ein Etagenbett war, hatten sie sich ins untere Bett gezwängt: aneinandergekuschelt, verängstigt. Wieder einmal aus ihrem Leben herausgerissen. Der Junge war sechs, das Mädchen vier. Bilderbuchkinder einer Bilderbuchfamilie. Vater Lehrer, Mutter Lehrerin. Ideale Voraussetzungen, um den Absprung zu schaffen, und trotzdem war die Frau zu ihrem Mann zurückgekehrt.
Kinder brauchen ihren Vater, hatte sie gesagt. Und auch jetzt sagte sie es wieder.
»Kinder brauchen doch ihren Vater.« In ihrer Stimme schwang die Bitte um Bestätigung mit.
»Kinder brauchen Liebe und Sicherheit«, entgegnete Rabea. Es war nicht ihr Job, die Frauen darin zu bestärken, in toxischen Beziehungen zu bleiben.
»Aber er liebt seine Kinder, wirklich.« Mit jedem Wort wurde die Stimme der Frau atemloser. So als würde sie durch die Sätze hasten, um nicht über ihre Worte nachdenken zu müssen. »Er würde ihnen nie etwas antun.« Ihr Blick klebte jetzt geradezu an Rabea, so sehr wünschte sie sich Bestätigung. »Und er liebt auch mich. Aber wenn er getrunken hat, da ist dann diese Wut in ihm.«
»Ich weiß.« Rabea unterdrückte ein Seufzen. Sätze, die mit dem Wörtchen »aber« anfingen, nahmen selten ein gutes Ende. »Warst du beim Arzt?«
»Nein!« Unwillkürlich griff sich die Frau an die Rippen.
»Ich kann dir was gegen die Schmerzen geben«, bot Rabea an. Das war zwar gegen die Vorschriften, schließlich waren sie keine Ärzte, doch es blieben immer Medikamente in den Zimmern zurück, wenn die Frauen auszogen. Irgendwie ließ die Hoffnung auf ein besseres Leben sie die Schmerzmittel vergessen. Selbst wenn sie zu ihren Ehemännern zurückkehrten.
»Warum konnte ich nicht einfach die Klappe halten.« Die Frau griff sich in die Haare, zuckte zusammen. Wahrscheinlich waren ihre Fingerspitzen auf eine Beule gestoßen. »Ich weiß doch, wie er ist, wenn er getrunken hat. Ich hätte mich schlafend stellen sollen.«
»Wie sonst immer?« Diese Replik war nicht hilfreich, war es nie. Doch manchmal verlor Rabea ihre professionelle Distanz, und dann war sie wütend: auf die Männer, die ihre Frauen schlugen, und auf die Frauen, die sich daran die Schuld gaben.
»Zumindest hat es funktioniert«, fauchte die Frau. Die Wut, die sie nicht gegen ihren Mann richten konnte, richtete sich gegen Rabea. Niemand bekam gerne den Spiegel vorgehalten. Die Schultern der Frau sackten nach vorn. »Was soll ich denn machen?«, murmelte sie und putzte sich die Nase.
»Komm erst einmal zur Ruhe«, sagte Rabea. »Und dann sehen wir weiter.«
»Die Kinder hassen es, hier zu sein.« Für einen Moment bettete die Frau den Kopf auf ihre auf dem Tisch liegenden Unterarme. Ihre Stimme klang undeutlich. »Sie wollen zu ihrem Papa.«
»Sie sind noch so klein.«
»Was soll ich nur tun?« Die Frau hob den Kopf. Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Wir reden morgen weiter.« Rabea stemmte sich in die Höhe.
»Es ist bereits morgen«, murmelte die Frau nach einem Blick aus dem Fenster. »Der Tag danach«, fügte sie nachdenklich hinzu. »Das ist das Komische daran, obwohl es nicht zum Lachen ist: Deine Welt zerbricht, und das Leben geht einfach weiter. So, als spiele es überhaupt keine Rolle.«
»Hier spielt es eine Rolle.« Rabea griff nach ihrer Kaffeetasse und trank den letzten Schluck. Unwillkürlich schüttelte sie sich. Der Kaffee war kalt und bitter. Sie stellte die Tasse in die Spüle und blieb hinter der Frau stehen, musterte ihren Hinterkopf. Eine Woge von Vergeblichkeit rauschte über Rabea hinweg. Die Frau würde wieder und wieder zu ihrem Mann zurückgehen und sich so lange verprügeln lassen, bis die Kinder aus dem Haus waren, und die beiden würden ihr Leben lang darunter leiden. Vielleicht würde der Junge, der jetzt noch schüchtern und hilfsbereit war, selbst zum Schläger werden. Und das Mädchen vielleicht wieder zur geschlagenen Ehefrau. Jede Familie war ihre eigene Hölle und verheimlichte das, bis es nicht mehr ging. Und wenn man an einem Ort wie diesem arbeitete, tat man gut daran, seine eigene Hölle zu kennen. Rabea wusste, dass sie im Vergleich zu den Kids hier eine glückliche Kindheit gehabt hatte. Trotzdem trug auch sie Verletzungen mit sich herum. Als Tochter eines überzeugten Linken, der diesem Staat und seinen Institutionen misstraute, hatte sie sich zwischen ihrem Vater und der Welt, in der sie lebte, aufgerieben. Immer sollte sie die Beste sein, jedoch auf keinen Fall Karriere machen. Schließlich hatte sie Sozialarbeit studiert. Nicht die schlechteste Berufswahl, wie sie fand. Und dann hatte sie Marvin kennengelernt. Sie war gerade Mitte zwanzig gewesen, als sie sich in ihn verliebt hatte. Marvin lebte im eigenen Haus, träumte von einer Hochzeit in Weiß und war zu allem Überfluss auch noch Polizist in zweiter Generation. Marvin war also alles, was ihr Vater verachtete. Deshalb hatte sie ihre Beziehung lange verheimlicht und sich selbst eingeredet, dass es ihre Eltern nichts anging, mit wem sie schlief. Doch als Marvin und sie dann zusammenzogen, hatte sie ihren Eltern von ihm erzählt. Nur seinen Beruf hatte sie ihnen verschwiegen. Er sei Beamter, hatte sie gesagt, das war nah genug an der Wahrheit. Marvin war gegen diese Lüge gewesen, doch er hatte sich gefügt. Wir sagen es ihm, wenn er dich besser kennt, hatte sie versprochen. Zwei Jahre war das jetzt her, und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde es schwieriger, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen. Marvin und er hatten sich miteinander arrangiert. Sie waren nicht unbedingt Freunde geworden – das würden sie niemals sein –, doch da beide gerne Doppelkopf spielten, konnten sie miteinander umgehen, ohne sich allzu sehr in die Haare zu geraten.
Flirrendes Blaulicht brachte Rabea zurück in die Gegenwart. Zurück in die gemütliche Wohnküche, zu der Frau mit den Schmerzfalten in den Mundwinkeln.
»Was wollen die denn hier?« Die Stimme der Frau klang schrill.
Wovor hatte sie Angst? Hatte sie sich gewehrt? Lag ihr Mann tot in ihrer Küche? Nein, dachte Rabea. Diese Frau nicht. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die sich wehrten. Sie gehörte auch nicht zu den Frauen, bei denen zuerst die Sicherungen durchbrannten, die ihre Partner ohrfeigten, ihnen das Gesicht zerkratzten oder mit Gegenständen nach ihnen warfen und sich dann wunderten, wenn die Gewalt eskalierte. Sie gehörte zu den Frauen, die wegliefen. Immer wieder.
»Nichts«, sagte Rabea, als das Blaulicht in der Nacht verschwand. »Sie sind nur vorbeigefahren. Geh schlafen.« Sie legte der Frau die Hände auf die Schultern, zog sie aber zurück, als die Frau zusammenzuckte.
Rabea saß im Büro des Frauenhauses und spielte Jewel Quest auf ihrem Handy. Sie war zu müde, um etwas Sinnvolles zu tun. Zu müde, um nach Hause zu fahren. Sie griff in die Papiertücherbox, die für Notfälle bereitstand, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Vielleicht sollte sie sich das Notbett beziehen und hier schlafen. Marvin war sowieso nicht zu Hause. Er hatte Nachtdienst. Im Hof sprang der Bewegungsmelder an und tauchte die Einfahrt in gleißendes Licht. Rabea blickte von ihrem Spiel auf. Ein Polizeiwagen rollte in den Hof. O nein, dachte sie. Wer jetzt noch kam, musste im Notbett oder, wenn es eine Familie war, im Wohnzimmer schlafen. Das war für niemanden schön, am wenigsten für jemanden, dessen Welt gerade zusammengebrochen war. Widerwillig stemmte sich Rabea in die Höhe und öffnete die Eingangstür. Warme Luft wehte ihr entgegen. Sie brachte den Duft von nassem Gras mit sich. Zu ihrer Überraschung stieg Marvin aus dem Polizeiwagen. Sofort schlug Rabeas Herz schneller. Was wollte er hier? Er kam auf sie zu. Die Ärmel hochgekrempelt, die Daumen in den schweren Gürtel eingehakt. Kein Lächeln im Gesicht.
»Was ist passiert?« Rabea verschränke die Arme vor der Brust: ein Schutzschild.
»Gabi hat mich angerufen.« Marvin schloss sie in die Arme.
Rabea atmete seinen Geruch nach Schweiß und dem Deo ein, das er immer benutzte.
»Warum? Was ist los?« Sie stemmte die Hände gegen seine Brust, schaute ihm in die Augen, sah die feinen Fältchen in seinen Augenwinkeln, die Sorge in seinem Blick.
»Dein Vater«, sagte Marvin.
»Was ist mit ihm?« Rabeas Augen füllten sich mit Tränen, und sie dachte in einer Endlosschleife: Bitte nicht!
2. Kapitel
Nika, November 1989
Fröstelnd schob sich Nika ein Pfefferminzbonbon in den Mund. Noch war es dunkel und so kalt, dass ihre Zähne schmerzten. Trotzdem schwitzte sie. Ihr Hals kratzte, und sie fühlte sich ein bisschen fiebrig. Seit Tagen hatte sie nicht mehr richtig geschlafen. Die langen Diskussionen, die machten, dass ihr Kopf gleichzeitig schmerzte und auf Hochtouren lief, waren nicht gerade schlaffördernd. Trotzdem war sie hellwach: bis in die Haarspitzen voller Adrenalin. Ein ziehender Schmerz im Rücken. Vor Schreck zerbiss sie das Bonbon. Das Funkgerät in ihrer Jackentasche knisterte, und Nika vergaß den Schmerz. Sie verschluckte sich an den Bruchstücken des Pfefferminzbonbons, hustete, spürte, wie ihr Slip feucht wurde, dabei hatte sie nicht einmal das Gefühl, pinkeln zu müssen. Sie spuckte die Bröckchen im hohen Bogen auf die Straße, und der Dackel schnüffelte daran. Jetzt nur keinen Fehler machen, nur nicht versagen. Ab jetzt hing die ganze Aktion von ihr ab.
Nika zog den Dackel mit sich und ging hinüber zu der Stelle, an der Batterie und Kabel versteckt waren. Miteinander verbunden, würden sie die Lichtschranke mit Strom versorgen. Ihre Beine zuckten, wollten rennen, aber sie wusste, dass sie genügend Zeit hatte, also schlenderte sie. Nika wirkte unbeteiligt, eine müde junge Frau im Jogginganzug, die ihren Dackel Gassi führte.
Der erste Wagen rauschte an ihr vorbei, passierte das Kinderfahrrad. Sie bückte sich, als wolle sie ihren Schuh zubinden, und griff nach den losen Drahtenden, die aus dem Gebüsch herausragten. Der zweite Wagen tauchte aus der Sackgasse auf. Nikas Finger zitterten. Sie starrte auf das Kinderfahrrad, das am Geländer lehnte. Zum dritten Mal hatten sie es dort hingestellt. Wenn es heute nicht klappte, würden sie die Aktion abblasen müssen. Es war eh schon ein Wunder, dass noch niemand Verdacht geschöpft hatte. Sie legte das Bekennerschreiben, in dem sie als »Kommando Wolfgang Beer« die Verantwortung für die Hinrichtung des Chefs der Deutschen Bank übernahmen, unter einen Stein und verband die Drahtenden mit der Batterie. Sie hätte es im Schlaf gekonnt. Die Zeichnung der Konstruktion hatte sich in ihr Hirn gebrannt. Nika richtete sich auf. Für einen Moment war da wieder dieser Schmerz im Rücken, außerdem drehte sich die Welt um sie. Dann war es vorbei, und sie zerrte den Dackel hinter sich her. Nur weg hier. Alles in ihr wollte wegrennen, doch sie zwang sich, normal weiterzugehen. Der Dackel lief auf ein Stück Wiese, drehte sich im Kreis. Nika zog ihn weiter. Verständnislos stemmte er sich gegen den Zug der Leine. Die Detonation ließ Nika zusammenfahren. Ihre Zähne schlugen aufeinander. Warme Nässe lief ihre Beine hinunter, dampfte in der morgendlichen Novemberluft. Der Dackel zerrte jetzt an der Leine: jaulend, den Schwanz zwischen die Hinterbeine geklemmt. Nika ließ die Leine fallen. Sie hatte nicht mehr die Kraft, sie zu halten, starrte auf die nassen Flecken, die sich auf ihren Hosenbeinen ausbreiteten. Weitergehen, nicht stehen bleiben, wusste der im Guerillakampf geschulte Teil ihres Gehirns, nur ihre Beine konnten damit nichts anfangen. Sie zitterten, fühlten sich an, als seien sie unter Strom gesetzt. Das durchdringende Heulen von Sirenen brachte Nika zurück in die Wirklichkeit. Fast mechanisch stieg sie in den Fluchtwagen, der am Straßenrand parkte.
Ob alles geklappt habe, fragte Ringel und setzte den Blinker. Kein Auto kam ihnen entgegen, dafür hatten die Genossen gesorgt.
Nika drehte sich um. Sah den Wagen, den Fahrer, der aus dem Wagen taumelte. Desorientiert, blutend. »Ja.« Ihre Stimme war ein Fiepsen, fast so schrill wie das Jaulen des Dackels.
Ob sie sich in die Hose gepisst habe? Ringels Stimme klang spöttisch.
»Sieht so aus.« Nika starrte auf ihre nassen Hosenbeine. Ihre Zähne klapperten vor Kälte, und ihr Rücken schmerzte wieder. Wollte ihr Körper sie bestrafen? Am liebsten hätte Nika sich die Hose vom Leib gerissen, doch daran war nicht zu denken. Was war sie nur für ein bourgeoises Weichei?
»Muss ein Scheißgefühl gewesen sein.«
Ringels Verständnis traf Nika unvorbereitet. Sie hatte die Lichtschranke aktivieren wollen und war sauer gewesen, als die Genossen sich für Nika entschieden. Dabei war der Grund für diese Entscheidung wenig schmeichelhaft: Nika war das schwache Glied in der Kette. Sie hatte zwar ein fotografisches Gedächtnis, aber nicht die Nerven, einen Fluchtwagen zu steuern. Also war es ihr zugefallen, die Lichtschranke zu aktivieren. Es war der einfachste Job gewesen.
»Ein Schwein weniger.« Nika biss sich auf die Unterlippe. Der Satz fühlte sich falsch an. Aber wenn es nicht richtig war, was sie hier taten, was blieb ihr dann? Sie konnte nicht zurück. Wieder zog es in ihrem Rücken: drängender, schmerzhafter. Nika fummelte eine Zigarette aus der Packung, doch nach dem ersten Zug wurde ihr schlecht. Sie kurbelte das Fenster herunter und warf die Zigarette aus dem Seitenfenster.
»Du bist zu weich«, sagte Ringel. Ein ständiger Streitpunkt zwischen ihnen. »Trotzdem«, fügte sie hinzu. »Du hast deine Sache gut gemacht.«
»Halt an!« Nika presste die Hand vor den Mund. Ihr Bauch zog sich zusammen, füllte ihren Mund mit Magensäure.
Ringel bremste und lenkte den Wagen an den Straßenrand. Sie fluchte und wollte wissen, was mit Nika los sei. »Nicht schon wieder«, brachte Ringel zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. »Mach jetzt nicht schlapp.« Hinter ihnen hupte es. Auf der Gegenfahrbahn rasten Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn an ihnen vorbei. Nika stieß die Beifahrertür auf und erbrach sich in den Rinnstein.
»Scheiße«, sagte Ringel, als Nika sich mit schweißnassem Gesicht zurücklehnte. »Du hast dich nicht bepisst.« Ringel war blass, ihre Stirn gerunzelt. Sie legte die Hand auf Nikas Oberschenkel. Auf einmal war ihre Stimme weich, fast fürsorglich, und passte so wenig zu der Ringel, die Nika kannte, dass es schmerzte. »Das ist …«
»Nein.« Nika schlug die Hand weg. Sie wollte nicht hören, was Ringel sagte.
Doch eine Stimme konnte man nicht einfach so wegschlagen. Vor allem, wenn es nicht die eigene war.
3. Kapitel
Auch wenn es eine Plattitüde war, stimmte es tatsächlich, Rabea dachte an die Worte der Frau, mit der sie in der letzten Nacht ihres alten Lebens am Küchentisch gesessen hatte – deine Welt bricht auseinander und trotzdem ist alles wie bisher. Die Sonne geht auf, die Müllabfuhr leert klappernd die Tonnen, Nachbarn holen die Zeitung rein und decken den Frühstückstisch auf der Terrasse. Ein Flugzeug zieht einen Kondensstreifen hinter sich her. Zu hoch, um das Brummen der Motoren über dem Rauschen der Autos zu hören, die als stetiger Strom über die nahe gelegene Bundesstraße fuhren. Im Garten tschilpten Spatzen, Tauben gurrten. Alles wie immer. Nur in ihr selbst war alles anders.
Rabea saß in ihrem Wohnzimmer, blickte hinaus in den Garten und fühlte nur Leere in sich. Sie trug das Sommerkleid, das ihre Eltern ihr einmal aus einem Spanienurlaub mitgebracht hatten, kein Schwarz. Ihr Vater hätte es nicht gewollt. Er hätte wahrscheinlich auch die Beerdigung so nicht gewollt. Aber eine Beerdigung war für die Lebenden, nicht für die Toten. Also hatten sie alles so gemacht, wie ihre Mutter es gewollt hatte. Sie war immer die Konventionellere gewesen. Ihr Vater hatte sie seinen Anker genannt und behauptet, dass er ohne sie wahrscheinlich schon lange tot gewesen wäre. Rabea hatte gedacht, das sei die romantischste Liebeserklärung, die ein Mann seiner Frau machen konnte. Aber als sie älter wurde, hatte sie begriffen, dass es ihre Geburt gewesen war, die dieses andere Leben unmöglich gemacht hatte. Und auch wenn Rabea nur eine sehr verschwommene Vorstellung von diesem anderen Leben hatte, fühlte sie sich doch schuldig. Und nun war ihr Vater tot, und sie konnte nicht mehr mit ihm darüber sprechen. Sie griff nach einem Taschentuch und schnaubte sich die Tränen aus der Nase: Papa ist tot. Drei Worte, ein Satz. Ein Schlussstrich. Geschichten endeten anders. In Märchen hieß es: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die entscheidenden Worte waren »Und wenn«. Peter war gestorben, einfach so. Der Tod hatte ihn aus dem Leben gerissen. Was für eine Phrase und doch so wahr.
Marvin hatte Rabea vom Frauenhaus direkt ins Krankenhaus gebracht.
Ein Pfleger zeigte ihnen den Weg. Vorbei an verschlossenen Türen und gelben Schildern, die vor nassen Fußböden warnten. Neonröhren, gleißendes Licht, klackernde Schritte. Ihre hell, Marvins dunkel. Der Pfleger drückte auf einen Schalter, und eine Tür glitt lautlos vor ihnen auf.
Rabeas Vater lag noch in dem gekachelten Raum, in dem die Ärzte vergeblich versucht hatten, ihn wiederzubeleben. Auch wenn jemand aufgeräumt zu haben schien, stieß Rabeas Fuß gegen eine Plastikverpackung. Gabi stand über Peter gebeugt, strich ihm die Haare aus der Stirn, sprach leise mit ihm, als wollte sie ihn nicht wecken.
Als Rabea ihre Mutter ansprach, blickte Gabi auf, die Augen weit aufgerissen, trocken. Kurz streifte ihr Blick Marvins Uniform, unwillkürlich trat Rabea zwischen sie und Marvin. Sie schämte sich auf einmal schrecklich. Wieso hatte sie ihren Eltern nie gesagt, dass er Polizist war? Wieso musste Gabi es in dieser Situation erfahren?
Peter habe nur ein Glas Wasser trinken wollen, sagte Gabi. Sie schien Marvins Uniform überhaupt nicht wahrzunehmen. Und als er nicht zurückkam, sei sie in die Küche gegangen. Ihre Stimme klang flach, als läse sie die Worte von einem Zettel ab.
Am Tisch habe er gesessen, den Kopf auf den Unterarmen, so als sei er im Sitzen eingeschlafen, aber er habe nicht geschlafen, und sie habe die Rettung gerufen.
Ihre Mutter trat zur Seite, und Rabea sah das Gesicht ihres Vaters, die etwas wirren Locken, die sie geerbt hatte und die erst an den Schläfen grau wurden. Augen und Wangen wirkten eingefallen, die Haut so grau wie sein Bart. Rabea strich ihm über die Stirn, die Haut war so kalt und fühlte sich überhaupt nicht mehr an wie Haut. Eher wie … Rabea fiel kein Vergleich ein.
Er habe nichts gespürt, sagen die Ärzte. Ihre Mutter lehnte die Stirn gegen Rabeas Schulter. Eigentlich ein schöner Tod, fügte sie hinzu. Nur zu früh. Ihre Stimme: ein Schrei. Es ist zu früh. Ein Schluchzen gurgelte aus ihrer Kehle, als habe es nur auf den ersten Riss in Gabis Selbstbeherrschung gewartet.
Rabea schlang die Arme um den Körper der Mutter. Nun gibt es nur noch dich und mich, dachte sie. Kein Peter mehr, der überall Tabakkrümel verstreute, kein Peter mehr, der die Nachrichten kommentierte und einem die Welt erklärte. Kein Peter mehr, der Hühnersuppe kochte, wie nur er sie kochen konnte. Kein Peter mehr, der mit ihrer Mutter im Arm in der offenen Haustür stand und ihr nachwinkte. Adam und Eva. Tristan und Isolde. Peter und Gabi. Rabea konnte den einen nicht ohne die andere denken. Nicht die Mutter ohne den Vater. Aber besser so als andersherum. Der Gedanke kam aus der Ecke ihres Gehirns, die kleine hässliche Gedanken produzierte. Und es nützte auch nichts, dass Rabea sich für diesen Gedanken hasste. Kleine hässliche Gedanken nahmen keine Rücksicht auf Gefühle. Sie waren einfach da, konfrontierten einen mit dem ebenso kleinen und hässlichen Selbst. Eine Welt mit ihrer Mutter, doch ohne ihren Vater war schlimm. Eine Welt ohne ihre Mutter, dafür aber mit ihrem Vater war schlichtweg undenkbar. Immer war Gabi der Prellbock zwischen ihr und Peter gewesen, hatte vermittelt, Brücken gebaut, Standpunkte angenähert und Geheimnisse bewahrt.
Weinend lagen sie sich in den Armen, bis Marvin sich räusperte. Er stand in der Tür. Gerade weit genug weg, um ihrer Trauer Raum zu geben, und nah genug, um einfach da zu sein. Eine Frau und ein Mann standen neben ihm.
Dass es ihnen leidtäte, sagten sie, und dass sie von der Kriminalbereitschaft seien.
Nebelzeit: erlebt, erlitten. Rabea stopfte das Taschentuch zu den anderen, die bereits die aufgesetzte Tasche des Sommerkleides ausbeulten. So viele Tränen. Rabea weinte um den Verlust ihres Vaters, den Verlust ihrer Kindheit, und sie weinte darum, dass sie ihm nicht die Wahrheit über Marvins Beruf gesagt hatte. Dass sie nie den Mut gefunden hatte, dass es überhaupt Mut gebraucht hatte.
In dem Moment, in dem die beiden Kriminalbeamten neben Marvin gestanden hatten, hatte ein Teil von Rabea die Wut ihres Vaters geteilt. Der andere Teil hatte gewusst, dass die beiden ihnen kein Unrecht antaten, dass sie nichts zu fürchten hatten, dass das Schlimmste ja bereits geschehen war. Die beiden taten nur ihre Pflicht, und sie taten es so schonend wie möglich.
Mittlerweile hatten sie das staatliche Misstrauen, das jeder plötzliche Todesfall hervorrief, überstanden, Peters Leiche war eingeäschert, und heute war die Beisetzung. An deinem Quasi-Namenstag hatte Gabi gesagt. Und dass das Peter gefallen hätte.
Rabea war es egal. Sie hatte kein Verhältnis zu ihrem zweiten Vornamen Gudrun. Und somit auch nicht zu ihrem Quasi-Namenstag, dem 25. August. Gudrun Ensslins Geburtstag. Sie feierte lieber ihren eigenen, als den einer toten Terroristin. Und irgendwie passte es, weil mit Peters Tod auch die Familientradition des Quasi-Namenstages gestorben war. Weder Rabea noch Gabi würden sie weiterführen. Sie würden andere Traditionen entwickeln. Traditionen, zu denen auch dieser Tag gehören würde.
»Bist du so weit?« Marvins Gestalt spiegelte sich in der Wohnzimmerscheibe. Er trug einen dunklen Anzug. Von ihnen beiden war er der Konventionellere, so wie ihre Mutter immer die Konventionellere gewesen war. Geschichte wiederholte sich halt doch irgendwie.
»Ja.« Rabea stand auf und strich den Rock glatt.
»Vielleicht solltest du ein paar Taschentücher hierlassen.« Marvin streckte die Hand aus. »Du wirst Platz in den Taschen brauchen.«
»Danke.« Rabea drückte ihm die gebrauchten Tücher in die Hand. Er nahm sie ihr ab, wie er ihr alles in den letzten Tagen abgenommen hatte.
»Ich habe Vorrat eingesteckt.« Er klopfte sich auf die Anzugjacke. »Sollen wir Gabi abholen?«
»Wir treffen sie auf dem Friedhof.«
»Wird eine größere Sache, was?«
»Peter hatte viele Freunde.« Rabea dachte an die Kondolenzbriefe aus aller Welt, die oft mit der Floskel »Solidarische Grüße« unterzeichnet gewesen waren.
»Eher Genossen, oder?« Auch Marvin hatte die Kondolenzschreiben gelesen.
»Du weißt, wie er war.« Rabea rieb sich die Schläfen. Sie hatte das Gefühl, Peter verteidigen zu müssen.
An Marvins Seite verließ Rabea das Haus, in dem sie seit zwei Jahren gemeinsam lebten. Es war ihr nicht leichtgefallen, zu ihm zu ziehen. Sie hatte ihre kleine Wohnung in der Stadt gemocht, aber schließlich hatte die Vernunft gesiegt. Ihre Wohnung war zu klein und das Haus abbezahlt. Das hatte sogar ihren Vater überzeugt. Immerhin heiratet ihr nicht gleich, hatte er gesagt, und als Rabea ihm den Spiegel vorgehalten hatte, immerhin waren ihre Eltern verheiratet, hatte er geantwortet, das hätten sie nur wegen ihr gemacht, weil es damals noch kein gemeinsames Sorgerecht gegeben habe. Unwillkürlich seufzte Rabea. Sie hatte diese Diskussionen gehasst, jetzt würde sie alles tun, um nur noch einmal seine Stimme zu hören.
»Du schaffst das.« Marvin klemmte sich hinters Steuer und lenkte den Wagen aus der Einfahrt.
»Ich wünschte, es wäre schon vorbei.«
»Da sind wir schon zu zweit. Und Rabea?« Marvin räusperte sich. »Wenn das alles vorbei ist, würde ich gerne mit dir über unsere Zukunft sprechen. Nicht sofort«, fügte er hastig hinzu. »Aber bald.«
»Ich liebe dich.«
»Obwohl ich so ein Langweiler bin?« Marvin bremste vor einer roten Ampel.
»Du bist alles, aber sicher kein Langweiler«, widersprach Rabea.
»Und ich dachte, genau das liebst du an mir.« Er beugte sich zu ihr und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. Die Ampel sprang auf Gelb. Die plötzliche Beschleunigung drückte Rabea in den Sitz. »Zumindest fährst du nicht wie einer.«
»Jeder sucht sich das Risiko, das zu ihm passt.«
In der Trauerhalle drängten sich die Menschen. Rabea sah viele bekannte Gesichter. Freunde und Kollegen, Menschen, die gemeinsam mit ihren Eltern alt geworden waren. Eydan war da mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er nickte ihr zu. Seine Augenlider waren gerötet. Als sie klein gewesen war, hatte er oft mit ihrem Vater auf dem Balkon diskutiert, dabei hatten sie eine Zigarette nach der anderen geraucht und süßen Tee geschlürft. Später war er dann seltener gekommen. Er und seine Familie saßen inmitten von Menschen, die Rabea nicht kannte. Schnauzbärtige Männer mit traurigen Augen, Flüchtlinge, die ihr Vater ehrenamtlich betreut hatte und die zwischen all den Kerzen und Blumen fehl am Platz wirkten. Rabea spürte die Blicke, als sie durch den Mittelgang ging. Und sie spürte sie auch noch, als sie sich zwischen Gabi und Oma Mary in die erste Reihe setzte. Großmutters ausgezehrter Altfrauenkörper war in sich zusammengesunken, und ihre Finger krallten sich um die Griffe des Rollators, der vor ihr stand. Im letzten Jahr war ihr Mann gestorben, nun begrub sie den Sohn. Rabea beugte sich vor und legte ihre Hand auf die ihrer Großmutter. Die Haut war trocken und so weich, dass sie nicht einmal die Falten spürte.
»Warum hat der liebe Gott nicht mich genommen?«, seufzte die alte Frau. Sie sah Rabea an, die Augen milchig trübe. Oma sah schon lange nichts mehr.
Eine Frau trat aus einer Seitentür und setzte sich hinter die Orgel. Die Trauerfeier begann. Vaters ältester Freund trat neben die Urne und sprach über Peters Leben. Es war eine sehr persönliche Rede, die nicht nur Rabea und ihre Mutter zum Weinen brachte. Schließlich setzte die Orgel wieder ein, und die Melodie von Up where we belong verschaffte den Trauernden eine Verschnaufpause, bevor die Urne zum Grab getragen wurde.
Rabea stand zwischen Marvin und ihrer Mutter am Grab, als sie den Fotografen bemerkte. Für einen Moment hatte der Wind aufgehört, durch die Kastanien zu rauschen, und hatte sie aufblicken lassen. Der Fotograf stand auf einem parallel verlaufenden Weg und fotografierte die Trauergäste.
Rabea griff nach Marvins Hand. »Siehst du den Mann dort drüben?«, flüsterte sie.
»Vielleicht ein Kollege vom Staatsschutz«, murmelte Marvin.
Rabea spürte, dass ihm der Gedanke nicht gefiel, und sie begriff, dass er für einen Polizisten auf der falschen Beerdigung war.
»Das ist doch albern«, zischte Rabea. »Mein Vater war doch kein Terrorist.«
»Natürlich nicht, aber ob man das von all diesen Leuten hier behaupten kann?«, flüsterte Marvin.
»Trotzdem hat er kein Recht.«
»Was willst du dagegen machen?«
»Ihn zur Rede stellen.« Rabea schüttelte Marvins Hand ab und achtete auch nicht auf das beschwichtigende Kopfschütteln ihrer Mutter, sondern schob sich an ihr vorbei und lief auf den Mann zu. Er sah sie herankommen und senkte die Kamera. Ruhig blickte er ihr entgegen. Sein Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung verrieten, dass er sich im Recht fühlte.
Scheiß auf im Recht, dachte Rabea. Das ist die Beisetzung meines Vaters. Seine Freunde nehmen Abschied. »Was wollen Sie hier?« Sie schrie den Satz, obwohl sie direkt vor dem Mann stand. Er war schlank mit einem kleinen Bauchansatz, hochgewachsen, trug eine Nerdbrille und musterte sie aus braunen Augen, die so gar nicht zu seinem Pfeffer-und-Salz-Bart passen wollten.
»Wieso fotografieren Sie die Trauergäste? Das dürfen Sie nicht.«
»Sie sind Rabea-Gudrun«, sagte der Mann und nickte, als wisse er, wem sie ihren zweiten Namen verdankte. Und wahrscheinlich tat er das sogar.
»Für Sie bin ich Frau Tenwinkel.«
»Stolte.« Der Mann zog eine Visitenkarte aus der Jackentasche.
Ohne es eigentlich zu wollen, griff Rabea danach. »Sie sind Journalist? Ich dachte …«
»Ich sei vom Verfassungsschutz?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich glaube, so wichtig war Ihr Vater dann doch nicht.«
Eigentlich hätte diese Bemerkung Rabea beruhigen sollen, doch zu ihrer Überraschung spürte sie so etwas wie Schuld. Ihr Vater hatte sein Leben nach ihrer Geburt komplett umgekrempelt. Er hatte sich für sie und gegen den politischen Kampf entschieden. Hatte sich entschieden, vom Akteur zum Unterstützer zu werden. Seit sie denken konnte, haderte Rabea mit diesem Wissen, dabei hatte ihr Vater es nie als Vorwurf formuliert. Eigentlich hatte er nie darüber gesprochen. Trotzdem hing diese Tatsache wie eine Regenwolke am Rande des familiären Bewusstseins. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie ihre Mutter damit hatte leben können.
»Und warum, verdammt noch mal, sind Sie dann hier? Dies ist eine private Trauerfeier. Hier ist niemand von öffentlichem Interesse. Ich möchte Sie bitten, uns nicht weiter zu belästigen, sonst …«
»… hetzen Sie Ihren Polizistenfreund auf mich?«, beendete Stolte ihren Satz.
»Spionieren Sie mir nach?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Nicht Ihnen. Ihrer Mutter, aber die ist nicht da.«
»Meiner Mutter?«, fragte Rabea fassungslos und sah hinüber zu Gabi, die sie mit besorgten Blicken musterte. »Aber …«
»Ich rede nicht von Gabi Tenwinkel.« Schon wieder beendete Stolte ihren Satz. Das war schon schlimm genug, aber schlimmer noch war das Mitleid in seinem Blick.
»Aber Sie haben doch …« Rabea starrte ihn an, und ihr Magen verwandelte sich in einen Eisklotz.
»Ich weiß, was ich gesagt habe. Mein Beileid, Frau Tenwinkel.« Stolte drehte sich um. Bevor er zwischen den Bäumen verschwand, drehte er sich noch einmal um. »Die Fotos werde ich übrigens löschen. Ihre Mutter ist nicht gekommen.«
Ihre Mutter ist nicht gekommen! Rabea starrte auf die Bäume, zwischen denen der Journalist verschwunden war.
»Wo bleibst du?« Marvin legte die Hand auf ihre Schulter.
Unwillkürlich zuckte Rabea zusammen. Sie hatte ihn nicht kommen hören.
»Wir warten nur noch auf dich.«
Sie spürte die Wärme seiner Finger durch den dünnen Stoff des Kleides. Fröstelnd zog sie die Schultern hoch.
»Was hast du da?« Behutsam nahm Marvin ihr die Visitenkarte aus der Hand. »Ein Zeitungsfritze?« Er pfiff durch die Zähne. »Dagegen können wir vorgehen.«
»Er löscht die Bilder, hat er gesagt.« Die Kälte war jetzt in Rabeas Kehle angekommen, machte ihre Stimme rau, klirrend wie brechendes Eis. Und da war sie wieder, diese Erinnerung an einen Geruch nach Minze, die wie eine Luftblase aus ihrem Unterbewusstsein auftauchte und mit der sie so gar nichts anfangen konnte. Bis jetzt?
»Warum hat er sie dann gemacht?«, fragte Marvin in ihre Gedanken hinein.
»Er …« Ihre Mutter ist nicht gekommen! Das war unmöglich, ein übler Scherz. »Ich weiß nicht.« Rabea wandte sich ab, drehte der Stelle, an der ihr Leben zerbrochen war, den Rücken zu und umschlang Marvin mit beiden Armen. Sie atmete den Duft seines Körpers ein und verdrängte damit die Erinnerung an diesen anderen Duft.
»Du frierst ja.« Marvin drückte sie fest an sich. Seine Hände rieben Wärme in ihren Körper.
»Lass uns gehen.« Rabea löste sich aus der tröstlichen Umarmung, und Hand in Hand kehrten sie zum Grab ihres Vaters zurück. Nur noch Gabi und ihre Großeltern warteten dort auf sie. Die anderen Gäste waren entweder nach Hause oder zu dem Lokal gefahren, in dem Gabi einen Tisch für die Familie und die engsten Freunde reserviert hatte.
»Was war das für ein Mann?«, fragte Gabi. »Warum hat er Fotos gemacht?«
»Ein Journalist«, antwortete Marvin.
»Ein Journalist?« Gabi schüttelte den Kopf. »Haben die sonst nichts, über das sie berichten können?«
»Wohl nicht«, antwortete Marvin.
Das Gespräch rauschte an Rabea vorbei, wie es an ihrer Großmutter vorbeirauschte, die zusammengesunken auf ihrem Rollator hockte.
4. Kapitel
Es war die erste Woche nach der Beerdigung, die dritte nach dem Tod ihres Vaters. Rabea arbeitete wieder im Frauenhaus, betreute dort die Kinder, und wenn sie etwas zerstreut war, dann schrieb das jeder ihrer Trauer zu. Irgendwie kehrte der Alltag zurück. Alles schien zu funktionieren. Nur Rabea spürte die Unwucht. Sie schlief mit den Worten des Journalisten ein und wachte mit ihnen auf.
Die Karte, die Stolte ihr auf der Beerdigung in die Hand gedrückt hatte, war wellig und fleckig geworden, so oft hatte sie sie in der Hand gehalten. Bernhard Stolte, freier Journalist, und eine Handynummer, die Rabea mittlerweile runterbeten konnte.
An diesem Nachmittag war sie mit Gabi verabredet. Ihr Vater hatte kein Testament gemacht, und deshalb mussten einige Unterschriften geleistet werden. Rabea würde sie abholen, und gemeinsam würden sie zu dem Termin beim Notar fahren.
Es war das erste Mal seit der Beerdigung, dass Mutter und Tochter allein miteinander waren. Sonst waren immer andere Verwandte, Freunde oder Marvin dabei gewesen. Ihre Mutter erwähnte die Uniform mit keinem Wort, und Rabea fragte sich, ob sie sie in ihrer Trauer überhaupt wahrgenommen hatte.
»Wir hätten ein Berliner Testament machen sollen.« Gabi stieg zu Rabea in den Wagen.
»Papa war zu jung zum Sterben.« Rabea musterte ihre Mutter. Sie hatte abgenommen, aß und schlief wahrscheinlich nicht genug.
»Es ist nur so ein Aufwand. An was man alles denken muss: Heirats- und Geburtsurkunden. Du hast doch deinen Ausweis dabei, oder?«
»Meine Geburtsurkunde?«
»Wessen sonst? Als Beweismittel quasi.« Gabi schüttelte den Kopf.
Natürlich, dachte Rabea, und es war, als fiele ihr eine Last von den Schultern. Wie hatte sie nur so blöd sein können, auch nur einen Fliegenschiss auf diesen Stolte zu geben. Sie hatte die Namen ihrer Eltern schließlich schwarz auf weiß: Peter Tenwinkel und Gabi Niemann. Unwillkürlich schnaubte Rabea.
»Alles in Ordnung?«, fragte Gabi und musterte sie skeptisch.
»Ja«, entgegnete Rabea. Der Gedanke, dass sie einen Beweis hatte, nahm ihr eine Last von der Seele.
»Und es ist dir wirklich recht, dass du auf dein Pflichtteil verzichtest?«
»Sicher.«
»Ich meine, du kriegst sowieso alles, wenn …«
»Mama«, sagte Rabea, und das Wort fühlte sich richtig an. »Es ist dein Geld. Ich will nichts davon.«
»Ich weiß, es ist nur so … man kommt sich halt vor wie ein Bittsteller.«
»Schlimm genug.« Rabea blinzelte die Tränen weg, die ihr in die Augen stiegen. »Schließlich haben wir doch nur noch uns.«
Nach dem Notartermin brachte Rabea ihre Mutter nach Hause.
»Hast du noch Zeit?«, fragte Gabi.
»Auf einen Kaffee immer«, entgegnete Rabea.
Nichts hatte sich in der Wohnung der Eltern verändert. Peters Windjacke hing immer noch an der Garderobe, und seine Sandalen standen vor dem Sofa, auf dem er immer gelegen und gelesen hatte.
Als spüre sie Rabeas Blicke, sagte Gabi, dass sie es einfach nicht schaffe, irgendetwas wegzunehmen, sie habe noch nicht einmal sein Bett abgezogen, schlafe immer noch mit seinem Geruch in der Nase ein.
»Mit dem Geruch ist das so eine Sache«, antwortete Rabea. »Ich habe mal gelesen, Geruchserinnerungen würden nie vergehen.«
»Oh, es gibt schon einige Gerüche, die ich gerne vergessen würde.« Ein schmerzliches Lächeln zuckte in Gabis Mundwinkel.
»Papas Gigantoschiss nach Fisch zum Beispiel.« Auch Rabea schmunzelte.
»Oder Omas Lieblingskäse.«
»Harzer Rolle, gut temperiert.«
Sie lachten. Es tat so gut, beisammen zu sein.
»Ich vermisse seine Stimme.« Gabis Lachen ging nahtlos in Weinen über. »Das ist das Schlimmste, dass ich nicht mehr mit ihm sprechen kann. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste ihm noch etwas sagen.«
»Was denn?«, fragte Rabea.
»Das weiß ich eben nicht.«
»Ach, Mama.« Weinend lagen sie sich in den Armen. »Ich hätte euch sagen sollen, dass Marvin Polizist ist«, flüsterte Rabea am Hals ihrer Mutter. »Es tut mir so leid.«
»Wir wussten es.«
»Was?« Rabea glaubte, sich verhört zu haben. »Wieso?«
»Marvin hat es uns gesagt«, sagte ihre Mutter schlicht. »Eines Abends ist er mit einer Flasche Weinbrand gekommen und hat gemeint, er müsse uns etwas sagen. Wir haben gedacht, wer weiß was los sei, und waren geradezu erleichtert, dass nichts mit dir war.«
»Und ihr habt euch nichts anmerken lassen? Ich meine: Wie hat Papa es aufgenommen?«
»Na ja«, sagte Gabi. »Begeistert war er nicht, und er hat sich geschämt. Ich meine …« Sie strich Rabea eine Haarsträhne hinters Ohr. Die Berührung fühlte sich an, als streichle sie ihre Seele. »Natürlich war es ein Scheißgefühl, dass du uns nicht vertraut hast, doch was sollten wir machen? Wir haben es Marvin hoch angerechnet, dass er uns alles gesagt hat, und der Weinbrand war wirklich gut.«
»Ich hab gedacht, Papa könnte Marvin nicht akzeptieren, wenn er erfahren würde, dass er Polizist ist.«
»Da hast du dich wohl geirrt. Marvin hatte da wohl den besseren Riecher.«
»Aber er hätte es mir doch sagen können.«
»Sei ihm nicht böse. Er hat es nur gut gemeint.«
»Gut gemeint ist nicht gut gemacht«, murmelte Rabea.
»In diesem Fall schon.« Gabi stieß einen Seufzer aus und schob Rabea so weit von sich, dass sie ihr in die Augen blicken konnte. »Manchmal hält man eben Sachen geheim. Und schließlich«, mit der Spitze ihres Zeigefingers tippte sie gegen Rabeas Nase, »haben wir alle unsere Geheimnisse, nicht wahr?«
Auch wenn Rabea Marvins Rolle in dieser Intrige nicht gefiel, fühlte sie sich doch getröstet, dass ihr Vater Bescheid gewusst hatte. Zu Hause angekommen, öffnete sie die Tür zum Garten und setzte sich auf die alte Holzbank, die Marvins Opa geschnitzt hatte. Er war Tischler gewesen, und im ganzen Haus gab es keinen Schrank, den er nicht selbst gebaut hatte. Seine Frau war früh verstorben, und weil seine einzige Tochter ein eigenes Haus besaß, hatte er es seinem Enkel vererbt. Marvin hatte nicht viel daran verändert, und auch Rabea gefiel es, inmitten all der selbst gebauten Möbel zu leben. Sie mochte die Geschichten, die das Haus über seine Bewohner erzählte, und fand die Einrichtung sehr viel persönlicher als die IKEA-Möbel in der Wohnung ihrer Eltern. Obwohl auch die Geschichten erzählten, ziemlich dramatische sogar. Weder ihr Vater noch ihre Mutter waren handwerklich geschickt oder verfügten über genügend Geduld, einer Anweisung Schritt für Schritt zu folgen. Dafür konnten sie Geheimnisse bewahren. Eine Fähigkeit, die sie offensichtlich an ihre Tochter vererbt hatten.
Rabea griff in die Kleingeldtasche ihrer Jeans und holte die verknitterte Visitenkarte heraus. Sie drehte sie zwischen den Fingern und warf sie schließlich in die Feuerstelle des gemauerten Grills. Am besten, sie vergaß diesen Typen so schnell wie möglich.
Als Marvin nach Hause kam, saß sie im Wohnzimmer und schaute sich eine Kochsendung auf Arte an. Sie blickte auf, als er hereinkam.
»Hi«, sagte sie.
»Hi.« Marvin ließ sich neben ihr aufs Sofa fallen und legte den Arm um ihre Schulter. »Alles klar bei dir?« Er zog sie an sich, und Rabea landete mit dem Kopf auf seiner Brust.
»Gabi hat mir von eurem Gespräch und der Flasche Weinbrand erzählt«, sagte sie.
»Bist du sauer?« Marvins Stimme klang zerknirscht.
»Ich weiß nicht.« Rabea hatte sich genau diese Frage gestellt, als sie im Garten gesessen und den Schatten beim Wachsen zugesehen hatte. »Irgendwie schon«, räumte sie schließlich ein. »Gleichzeitig bin ich froh, dass er Bescheid wusste. Aber ich hätte es ihm gerne selbst gesagt.«
»Du hättest es nie getan.«
»Natürlich hätte ich das.« Rabea wusste, dass sie sich gerade selbst belog, und Marvin wusste es auch. Er drückte sie noch einmal an sich, dann ging er hinaus in den Garten, um noch eine letzte Zigarette zu rauchen.
»Was ist das?«, fragte Marvin, als er zurückkehrte. Zwischen Zeige- und Mittelfinger hielt er die Visitenkarte.
»Die hat mir der Typ auf dem Friedhof gegeben.«
»Und warum?«
»Er hat behauptet, ich sei nicht das Kind meiner Mutter.«
»Wie bitte?«
Rabea wiederholte den Satz, und dann erzählte sie Marvin von dem kurzen Gespräch. »Aber es ist albern«, schloss sie. »Es gibt ja die Geburtsurkunde.«
»Trotzdem hast du die Karte behalten?«
»Habe ich nicht«, fuhr Rabea auf. »Du hast sie aus dem Grill gefischt, also habe ich sie ja wohl weggeworfen.«
»Und wann hättest du mir davon erzählt?«
»Überhaupt nicht. Ich hielt es nicht für wichtig.«
»Genauso unwichtig wie die Tatsache, dass der Mann, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst, ein Bulle ist.«
»Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.«
»Wirklich nicht?« Marvin drehte die Karte zwischen den Fingern. »Hast du Gabi davon erzählt?«
Rabea schüttelte den Kopf.
»Vielleicht solltest du das tun.«
»Spinnst du? Papa ist gerade gestorben. Ich kann doch nicht hingehen und sagen: By the way, bin ich eigentlich deine Tochter? Weil: Da ist so ein Typ, der behauptet das Gegenteil. Außerdem: Der Typ hat doch einen Knall.«
»Und was ist, wenn er damit an die Öffentlichkeit geht?«, fragte Marvin. »Auf der Karte steht: investigativer Journalist. Solche Typen verdienen ihr Geld damit, in der Vergangenheit anderer Leute zu graben.«
»Der kann doch nicht einfach irgendwas schreiben? Ich meine: das geht doch nicht. Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen.«
»Kann sein. Aber immerhin ist er bei der Beerdigung deines Vaters aufgetaucht. Hat er irgendetwas über diese Frau gesagt?«
»Nur dass sie meine Mutter sei.«
»Sprich mit Gabi.« Marvin steckte die Visitenkarte ein.
»Was willst du damit?«
»Mal schauen, was ich herausfinde.«
»Du bist bei der Autobahnpolizei.«
»Aber trotzdem Polizist.« Marvin grinste. »Ich habe Freunde.« Der letzte Satz klang wie ein Zitat aus einem Mafiafilm.
Bis zum nächsten Abend sprachen sie nicht mehr über den Journalisten, obwohl er wie eine Zecke in Rabeas Gedanken hockte. Erst nach dem Abendbrot, der Tisch war abgeräumt, legte Marvin einen Pappschnellhefter auf den Tisch.
»Was ist das?« Rabea griff danach.
»Ich hab doch gesagt, ich scann den Typen mal.«
Rabea schlug die erste Seite auf: Bernhard Stolte stammte ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, war zweiundvierzig Jahre alt, geschieden, nicht vorbestraft und Vater einer Tochter, für die er unregelmäßig Unterhalt zahlte. Er lebte in Berlin und hatte dort auch sein Büro. Studiert hatte er Germanistik und romanische Sprachen, beides in Heidelberg und ohne Abschluss. Mit Mitte zwanzig war er dann von Heidelberg nach Frankfurt gegangen, um dort Kommunikationswissenschaften zu studieren. Hier hatte er dann auch einen Abschluss gemacht.
»Was die Autobahnpolizei alles so weiß.« Rabea legte den Hefter auf den Küchentisch.
»Ich hab dir doch gesagt, ich habe Freunde.« Marvin grinste breit. »Und einer davon schuldete mir noch einen Gefallen.«
»Hast du mich auch überprüft?« Rabea dachte an die Vorträge ihres Vaters über den Überwachungsstaat.
»Jetzt klingst du wie Peter.«
»Ich weiß«, räumte Rabea ein. Aber du weichst mir aus. Also: Hast du mich überprüft, als wir uns kennenlernten?«
»Nein.« Marvin fasste sich an die Nase. »Ich hab einen Riecher für tolle Frauen. Und du bist eine tolle Frau.«
»Papa fehlt mir so.« Rabea seufzte, Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Ich weiß.« Marvin streckte die Hand aus und streichelte ihr die Tränen von der Wange. »Du hättest dich krankschreiben lassen sollen.«
»Nein«, widersprach Rabea. »Arbeiten ist schon in Ordnung. Es lenkt ab.«
»Und was hast du sonst so gemacht?«
»Diesen Stolte gegoogelt. Ich hab ja keine Freunde bei der Polizei. Also blieb mir nur das World Wide Web.«
»Und?«
»Er scheint ein RAF-Experte zu sein.« Rabea biss sich auf die Unterlippe. Jeder Satz, den sie von ihm gelesen hatte, machte ihr Angst. »Er hat einen Blog und schreibt für die taz und so. Schwerpunkt: die dritte Generation der RAF.«
»Ach du Scheiße.« Marvin begriff sofort, was sie meinte. »Und der kommt aus Berlin zur Beerdigung deines Vaters angereist?«
5. Kapitel
Nika, August 1980
Nika sah hinaus in den Garten. Eine Drossel hüpfte über die Wiese, und die Wolken hingen tief. Sie unterdrückte einen frustrierten Seufzer. So etwas nannte sich Sommer. Sie zog den Friesennerz über den Pullover, den ihre Großmutter gestrickt hatte, und stieg in die Gummistiefel, dann checkte sie ihren Rucksack: Ersatzsocken, Pfefferminzbonbons und Kochsalzspülung als Erste Hilfe gegen Tränengas.
Obwohl Nika mit den Protesten an der Startbahn West aufgewachsen war, selbst ihre Eltern beteiligten sich daran, war die Flasche noch originalverpackt. Ihre Familie hielt sich fern von den »Krawallmachern«, wie ihr Vater sie nannte. Und auch wenn Nika selten einer Meinung mit ihrem Vater war, vertraute auch sie mehr dem Wort als der Faust. Einfach weil sie besser reden als kämpfen konnte.
»Veronika!«, rief ihre Mutter von unten. »Bist du so weit?«
»Sofort.« Ihre Mutter rief nicht zum ersten Mal, und dass sie ihren Taufnamen und nicht ihren Spitznamen benutzte, sprach dafür, dass ihr Geduldsfaden zum Zerreißen gespannt war. Suchend blickte Nika sich um. Sie wäre schon längst unten, wenn ihr Streifenhörnchen nicht wieder ausgebüxt wäre. Sie hatte sich Tipsi von ihrem Konfirmationsgeld gekauft. Ihre Mutter war dagegen gewesen. Sie solle das Geld lieber sparen, hatte sie gesagt, man wisse nie. Nika hatte ihn trotzdem gekauft.
Tipsi hatte neuerdings den Bogen raus, wie er das Fallgitter hochschleudern und aus seinem Käfig entweichen konnte. Nika hatte immer Angst, dass es irgendwann auf ihn herabfallen würde, aber bisher war er immer schnell genug aus dem Käfig geschlüpft. Jetzt stand die Käfigtür offen. Sobald sie ihn hatte, würde sie ihn hineinwerfen und das Gitter mit ihrem Tagebuchschloss sichern.
»Tipsi.« Nika schnalzte mit der Zunge und reckte sich. Meistens hockte er oben auf ihrem Schrank, aber jetzt sah sie ihn nicht. Vielleicht war er doch in seinem Käfig. Sie klopfte an die mit Erde und Papiertaschentüchern ausgestopfte Teekanne mit der abgebrochenen Tülle, in der er immer schlief. Nichts regte sich.
»Komm schon«, murmelte sie. Das letzte Mal, als sie Tipsi unbeaufsichtigt hatte herumlaufen lassen, hatte er sich durch ihre Bettdecke gefressen und sich ein zentrales Nussdepot inmitten der Daunen eingerichtet.