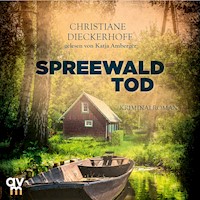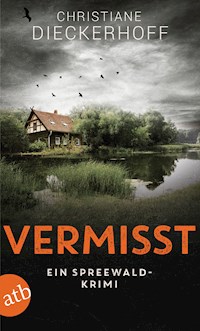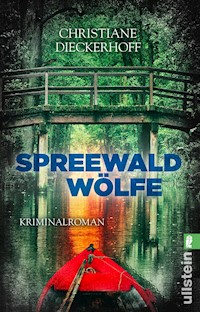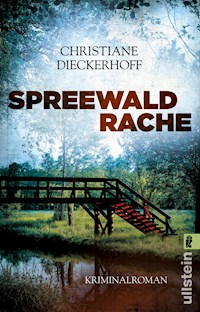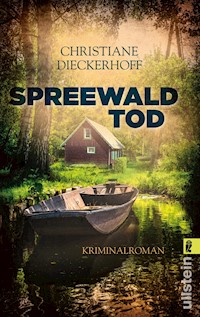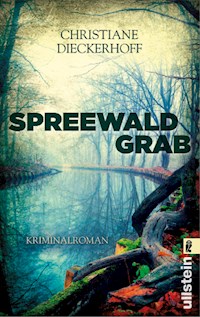
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Polizistin Klaudia Wagner lässt sich vom hektischen Ruhrgebiet in den idyllischen Spreewald versetzen. In Lübbenau ist es allerdings wenig beschaulich. Zwischen den Kanälen und Fließen verbergen sich Geheimnisse und nie vergessene Schicksale. So auch in ihrem erstem Fall: Ein Unternehmer wird tot aufgefunden, seine Geliebte ist verschwunden. Dann findet Klaudia tief im Wald vergraben das Skelett einer jungen Frau. Regen und Nebel ziehen im Spreewald auf und Klaudia droht, sich bei den Ermittlungen selbst zu verlieren. Sie muss erkennen, dass die Idylle nicht nur trügt, sondern eine teuflische Kehrseite hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Polizistin Klaudia Wagner hat genug von der Hektik der Großstadt und lässt sich vom Ruhrgebiet in den beschaulichen Spreewald versetzen. So richtig idyllisch ist es in Lübbenau allerdings nicht. Zwischen den Kanälen und Fließen verbergen sich Geheimnisse und nie vergessene Schicksale. Und bald schon hat Klaudia zwischen den staubigen Akten ihres Vorgängers den ersten Fall auf dem Tisch: Ein Unternehmer wird tot aufgefunden, seine Geliebte ist spurlos verschwunden. Bei den Ermittlungen stößt sie tief im Wald vergraben auf das Skelett einer jungen Frau.
Dunkle Wolken ziehen im Spreewald auf, und Klaudia droht, sich bei den Ermittlungen selbst zu verlieren. Sie muss erkennen, dass die Idylle nicht nur trügt, sondern eine teuflische Kehrseite hat …
Die Autorin
Christiane Dieckerhoff, Jahrgang 1960, machte eine Berufsausbildung zur Kinderkrankenschwester, ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt in Datteln. Sie schreibt vor allem aktuelle und historische Krimis.
CHRISTIANE DIECKERHOFF
SPREEWALD
GRAB
KRIMINALROMAN
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1206-4
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Januar 2016
© 2016 by Christiane Dieckerhoff
© dieser Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Montag 27. Mai
Grelles Licht. Bleilider. Ein Wasserfleck. Erinnerungen: Der italienische Stiefel. Treppe. Telefon. Die Frau schluckt. Galle steigt ihr in die Kehle. Weiter. Nicht aufgeben: Das Haus am Fließ. Das Haus der alten Frau. Ihr Haus. Sie ist zu Hause. Liegt im Schlafzimmer. Ihrem Schlafzimmer. Auf dem Bett. Ihrem Bett. Ist gefesselt. Zäh wie Schlick schwappen die Erinnerungen durch ihren Schädel. Ihr Zwerchfell zieht sich zusammen. Wieder füllt sich ihr Mund mit dem fauligen Inhalt ihres Magens. Diesmal gibt es kein Zurück. Sie kann nicht schlucken, kann nicht atmen. Ihr Herzschlag stolpert. Sie wirft sich auf die Seite, die Fesseln zerren an ihren Gelenken. Schweiß brennt in ihren Augen. Sie würgt und kotzt und würgt und keucht: Luft. Atmen. Ihr Herz pumpt gegen den Druck in ihrer Brust an, bis nur noch einzelne Schläge in ihren Schläfen widerhallen. Schlieren wabern vor ihren Augen, nehmen ihr die Sicht. Dunkelheit. Schwärze. Tod. Panisch reißt sie die Augen auf. Sieht die Rose. Angst. Ein Knarren. Die Tür öffnet sich. Ein Mann stolpert in den Raum. Er ist nackt.
Nicht Uwe, gellt eine Stimme im Inneren der Frau.
1. Kapitel
16. Mai
»Dein unbekannter Verehrer hat wieder zugeschlagen.«
Klaudia kramte nach ihrem Autoschlüssel, als Silkes verschnupfte Stimme sie zwischen den Schulterblättern erwischte.
»Ich bin spät dran«, sagte sie, und das war nicht einmal gelogen, denn irgendwie versackte sie ständig in dem Zeitloch, das zwischen Dusche und Wasserkocher lauerte. Dabei verbrachte sie nicht einmal mehr viel Zeit im Bad.
Vorbei die Zeiten, als sie eine halbe Stunde eher aufgestanden war, um sich zurechtzumachen. Heute drehte sie sich selbst beim Haare föhnen den Rücken zu. Was gab es auch schon großartig zu sehen. Müde Augen mit Krähenfüßen, mittelblonde Haare, die am Ansatz grau wurden, Kerben in den Mundwinkeln. Unattraktiv. Ausgemustert. Und ersetzt durch ein jüngeres Modell. Es bestand kein Grund mehr, Mängel zu übertünchen oder das Fahrgestell zu tunen.
»Uwe ist schon weg.« Ihre sonst immer adrett gekleidete Vermieterin zog ein Taschentuch aus dem Ärmel der ausgeleierten Strickjacke, die sie über T-Shirt und Jogginghose trug, und putzte sich umständlich die Nase.
Ich weiß, hätte Klaudia antworten können. Sein Abgang gestern war laut genug gewesen. Nicht zum ersten Mal verfluchte sie die Idee, in die Einliegerwohnung eines Kollegen zu ziehen.
»Er musste früh raus.« Silke stopfte das Taschentuch zurück in den Jackenärmel. Ihre Stimme zitterte bei der Lüge.
»So ist Polizeiarbeit halt.« Klaudia wusste nicht, was sie sonst sagen sollte. Vielleicht: Das wundert mich aber. Schließlich hat dein Mann als Repo so viel mit Polizeiarbeit zu tun wie ein Sachbearbeiter beim Finanzamt. Für einen Augenblick wunderte sie sich über diesen Vergleich: Musste daran liegen, dass sie mit ihrer Steuererklärung im Rückstand war. Der letzten gemeinsamen.
Aber ganz so falsch war der Vergleich nicht. Bevor Klaudia ihren Dienst in Brandenburg angetreten hatte, hatte sie nicht einmal gewusst, was ein »Repo« war. Sie hatte den Begriff googeln müssen, und zwar in Kombination mit Brandenburg und Polizei, ansonsten warf die Suchmaschine auf den ersten Seiten nur Treffer im Bereich Rest- und Sonderposten aus. Wobei diese Begriffe durchaus auch auf Revierpolizisten anwendbar waren, fand Klaudia, behielt diesen Gedanken aber lieber für sich.
»Ich muss los.« Entschlossen, sich nicht von Silke aufhalten zu lassen, öffnete sie die Haustür. Ein Schwall kühler Morgenluft wehte ins Treppenhaus, und irgendwo in Silkes Wohnung knallte ein Fenster zu.
Du kannst sie nicht einfach so stehen lassen. Klaudias Erziehung machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Als Tochter einer Krankenschwester und eines Arztes war die Verpflichtung, zu helfen, in ihren Genen verankert. Und außerdem: Wer, wenn nicht sie, wusste schließlich, wie beschissen Beziehungen sein konnten.
»Es tut mir leid.« Klaudia ignorierte ihr schlechtes Gewissen, ebenso wie ihre Vermieterin die Abfuhr ignorierte. Sie hörte, wie Silke die Wohnungstür hinter sich ins Schloss zog und ihr zu dem funkelnagelneuen Peugeot folgte, den sie sich von ihrem Anteil am gemeinsamen Bausparvertrag gekauft hatte. Ihr alter Wagen war bei Arno geblieben, ebenso wie die Couchgarnitur und der Schadenfreiheitsrabatt. Klaudia erwischte sich dabei, dass sie mit den Zähnen knirschte. Sofort schwoll das Rauschen in ihrem Ohr an. Sie entspannte den Unterkiefer, wie sie es in der Kur gelernt hatte. Gut, dass Silke ihr Gesicht nicht sehen konnte. Mit entspannt hängendem Unterkiefer sah sie aus wie ein Betrunkener mit Sabberproblem.
»Wenn du Uwe siehst, kannst du ihm vielleicht etwas ausrichten?«
Nein, kann ich nicht, dachte Klaudia. Sie wollte sich nicht einmischen. Sie hatte genügend eigene Sorgen, sie brauchte nicht noch die anderer Leute. Silkes Frage wirkte wie ein Magnet auf ihre Backenzähne, und das Rauschen schwoll wieder an. Entsprechend schmallippig fiel ihre Antwort aus.
»Ja klar«, antwortete Klaudia und lächelte Silke gemäß dem Motto, eine Lüge und ein Lächeln sind besser als eine Lüge allein, so freundlich an, wie es ihre knirschenden Backenzähne erlaubten.
»Sag ihm einfach, er soll mich anrufen.«
Jetzt zitterte nicht nur Silkes Stimme, sondern auch ihr Kinn.
»Mach ich, klar.« Kommunikation zwischen Minenfeldern ist schon eine schwierige Sache, dachte Klaudia. Du weißt, dass ich weiß, und ich weiß, dass du weißt, aber beide tun wir so, als sei alles in Ordnung.
Sie dachte an das letzte Jahr mit Arno und ihre Gespräche, die sich um Einkaufslisten und Fälle gedreht hatten. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß …
Warum sagten die Leute nicht einfach die Wahrheit? Warum sagte sie nicht einfach die Wahrheit? Wie Mama, dachte Klaudia. Der Gedanke fühlte sich an wie Sodbrennen.
Mit dem Gefühl, haarscharf einer Katastrophe entgangen zu sein, zog Klaudia die lachsfarbene Rose unter dem Wischerblatt hervor.
»Und du hast wirklich keine Ahnung, wer das sein könnte?« Auch Silke schien erleichtert zu sein, zum Ausgangspunkt ihrer Unterhaltung zurückkehren zu können.
»Nein wirklich nicht«, antwortete Klaudia.
»Na ja, irgendeiner der Kollegen muss sich doch irgendwie …« Silke beendete den Satz mit einer Handbewegung, als wedele sie eine Mücke fort. »Du kannst mir nicht erzählen, dass du so gar keine Ahnung hast.«
»Und doch ist es so.« Nachdenklich drehte Klaudia die Rose zwischen den Fingern. Dieser heimliche Rosenkavalier war ihr nicht ganz geheuer. Es erschien ihr so … altmodisch. Wie aus der Zeit gefallen.
»Uwe meint, der alte Dassow vom Ende der Straße könnte es sein«, sagte Silke. »Verrückt genug ist er, und er dreht immer vor Tau und Tag eine Runde mit seinem Hund.«
»Mag sein«, antwortete Klaudia, einfach nur um Silke zum Schweigen zu bringen. Sie warf die Rose auf den Beifahrersitz und schlug die Tür zu. Möglicherweise war der alte Mann verrückt, aber nicht so verrückt, einer mittelalten, mittelattraktiven Polizistin Rosen unter die Wischblätter zu stecken. Oft genug kühlte sie in den schwarzen Stunden zwischen drei und fünf, wenn die Sehnsucht nach ihrem alten Leben sie am Weiterschlafen hinderte, ihre Stirn an der Fensterscheibe und starrte hinaus in die ruhige Seitenstraße. Dabei hatte sie den Alten schon oft gesehen, aber nicht einmal sein Border Collie hob das Bein an ihrem Wagen. Und trotzdem klemmte jeden Morgen eine Rose unter dem Scheibenwischer.
»Aber ich glaub’s nicht«, verkündete Silke. »Du hast bestimmt einen Verehrer.« Seufzend putzte sie sich die Nase, und Klaudia fragte sich, ob Silke nach all den Streitereien vielleicht ein bisschen neidisch war. Nicht ihr Problem. Klaudia klemmte sich hinters Lenkrad. Sie hatte weder Zeit noch Lust, sich weitere Gedanken über das Eheleben ihrer Vermieter zu machen. Wollte sie noch einigermaßen pünktlich zur Morgenbesprechung kommen, ohne ein Ticket zu riskieren, musste sie los. Sie winkte Silke zum Abschied, startete den Wagen, und Celine Dion schallte aus den Lautsprechern. My heart will go on. Wie wahr. Auch ihr Herz schlug nach der Trennung einfach weiter. Dafür hatte ihr rechtes Ohr den Löffel abgegeben.
»Danke, Arno«, murmelte Klaudia und streckte der Erinnerung an ihren Ex den Mittelfinger entgegen. »Blumen zum Abschied hätten völlig gereicht.«
2. Kapitel
Nach einer unruhigen Nacht, die Uwe eingeklemmt zwischen Schreibtisch und Heizkörper verbracht hatte, weckte ihn ein schriller Schrei.
»Herrgott im Himmel, ham Sie mich erschreckt«, stammelte die Putzfrau und bückte sich nach dem Wischmopp, der klappernd auf seinen Beinen gelandet war.
Eine Entschuldigung murmelnd, quälte Uwe sich aus dem Schlafsack. Seine Hüfte schmerzte, und sein Rücken fühlte sich an, als hätte er auf einem Nagelbett genächtigt. Er war eindeutig zu alt, um auf dem Fußboden zu schlafen. Er war auch zu alt, um von einer erschrockenen Putzfrau aufgescheucht zu werden. Den Schlafsack unter den Arm gezwängt, drängte er sich an der Frau vorbei. Wahrscheinlich wussten morgen sämtliche Kollegen, dass er die Nacht hier verbracht hatte. Triefend vor Selbstmitleid öffnete er die Tür zum Waschraum. Ein kritischer Blick in den Spiegel zeigte ihm, dass die Nacht keine Spuren hinterlassen hatte, die sich nicht durch den beherzten Einsatz von kaltem Wasser beseitigen ließen. Mit steifem Rücken beugte er sich über das Handwaschbecken und drehte den Wasserhahn auf. Leidlich erfrischt verließ er dann das Bad und schlich aus dem Revier, um den Schlafsack in seinem Sharan zu verstauen. Von dort lief er hinüber zu ›Bubner‹ und kaufte sich zwei Käsebrötchen und einen Coffee to go.
»Wie geht’s Annalene?« Die Verkäuferin packte ihm unaufgefordert ein Quarkbällchen zur Bestellung. Ihre Tochter Chantalle war Annalenes beste Freundin. Silke mochte Chantalle nicht. Sie sei nicht der richtige Umgang, fand sie. Dabei waren die beiden schon seit der Grundschule unzertrennlich. Aber Chantalle lebte mit ihrer Mutter hinter den Bahngleisen und damit in einer Welt aus renovierter Platte und Billigklamotten, in der Jugendliche viel zu früh mit Alkohol und Drogen in Kontakt kamen.
»Gut.« Uwe kramte nach Kleingeld. Er fragte sich, ob die Frau ihm die Quarkbällchen aus Mitleid zusteckte oder weil er Polizist war. Wahrscheinlich wusste sie von ihrer Tochter, dass der Haussegen im Hause Michalke schief hing. Oder auch nicht. Wenn Chantalle nur halb so verstockt war wie Annalene, würde sie mit ihrer Mutter bestenfalls sprechen, wenn sie irgendwohin gefahren werden wollte.
Zurück im Bürgerbüro steckte Uwe das Ladekabel seines iPhones ans Stromnetz und setzte sich vorsichtig hinter den Schreibtisch. Die Wirbel in seinem Rücken knirschten. Noch so eine Nacht und er wäre dienstunfähig bis Neujahr. Dabei war noch nicht einmal Pfingsten. Er schob das blaue Stiefmütterchen zur Seite, das mitten auf dem Schreibtisch thronte und das eine psychologisch geschulte Kollegin angeschafft hatte, um die Hemmschwelle für den Bürger zu senken. Vorsichtig zerriss Uwe die Bäckereitüte, pickte die Salatblätter vom Käse und biss in die krachende Kruste. Nach dem ersten Bissen legte er das Brötchen zurück. Streit schlug ihm immer auf den Magen. Außerdem fror er wie ein abgezogenes Kaninchen. Mit beiden Händen umfasste er den Pappbecher, während er noch einmal den gestrigen Abend Revue passieren ließ. Der Abend hatte so toll angefangen: die Mädchen bei Freundinnen. Entenbraten mit Gurkensoße und Bratkartoffeln. Kerzenlicht. Ein Glas Wein für ihn, Wasser für Silke. Das allein hätte ihn misstrauisch machen sollen, aber er war nur ins Bad gegangen und hatte im gravierten Ehering nachgeschaut. Kein Hochzeitstag. Also hatte er beschlossen, den Abend zu genießen; hatte gedacht, sein Lieblingsessen sei so eine Art Entschuldigung. Die letzten Wochen waren nicht einfach gewesen. Ständig war Silke losgegangen, wie eine ungesicherte SIG Sauer.
Uwe schnaubte. Entschuldigen? Silke? Eher schmilzt das Eis der Arktis. Er hätte es wissen müssen, die Anzeichen erkennen. Und dann hatte sie ihm die drei Worte ins Ohr geflüstert: Ich bin schwanger. Vor Schreck hatte er sich am Wein verschluckt, und danach war die Sache gelaufen.
Ich dachte, du freust dich, hatte sie gesagt, als er sich in seinen Sätzen verhedderte. Später hatten sie sich nur noch angeschrien. Zum Schluss hatte sie ihn als egoistisches Arschloch beschimpft. Ihn. Ausgerechnet ihn. Uwe drückte den Pappbecher zwischen den Handballen zusammen. Hatte er nicht alles für sie und die Mädchen getan? War sogar Repo geworden und regelte vor Kindergärten den Verkehr, anstatt richtige Polizeiarbeit zu leisten. Er war kein Egoist. Er wollte nur kein Kind mehr. Ein Klopfen riss ihn aus seinen trüben Gedanken.
»Früher Vogel fängt den Wurm, wa Achim?« Schiebschick setzte sich auf den Besucherstuhl vor Uwes Schreibtisch. Er war der Einzige, der Uwe mit seinem zweiten Rufnamen ansprach.
Schiebschicks nach Zwiebeln und feuchten Wänden riechender Körper vertrieb den letzten Hauch von Kaffeeduft, der noch über dem Schreibtisch schwebte.
»Du siehst dem alten Achim immer ähnlicher.« Schiebschick tippte sich gegen die Nase. Er und Uwes Großvater waren zusammen im Tagebau gewesen. Der alte Achim war kurz nach seiner Verrentung an den Folgen einer Tuberkulose und zu vielen Schnäpsen gestorben.
»Sprechstunde ab zehn.« Uwe zerknüllte die Bäckereitüte und warf sie in den Papierkorb. Dann schob er das Stiefmütterchen wie einen Schild zwischen sich und Schiebschick.
»Nu hab dich mal nicht so. Wa? Bist doch schon da.«
»Was willst du?« Mit einem Seufzer, der Schiebschick zeigen sollte, wie schwer das Polizistenleben war, beugte Uwe sich vor. »Hat wieder einer Fensterscheiben angesprüht?«
Seit Wochen trieb ein Unbekannter sein Unwesen und schmiss mit roter Farbe gefüllte Farbbeutel gegen Spreewaldhäuser. Allerdings nur gegen die Fensterscheiben von Datschen. Meist informierte der Förster oder einer der Kahnführer die Polizei. Und weil die Kollegen von der Wasserschutzpolizei sich für nicht zuständig erklärt hatten, landeten diese Fälle von Vandalismus nun bei ihm.
»Kommt noch. Wa?« Schiebschick drehte den Kopf zur Seite und spitzte die Lippen, als wolle er ins Wasser spucken, erinnerte sich aber noch gerade rechtzeitig daran, dass er nicht auf seinem Kahn war. »Von mir aus könnten sie denen alle die Fensterscheiben verkleistern. Bleiben sie wenigstens in Berlin. Wa?«
»Bist doch selbst von da.«
»Aber kein Bonze.« Schiebschick ließ sich nur ungern daran erinnern, dass er kein echter, sondern nur ein eingeheirateter Sorbe war.
»Immerhin richten sie die Häuser her«, gab Uwe zu bedenken. Es war kein Geheimnis, dass die Datschenbesitzer bei den Alteingesessenen so beliebt waren wie ein Furunkel zwischen den Arschbacken. »Also, was führt dich zu mir?«
»Der kleine Rudnik hat angerufen.«
»Aha.« Obwohl jeder Knochen unterhalb seines Zwerchfells schmerzte, grinste Uwe. Solange Schiebschick lebte, würde Uwe »Achim« und Thang »der kleine Rudnik« bleiben. So war das hier eben. Namen waren hier so beständig wie die geteerten Kähne.
»Er sagt, diesmal isset eine Kollegin.« Schiebschick schüttelte den Kopf. Für ihn gehörten Frauen an den Herd oder – wenn sie schon arbeiten mussten – als dralle Bedienung in eine Wirtschaft. Auf keinen Fall gehörten sie zur Polizei. »Ist sie wenigstens hübsch?«
Typisch Schiebschick. Nach allem, was Uwe über ihn wusste, war der Alte in seiner Jugend ein richtiger Schwerenöter gewesen, und an guten Tagen hielt er sich auch jetzt noch für ein Gottesgeschenk an das weibliche Geschlecht.
»Hübsch?«
Uwe kratzte sich am Nasenflügel. War Klaudia hübsch? Bisher hatte er sich noch keine Gedanken über seine Mieterin gemacht. Sie sah ein bisschen aus wie Silke, fand er: nicht zu groß, nicht zu klein, ein schmales Gesicht. Ihre Haare waren länger als Silkes und heller. So irgendwie mittelblond.
»Ich glaub schon«, sagte er schließlich.
»Ich soll sie zu ’nem Tatort bringen, sagt der kleine Rudnik. Wa?« Wieder erinnerte sich Schiebschick erst im letzten Augenblick daran, dass er nicht auf seinem Kahn war. Uwe sah, wie der Adamsapfel den faltigen Hals herunterwanderte.
»Gönn ihr die große Runde«, sagte er. »Bis runter nach Burg.« Sollte wenigstens Klaudia einen netten Tag haben. Sie wirkte sowieso immer verspannt. Vielleicht sollte er mit Silke auch mal wieder eine Runde durch den Hochwald staken. Aber dann fiel ihm wieder der Grund für ihren gestrigen Streit ein.
3. Kapitel
Seufzend zog Klaudia den Zündschlüssel. Celine Dion verstummte und machte Platz für den Wasserkessel, der in ihrem Kopf pfiff.
Zu laut. Mittlerweile kannte sich Klaudia mit den diversen Geräuschen aus, die ihr Gehirn seit dem Hörsturz produzierte. Langsam ließ sie den Kopf kreisen. Tatsächlich. Die Welt hinkte der Kopfbewegung mal wieder einen Wimpernschlag hinterher. Scheiße. Dieses ständige Ruckeln über Kopfsteinpflaster war einfach Gift für ihr Ohr. Klaudia biss sich auf die Unterlippe: Nicht mehr lange, und die Welt würde ihren Bewegungen nicht mehr nur hinterherhinken, sondern sich um sie drehen, und das war ein Zustand, den sie nie lange ertrug.
Aus dem Rückspiegel starrte Klaudia ihr eigenes grimmiges Grinsen entgegen. Als Kind, das zwischen den Teppichstangen der Hochhaussiedlung tanzte und davon träumte, einmal eine berühmte Ballerina zu sein, hatte sie sich gewünscht, die Welt möge sich um sie drehen. Und jetzt hing sie kotzend über der Kloschüssel, weil sie es tatsächlich tat. So war es nun mal mit Wünschen, sie konnten in Erfüllung gehen.
Aber auf keinen Fall würde sie zulassen, dass der Schwindel sie außer Gefecht setzte. Sie hatte ein neues Leben, eine neue Heimat, einen neuen Job. Und in keiner dieser neuen Errungenschaften war Platz für Schwindelattacken. Klaudia griff nach ihrer Schultertasche. Auch neu. Ihren Rucksack hatte sie in der Emscher versenkt. Zu viele Erinnerungen verbargen sich in seinem altersfleckigen Leder. Klaudia schüttete den Inhalt der Tasche auf den Beifahrersitz. Haustürschlüssel, Portemonnaie, Taschentücher, Tampons und die Notfall-Vomex-Packung plumpsten auf den Sitz und begruben die Rose unter sich. Klaudia griff nach der Tablettenschachtel, die sich erschreckend leicht anfühlte. Noch mal Scheiße. Leer. Einen Augenblick zögerte sie, dann wischte sie über den Bildschirm ihres Smartphones und gab »Nächste Apotheke« in das sich öffnende Menü ein. Während die Suchmaschine rechnete, startete sie den Wagen und rollte vom Parkplatz. Besser zu spät zum Dienst als kotzend in der Ecke hängen.
Noch etwas außer Atem vom Aufstieg ins Dachgeschoss hängte Klaudia schließlich die Schultertasche an den Haken neben der Tür und murmelte etwas, das wohlwollend interpretiert als Gruß durchgehen konnte. In der Apotheke hatte sie sich noch mit Kaugummi versorgt, das sie nun gegen den schlechten Geschmack kaute, den das Vomex auf ihren Schleimhäuten hinterließ.
Thang, der halbvietnamesische Kollege, mit dem sie sich das Büro im Backsteingebäude der Polizeiwache Lübben teilte, telefonierte gerade. Theatralisch hielt er den Hörer einige Zentimeter vom Ohr entfernt. Klaudia hörte das Keifen einer hysterischen Altfrauenstimme.
»Natürlich kommt eine Kollegin und nimmt alles auf, Frau Nowak«, schrie er gegen das Keifen an. »Machen Sie sich keine Sorgen.«
Er legte auf und strich sich mit der Hand übers Gesicht, als müsste er seine Gesichtszüge zurechtrücken. Nicht dass er das nötig gehabt hatte. Die dunkelbraunen Augen in seinem asiatischen Gesicht verbargen jede Emotion.
»Ausgeschlafen?«
»Ich musste noch was erledigen.« Klaudia verfrachtete das Kaugummi hinter die Backenzähne. »Wer war ’n das?«
»Eine Frau Nowak. Sie sagt: In ihr Haus sei eingebrochen worden.«
»Mal wieder?«
Klaudia fuhr herum. Joachim Schreiber, der von allen außer ihr – der Neuen – nur Joe genannt wurde, stand direkt hinter ihr. Schreiber schien ihr Zusammenzucken nicht zu bemerken. Im Gegensatz zu Thang, dessen Augenbrauen in die Höhe fuhren. Dem Mann entging so leicht nichts.
»Ihr sollt die hier unterschreiben und dann weitergeben.« Schreiber warf eine Geburtstagskarte auf den Tisch. »Pi Äitsch wird fünfundfünfzig.« Joe sprach, wie alle anderen, die Initialen des Chefs englisch aus.
»Wofür steht PH eigentlich?«
»Das ist eins der großen Reviergeheimnisse«, flüsterte Thang theatralisch. »Angeblich für seinen Vornamen.«
»Wieso angeblich?«
»Nicht mal Petra kennt ihn.«
»Aha.« Klaudia fragte sich, was sie von einem Chef halten sollte, der seinen Vornamen geheim hielt und dem diese Abkürzung als Spitzname gefiel.
»Und ich soll Geld für das Geschenk einsammeln.« Schreiber senkte den Blick auf seine Schuhspitzen.
»Wer hat die denn besorgt?« Thang las mit gerunzelter Stirn den Aufdruck. »Mit fünfundfünfzig bist du schon erfahren …«, las er.
»Keine Ahnung.« Abwehrend hob Schreiber die Hände. »Ich bin nur der Bote.«
»Wie viel Geld sammeln Sie denn immer so ein?« Verzagt dachte Klaudia an den letzten Zwanziger in ihrem Portemonnaie. Sie hatte es wieder nicht zum Geldautomaten geschafft. Irgendwie schaffte sie nichts mehr.
»Ein Fünfer reicht«, antwortete Schreiber, den Blick immer noch auf seine Schuhspitzen geheftet.
Klaudia dachte an Silkes Bemerkung. Vielleicht war dieser Schreiber ihr Rosenkavalier. Sie musterte ihn: Ganz unsympathisch war ihr der Gedanke nicht, aber dann rief sie sich selbst zur Ordnung. Der Mann wusste wahrscheinlich nur, dass sie meistens Sneakers trug.
»Ich hoffe, Sie haben sich schon ein wenig bei uns eingelebt?«, sagte Schreiber in seiner umständlichen Art, und es verging mehr als eine Schrecksekunde, bis Klaudia begriff, dass er tatsächlich mit ihr sprach.
»Ja danke.« Unwillkürlich senkte auch sie den Blick. Schreibers Schuhe waren braun und ein wenig staubig, und sie passten zu seinem aktenblassen Wesen. Wieder ein Gedanke, für den sie sich schämen sollte. Hitze kroch in ihre Wangen.
»Ich geb Ihnen sofort das Geld.« Klaudia kramte in ihrer Schultertasche. »Autsch.« Sie zog die Hand zurück. Ein Bluttropfen quoll aus der Fingerbeere ihres Mittelfingers. »Verdammt.« Sie steckte den Finger in den Mund und angelte mit der linken Hand die Rose aus ihrer Tasche.
»Wenn Sie die mal halten könnten?«
Schreiber öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, unterließ es dann aber.
Als sie ihm endlich das Geld geben konnte, reichte er ihr die Rose mit einer angedeuteten Verbeugung zurück und verließ das Büro.
»Na da hat sich aber einer in die neue Kollegin verguckt.« Grinsend schob Thang ihr die Karte zu.
»Sei nicht albern.« Klaudia warf die Rose in den Abfall. »Er will bestimmt nur nett sein. Ich wünschte, PH hätte das gleiche Bedürfnis.«
Klaudia nahm einen Kugelschreiber und unterschrieb in der äußersten Ecke der Karte, damit er zur Not ihre Unterschrift übersehen konnte.
»Hat er dir seinen Vortrag über Aktenführung und kollegialen Führungsstil gehalten?«
»Jepp«, bestätigte Klaudia.
»Dann ist doch alles in Butter.«
»Wahrscheinlich.« Klaudia sah keinen Grund, Thang zu erzählen, dass sie PH hatte auflaufen lassen, als er versuchte, sie über ihre gesundheitliche Situation auszuhorchen.
Meine Tür steht Ihnen immer offen, hatte er mit dieser falschfreundlichen Stimme gesagt, die jeder Bulle beherrschte.
»Sag mir lieber, was mit diesem Einbruch ist.«
»Tja, da du ja bei der Frühbesprechung gefehlt hast und mein Schreibtisch unter der Last der Akten ächzt …« Grinsend tätschelte Thang den Aktenstapel zu seiner Linken. »… bist du wohl die Kollegin, die das Glück hat, bei diesem herrlichen Sonnenschein einen Außentermin wahrnehmen zu dürfen.«
»Du klingst wie ein Anlageberater.« Nichts lag Klaudia ferner, als dem Schicksal zu danken. Auch auf ihrem Schreibtisch wartete ein ansehnlicher Aktenberg. Wahrscheinlich war der Kollege, dessen Stelle sie in der Tauschbörse ergattert hatte, einfach nur geflohen, bevor der Aktenberg ihn unter sich begraben konnte.
»Sieh es positiv«, sagte Thang. »So lernst du wenigstens deine neue Heimat kennen. Du solltest dir wirklich ein Rad anschaffen.«
»Wohin muss ich?« Noch mehr als vor dem Anwachsen des Aktenberges auf ihrem Schreibtisch fürchtete Klaudia die sportlichen Anwerbeversuche des Kollegen.
Thang kam jeden Morgen mit dem Rennrad zum Dienst und joggte in der Mittagspause durch den Hain, während Klaudia auf der anderen Seite der Gleise zwischen KiK und Döner ihr Heimweh pflegte.
»Nach Lübbenau zum Anleger. Dort nimmst du einen Kahn.«
»Ein Boot?« Das Sirren in Klaudias Klingelohr schwirrte plötzlich wie eine ungeduldige Wespe.
»Kein Boot. Einen Kahn.«
»Macht das einen Unterschied?«
Thang schüttelte den Kopf. »Kommt in den Spreewald und kennt nicht mal den Unterschied zwischen einem Boot und einem Kahn.«
»Ich kann nicht behaupten, dass mir eins von beiden sympathisch wäre.«
»Du kannst natürlich auch schwimmen.«
»Klaro.« Klaudia verdrehte die Augen. Sie konnte sich sogar vorstellen, wie Thang zu einem Tatort kraulte.
»Frag nach Gustav Schiebschick«, fuhr Thang fort. »Er bringt dich zum Haus von Frau Nowak.« Er schrieb eine Adresse auf einen Zettel und gab ihn ihr. »Und: Gib ›Großer Kahnhafen‹ in dein Navi ein.«
»Wieso machen das nicht die Kollegen in Lübbenau?«, startete Klaudia einen letzten Versuch.
»Uwe hat Bürgersprechstunde«, antwortete Thang knapp. »Und nun mach dich vom Acker, und nicht vergessen: Lübbenau. Großer Kahnhafen. Nicht dass du in Berlin landest.«
»Komm du mal ins Ruhrgebiet«, murmelte Klaudia. Ihre fehlende Ortskenntnis war für Thang ein sprudelnder Quell der Heiterkeit. Als Kind einer Vietnamesin und eines Deutschen war er hier aufgewachsen und kannte jeden Stein zwischen dem Müggelsee, den Zittauer Bergen und der Neiße, während Klaudia ohne die Pfadfinderfunktion ihres Smartphones gerade mal zurück nach Hause fand.
Aber wahrscheinlich würde Thang sich als ständig trainierender Triathlet auch an der Ruhr innerhalb kürzester Zeit auskennen, und zwar ohne GPS und Smartphone, sondern nur durch die Kraft seiner Waden, die für den eher zierlichen Halbvietnamesen wirklich beachtlich waren, was Klaudia neidlos anerkannte.
4. Kapitel
Pling – Pling – Pling. Das Geräusch zerplatzt auf ihrer Stirn. Die Frau rollt sich zusammen, umschlingt die Beine mit ihren Armen. Embryonale Haltung. Schutzreflex. Klein machen. Noch ist sie ein vegetatives Bündel aus Schmerz und Benommenheit. Nicht bereit, aufzutauchen aus dem Nirgendwo, in das sich ihr Geist geflüchtet hat.
Pling – Pling – Pling.
Ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel … Das. Bist. Du. Kinderstimmen treiben durch ihr Gehirn.
»Ich?« Rau zwängt sich die Silbe über die verkrusteten Lippen der Frau.
»Ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel …«
Sie reißt die Augen auf. Alles Licht der Welt ist verschwunden. Dunkelheit dringt mit jedem Atemzug in ihren Körper. Erstickt sie von innen. Die Frau spürt das Schlagen ihres Herzens in den Schläfen, den Fingerspitzen, den Zehen. Druck in der Brust. Vor ihren Augen wirbeln Schlieren. Keuchend atmet sie ein, löst die verschränkten Finger, hebt die Hände, stößt dabei mit den Fingerknöcheln gegen etwas. Sie presst die Handflächen auf dieses Etwas. Kälte kriecht ihre Knochen entlang.
Wand. Das Wort taucht aus dem Nichts auf. Trotzdem weiß die Frau, dass dieses Wort richtig ist. Vor ihr ist eine Wand.
Pritsche. Das nächste Wort. Auch dieses Wort fühlt sich richtig an. Was sich nicht richtig anfühlt, sind der Schmerz in ihrem Kopf und die Dunkelheit. Blind. Wieder ein Wort. Ich bin blind. Nein. Es fühlt sich falsch an. Auch wenn die Frau versteht, was es bedeutet.
Ich bin. Das hat etwas mit ihr zu tun. Das versteht sie, auch wenn sie nicht weiß, wer sie ist oder woher die Schmerzen und die Dunkelheit kommen. Müllers Esel. Irgendwo im Nirgendwo weiß die Frau, dass sie nicht Müllers Esel ist. Sie ist jemand. Sie hat einen Namen, eine Geschichte, ein Leben. Und irgendwo im Nirgendwo weiß die Frau, dass die Dunkelheit nicht ihr Leben ist.
Amnesie. Wieder ein Wort aus dem Nichts.
»Amnesie.« Die Silben scharren über ihre Zunge.
Ich und du, Müllers Kuh. Ich und du! Müllers Kuh! Müllers Esel! Müllers Esel! Müllers Esel!
Die Frau presst die Hände gegen die Ohren, sofort verstummen die Kinderstimmen. Zurück bleibt der Schmerz. Mit zitternden Fingern zupft sie verklebte Haarsträhnen auseinander. Immer wieder muss sie innehalten. Wie hat sie jemals das Gewicht ihrer Arme halten können? Schließlich ertastet sie die Quelle ihres Schmerzes.
Hühnereigroß. Die Frau ist dankbar über jedes Wort, das aus dem Nirgendwo auftaucht.
Blut. Beule. Bald wird auch ihre Erinnerung aus dem Nirgendwoauftauchen. Erinnern. Ein Zittern überrollt die Frau, ihre Zähne schlagen aufeinander. Sie rollt sich zusammen, zieht den Kopf zwischen die Schultern. Welche Erinnerung lauert im Nirgendwo?
Pling – Pling – Pling.
Wasser. Mit dem Wort kommt der Durst.
»Wasser.« Die Zunge klebt an den Silben fest.
Ich muss aufstehen. Die Frau dreht sich weg von der Wand, streckt die Hände in die Dunkelheit, richtet sich auf. Wabernd bricht Übelkeit über ihr zusammen.
Boden. Fußsohlen. Kälte. Die Worte tröpfeln jetzt so regelmäßig wie das Wasser. Keuchend vor Anstrengung sitzt die Frau auf der Kante der Pritsche. Ihre Finger krallen sich in die Matratze, suchen Halt. In ihrem Kopf tobt wirbelndes Chaos. Die Frau krümmt sich, würgt. Galle tropft ihr vom Kinn. Schließlich ebbt die Übelkeit ab, und die Frau kann die Arme vorstrecken. Vor ihr ist nichts. Ich bin nichts.
5. Kapitel
Kaum hatte Klaudia das Büro verlassen, schallte die elektronisch verzerrte Version von »Auferstanden aus Ruinen« aus Thangs Jackentasche. Für einen Moment war er in Versuchung, den Anruf zu ignorieren. Auch in Zeiten des Handys war man schließlich nicht immer erreichbar. Er könnte sonst wo sein: in einer Befragung, einem Funkloch, auf der Toilette. Doch kurz bevor sich die Mailbox einschaltete, glitt seine Hand doch in die Jackentasche.
»Kommst du heute pünktlich nach Hause?«, fragte Janina. Ihr Atem pfiff, als sei sie zu schnell gerannt.
»Ich denke.« Etwas wie eine Faust ballte sich unterhalb seines Zwerchfells.
»Ich dachte nur …«
Nicht schon wieder. Ungehört verhallte Thangs Stoßgebet. Er wusste, was seine Frau dachte. Ihr ganzes Sein kreiste nur noch um ein Thema.
»Könntest du noch was einkaufen?«
»Natürlich«, beeilte er sich zu sagen. Sie konnte schließlich nichts dafür, dass sie ans Haus gefesselt war. Es sei nicht ihre Schuld, hatte der Arzt gesagt. Es sei eine Krankheit. Alle Menschen, die ihr einmal wichtig gewesen waren, hatte sie nach dem Unfall aus ihrem Leben verbannt, und nun gab es nur noch ihn in ihrem Leben. Eigentlich hatte er vorgehabt, nach Dienstschluss noch eine Runde zu schwimmen. Der Sport und der Job waren die beiden Konstanten, die ihm geblieben waren. Und natürlich Janina. Irgendwo in dieser Frau, die in seiner Wohnung lebte, musste sie stecken. Nicht zum ersten Mal ertappte sich Thang bei der Frage, was er falsch gemacht hatte.
»Was brauchst du denn?«
»Mir ist langweilig.«
»Ich komm, sobald ich kann, okay? Und ich bring dir was Süßes mit, ja? Was Süßes für die Süße.« Womit sie beim Thema waren. Essen.
»Stör ich?« Petra Bartke steckte den Kopf zur Tür herein.
»Ich muss Schluss machen.« Hastig drückte Thang das Gespräch weg. Ein vorbeifahrender Zug ließ die Fensterscheiben klirren.
»Nur wenn du Arbeit bringst.«
»Etwas mehr Einsatz bitte, Herr Rudnik«, näselte die Sekretärin. »Joe sagt, Frau Nowak hat angerufen?« Sie zwinkerte ihm zu.
»Ja«, antwortete Thang, ohne dass ein Muskel in seinem Gesicht auch nur zuckte. »Bei ihr wurde wohl eingebrochen.«
»Irgendwann kommt dir PH auf die Schliche.«
»Du würdest mich doch nicht verraten, oder?« Thang bückte sich nach seiner Fahrradtasche, die er sich zu Weihnachten gegönnt hatte. Er mochte Petra. Sie war so etwas wie der gute Geist des Reviers und die Einzige, die es wagte, PH zu widersprechen. Wahrscheinlich schliefen die beiden miteinander.
»Ich hab was für dich.« Er reichte Petra eine Tupperdose. Bevor seine Mutter zu ihrer Schwester nach Hanoi gefahren war, hatte sie ihnen die Eistruhe vollgepackt, und Janina steckte ihm jeden Morgen eine gefüllte Tupperdose in den Rucksack.
»Was ist es denn?« Voller Vorfreude öffnete sie die Dose. »Oh, Frühlingsrollen.« Die Augen verträumt geschlossen, atmete sie ein. Petra mochte alles, was seine Mutter kochte, dafür liebte Thang sie.
»Bedien dich.«
»Aber die sind doch für dich.« Widerstrebend stellte Petra die Dose auf seinen Schreibtisch. »Du bist eh nur ein Hungerhaken.«
»Kein Hungerhaken. Durchtrainiert. Nimm dir.« Allein der Gedanke an die fetttriefenden Köstlichkeiten schnürte ihm den Magen zu.
»Aber nur eine und nur, weil ich dir keinen Wunsch abschlagen kann. Gott ist mein Zeuge.« Nach einem Blick zur Zimmerdecke griff Petra in die Tupperdose. »Bei den Kochkünsten deiner Frau würde ich aufgehen wie ein Hefekuchen.«
Begeistert kauend, klopfte sie sich auf den flachen Bauch. »Mach mal lieber zu«, nuschelte sie an der Frühlingsrolle vorbei. »Bevor ich die ganze Dose leer futtere.«
»Iss ruhig«, forderte Thang sie auf, aber Petra winkte kauend ab.
»Hast du nicht etwas vergessen?«, fragte er sie, als schon fast die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. »Du bist doch nicht gekommen, um Frühlingsrollen abzustauben?«
»Erwischt.« Kauend zog sich Petra einen der Besucherstühle an Thangs Schreibtisch. »Also«, sie beugte sich vertraulich vor. »Das bleibt aber unter uns, klar?«
»Nun mach’s nicht so spannend.«
»Es ist wegen der Neuen. PH macht sich Gedanken.«
»Wieso das?«
»Na ja. Sie war sehr lange krankgeschrieben und dann dieser Wechsel.«
»Also auf mich wirkt sie ganz patent.« Thang spielte mit der Maus seines Rechners. So gern er Petra mochte, so ungern ließ er sich vor PHs Karren spannen.
»Auf mich auch.« Petra legte die Hand auf die Brust, als würde sie die Nationalhymne singen. »Aber PH hat versucht, in ihrer alten Dienststelle etwas über sie zu erfahren, und er sagt, der Kollege dort sei seltsam zugeknöpft gewesen.«
»Vielleicht steht er einfach nur nicht auf Klatsch und Tratsch. Im Gegensatz zu PH.« Thang hob die Augenbrauen.
»Er macht sich halt Sorgen«, verteidigte Petra, ganz loyale Sekretärin, den Chef.
»Und deshalb schnüffelst du für ihn herum.«
»Nein, so ist das auch nicht.« Petra wurde tatsächlich rot. »Ich wollt’ nur mal nachhören. Oder von Frau zu Frau mit ihr sprechen. Apropos Frau«, fügte sie hastig hinzu. »Ich hab Janina ewig nicht mehr gesehen. Wie geht’s ihr eigentlich?«
»Gut«, antwortete Thang, und als Petra ihn weiterhin freundlich lächelnd anschwieg, fügte er hinzu: »Sie kämpft halt mit ihren Allergien.«
»Ja. Jetzt im Frühling ist das besonders schlimm.« Mitfühlend wackelte Petra mit dem Kopf. »Grüß sie ganz lieb von mir.«
»Mach ich.« Als Petra das Büro verlassen hatte, griff Thang nach der Tupperdose. Der Duft von Sesamöl und Sojasoße stieg ihm in die Nase. Hastig setzte er den Deckel auf.
6. Kapitel
Klaudias Navigationsgerät kam nicht zum Einsatz. Wo der Kahnhafen in Lübbenau war, wusste sie. Schließlich wohnte sie in der Nähe. Sie parkte vor der Kindertagesstätte und lief Richtung Altstadt. Immer wenn Klaudia in diesem Teil ihrer neuen Heimat unterwegs war, fühlte sie sich, als lebte sie in Disneyland. Das Kopfsteinpflaster, die zierlichen Brücken, das Schloss, die Touristen, die die Gaststätten rund um den Hafen belagerten. Vor dem Restaurant Flaggschiff verdarb allerdings ein hellgelber Fiat Panda den Gesamteindruck. Der rostige Kleinwagen wurde nur noch durch Aufkleber zusammengehalten. Die Erinnerung brannte wie Ameisenpisse in ihrem Herzen: So einen Fiat hatte sie in ihrem Leben vor der Trennung auch besessen. Als Zweitwagen halt. Den großen fuhr Arno und sie den kleinen. Nur ohne bunte Aufkleber. Ein Auto war schließlich keine Litfaßsäule.
Der Besitzer dieses Autos schien in diesem Punkt allerdings anderer Ansicht zu sein. Zwei besonders große Aufkleber schmückten die Beifahrertür. Der eine zeigte silberne Blätter auf rotem Grund, der andere blaue Wolken, aus denen Flammen züngelten, unterschrieben mit Energiecamp 2012. Klaudia bog ab zum Anleger. Von den Lautsprechern am Flaggschiff mit Musik beschallt, vertrieben sich Touristen die Zeit bis zum Beginn der ersten Spreewaldkahntour an den Auslagen der Verkaufsbuden. Klaudia zwängte sich zwischen Rentnern mit bayrischen Trachtenjoppen hindurch und lief zu einer Gruppe Kahnführer, die vor dem Büro der Genossenschaft auf einer Bank hockten.
»Guten Morgen die Herren, ich such einen Herrn Schiebschick.« Stoisch ertrug sie die abschätzenden Blicke der Männer.
»Wohin willste denn?« Ein hagerer Mann, dessen blaue Weste über einem kleinen Altmännerbauch spannte, erhob sich ächzend.
»Hierhin.« Klaudia gab ihm den Zettel mit der Adresse. »Mein Kollege hat gesagt, Sie würden mich hinbringen.«
»Soso.« Schiebschick wackelte mit dem Kopf. »Dann tu ich das wohl. Wa?« Er fingerte eine Hornbrille aus der Brusttasche seines Hemdes, schob sie auf die Nase und trat so dicht an Klaudia heran, dass sie sein Altmännergeruch einhüllte. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück. Nicht wegen des Geruchs. Als Polizistin in einer sterbenden Ruhrgebietsmetropole hatte ihre Nase schon Schlimmeres ertragen. Aber seit dem Hörsturz hatte sie das Gefühl, sich irgendwo festhalten zu müssen, wenn jemand zu dicht vor ihr stand.
»So eine nette holca«, brummelte Schiebschick.
»Nette was?«
»Das heißt Mädchen«, sagte einer der anderen Fährleute. »Ist sorbisch.«
»Und so was ist bei der Polizei.« Schiebschick schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Von hier bisse nicht, wa?«
»Nein. Wessi.« Klaudia hatte die Erfahrung gemacht, dass den meisten Menschen hier die grobe Richtung reichte. Sie spreizte die Finger, als sie dem Alten zum Kahn folgte. Noch so eine Angewohnheit, die sie nach dem Hörsturz angenommen hatte. Irgendwie half ihr die dadurch entstehende Körperspannung, das Gleichgewicht zu halten. Schweiß versickerte im Kragen ihres Poloshirts.
Die Bretter am Anleger knarrten, und das träge gegen die Pfosten plätschernde Wasser flimmerte im Sonnenlicht. Klaudia schob sich ein neues Kaugummi in den Mund. Allein die Vorstellung, gleich in einen schwankenden Kahn zu steigen, ließ ihren Magen zaghaft am Zwerchfell anklopfen und nach dem nächsten Ausgang fragen.
»Ist es weit, Herr Schiebschick?«
»Knappes Stündchen.«
»Und es gibt keine andere Möglichkeit, zu diesem Haus zu kommen?«
»Na schon. Von Burg aus. Aber das ist genauso weit. Von hier aus haste Sprit gespart. Tut die Umwelt schonen. Wa?«
Der alte Mann spuckte ins Wasser. »So ist das hier bei uns im Spreewald. Wa? Wie Venedig, nur ohne Markusplatz.« Der Bootsführer half ihr ins Boot. »Und sag Gustav zu mir. Wa?«
Das Boot schwankte weniger, als Klaudia befürchtet hatte, und wider Erwarten genoss sie die Fahrt. Zunächst hielten sie an einem Steg, wo Schiebschick sie trotz ihres Protestes mit einer Gurke und Kaffee versorgte, dann verließen sie das Hauptfließ, und schon bald schien es nur noch dieses Boot und die langsam vorbeigleitende Landschaft zu geben.
»Warum sind die Stämme an der Wetterseite so rot?« Klaudia biss in die Gurke. Die erwartete Säure blieb aus. Fade süßlich breitete sich der Geschmack in ihrem Mund aus. Hastig trank sie einen Schluck Kaffee. Der war immerhin so, wie sie ihn erwartet hatte: heiß und stark.
»Rotfäule.« Schiebschick stemmte sich gegen das Rudel. »Macht die Erlen kaputt.« Er spuckte ins Wasser. Lautlos glitt der Kahn über die Wasserfläche. Ein Entenpärchen näherte sich dem Boot. Klaudia war versucht, sie mit ihrer Gurke zu füttern, aber wahrscheinlich würden sich die beiden daran nur den Magen verderben. Sie leerte ihren Kaffeebecher. Durch das Blätterdach flimmerndes Sonnenlicht malte Muster auf ihre Hand.
Während Schiebschick stakte, erzählte er ihr mit seiner brüchigen Altmännerstimme die Sage von der Entstehung des Spreewaldes. Der Teufel höchstpersönlich habe hier das Bett der Spree in die Erde pflügen wollen, doch irgendwann hätten die Ochsen gebockt, und kein Schimpfen und Toben konnte sie von der Stelle bewegen. In seiner Wut schrie der Teufel: Da hol euch doch meine Großmutter. Das hätte er wohl besser nicht getan, sagte Schiebschick. Die Erde riss auf, und die alte Dame zischte wie ein Flaschengeist auf einer Schwefelwolke gen Himmel. Ihre riesige Gestalt verdunkelte die Sonne. Ihre donnernde Stimme fuhr wie ein Gewittersturm durch den Wald. Selbst der Teufel klammerte sich an einen Stamm. Schon griffen ihre klauenbewehrten Hände nach dem Gespann, da rissen sich die Ochsen los und flohen, den Pflug hinter sich herziehend, mal in die eine, mal in die andere Richtung und hinterließen anstelle eines geraden Flusslaufs ein Netz von kreuz und quer verlaufenden Wasserläufen.
»So eine nette holca«, murmelte Klaudia, als Schiebschick am Ende der Geschichte ins Wasser spuckte. Das Boot trieb an moosigen Baumwurzeln vorbei, deren Stämme sich im Wasser spiegelten. Von Baum zu Baum fliegend, begleitete ein Kleiber den Kahn. Sonnenflecken tanzten auf den Wellen, und Wasserläufer flohen langbeinig vor der flachen Bugwelle. Von Zeit zu Zeit paddelten Touristen mit Wasserkarten in der Hand an ihnen vorbei.
»Verirrt sich hier auch mal einer?«
»Ständig. Wa? Vor allem die Berliner. Wo keine S-Bahn fährt, finden die nicht hin. Wa?«
Offensichtlich hatte Schiebschick keine hohe Meinung von den Hauptstädtern.
Nach der nächsten Biegung wurde die Uferbebauung wieder dichter. Hölzerne Läden lagen vor den Fenstern.
»Wohnt hier eigentlich jemand?« Klaudia tauchte die Hand ins Wasser, genoss die Kühle. Sie hatte schon längst die Orientierung verloren. Die Orientierung und jegliches Gefühl für das Verstreichen der Zeit. Wie eine Decke aus Daunen breitete sich das Zwitschern der Vögel über das Sirren in ihrem Kopf, und zum ersten Mal seit ihrem Zusammenbruch herrschte Stille zwischen ihren Ohren. Fast erschrak sie vor dem Frieden, den dieses Schweigen ihr brachte. Die ersten Tage nach dem Hörsturz dröhnte ein Fragment von Puccinis Nessun Dorma wie eine hängen gebliebene Schallplatte in ihrem Kopf. Als Klaudia diese Arie das erste Mal hörte, hatte sie vor Rührung eine Gänsehaut bekommen. Als sich jedoch dieses Stück in ihrem Ohr festsetzte, stand sie kurz davor, den Kopf an den Wänden ihrer Wohnung zu zerschmettern. Nach einer Woche mit Infusionen und sehr viel Ruhe war Nessun Dorma diesem Sirren gewichen, das mal lauter und mal leiser durch ihre Schädelgrube flirrte.
»Alles Datschen«, knurrte Schiebschick. »Bonzen aus Berlin und so.«
Träge folgte Klaudias Blick der Handbewegung des alten Mannes. Rechts und links eines schmalen Wasserlaufs standen Holzbohlenhäuser mit schimmernden Fensterfronten und akkurat ausgerichteten Holzstapeln an kiesbedeckten Wegen.
»Kommt man hier mit dem Auto hin?« Klaudia drehte sich um. Vor einem der Häuser standen ein protziger Geländewagen und ein Coupé.
Ihre Frage ignorierend stemmte sich Schiebschick gegen das Rudel. Bisher waren sie mit der Strömung geglitten, doch nun schob Schiebschick den Kahn gegen die Strömung an.
Hinter der nächsten Kehre führte eine Holzbrücke über den Fließ. Ein Radfahrer raste plötzlich wie die Ochsen des Teufels darüber hinweg. Klaudia sah noch den Wolkenaufkleber auf dem Spritzschutz des BMX-Rades, dann war er auch schon zwischen den Bäumen verschwunden.
»Mit ihren Rädern rasen könn’se«, brummte Schiebschick. »Und mit ihren dicken Autos die Luft verpesten. Aber staken. Staken können die nicht. Kähne brauchen die nur noch, um Blumen darin zu pflanzen und in den Fischkästen kühlen die Schampus.« Schiebschick spuckte ins Wasser.
»Wie weit ist es noch?« Klaudia schaute auf ihre Armbanduhr. Schon Mittag. Sie waren bereits sehr viel länger als eine Stunde unterwegs.
»Wir haben hier viele Traditionen.« Als hätte Schiebschick ihre Frage nicht gehört, stakte er in einen schmalen Seitenarm. Zweige kratzten am Kahn. »Manche sind alt, andere neu.«
»Ah ja.« Eine Wolke schob sich vor die Sonne, durch die Baumkronen rauschte der Wind. Auf einmal wirkte der gerade noch so lichte Wald bedrohlich. Die Wespen kehrten in Klaudias Kopf zurück.
Schiebschick stakte das Boot an einen Steg und legte das Rudel auf die Planken.
»Hier ist ja alles verrammelt.« Klaudia schüttelte den Kopf. »Hoffentlich lässt sie uns rein.« Sie schaute hinüber zu den geschlossenen Fensterläden.
»Wohl nicht.« Schiebschick kratzte sich das Kinn.
»Wie? Wohl nicht.« Sie drehte sich zu Schiebschick.
»Aber ich hab einen Schlüssel.« Er strahlte sie an, als würde er ihr ein Geschenk machen. »Man kann es übrigens mieten. Wa. Ist möbliert.«
»Möbliert«, wiederholte Klaudia. »Aber. Ich suche keine Wohnung, sondern ein Haus, in das eingebrochen wurde. Außerdem, was soll ich mit einem Haus, zu dem ich staken muss?«
Andererseits. Klaudia lauschte auf das friedliche Sirren in ihrem Ohr. Es war schon nett hier und ruhig. Ihr gefiel das Holzhaus mit den für die Region so typischen Schlangen auf dem Giebel und den roten Fensterläden, die so gar nicht aufgehebelt aussahen, sondern hübsch ordentlich verriegelt. Alles um sie herum wirkte friedlich. Das träge gluckernde Wasser des Fließ, das Zwitschern der Vögel, das Knattern eines vorbeifahrenden Traktors.
»Das Haus liegt ja an einer Straße.« Fassungslos drehte sie sich zu Schiebschick herum.
»Na ja«, antwortete er und setzte die Worte, wie er stakte. Langsam und bedächtig. »Das ist wohl so.«
»Und wieso schickt mich Thang dann zu Ihnen?«
»Na ja.« Schiebschick spuckte wieder ins Wasser. Wenn er so weitermachte, würde das Fließ über die Ufer treten. Schließlich bequemte er sich aber doch noch, etwas anderes als Speichel über seine Lippen kommen zu lassen. »Ich hab Ihnen das ja erklärt mit den Bräuchen.«
»Ja und?« Klaudia verstand immer weniger. Sie zog ihr Smartphone aus der Tasche. Vielleicht würde Thang ihr ja diese Frage beantworten können.
»Na ja«, sagte Schiebschick zum dritten Mal und hob die Hand, als wollte er sie daran hindern, zu telefonieren. »Immer wenn die gute Heidelise ein unbewachtes Telefon findet, ruft sie bei der Polizei an, und wenn die einen Neuen haben, schicken sie ihn zu mir.«
»Wie nett.« Klaudia schluckte an ihrer aufwallenden Wut. Thang würde was zu hören kriegen. Ihr Schreibtisch bog sich unter der Aktenlast ihres faulen Vorgängers, und er schickte sie in die Wüste.
Klaudias Smartphone klingelte.
Ihr Ausflug sei zu Ende, sagte Thang, und Klaudia hatte das Gefühl, ein hämisches Grinsen in seiner Stimme zu hören.
»Du mich auch«, schnarrte sie in den Hörer. »Meinst du eigentlich, ich hätte nichts Besseres zu tun, als mich von euch auf die Schippe nehmen zu lassen? Echt. Ich ….«
»Reg dich ab«, unterbrach Thang sie. »Es ist gerade eine Meldung eingegangen. In einer der Datschen soll eine Leiche liegen. Gib mir mal Schiebschick, damit ich ihm sagen kann, wohin er dich bringen soll.«
»Einen Teufel werde ich tun. Schiebschick wird mich direkt zurück zum Anleger bringen. Ich hab hier schon genug Zeit vertrödelt.« Klaudia drückte das Gespräch weg.
»Was starren Sie mich so an? Und wenn ich zehnmal ein Spielverderber bin. Ich muss zurück an meinen Schreibtisch. Ich bin hier nicht in den Ferien.«
»Ist ja gut, Mädchen.« Schiebschick schlurfte zurück zu seinem Kahn. »Kommst du halt wieder, wenn du mehr Zeit hast.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.