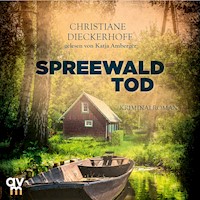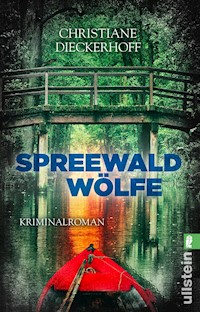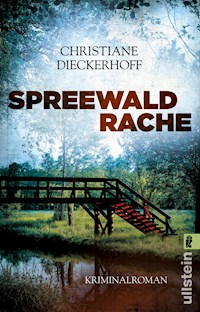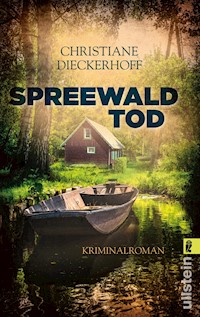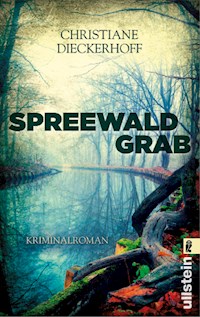Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ermittlungen im Spreewald
- Sprache: Deutsch
Die Tote im Spreewald.
Als ihr nachts in der Nähe von Lübbenau ein unbeleuchtetes Auto die Vorfahrt nimmt, kann Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner im letzten Moment ausweichen. Doch dabei überfährt sie eine Frau. Klaudia ist am Boden zerstört. Dann die Überraschung: Die Frau galt bereits als tot. In einem Indizienprozess wurde ein Mann als ihr Mörder schuldig gesprochen. Wo aber ist Jennifer Böseke in den letzten zwei Jahren gewesen? Klaudia beginnt zu ermitteln und gerät an eine Frau, die als Spreewaldhexe gilt und die seit der Unglücksnacht einen jungen Mann vermisst, der in ihrem Haus gewohnt hat ...
Ein rätselhafter Kriminalroman vor der eindrucksvollen Kulisse des scheinbar idyllischen Spreewalds.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Christiane Dieckerhoff
Christiane Dieckerhoff lebt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Nach über dreißig Berufsjahren als Kinderkrankenschwester und ersten erfolgreichen Veröffentlichungen wagte sie 2016 den Sprung in die Freiberuflichkeit. Sie hat bisher vier Spreewaldkrimis veröffentlicht.
Mehr zur Autorin unter www.krimiane.de
Informationen zum Buch
Die Tote im Spreewald.
Als ihr nachts in der Nähe von Lübbenau ein unbeleuchtetes Auto die Vorfahrt nimmt, kann Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner im letzten Moment ausweichen. Doch dabei überfährt sie eine Frau. Klaudia ist am Boden zerstört. Dann die Überraschung: Die Frau galt bereits als tot. In einem Indizienprozess wurde ein Mann als ihr Mörder schuldig gesprochen. Wo aber ist Jennifer Böseke in den letzten zwei Jahren gewesen? Klaudia beginnt zu ermitteln und gerät an eine Frau, die als Spreewaldhexe gilt und die seit der Unglücksnacht einen jungen Mann vermisst, der in ihrem Haus gewohnt hat.
Ein rätselhafter Kriminalroman vor der eindrucksvollen Kulisse des scheinbar idyllischen Spreewalds.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christiane Dieckerhoff
Vermisst
Ein Spreewald-Krimi
Inhaltsübersicht
Über Christiane Dieckerhoff
Informationen zum Buch
Newsletter
Handelnde Personen
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Danksagung
Impressum
DEN SPREEWALD gibt es natürlich wirklich, doch diese Geschichte ist meiner Phantasie entsprungen, sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Handelnde Personen
Kriminalhauptmeisterin Klaudia Wagner – Mitte vierzig; Klaudia hat es vom Ruhrgebiet in den Spreewald verschlagen. Sie versackt regelmäßig in einem Zeitloch, das ihr morgens zwischen Dusche und Kaffeemaschine auflauert.
Erster Kriminalhauptkommissar Klaus Naumann – Ende fünfzig, genannt Pi Äitsch – ist Klaudias Chef und hat kein Verständnis für Zeitlöcher.
Kriminalobermeister Thang Rudnik – Mitte dreißig, ist Triathlet und macht gerne pünktlich Feierabend, um den mit seiner Frau zu verbringen.
Kriminalhauptmeister Peter Demel – Ende vierzig, fotografiert und flirtet gerne; trägt es mit Fassung, wenn er mal wieder abblitzt.
Kriminalhauptmeisterin Wibke Bredau – Anfang vierzig, ist bei der Spurensicherung und Klaudias beste Freundin.
Revierpolizist Uwe Michalke – Mitte vierzig, Witwer und Vater von drei Kindern. Er und Klaudia haben viel miteinander durchgemacht.
Reviersekretärin Petra Bartke – Mitte fünfzig, ist die gute Seele des Reviers und manchmal etwas zickig.
Und dann gibt es noch:
Staatsanwältin Birgit Demeter-Anders – Ende dreißig; sie und Klaudia sind sich zu ähnlich, um sich gut zu verstehen.
Kahnführer Schiebschick – niemand weiß, wie alt er ist, und obwohl er Berliner ist, halten ihn alle für einen waschechten Sorben.
Uwes Kinder: Annalene, Banu und Tim.
Dickie – freiheitsliebender Kater unbestimmten Alters, der auch eine Katze sein könnte, so genau weiß Klaudia das nicht.
Prolog
Die Frau und der Mann stehen zwischen dem Fließ, vor Jahrmillionen von schmelzenden Gletschern in den Boden gefräst, und dem Lagerfeuer, das ihr Werk ist. Einzelne Flammen züngeln aus dem schon fast verkohlten Holz. Die beiden sind jung, fast noch Kinder in den Körpern von Erwachsenen: Er trägt ausgeleierte Jogginghosen und sonst nichts, sie ein verwaschenes Trikot von Hertha BSC, das ihr bis zu den Knien reicht.
Böiger Wind rauscht durch nachtschwarze Erlen. Der aufziehende Sturm ist nichts im Vergleich zu dem Aufruhr in ihrem Inneren. Die beiden schreien sich an, beschimpfen sich, die Hände zu Fäusten geballt, die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen. Eigentlich lieben sie sich, zumindest ist da dieses Kribbeln im Bauch, das sie für Liebe halten, doch gerade jetzt sind sie Feinde. Feinde mit stecknadelkopfgroßen Pupillen.
Um das Feuer liegen bauchige Weinflaschen im niedergetrampelten Gras, und aus einem umgefallenen Tetrapack sickert Orangensaft in den sandigen Boden. Die Frau schlägt nach dem Mann. Sie holt weit aus, sie ist es nicht gewohnt zuzuschlagen. Der Mann weicht aus, der Schlag streift nur seine Wange. Trotzdem schlägt er zurück. Selbst wenn er zugedröhnt ist, funktionieren seine Reflexe. Sie sieht den Schlag nicht kommen. Als er sie trifft, stolpert sie, fängt sich so gerade eben noch. Sie streckt die Arme vor, die Finger gekrümmt, Nägel wie Dolche. Er wehrt sie ab. Sie tritt, kreischt. Das macht ihn wütend. Sie soll endlich still sein. Seine Faust trifft ihr Kinn. Ihr Kopf fliegt zurück, sie geht zu Boden, schreit und schreit: schrill, durchdringend. Ihr Kreischen vibriert in seinem Schädel: eine Sirene aus Schmerz und grellem Licht.
Sei endlich still, denkt er. Sein Fuß schnellt vor, trifft sie in die Rippe. Er spürt den Schmerz in den Zehen. Sie krümmt sich, wimmert jetzt, schützt ihren Kopf mit den Armen. Er stolpert, sinkt neben ihr in die Knie, verbirgt das Gesicht in den Händen.
»Du verfickte Fotze.« Seine Stimme klingt fast versöhnlich, doch dann trifft ihn etwas hart an der Schläfe. Blind vor Schmerz heult er auf, Halt suchend greift er hinter sich, hat auf einmal eine Weinflasche in der Hand. Na warte, denkt er. Blut läuft ihm über die Wange. Er zerschlägt die Flasche an einem der Steine, die das Feuer sichern, hebt den Arm. Ihr Schrei dröhnt in seinem Kopf. Sie tritt nach ihm, die Augen schreckensweit aufgerissen, robbt sie fort. Fort von ihm, fort von seinem blindwütigen, vom Amphetamin gepuschten Hass. Ihre Haare fangen Feuer. Sie kreischt. Ihr Schrei vibriert in seinen Trommelfellen, seinen Knochen. »Hör auf!«, schreit er. »Sei endlich still!« Dann schlägt er zu.
1. Kapitel
… und ich sehe auf der Straße nach Norden, dieser Teil der Welt ist anders geworden…
Klaudia summte die etwas rockige und gleichzeitig melancholische Melodie mit, die aus den Lautsprechern dröhnte. Die Kollegen hatten ihr diese CD mit Liedern von Gerhard Gundermann zu ihrer Beförderung zur Kriminalhauptmeisterin geschenkt. Sie fanden, es sei an der Zeit, etwas anderes als Celine Dion zu hören. Klaudia war nicht unbedingt der gleichen Meinung, doch nach annähernd sechs Stunden Fahrt konnte sie eine Pause von ihrer Lieblingssängerin gebrauchen.
… und ich frag mich, was ich bin, was ich war, in der Suppe das Salz oder das Haar …
Regen trommelte auf das Wagendach. Die Scheibenwischer schafften es kaum, der Wassermassen Herr zu werden, die über die Windschutzscheibe flossen.
… ich schwimme mittendrin in meinem alten Hemd, gehöre noch dazu und bin schon ziemlich fremd.
Der Schmerz kam überraschend. Klaudia realisierte erst, dass sie weinte, als Tränen von ihrem Kinn tropften.
Sie beugte sich vor, um das Radio einzuschalten. Was sie jetzt brauchte, war etwas Seichtes. Kein Liedermacher, nicht Celine Dion, deren Texte auch so oft mitten ins Schwarze trafen, sondern einfach nur Trallala. Mit dem Handrücken wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht. Offensichtlich steckte ihr die letzte Woche wesentlich übler in den Knochen, als sie sich selbst eingestehen wollte. Conny hatte ins Krankenhaus gemusst. Nichts Ernstes, hatte ihre Stiefmutter gesagt, nur eine Untersuchung. Außerdem hatte sie gesagt, und es klang wie eine Entschuldigung, dass die Zwillinge nicht einspringen konnten. Weil sie doch Familie hatten, kleine Kinder. Also hatte Conny sie angerufen, die älteste Tochter ihres Mannes. Es sei auch nur für eine Woche, hatte sie hinzugefügt, ansonsten müsse Papa – sie hatte tatsächlich Papa gesagt – in eine Kurzzeitpflege. Kurzzeitpflege! Das Wort hatte den Ausschlag gegeben. Außerdem war nicht viel los, wie meistens im Sommer, wenn die Touristen wie Mückenschwärme über den Spreewald hereinbrachen. Klaudia hatte mit ihrem Chef gesprochen, den alle nur Pi Äitsch nannten. Natürlich hatte er ihr frei gegeben. Er war froh, dass sie auf diese Weise Überstunden abbauen konnte. Also war sie am letzten Samstag, statt mit ihren Kollegen zum Spreewaldfest in Lübbenau zu gehen, nach Essen gefahren, wo ihr Vater lebte und wo sie die längste Zeit ihres Lebens gewohnt hatte. Sie kannte sich aus in Essen, im Haus ihres Vaters, doch noch nie hatte sie sich so fremd gefühlt wie in dieser Woche, allein mit ihrem Vater. Sie hatte ihm seine Medikamente gegeben und die Krusten vom Brot geschnitten, weil er sich jetzt immer so schnell verschluckte. Sie war mit ihm in einem Spielzeuggeschäft gewesen, um ein Holzauto für Tim zu kaufen. Uwes Sohn wurde drei, und als seine Patentante war sie natürlich eingeladen. Ihr Vater hatte das Auto ausgesucht, obwohl er fand, dass ein Auto nicht das richtige Geschenk für die Zwillinge sei. Klaudia hatte seinen Irrtum nicht aufgeklärt. Warum auch. In seiner Welt existierten Uwe und Tim nicht.
Ansonsten waren sie jeden Tag in den Grugapark gegangen, hatten auf einer Bank gesessen und dem Leben dabei zugesehen, wie es vorbeirauschte: in Kinderwagen, auf Inlineskatern, auf leisen Sohlen. Und sie hatte ihren Vater in den Arm genommen, wenn er nachts, verschreckt von einer Angst, die er nicht benennen konnte, durch das Haus irrte. Das alles hatte sie getan, und trotzdem lächelte er sie nur verwirrt an, wenn sie ihn morgens weckte. Er ahnte wohl, dass er sie kennen müsste, rief sie abwechselnd mit den Namen ihrer Schwestern oder sagte auch Mutter zu ihr, doch nie Klaudia. Und wenn sie ihm sagte, wer sie war, ihm von ihrem gemeinsamen Leben erzählte, nickte er und vergaß es sofort wieder. Das Hirnareal mit ihrem Namen und dem Namen ihrer Mutter war nur noch ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum.
Als ihre Stiefmutter aus dem Krankenhaus zurückkehrte, hatte Klaudia ihr erzählt, dass ihr Vater sie vergessen hatte. Sie hatte versucht, es so klingen zu lassen, als würde es ihr nichts ausmachen. Sie war sich jedoch nicht sicher, ob ihr das wirklich gelungen war. Diese irrationale Eifersucht, von der sie geglaubt hatte, sie überwunden zu haben, nagte an ihr.
Conny hatte sie in den Arm genommen und gesagt, er würde sie nur nicht erkennen, weil sie so selten zu Besuch kommen konnte. Und auch wenn sie es als Trost meinte, hörte Klaudia vor allem den Vorwurf. Sie warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel, sah ihr schmales Gesicht, die mittelblonden Haare, die dringend nachgeschnitten werden mussten, die zarten Falten in den Mundwinkeln, die ihr noch fremd waren. Nein, dachte sie, so sehr hatte sie sich nicht verändert und außerdem: Die Zwillinge lebten auch schon lange nicht mehr bei ihm und Conny. Trotzdem hatte er sie nicht aus seiner Erinnerung radiert. Er hatte ihr von ihnen erzählt, sie hatten in alten Alben geblättert. Immer hatte er auf die Mädchen mit dem glatten dunklen Haar gezeigt, die sich bis auf die Sommersprossen glichen, nie auf das Mädchen im Hintergrund mit dem pinkfarbenen Irokesen. Es tat weh. Egal, was Conny sagte. Trotzdem hatte sie das Bild abfotografiert, es war das einzige, auf dem sie zusammen mit ihrem Vater zu sehen war. In den Jahren nachdem dieses Foto entstanden war, hatte sie sich immer geweigert, für das obligatorische Familienbild zu posieren. Nun nutzte sie es als Startbildschirm. Es sollte sie daran erinnern, was sie verloren hatte. Ein Nachrichtensprecher verlas mit unbeteiligter Stimme, dass die NATO Abschreckungsmaßnahmen gegen Russland beschlossen habe. Klaudia kramte nach ihrem Handy, dann doch lieber Celine Dion. Sie tastete nach dem Verbindungskabel, war für einen Moment abgelenkt. Als sie wieder aufblickte, schoss ein unbeleuchteter Wagen aus einer Seitenstraße hervor.
Instinktiv riss Klaudia das Lenkrad herum. Ihr Peugeot brach aus, sie bremste, sah den vor Nässe glänzenden Asphalt, dann schlugen Zweige gegen ihre Windschutzscheibe. Der Wagen rumpelte in einen Acker. Klaudia klammerte sich an das Lenkrad. Etwas krachte, der Wagen holperte über Bodenrillen und setzte schließlich hart auf. Der Motor erstarb. Die Stille dröhnte in ihren Ohren und vereinigte sich mit dem Sirren, das sie der Trennung von ihrem Ex verdankte. Die Arme weit von sich gestreckt, klammerte Klaudia sich an das Lenkrad. Die erste Bodenwelle hatte den Gurt arretiert. Das grelle Licht der Scheinwerfer beleuchtete einen Gurkenflieger, der wie ein überdimensionales Segelflugzeug mitten auf dem Feld stand. Scheiße, dachte sie. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Mit fliegenden Fingern löste Klaudia den Gurt. Bevor sie die Fahrertür aufstieß, schloss sie für einen Moment die Augen. Jetzt eine Zigarette. Der Gedanke war absurd. Seit dem Hörsturz nach der Trennung von Arno – und das war immerhin bald vier Jahre her – hatte sie keine Zigaretten mehr angefasst, doch jetzt flatterte ihre Lunge vor Begierde.
Klaudia stieg aus. Der Regen prasselte auf sie nieder, doch die kalte Dusche half ihr, die Fassung wiederzugewinnen. Trotzdem zitterten ihre Knie, als sie vorsichtig ihren Wagen umrundete. Die Räder hatten sich tief in den Boden gegraben, der so weich und nass war, dass er bei jedem Schritt quatschte. Auch das noch! Frustriert trat Klaudia gegen einen Reifen, dann stieg sie wieder ein, wischte sich die Nässe aus dem Gesicht und schaltete die Zündung ein. Der Wagen sprang an, doch beim Versuch, rückwärts zu fahren, drehten die Räder durch.
Bitte, bitte, bitte … Klaudia richtete ihr Stoßgebet an niemanden im Besonderen. Ihre mehr als zwanzig Dienstjahre bei der Polizei hatten nicht gerade dazu beigetragen, ihren Glauben an einen Gott oder das Universum zu festigen. Sie schaltete in den ersten Gang und versuchte, den Wagen etwas vorrollen zu lassen. Nach einigen Versuchen gab sie auf und kramte nach ihrem Handy, das natürlich verschwunden war. Schlimmer geht immer! Seufzend stieg Klaudia wieder aus und öffnete die Heckklappe. Obwohl sie bei ihrem Vater gewesen war, stand dort ihr Einsatzrucksack. Sie kramte ihre Stablampe und ein Regencape heraus, streifte es über und leuchtete den Fußraum ihres Wagens aus. Das Handy war unter den Beifahrersitz gerutscht. Klaudia holte es heraus und wählte die Nummer der Leitstelle. Mittlerweile war ihr so kalt, dass ihre Zähne klapperten.
»Hast du nicht frei?«, fragte der diensthabende Kollege, bevor Klaudia ihren Namen nennen konnte. Sie schilderte ihm ihre Situation und bat ihn, ihr einen Streifenwagen mit einem Abschleppseil zu schicken.
»Das ist ja wohl eher ein Fall für die Feuerwehr«, meinte der Kollege. »Wo bist du genau?«
»Mitten auf dem Acker.« Klaudia blickte sich um. »Weißt du was«, sagte sie. »Vergiss das mit der Feuerwehr, ich lasse meinen Wagen morgen vom Bauern rausziehen. Ich rufe mir ein Taxi.«
»Warte mal.« Klaudia hörte gedämpfte Stimmen, dann meldete sich ihr Kollege Demel.
»Ich kann dich abholen«, sagte er.
»Wieso bist du im Revier?«
»Kriminalbereitschaft«, sagte er. »Sag mir, wo du bist, dann hole ich dich ab. Hast du das Nummernschild des Wagens gesehen, der dir die Vorfahrt genommen hat?«
»Nein, sorry.« Klaudia hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. »Der Wagen war nicht beleuchtet, und es ging alles so schnell.« Das war nur die halbe Wahrheit: Hätte sie nicht nach dem Kabel gesucht, hätte sie den Wagen wahrscheinlich den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde eher gesehen.
»Okay«, sagte Demel. »Wo finde ich dich?«
Klaudia beschrieb es ihm, so gut sie konnte. »Ich warte an der Straße auf dich«, sagte sie schließlich.
»Bei diesem Wetter?«
»Ich bin gut ausgerüstet.« Was wahr, jedoch trotzdem nicht richtig war, denn unter ihrem Regencape war sie nass wie eine ertrunkene Katze. Klaudia hievte ihre Reisetasche aus dem Kofferraum und verschloss den Wagen. Dann machte sie sich auf den Weg. Im Schein ihrer Maglite sah sie die tiefen Radspuren, die ihr Wagen in das Feld gefräst hat. Sie füllten sich bereits mit Regenwasser, das im Lichtschein glänzte. Klaudia leuchtete die Böschung ab, durch die ihr Wagen gebrochen war. Abgebrochene Zweige, niedergewalzte Büsche.
Ein Blitz erhellte den nächtlichen Himmel. Klaudia zuckte zusammen. Da war etwas, am Rande ihres Blickfeldes. Etwas, das ihren Pulsschlag beschleunigte. Langsam richtete sie den Schein ihrer Taschenlampe auf die Stelle und schluckte. Da lag eine Hand. Klaudia blinzelte sich das Regenwasser aus den Augen. Die Hand blieb. Es war eine Frauenhand, und die gehörte eindeutig nicht auf einen Gurkenacker.
Wird man als Polizistin zu einer Todesfallermittlung gerufen, rechnet man mit einer Leiche. Man ist vorbereitet und ruft eine innere Checkliste auf. Stößt man mitten in der Nacht bei Regen und Gewitter auf einen leblosen Körper, fehlt das alles.
Klaudia unterdrückte den Impuls, einfach weiterzugehen und die geisterhaft blasse Hand aus ihrer Erinnerung zu löschen wie eine fehlerhafte Eintragung im ComVor, dem Vorgangsbearbeitungsprogramm, das polizeiintern nur Komfortzone genannt wurde. Einfach zur Straße gehen, sich von Demel nach Hause bringen lassen, in ihr warmes Bett fallen und die Decke über den Kopf ziehen. Und morgen würde die Sonne scheinen, und die Hand wäre verschwunden, doch Klaudia wusste es besser. Sie musste sich kümmern. Zögernd näherte sie sich der Hand, der Schein ihrer Maglite fuhr über einen Arm, einen weiblichen Körper, und dann krümmte sich Klaudia vor Entsetzen, und die Maglite landete im Schlamm.
2. Kapitel
Manuela setzte sich in ihrem Bett auf. Für einen Moment desorientiert, sah sie sich um, dann blitzte es, und der Fensterladen knallte. Das also hatte sie geweckt. Es zog wieder ein Gewitter über den Spreewald. Vor der Wende hatte es das nicht gegeben. Wieder knallte der Fensterladen. Mike hätte schon längst den Feststellhaken reparieren sollen. Gleich morgen würde sie es ihm sagen.
Mike war ihr Mieter. Nach der Wende hatte sie die Kahnwerkstatt umgebaut, um an Feriengäste zu vermieten, doch dann hatte sie gemerkt, dass es ihr nicht lag, jede Woche den Schmutz von Fremden wegzuputzen. Also vermietete sie nur noch an Saisonkräfte, die wollten ihre Ruhe und ließen ihr ihre. Außerdem waren die meisten recht geschickt und halfen ihr, wenn es im Haus etwas zu erledigen gab. In diesem Jahr war Mike ihr Mieter. Ihr Nachbar Kurt hatte sie gefragt. Seine Tochter suchte eine Unterkunft für einen jungen Mann, der ein Praktikum in der Apotheke ihres Mannes machte. Sie hatte zugestimmt, obwohl sie nicht gut mit Studierten konnte, außerdem hatten die meistens zwei linke Hände, sah man ja an dem Apotheker, wahrscheinlich schmierte Rena ihm die Schnittchen. Aber Kurt hatte ihr versprochen, dass der junge Mann geschickte Hände hätte, und tief in ihrem Inneren hoffte sie, so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Sie hätte gerne Salben und Tees über die Apotheke verkauft. Nach dem Motto: Eine Hand wäscht die andere. Natürlich nur die Sachen, die über den Ladentisch gehen konnten, nicht das, was sie im Internet verkaufte. Einer der jungen Männer hatte ihr einen Internetshop eingerichtet: Spreewaldhexe dot com. Klang richtig gut. Vor allem ihre Kräuterkerzen waren sehr beliebt. Reich wurde sie zwar nicht davon, aber sie hatte ja auch kaum Unkosten. Sie war weitestgehend Selbstversorger. Aber der Apotheker weigerte sich trotzdem, irgendetwas von ihr in seiner Apotheke zu vertreiben. Er war eben Wessi, er wusste nicht, dass es wichtig war, sich Freunde zu machen. Manuela hatte schon mehrmals versucht, mit ihm zu reden, doch meistens starrte er sie an, als würde er kein Deutsch verstehen. Dabei war sein Deutsch auch nicht das reinste. Er rollte die R-Laute wie Kieselsteine. Er wolle nichts mit ihrem esoterischen Gedöns zu tun haben, hatte Zink ihr durch Rena ausrichten lassen. Esoterisches Gedöns! Manuela schnaubte unwillkürlich. Das konnte nur einem Wessi einfallen. Sie war eine Spreewaldhexe wie ihre Großmutter und ihre Urgroßmutter, und sie war stolz darauf.
Ein Blitz erhellte das Zimmer so hell wie früher das Stroboskoplicht im Discoklub. Gleich darauf erschütterte ein krachender Donner das Holzbohlenhaus am Fließ. Unwillkürlich bekreuzigte sich Manuela. Ihr Urgroßvater hatte das Haus erbaut, seitdem hielt es. Und es würde auch dieses Gewitter überstehen. Nur im Moment fühlte es sich gerade nicht so an. Das war das Leidige am Alleinleben. Irgendwann würde sie tot in ihrem Bett vertrocknen, und niemand würde sie vermissen. Kein Gedanke, der sich für die Dunkelheit eignete.
Manuela tastete nach dem Schalter der Nachttischlampe. Kein Strom. Natürlich nicht. Die Elektrik war so alt wie das Haus. Mit einem Seufzer quälte sie sich auf die Bettkante. Sie war gestern im Fitnessstudio gewesen. Manuela und Fitness, sie schnaubte. Eigentlich passten die beiden Worte nicht in einen Satz, aber sie war zweiundfünfzig, da musste sie ans Alter denken. Nicht, dass sie so endete wie Kurt, der kaum noch zurechtkam, aber zu stolz war, Hilfe anzunehmen. Nicht mal von seiner Tochter. Arme Rena! Sie war ein nettes Mädchen, auch wenn sie einen Wessi geheiratet hatte. Außerdem war der Besuch im Fitnessstudio ein Schnupperangebot gewesen. Nach einem Blick in ihr rundes Gesicht wollte der Trainer sie in den Kurs »Fit in den besten Jahren« stecken. Er versprach ihr, dass sie bei regelmäßigem Training ihren Alltag leichter meistern und dank der gezielten Übungen auch ihren Rücken nicht mehr spüren würde. Manuela wollte in keinen Kurs für Frauen in den besten Jahren, also landete sie im Calanatics-Kurs und verbog sich unter Anleitung einer untergewichtigen Schnepfe. Nun wusste Manuela, welche Muskelgruppen für die Stabilität ihrer Wirbelsäule zuständig waren, weil sie jede einzelne Muskelfaser spürte, und auch ihre Oberschenkel fühlten sich an, als seien sie durch die Wäschepresse ihrer Großmutter gezogen, die mit Thymian und Quendel bepflanzt vor dem Haus stand.
Manuela entzündete die Kerze, die neben ihrem Bett stand, und atmete den Duft von Bitterorange und Lavendel ein, den sie verströmte. Sie würde in die Küche hinuntergehen und einen Stiefmütterchentee ansetzen.
Mit einem Ruck richtete sie sich auf und griff nach dem silbernen Kerzenhalter aus der Aussteuer ihrer Urgroßmutter. Erneut blitzte es, doch diesmal folgte der Donner den Bruchteil einer Sekunde später. Erleichtert atmete Manuela auf. Das Gewitter zog weiter. Nur der Regen prasselte noch auf das Dach.
In der Küche schaltete Manuela die Sicherung wieder ein. Vom Fenster aus sah sie, wie im Kahnschuppen das Licht anging. Sie blinzelte. Mist, dachte sie, das Dachfenster steht offen.
Der Kredit für die Ferienwohnung im Kahnschuppen war noch nicht abbezahlt. Das lag einerseits daran, dass sie nur an Dauermieter vermietete, andererseits an dem Architekten, der voller innovativer Ideen steckte. Unter anderem fand er Dachfenster großartig. Ein unbedingtes Muss, hatte er gemeint. Und weil Manuela ihn großartig fand – wo sich ihre Kraftfelder berührten, bildete sich ein Regenbogen –, besaß die Ferienwohnung nun ein elektrisch zu bedienendes Fenster aus selbstreinigendem Glas, was fast so viel gekostet hatte wie die Küchenzeile.
Ihr Urgroßvater würde sich im Grab umdrehen, wenn er seine alte Werkstatt heute sehen könnte. Er hatte Kähne gebaut und ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Wie man das damals so tat im Spreewald. Manuela liebte es, in den alten Fotoalben ihrer Familie zu blättern. Bilder vom Frühjahrsauftrieb, wenn die Kühe mit dem Kahn auf die Weide gebracht wurden, oder Bilder von der Heuernte, wenn Männer und Frauen mit langen Rechen die Heuschober einrichteten. Ihre Urgroßeltern waren nicht reich gewesen, trotzdem hatten sie dieses Haus gebaut. Schließlich lieferte der Spreewald alles, was sie brauchten. Holz für die Wände und Decken und Reet fürs Dach. Außerdem Nachbarn, die einem halfen. Was fehlte, waren Architekten, die einem teuren Schnickschnack aufschwatzten und dann Ferien im Spa-Hotel in Burg machten.
Na ja, Manuela drehte den Wasserhahn auf und streckte sich nach der Dose mit den getrockneten Stiefmütterchenblättern. Das Licht würde Mike schon wecken. Sie knirschte mit den Zähnen. Auch die Streckung schmerzte. Sport ist Mord, hatte ihr Großvater immer gesagt. Und so ungern sie es zugab, ihr Körper fühlte sich an, als hätte er recht gehabt.
Nachdem sie den Tee vorbereitet hatte, trank Manuela noch ein Glas lauwarmes Wasser. Das half ebenfalls gegen die Schmerzen, und außerdem war es gut für die Figur und vertrieb den Knoblauchgeschmack, der wie ein pelziger Belag auf ihrer Zunge lag. Nach dem verunglückten Training hatte sie sich eine Tiefkühlpizza gegönnt. Das tat sie nicht oft. Manuela legte Wert auf gesunde Ernährung, aber manchmal brauchte frau Tiefkühlpizza. Zum Essen hatte sie ebenfalls ein Glas warmes Wasser getrunken, sozusagen als Antidot. Es lag so viel Kraft in Wasser. Man konnte sich Menschen sogar damit schön trinken, hatte sie erst kürzlich gelernt. Also nicht wirklich schön, sondern nur sympathisch. Es gab Studien, die das bewiesen. Irgendwie stimulierte warmes Wasser im Lustzentrum die Hirnregionen, in denen man Sympathie für andere empfand. Vielleicht sollte sie einmal den Apotheker auf ein Gläschen Wasser einladen. Manuela stellte das Glas in die Spüle. In der Ferienwohnung brannte immer noch Licht, und das Dachfenster war auch noch geöffnet. Leise fluchend stieg sie in ihre Gummistiefel und zog den Regenmantel ihres Großvaters über den Schlafanzug. Sie nahm den Ersatzschlüssel vom Brett und stapfte durch das Gewitter über den Hof. Hoffentlich hatte der Bengel eine Haftpflichtversicherung. Sie klopfte einmal kurz, dann schloss sie auf. Niemand da. Na so was! Dabei war es immer das Erste, was sie ihren Mietern eintrichterte: Niemals das Dachfenster geöffnet lassen, wenn du nicht da bist. Aber so war das mit den jungen Leuten, zuhören war nicht so ihr Ding. Wobei das nicht stimmte, auf die Polen und Rumänen konnte sie sich verlassen, die deutschen Mieter waren das Problem, vor allem, wenn sie jung waren wie Mike. Die kriegten doch allesamt den Hintern bis in die Pubertät gepudert. Manuela war froh, dass sie keine Kinder hatte, obwohl so eine Tochter? Seufzend verbot sie sich den Gedanken. Sie hatte auch ohne Sehnsuchtsgefühle genug auf ihrem Teller.
Direkt unter dem Fenster hatte sich bereits eine Pfütze gebildet. Während sich das Fenster schloss, holte Manuela Mopp und Eimer aus dem Putzschrank und wischte auf. Ihre Oberschenkel protestierten wie bei der einen Übung, die ihr den Rest gegeben hatte. Nachdem der Boden wieder trocken war, sah Manuela sich um. Wenn sie schon einmal hier war, konnte sie auch gleich nach dem Rechten sehen.
Ordentlich war dieser Mike nicht. Wie schon bei ihrem letzten Kontrollbesuch juckte es sie in den Fingern aufzuräumen. Der Esstisch war übersät mit Tabakkrümeln. Und wozu brauchte er eine Kräutermühle? Manuela nahm sie in die Hand und roch daran. Ein harziger Duft, den sie nicht einordnen konnte, stieg ihr in die Nase. Ob Mike das Zeug rauchte? Wahrscheinlich Gras oder wie das hieß. Manuela legte die Mühle zurück. Sie hatte gelegentlich darüber nachgedacht, das Zeug anzubauen, einer ihrer Mieter hatte sie auf die Idee gebracht, aber dann war ihr das doch zu heikel gewesen. Sie beschränkte sich lieber auf das, was im Wald und am Wegrand wuchs, und verarbeitete es, wie es schon ihre Mutter und Großmutter getan hatten. Die alten Rezepte waren immer noch die besten. Manuela schnalzte mit der Zunge und sah sich weiter um. Das Bett war auch nicht gemacht. Eigentlich merkwürdig, weil Mike das immer tat. Nicht dass sie schnüffelte, aber Manuela wusste eben gerne über solche Dinge Bescheid. Als Vermieterin konnte man sonst böse Überraschungen erleben, wenn die Saison vorbei war und die Mieter auszogen. Da half dann auch kein Glas warmes Wasser.
Neben dem Kissen lag Mikes Handy. Es hing am Ladekabel, was erklärte, warum er es nicht mitgenommen hatte. Manuela nahm es in die Hand. Es war flacher als ihr Handy, irgendwie schicker. Was kein Wunder war. Manuelas Handy war alt. Sie konnte damit telefonieren, und mehr tat sie auch nicht. Sie wollte den ganzen Quatsch nicht. Diese modernen Handys veränderten die Aura. Und außerdem – wie hieß es so schön: Wer in den Wald hineinruft, muss mit einem Echo rechnen. Man wusste nie, wer alles in diesen Dingern herumpfuschte und einem nachspionierte. Manuela wollte nicht, dass jemand ihr nachspionierte, sie wollte ihre Geheimnisse bewahren.
Nachdenklich drehte sie das Smartphone in ihrer Hand. Für so ein Teil musste sie bestimmt eine Menge Pilze trocknen und Salben anrühren. Ohne darüber nachzudenken, wischte sie mit dem Daumen über das Display. Ein Chatfenster erschien. Wie nachlässig! Mike hatte nicht einmal eine Sperre. Offensichtlich gehörte er nicht zu den Menschen, die Geheimnisse hatten oder bewahrten. Er war wie ein offenes Buch. Obwohl Manuela nur ein altes Nokia besaß, kannte sie so Sachen wie WhatsApp. Schließlich lebte sie im Spreewald und nicht hinterm Mond. Offensichtlich schrieb Mike sich mit einem oder einer Robbie. Ich komm hier nicht weg, stand da. Die Nachricht war bereits ein paar Tage alt und hatte einen weinenden Smiley ausgelöst. Sofort stieg Mitleid in Manuela auf. Sie sah auf das Datum. Mike war an dem Tag nach Hause gefahren und erst spät in der Nacht zurückgekehrt. Die letzte Nachricht war von heute. Du glaubst es nicht, las sie, aber ich habe gerade einen Geist gesehen!!!! Robbies Antwort war ein staunender Smiley, keine weiteren Erklärungen von Mike, trotz der Ausrufezeichen.
Unruhe stieg in Manuela auf. Hoffentlich gab das keinen Ärger. Mit beiden Händen umschloss sie das Handy, lenkte den Blick nach innen und versuchte, mit Mike Kontakt aufzunehmen. Aber er war zu weit weg und sein Kraftfeld voller grauer Schlieren: eine Seifenblase kurz vor dem Platzen. Unmöglich!
Das Handy entglitt ihren plötzlich kraftlosen Fingern. Manuelas Nackenhaare stellten sich auf. Die Frauen ihrer Familie hatten den siebten Sinn. Ihre Großmutter hatte er vor den anrückenden Russen gewarnt. Gerade noch rechtzeitig war sie mit dem Kahn und ihrer kleinen Tochter in den Hochwald geflohen. Als sie zurückkam, waren alle Hühner verschwunden und die Sau auch. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was den Nachbarinnen passiert war.
Manuelas siebter Sinn sagte ihr, dass Mike etwas passiert war. Sie lief aus dem Haus. Ihr Herz stolperte, es schmerzte wie ihre malträtierten Muskeln. Am Horizont, dort, wo die Landstraße verlief, kreiste Blaulicht über den nächtlichen Himmel.
3. Kapitel
Der Kollege von der Leitstelle war ziemlich verdattert, als Klaudia ihn erneut anrief. Falls er einen Scherz parat hatte, blieb der ihm im Hals stecken, als Klaudia ihm abgehackt von der Leiche im Acker berichtete.
»Fassen Sie bitte nichts an!« Auf einmal siezte er sie. Wahrscheinlich nur, weil dieser Satz in seinen Genen verankert war, doch Klaudia fühlte sich ausgeschlossen. Das Herz wummerte in ihrer Kehle, und oberhalb ihres Magens flatterte die Angst. Sie hatte jemanden überfahren und getötet, nicht vorsätzlich, aber das änderte nichts daran, dass ein Mensch durch ihr Verschulden zu Tode gekommen war. Sie war lange genug Polizistin, um all die Rechtfertigungsgründe aufzählen zu können, die die Last ihrer Schuld minderten. Jemand hatte ihr die Vorfahrt genommen, regennasse Straße, Aquaplaning. Sie hatte keine Gewalt mehr über ihren Wagen gehabt. Wie ein Katapult war er in den Acker gerast. Und dann all die Gründe, die gegen sie sprachen. Sie war zu schnell gefahren, war abgelenkt gewesen: das Kabel. Die Waagschale, in der ihre Schuld wie ein Organ bei einer Obduktion lag, senkte sich.
»Geh zur Straße.« Die Stimme des Kollegen klang weich, fürsorglich. »Demel ist bestimmt gleich da und die anderen auch.«
Er musste Klaudia nicht sagen, wer die anderen waren, sie wusste es selbst. Alle würden anrücken.
»Mach ich«, krächzte sie.
»Soll ich in der Leitung bleiben?«
»Nein«, antwortete sie. »Geht schon. Aber danke.« Sie drückte das Gespräch weg und bückte sich nach ihrer Maglite. Ohne einen weiteren Blick auf die Leiche zu werfen, kraxelte sie die Böschung hoch und stapfte zur Landstraße. Dort stand sie weinend im Regen. Sie hatte einen Menschen getötet. Ein Augenblick der Unachtsamkeit hatte sie zur Mörderin werden lassen. Auch wenn Klaudia es besser wusste, kam sie nicht gegen diese selbstzerfleischenden Gedanken an.
Scheinwerferlicht blendete sie, und dann lag sie auf einmal in Demels Armen. Er drückte sie an sich und strich ihr über den Rücken. Klaudia schluchzte an seiner Brust, bis sein Hemd von ihren Tränen durchnässt war. Unterbrochen von Schluchzern, erzählte sie ihm fast alles, und sie hasste die kleine Stimme in ihr, die sie daran hinderte, ihm die ganze Wahrheit zu sagen.
»Alles wird gut«, murmelte Demel. »Es ist ja nicht deine Schuld.«
»Das Gesicht«, wimmerte Klaudia. »Du hast das Gesicht nicht gesehen.«
»Hör auf.« Demel packte sie an den Schultern und schob sie ein wenig fort von sich. Gerade so weit, dass sie ihm in die Augen sehen musste. »Es ist nicht deine Schuld! Und nun setz dich in meinen Wagen«, sagte er. »Du bist völlig durchnässt.«
»Nein.« Klaudia schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht. Sorry.«
»Du bist völlig durch den Wind.«
»Natürlich bin ich das«, fauchte Klaudia und entschuldigte sich im nächsten Atemzug für ihre heftige Reaktion. »Tut mir leid.« Sie wischte sich mit dem Handrücken die Nase. »Ich weiß, dass du es gut meinst.«
»Du solltest dich wenigstens aufwärmen«, beharrte Demel. »Demeter-Anders ist auf dem Weg.«
»Wa…« Bevor Klaudia die Frage ausgesprochen hatte, wusste sie die Antwort. Natürlich hatte die Leitstelle die zuständige Staatsanwältin benachrichtigt. Dies hier war kein normaler Verkehrsunfall mit Todesfolge, der bestenfalls im Polizeibericht auftauchen würde. Dies war ein Fall von öffentlichem Interesse. Und vor allem von öffentlichem Misstrauen.
»Kennst du einen Anwalt?«, fragte Demel, und auch wenn seine Stimme klang, als würde er übers Wetter reden, wirkte sein Gesichtsausdruck äußerst besorgt.
»Ich bin Bulle«, antwortete Klaudia. »Ich kenne eine Menge Anwälte. Aber ich habe noch nie einen gebraucht.«
»Irgendwann ist immer das erste Mal.«
Klaudia biss sich auf die Unterlippe. »Wahrscheinlich hast du recht.«
Blaulicht zuckte über den nächtlichen Himmel. Zwei Streifenwagen hielten am Straßenrand. Eine uniformierte Kollegin kam auf sie zu, in der einen Hand trug sie eine Stablampe, in der anderen Absperrband. Klaudia atmete tief ein und löste sich aus der tröstlichen Umarmung. »Da hinten.« Sie zeigte aufs Feld. »Etwa fünfzig Meter von hier. Die Frau liegt im Graben.«
»Okay.« Die Kollegin nickte. »Ein Krankenwagen ist unterwegs.«
»Ihr hättet besser den Bestatter bestellt«, entgegnete Klaudia.
»Der Arzt ist für dich«, entgegnete die Kollegin.
»Mir geht’s gut«, erklärte Klaudia. Eine Lüge, der weitere folgen würden.
»Hallo!« Eine Frau tauchte auf einmal zwischen den Polizisten auf. Sie trug einen Regenmantel, der bis zu den Schäften ihrer Gummistiefel reichte.
»Wo kommen Sie denn her?«, fragte Demel und ging mit ausgebreiteten Armen auf die Frau zu. Kein Polizist liebte es, wenn plötzlich Bürger an einem Einsatzort auftauchten.
»Ich wohne da hinten.« Die Frau räusperte sich. »Und ich habe gedacht …« Ihre Augen weiteten sich, während sie sich umsah: Blaulicht, Absperrband, Polizisten, die über den Acker stapften.
»Gehen Sie bitte nach Hause«, bat Demel sie.
»Ich mache mir Sorgen.« Die Frau ignorierte ihn und sprach mit der uniformierten Kollegin. »Weil doch Licht war und das Dachfenster auf. Und da dachte ich …«
»Was dachten Sie?« Demels Tonfall war jetzt verbindlicher, geradezu freundlich. Er sah in der Frau nicht mehr einen Störfaktor, sondern eine potenzielle Zeugin. Klaudia ertappte sich dabei, dass sie die Luft anhielt. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass sie etwas über die Identität der Toten erfuhren.
»Na ja, dass er einen Unfall hatte. Wegen dem Blaulicht und so.«
Er, dachte Klaudia, sie spricht nicht von der Frau, die ich überfahren habe.
»Ich denke, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das hier«, Demel zeigte zum Acker, »hat sicherlich nichts mit Ihrem Sohn zu tun.«
»Er ist nicht zu Hause, und das Licht brannte.« Die Frau schien ihm gar nicht zugehört zu haben. »Ihm ist etwas passiert. Sie müssen sich darum kümmern.« Der letzte Satz galt wieder der uniformierten Kollegin.
»Wie alt ist er denn?«, fragte die Kollegin. Meistens half es, wenn man Anteil nahm.
»Ich weiß nicht.« Die Frau runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach. »Ist das wichtig?«
»Lassen Sie sich Zeit«, erklärte die uniformierte Kollegin. Die Frau musste ziemlich verwirrt sein, wenn sie nicht einmal mehr das Alter ihres Sohnes wusste. Andererseits hatte jeder von ihnen schon die merkwürdigsten Dinge erlebt. Je höher der Stresslevel war, umso geringer war oft die Fähigkeit, sich zu erinnern. Was eine logische Folge war. Stress bedeutete Aktion. Fight or flight. Kämpfen oder fliehen. Es bedeutete nicht: Erinnere dich!
»So Mitte zwanzig«, sagte die Frau schließlich.
»Na dann.« Die uniformierte Kollegin lächelte nun verständnisvoll. »In dem Alter sind junge Männer ja schon mal unterwegs.«
»Aber …«
»Gehen Sie nach Hause«, unterbrach die Kollegin die Frau und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Vielleicht ist er ja schon da.«
»Nein …« Die Frau presste die Zeigefinger gegen die Schläfen. »Er ist in Gefahr.« Ihr Blick traf Klaudias. Die Frau trat einen Schritt vor, streckte die Hand nach ihr aus. »Sein Kraftfeld ist voller Schlieren«, flüsterte die Frau. »Es verblasst.« Ihre Stimme war nur noch ein Hauch.
»Auch das noch«, zischte Demel zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
»Was immer Sie gespürt haben …« Klaudia fragte sich, von welchem Planeten diese Frau gerade funkte. Doch irgendwie normalisierte ihr merkwürdiges Verhalten die Situation für sie. Mit dieser verwirrten Frau umzugehen half ihr gegen die Panik, die nur darauf wartete, sie niederzuringen. Sie hatte einen Menschen überfahren. Ein Gedanke wie ein Messer in der Kehle. Weil sie für einen Moment abgelenkt gewesen war, war eine Frau tot.
»Ja?« Die Frau blickte ihr aufmerksam ins Gesicht.
»Ja, was?« Klaudia hatte den Faden verloren.
»Sein Kraftfeld. Ist er …?« Die Frau zeigte in Richtung der Unfallstelle.
»Nein«, beruhigte Klaudia die verwirrte Frau. Zwar war das Gesicht der Toten zerstört, doch ein Mann lag dort mit Sicherheit nicht.
»Das Gesicht«, murmelte sie. »Wieso eigentlich das Gesicht?«
»Denk nicht dran! Und Sie …«, Demel griff nach dem Arm der Frau, »… gehen jetzt bitte.«
»Aber was ist mit Mike?«
»Er wird schon wieder auftauchen. Junge Männer sind schon mal nachts nicht zu Hause.«
»Aber ich weiß, dass ihm etwas passiert ist«, beharrte die Frau. »Wegen seinem Kraftfeld.« Sie begann zu schluchzen.
Ihr Ausbruch war wie das Weinen eines Kindes. Heftig, laut und – ja, schamlos. Klaudia legte den Arm um die schluchzende Frau, ihre Hand strich über den nassen Regenmantel. Es fühlte sich an, als würde sie sich selbst trösten.
4. Kapitel
Die Ärztin hatte ein ernsthaftes Gesicht mit müden Falten in den Mundwinkeln. Mit einer dünnen Stablampe leuchtete sie Klaudia erst ins linke, dann ins rechte Auge. »Ist Ihnen schwindelig?«, fragte sie.
Klaudia blinzelte die blutroten Schlieren weg, die vor ihren Pupillen kreisten. Die Frage traf sie unvermittelt. Blut rauschte in ihren Ohren. Wieso fragte die Ärztin ausgerechnet nach Schwindel? Die Seitentür des Rettungswagens flog auf, bevor sie antworten konnte. Ein Schwall kalter Nachtluft wehte mit Demeter-Anders in den Krankenwagen.
Klaudia richtete sich auf der Trage auf, dabei vermied sie es, die Ärztin anzusehen. Noch nie war sie so froh über die Anwesenheit der Staatsanwältin gewesen. Ihre Erleichterung war jedoch nur von kurzer Dauer. Aufgeschoben war nicht aufgehoben, und das Gespräch mit Demeter-Anders würde schließlich auch kein Vergnügen werden. Ein winziger Augenblick der Unachtsamkeit und ein Idiot ohne Licht hatten sie aus ihrem Leben katapultiert.
»Wie geht es Ihnen?« Demeter-Anders streifte die Kapuze ihrer Multifunktionsjacke ab und strich sich die blonden Haare zurück. Nicht, dass das nötig gewesen wäre. Klaudia dachte an die Haarsprayreklame ihrer Kindheit. Egal wie, egal wo: Die Frisur sitzt perfekt. Und nicht nur die Frisur. Obwohl es mitten in der Nacht war, hatte die Staatsanwältin sogar noch Zeit gefunden, Lippenstift und Puder aufzutragen. Ansonsten war sie der Witterung und dem Anlass entsprechend gekleidet und trug Designerjeans zu Gummistiefeln, die auch nicht gerade wie ein Schnäppchen aussahen. Dies alles nahm Klaudia wahr, weil ihr Gehirn trotz des Schocks in den Ermittlermodus geschaltet hatte.
»Ganz okay«, sagte sie schließlich, weil sie irgendetwas sagen musste. »Ein bisschen wackelig auf den Beinen.« Klaudia versuchte ein Grinsen, das jedoch misslang. Demeter-Anders sah nicht unfreundlich aus. Ihre Stimme klang sogar aufrichtig besorgt, trotzdem spürte Klaudia, wie ein Kloß in ihrer Kehle wuchs: ein stacheliger Ballon, der sich in ihrem Hals breitmachte. Unwucht! Das Wort traf es. Sie lauschte in ihren Kopf hinein. Der Tinnitus war da. Er war nicht laut, nicht leise, sondern vielleicht ein bisschen schriller als sonst. Ein alter Bekannter, mit dem sie sich arrangiert hatte. Es fühlte sich nicht an wie damals. Klaudia wusste, dass sie sich selbst belog. Sie hatte keine Ahnung, was damals passiert war und wie es sich angefühlt hatte. Sie war betrunken gewesen und in Uwes Armen gelandet. Er hatte angenommen, sie wäre gestolpert, und sie hatte ihn in diesem Glauben gelassen. Gestolpert klang so viel besser als Blackout. Seit damals hatte sie nie wieder zu viel getrunken und auch nie wieder ein Blackout gehabt. Bis heute? Klaudia strich sich die Haare hinter die Ohren und ärgerte sich gleichzeitig über diese Geste. Sie verriet ihre Unsicherheit. Sie musste sich zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen. Die Ärztin konnte tausend Gründe haben, warum sie ausgerechnet nach Schwindel fragte. Außerdem hatte Klaudia nicht das Gefühl, dass sie ein Blackout gehabt hatte. Bis zur Frage der Ärztin hatte sie nicht einmal an diese Möglichkeit gedacht. Ihren Menière geheim zu halten war ihr so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie ihn selbst fast vergessen hatte. Und er hatte es ihr leichtgemacht: seit Jahren kein Schwindel, kein Blackout. Und jetzt hatte die Frage der Ärztin eine Möglichkeit eröffnet, die das Potenzial hatte, Klaudias Leben zu schreddern.
»Würden Sie bitte noch einen Moment draußen warten«, bat die Notärztin und sah Demeter-Anders auffordernd an. »Ich bin noch nicht fertig mit meiner Untersuchung.«
»Mir geht’s gut, wirklich.« Klaudia schob sich von der Liege und taumelte.
»Das entscheide ich.« Obwohl die Ärztin noch sehr jung war, lag so viel Autorität in ihrer Stimme, dass Demeter-Anders widerspruchslos – was durchaus bemerkenswert war – den Rettungswagen verließ und Klaudia sich wieder auf die Liege setzte.
»Mir geht es wirklich gut.« Sie klammerte sich an diese Behauptung wie an ein Rettungsseil.
»Sie haben einen leichten Nystagmus.« Die Ärztin sprach recht laut und betont, so als sei sie sich nicht sicher, dass Klaudia sie wirklich verstand.
»Sie meinen Pupillenzittern?« Klaudia widerstand der Versuchung, sich dumm zu stellen.
»Und Sie sind ein bisschen taumelig auf den Beinen.«
»Ja, ich weiß.« Klaudia schlug den sichersten Weg ein: zugeben, was sich nicht leugnen ließ, und nur am Bezugsrahmen drehen. »Mein Kreislauf ist mir wohl gerade abhandengekommen.« Diesmal gelang ihr ein Lächeln.
»Hatten Sie schon mal Probleme mit den Ohren?«
»Ich hatte einen Hörsturz, aber das ist eine Weile her.«
»Keine Ohrgeräusche, nichts?«
»Nein.« Klaudias Tinnitus sirrte unbeeindruckt von ihrer Lüge weiter in ihrem kranken Ohr. »Ich hatte Glück.«
»Okay.« Die Ärztin sah auf ihre Armbanduhr und schrieb etwas auf ihr Klemmbrett. »Möglicherweise haben Sie ein leichtes Schleudertrauma davongetragen. Sollten Sie also in den nächsten Tagen das Gefühl haben, Ihr Kopf würde Ihnen vom Hals purzeln, dürfte das der Grund sein. Sollten Sie jedoch Schwindel verspüren, müssen Sie einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Ein Hörsturz kann sich wiederholen. Vor allem in belastenden Situationen.«
»Mach ich.«
»Brauchen Sie etwas zum Schlafen?«
»Danke, nein.«
»Also gut«, sagte die Notärztin. »Dann überlasse ich Sie jetzt Ihrer Kollegin.« Sie klopfte gegen die Plexiglasscheibe, welche die Fahrerkabine von der Versorgungseinheit trennte.
»Passen Sie auf sich auf.« Die Ärztin schob die Tür für Klaudia auf und starrte auf den Acker hinaus. Die Kollegen der Spurensicherung waren mittlerweile eingetroffen. Am Rande des Weges besprachen sie sich mit Demel. Eine der weißvermummten Gestalten musste Wibke sein, doch Klaudia hätte nicht sagen können, welche.
»Scheißsituation, was?«, sagte die Ärztin.
»Ja.« Klaudia atmete tief ein und stieg mit zitternden Knien aus. Die Luft war warm und regennass.
»Wir müssen los.« Ein Rettungssanitäter beugte sich aus dem Seitenfenster. »Brustschmerzen in Burg.«
»Vielen Dank.« Klaudia trat zurück und sah dem Krankenwagen hinterher, der langsam abfuhr. Demeter-Anders trat neben sie. In der einen Hand hielt sie einen Schirm, in der anderen einen Kaffeebecher, den sie Klaudia in die Hand drückte.
»Habe ich den Kollegen von der Spusi abgeschwatzt«, sagte sie. »Und noch Zucker reingetan.« Wie die meisten Kriminalisten hielt auch die Staatsanwältin Kaffee mit viel Zucker für das beste Mittel gegen Schock.