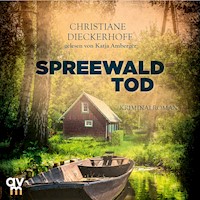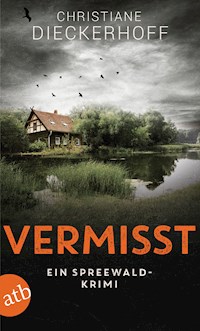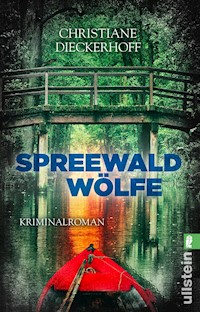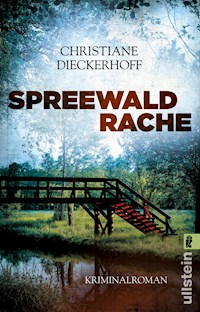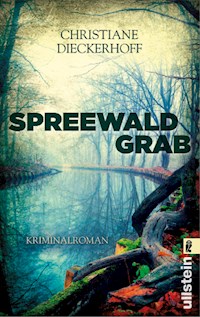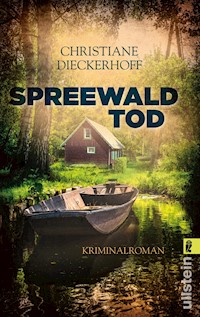
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Toter im Fließ stellt Kommissarin Klaudia Wagner vor eine neue Herausforderung. Dabei ist sie nach ihrem letzten spektakulären Fall noch psychisch angeschlagen und hat Probleme, mit ihrem verhassten Kollegen Demel zusammenzuarbeiten. Erste Spuren führen die beiden zu einem scheinbar korrupten Gurkenbauern, schließlich war der Tote ein Erntehelfer aus Rumänien. Aber bald gibt es eine weitere Leiche. Wer will diese Menschen aus dem Weg räumen? Klaudia droht in einem Strudel aus Intrigen unterzugehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Polizistin Klaudia Wagner ist eigentlich aus dem Ruhrgebiet in den Spreewald gezogen, um dort mehr Ruhe zu finden. Doch ihr beruflicher Start in Lübbenau war nicht nur dramatisch, sondern auch steinig. Seitdem ist die Situation für die Kriminalobermeisterin kaum einfacher geworden: Klaudia muss mit ihrem ungeliebten Kollegen Demel in einem neuen Fall ermitteln. Ein toter Mann wurde in einem Fließ gefunden. Erste Spuren führen zu einem Gurkenbauern aus der Gegend, der Tote stammte aus Rumänien und war dort als Erntehelfer beschäftigt. Ein ausländerfeindlicher Hintergrund könnte das Motiv sein. Klaudia hatte das Opfer zuvor im Streit mit einem Neonazi beobachtet. Doch dann gibt es eine weitere Tote, und Klaudia muss erkennen, dass die Intrigensümpfe im Spreewald tief sind. Eine Fehde, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, wirft auch heute noch ihre Schatten …
Die Autorin
Christiane Dieckerhoff, Jahrgang 1960, machte eine Berufsausbildung zur Kinderkrankenschwester, ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt in Datteln. Sie schreibt vor allem aktuelle und historische Krimis.
Von Christiane Dieckerhoff ist in unserem Hause bereits erschienen:
Spreewaldgrab
CHRISTIANE DIECKERHOFF
Spreewald
Tod
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1383-2
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Februar 2017
© 2017 by Christiane Dieckerhoff
© dieser Ausgabe 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Hört das Herz eines Menschen auf zu schlagen, ist er nicht sofort in Gänze tot, auch wenn es so scheint. Also war auch der junge Mann noch nicht ganz tot, der in dieser mondhellen Nacht im Fließ trieb. Sein Körper wurde von der sanften Strömung getragen, Fingerknöchel und Fußrücken glitten durch den zähen Schlamm und schreckten Strudelwürmer und Flohkrebse auf. Angelockt durch den Duft seines Blutes, setzte sich eine Mücke auf den ungeschützten Nacken des Mannes und stach zu, aber das spürte er nicht mehr. Sein Bewusstsein war mit einem Schlag erloschen, auch wenn seine Hirnzellen noch weitere zwei Minuten leben würden. Sein Herz hatte noch ungefähr acht Minuten, obwohl es schon längst aufgehört hatte zu schlagen. Die Zellen in der Lunge des Mannes würden noch eine, vielleicht zwei Stunden überleben, obwohl die Atemwege mit brackigem Flusswasser gefüllt waren. Die Muskelzellen hatten noch acht Stunden zu leben, und nach einem Tag würden gasbildende Bakterien im Magen-Darm-Trakt anfangen, seine Innereien zu verflüssigen. Sein Sperma würde erst nach drei Tagen zugrunde gehen. Und zwar in einem Kühlfach der Rechtsmedizin in Berlin. Aber noch trieb der Mann im dunklen, trüben Wasser. Er wurde nicht einmal von dem Entenpärchen bemerkt, das auf einem Baumstamm schlief, der das Fließ an dieser Stelle verengte. Eine Schulter des Mannes verfing sich im Gestrüpp der Äste, und der Körper drehte sich sanft mit der Strömung, bis er sich an den Stamm schmiegte, so als wolle er Schutz suchen, sich verstecken. Aber es war zu spät. Das Schicksal hatte den jungen Mann schon gefunden.
1. Kapitel
»Puh, das war mal laut.« Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner schüttelte den Kopf. Noch immer dröhnten die Beats in ihren Ohren.
»Ist doch toll«, widersprach Wibke Bredau, die mit ihr am Rand der Tanzfläche saß. Ihr hatte Klaudia es zu verdanken, dass sie diesen Sommerabend im Hecht und nicht in ihrer stickigen Einliegerwohnung verbrachte. »Mal was anderes.«
»Ich weiß nicht.« Klaudia griff sich ins Haar und ließ etwas Luft an ihren schweißfeuchten Nacken.
Nachdem der Spreewald im Frühjahr fast abgesoffen war, hing nun die Hitze wie eine Heizdecke über den Fließen. Klaudia beneidete die Enten, die den ganzen Tag auf dem Wasser herumschwammen. Die Sahara konnte nicht heißer sein als der Spreewald in diesem August. Den Urlaubern war es recht. So mussten Ferien in Deutschland sein.
Doch wenn man im Dachgeschossappartement eines Kollegen lebte und seine Tage im ebenso stickigen Dachgeschoss des Polizeireviers in Lübben verbrachte, war man froh über jede Abkühlung. Aber die hatte nicht einmal das heftige Gewitter gebracht, das Montag wie die apokalyptischen Reiter über Lübbenau hereingebrochen war. Also war Klaudia Wibkes Anruf sehr willkommen gewesen. Das Hechtfest ist toll, hatte die Spusi-Technikerin gesagt, und: Du brauchst Abwechslung! Du kannst schließlich nicht immer nur arbeiten und grübeln. Das letzte Argument hatte den Ausschlag gegeben. Klaudia wollte fort aus der Hitze und fort von ihren Gedanken, die sich so schnell zu der Sache mit Joe verirrten.
»Ich hol uns was zu trinken.« Wibke stand auf und beugte sich vor, um die Gläser mitzunehmen.
»Ich hab noch nicht mal ausgetrunken«, protestierte Klaudia. Wenn sie zu viel Bier trank, würde sie die meiste Zeit in der Schlange der Frauen verbringen, die am Fließ entlang vor dem einzigen Damenklo anstanden, und dazu hatte sie wenig Lust.
»Stell dich nicht so an«, antwortete Wibke. »Bei der Hitze musst du viel trinken.«
»Ich bezweifle, dass dieser Rat für Babbenbier gilt«, murmelte Klaudia, leerte aber doch ihr Glas. Es hatte keinen Sinn, Wibke zu widersprechen. »Du willst doch sowieso nur mit dem Bassisten flirten.« Sie wischte sich den Schaum von der Oberlippe.
»Mit ihm oder seinem Sohn.« Wibke zwinkerte ihr zu und schlängelte sich zwischen den Gästen hindurch, die noch immer auf der Tanzfläche herumstanden, als könnten sie nicht glauben, dass die Band eine Pause machte.
Klaudia schaute ihr nach. Die Kollegin trug ein geblümtes Sommerkleid und ihr dichtes rotes Haar zu einem Zopf geflochten, der ihr bis zur schmalen Hüfte reichte. Für einen Moment überlegte Klaudia, ob sie sich nicht die Haare wachsen lassen sollte, verwarf den Gedanken jedoch gleich wieder. Mit Anfang vierzig war sie zu alt für Experimente, und um so einen dichten Zopf wie Wibke zu haben, würde sie eine Haartransplantation brauchen. Freundschaftlicher Neid stieg in ihr auf. Die Kollegin musste Mitte dreißig sein, aber so wie sie aussah und sich bewegte, ging sie auch für Mitte zwanzig durch. Sie zog die Blicke auf sich, Männer jeder Altersgruppe strafften die Schultern, und die Frauen bekamen schmale Lippen, wenn sie Wibke sahen.
Mich würden sie nur bemerken, wenn ich ihnen auf die Füße trete, dachte Klaudia. Aber das war ihr nur recht. Sie fühlte sich wohl mit ihren mausblonden, schulterlangen Haaren und ihrem Standard-Outfit, bestehend aus Jeans und Polohemd. Klaudia lehnte sich zurück und malte mit dem Zeigefinger in dem feuchten Kreis herum, den ihr Glas auf der Tischplatte hinterlassen hatte. Nach der Sache im Frühjahr konnte sie gut auf männliche Aufmerksamkeit verzichten. Apropos verzichten: Der liebe Kollege Demel drängelte sich nun ebenfalls über die Tanzfläche, leider nicht in Richtung Theke, sondern in ihre.
Klaudias Unterkiefer versteifte sich. Geh weiter, dachte sie und starrte auf die Tischplatte vor sich. Zuckende Gliedmaßen, Blut. Hastig schaute sie auf und damit direkt in Peter Demels wasserblaue Augen.
»Hi«, sagte er.
Unwillkürlich schob Klaudia ihren Stuhl zurück. Seine schweißfeuchten blonden Haare lockten sich an den Schläfen. Zu T-Shirt und Jeans trug er einen dezenten Dreitagebart, der sein Gesicht schmaler wirken ließ.
Lustlos erwiderte sie seinen Gruß. Seit der Sache im Frühjahr versuchte sie, dem Kollegen aus dem Weg zu gehen. Was ganz gut funktionierte, weil Demel zur Dienststelle in Königs Wusterhausen gehörte.
»Du hier?«, fragte Demel das Offensichtliche.
»Sieht so aus.« Klaudia hatte nicht die Absicht, es ihm leichtzumachen. Sie wollte nicht mit ihm reden.
Demel blinzelte verlegen. Er sah aus, als wüsste er nicht, was er als Nächstes sagen könnte. Was hatte er erwartet? Dass sie ihn einlud, sich zu ihr zu setzen? Warum nur war er an ihren Tisch gekommen? Er hätte so tun können, als würde er sie nicht sehen. Sie hätte das gemacht. Dunkel genug war es, und der Raum war voller Menschen.
»Darf ich?« Demel zeigte auf den Stuhl, auf dem gerade noch Wibke gesessen hatte.
Oh nein, bitte nicht, dachte Klaudia, nickte aber. Der Demel von früher hätte sich einfach so gesetzt, rittlings und breitbeinig. Aber auch Demel hatte seit der Sache mit Joe viel von seiner raumgreifenden Art verloren. Das machte ihn nicht sympathischer, aber immerhin erträglicher.
»Was macht der LKW-Fahrer aus der Neckarsulmer Straße?«, fragte er.
Der will doch jetzt nicht wirklich Small Talk machen? Klaudia schielte an Demel vorbei zur Theke. Wo blieb nur Wibke? Mist. »Ist immer noch tot«, sagte sie schließlich, bevor die Pause zu peinlich wurde.
»Wir haben morgen zusammen Bereitschaft. Wusstest du das?«
»Nein.« Diesmal kam Klaudias Antwort schneller. »Warum?«, fügte sie hinzu, obwohl sie die Antwort ahnte. Seit den Ereignissen im Frühjahr war die Dienststelle in Lübben unterbesetzt, und jetzt hatte sich auch noch ihr rennradbegeisterter Kollege Thang Rudnik bei der Teichfahrer-Weltmeisterschaft in Bischdorf das Fußgelenk gebrochen. Also war klar, dass sie Verstärkung brauchten. Aber musste es ausgerechnet Peter Demel, die Allzweckwaffe aus Königs Wusterhausen sein? Teichfahrer-Weltmeisterschaft. Klaudia schüttelte unwillkürlich den Kopf. Sie hatte nicht einmal gewusst, dass es so etwas überhaupt gab.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Demel über die ersten Beats der wieder einsetzenden Musik hinweg. »Jetzt ist sowieso Saure-Gurken-Zeit.«
»Ich nehm dich beim Wort«, sagte Klaudia.
Demel sah aus, als wollte er noch etwas sagen, aber als Wibke nun doch an den Tisch zurückkehrte, verabschiedete er sich hastig.
»Hab ich den Kollegen etwa vertrieben?« Wibke schob ein Glas schäumendes Schwarzbier über den Tisch und setzte sich mit einem zufriedenen Seufzen.
»Das war wohl eher ich.«
»Bist du immer noch sauer auf ihn?«
»Sauer?« Klaudia schüttelte den Kopf. Sauer war man, wenn einem jemand den letzten Parkplatz vor der Nase wegschnappte. »Hilflos«, »fassungslos«, »außer sich« waren Worte, die eher zutrafen, wenn man vor versammelter Mannschaft als dämliche Fotze beschimpft wurde. »Nicht wirklich«, antwortete sie schließlich, weil jede andere Antwort zu heftig für einen netten Abend mit Schwarzbier und Seniorenrock war. »Aber irgendwie hängt das trotzdem in der Luft.«
»Ihr solltet darüber reden.«
»Machen wir.« Klaudia trank einen Schluck. Schaum stieg ihr in die Nase. Hastig setzte sie das Glas ab. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort.
»Das solltest du wirklich tun.« Wibke beugte sich vor, damit sie nicht so schreien musste. »Wenn du hierbleiben möchtest, musst du reinen Tisch machen.«
Wer sagt, dass ich hier bleibenmöchte?, dachte Klaudia und drehte mit beiden Händen das Glas auf dem Tisch. Sie schaute in den bräunlichen Schaum, beobachtete das Platzen der feinen Bläschen. Dieses Gespräch führten sie nicht zum ersten Mal. Klaudia fühlte sich wie das Kind in Brechts Der kaukasische Kreidekreis: Wibke drängte sie, zu bleiben, und ihr Vater wollte, dass sie nach Hause kam. Nach Hause. Unwillkürlich blies Klaudia die Wangen auf. Ihr Zuhause war nicht das Haus ihres Vaters gewesen, sondern die Eigentumswohnung in Essen. Aber da brütete die Neue vom Ex jetzt ihr Kind aus. Wenn sie nicht schon geworfen hatte.
Eifersucht ist schrecklich nicht wahr?, hörte sie Joes wispernde Stimme. Eifersucht tötet. Klaudia rieb sich die schweißfeuchten Arme. Träge wie Eiswasser trieb Joes Stimme durch ihre Gedanken. Dabei sollte er doch ein für alle Mal verstummt sein. Schließlich hatte sie ihn erschossen. Fröstelnd hob Klaudia die Schultern. Auf einmal lag Wibkes Hand auf ihrem Unterarm.
»Joe wirst du auch nicht los, wenn du wegläufst«, sagte die Kollegin.
»Kannst du Gedanken lesen?« Klaudia hob das Glas und trank das bittersüße Bier. Mit jedem Schluck, der kalt durch ihre Kehle rann, verblasste Joes Gesicht. Wibke hatte ja recht. Ein Umzug würde auch nichts ungeschehen machen. Der tote Kollege würde sie ebenso verfolgen, wie es der lebende getan hatte. Außerdem wäre sie in jeder anderen Dienststelle die Neue, die innerhalb eines Jahres zweimal gewechselt hatte. Also ein potentielles Problem. Hier glaubten die Kollegen zumindest nicht mehr, dass sie eine trockene Alkoholikerin war, auch wenn sie nicht wussten, was sie so lange außer Gefecht gesetzt hatte. Ihr krankes Ohr ging nur sie selbst etwas an, und außerdem verhielt es sich seit ihrem Zusammenbruch vorbildlich.
»Ich finde auf jeden Fall, dass du bleiben solltest«, sagte Wibke mit Nachdruck.
»Du erwähntest es gelegentlich.« Klaudia lächelte nachdenklich. Nach den Ereignissen im Frühjahr war Wibke so etwas wie ihre Freundin geworden. Dabei war Klaudia sich überhaupt nicht sicher, ob »Freundin« der richtige Begriff war. Sie hatte keine Erfahrung mit Freundschaft. Als Tochter einer alkoholkranken Mutter hatte sie lange Zeit nicht gewagt, andere Menschen in ihr Leben zu lassen, und als sie nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Vater zog, hatte sie nicht gewusst, wie man Freundschaften schloss. Freundinnen hatten immer nur die Zwillinge nach Hause gebracht, oder die Austauschschülerinnen.
»Wir wussten nicht, wohin mit dem Mädchen«, drang eine Stimme vom Nebentisch in ihre Gedanken. Irritiert stellte Klaudia das Glas ab.
»Den ganzen Platz mussten wir evakuieren.«
Erleichtert griff sie wieder nach ihrem Bierglas. Nicht von ihr war die Rede, sondern von dem Blitz, der am Montag auf dem Campingplatz am Schloss eingeschlagen und nicht nur den Kollegen von der Feuerwehr eine unruhige Nacht beschert hatte.
»Was ist nun mit deinem Bassisten?«, fragte sie, um Wibke abzulenken.
So bereitwillig Wibke ihr zuprostete, so wenig ließ sie sich vom Thema ablenken. »Irgendwann musst du dich deinen Dämonen stellen.«
»Vielleicht hast du ja recht.« Klaudia antwortete ohne Überzeugung. Sie hasste sich selbst für ihre Unentschlossenheit. »Du siehst ja, wohin mich das Weglaufen gebracht hat.«
»Ins wunderschöne Lübbenau. Ich weiß!« Wibke hob die Hände, um möglichen Widerspruch abzuwehren. »Aber das mit Joe hätte dir überall auf der Welt passieren können. Und hier ist es jetzt ja wohl unwahrscheinlicher als irgendwo anders, dass dich noch einmal ein Kollege umbringen will.«
»Du meinst, außer PH?« Wie alle im Revier, sprach Klaudia den Spitznamen mit englischer Betonung aus.
»So schlimm ist er gar nicht«, verteidigte Wibke den Chef des Lübbener Polizeireviers. »Und immerhin kennst du die Leute hier jetzt. Woanders würdest du wieder bei null anfangen.«
»Wen kenn ich schon?« Freudlos lachte Klaudia auf.
»Mich zum Beispiel«, antwortete Wibke prompt. »Und Schiebschick. Hier wimmelt es nur so von netten Menschen. Du wirst sehen.«
»Hier wimmelt es von Touristen.«
»Stimmt nicht.« Wibke drehte sich um. »Im Gegenteil. Heute wimmelt es hier nur so von Einheimischen. Zum Beispiel die Gurkenbauern und ihre Leute dahinten. Das ist der Thomas.« Sie zeigte auf einen Mittvierziger, der ein Mädchen über die Tanzfläche schob. »Nein«, korrigierte sie sich, als das Paar eine elegante Drehung hinlegte und sie das Gesicht des Mannes sehen konnten. »Das ist der Marco. Er und seine Frau bewirtschaften einen Hof in Klein Radden.«
»Die ist aber jung.« Klaudia musterte das Mädchen, das gelangweilt zur Decke starrte.
»Die Kleine doch nicht.« Wibke prustete in ihr Bier. »Die könnt doch glatt seine Tochter sein.«
»Vielleicht ist sie es.«
»Nein.« Wibke schüttelte den Kopf. »Marco und seine Frau haben keine Kinder.«
»Du kennst auch wirklich jeden hier, oder?«, sagte Klaudia scherzhaft.
»Nur die Älteren.«
»Das ist jetzt nicht dein Ernst?«
»Doch wirklich«, beteuerte Wibke. »Alles alter Gurkenadel.«
»Du etwa auch?« Klaudia kühlte sich die Stirn an ihrem Glas. Sie versuchte sich Wibke huldvoll lächelnd als Gurkenkönigin mit Krönchen und Silbergurke in der Hand vorzustellen. Ein Kichern kitzelte sie in der Kehle.
»Aber natürlich.« Wibke warf sich in die Brust. »Hab ich dir etwa nicht erzählt, dass mein Opa den Spargel in den Spreewald gebracht hat?«
»Du kommst wirklich vom Hof?« Klaudia nippte an ihrem Babbenbier. Wenn man sich erst einmal an den Geschmack gewöhnt hatte, schmeckte es richtig süffig.
»Ursprünglich ja. Mein Vater war Wiedereinrichter, aber der Hof ist schon lange weg. Nach dem Tod meiner Mutter hat er seinen Kummer in Selbstgebranntem ertränkt.«
»Lebt er noch?«
»Ja«, antwortete Wibke. »Irgendwie schon.« Sie wischte sich über die Wangenknochen und grinste schief.
»Das tut mir leid.« Klaudia fragte nicht nach, was diese geheimnisvolle Bemerkung bedeuten sollte. Sie alle hatten ihr Päckchen zu tragen, und ihr eigenes war gerade schwer genug.
»Muss es nicht.« Wibke drehte den Bierkrug in den Händen. Sie atmete tief ein. »Ich mag meinen Job. Die akribische Spurensuche und so. Außerdem ist es nicht so einfach mit der Landwirtschaft hier, und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger.«
»Schwer ist es überall.«
»Wahrscheinlich«, antwortete Wibke. »Das ist übrigens der Thomas.« Sie zeigte auf einen Mann am Rande der Tanzfläche. »Macht jetzt in Bio. Soll aber nicht ganz astrein sein.«
Klaudias Herzschlag setzte aus und wummerte dann in ihrer Kehle. Joe.Grelles Licht. Bleilider. Kann nicht schlucken. Kann nicht atmen. Ihre Hände verkrampften sich um das Glas in ihrer Hand, führten es zum Mund. Mit dem Bier schluckte sie ihre Panik herunter. »Und was bedeutet das?« Sie räusperte das Krächzen aus ihrer Kehle und rettete sich in einen lahmen Scherz. »Nimmt er etwa Turbodünger?«
»Keine Ahnung«, antwortete Wibke achselzuckend. »Die Leute reden halt. Vielleicht wundern sie sich auch nur, weil er nach so langer Zeit zurückgekommen ist und den Hof übernommen hat. Schließlich hat er bis vor zwei Jahren in Berlin im IT-Bereich gearbeitet.« Wibke tauchte den Zeigefinger in den Bierschaum und steckte ihn nachdenklich in den Mund. Sie schien nichts von Klaudias Panikattacke bemerkt zu haben.
»Und warum ist er zurückgekommen?«
»Aussortiert haben sie ihn, sagt seine Mutter. Zu alt.«
»Zu alt?« Klaudia schätzte diesen Thomas auf Anfang vierzig. Höchstens. Sie zwang sich, ihn genauer anzuschauen. Sein Gesicht war hagerer als Joes. Irgendwie passte der schmale Kopf nicht richtig zu den kräftigen Schultern. Je länger sie hinschaute, umso mehr Unterschiede bemerkte sie: Der Mann war breiter gebaut und auch kleiner als Joe. IT hin oder her. Ihr Herz beruhigte sich. Ein Bauer halt, wie auch dieser Marco. Die beiden Männer strahlten etwas Bodenständiges aus. Man konnte sie sich gut auf einem Trecker vorstellen, oder auch in einem mit Spreewaldgurken beladenen Kahn.
»Er ist etwa zwei Jahre älter als ich«, bestätigte Wibke Klaudias Vermutung. »Ist direkt nach dem Abi nach Berlin. Hat es nicht ausgehalten in der Provinz. War ihm immer alles zu klein hier und zu eng. Und nun ist er wieder da. Schon verrückt, oder?«
»Nicht verrückter als so manches andere, was einem im Leben passieren kann.« Klaudia biss sich auf die Unterlippe. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Scheiße.« Wibke griff nach ihrer Hand und drückte sie. »Tut mir leid. Lass uns tanzen.«
Ihren Widerspruch ignorierend, zog sie Klaudia auf die Tanzfläche, wo sie so ausgelassen tanzte, dass Klaudia gar nichts anderes übrigblieb, als trotz der Hitze ebenfalls herumzuhopsen.
»Gezz bin ich ma dran, wa?« Schiebschick schob sich zwischen Klaudia und Wibke. Seit den Ereignissen im Haus der alten Frau Nowak betrachtete sich der Kahnführer als Klaudias persönliche Leibwache.
»Aber benimm dich.« Scherzhaft drohte Wibke ihm mit dem Zeigefinger. »Nicht, dass mir Klagen kommen, wa?«, imitierte sie den Kahnführer.
Atemlos wischte sich Klaudia die schweißnassen Hände an ihrer Jeans ab und ließ sich von Schiebschick im Schneckenslowfox über die Tanzfläche schieben.
Es war weit nach Mitternacht, als sie sich dann doch noch in die Schlange vor dem Damenklo einreihen musste. Wibke begleitete sie auf den Anleger und nutzte die Auszeit für eine genussvolle Zigarette.
Grillen zirpten, und vom Fließ hallte das dumpfe Klacken der vertäuten Boote, die in der leichten Strömung aneinanderstießen. Paare saßen engumschlungen auf den Holzbohlen des Anlegers und schauten ins Wasser.
»Ist es nicht herrlich?« Wibke legte den Kopf in den Nacken und schaute zum nächtlichen Himmel hoch. »Im Frühjahr hab ich gedacht, es hört nie wieder auf mit dem Regen. Und nun ist Sommer.«
»Wenn nur die Mücken nicht wären.« Klaudia erschlug ein besonders blutrünstiges Exemplar, das sich auf ihrem Arm niedergelassen hatte.
»Die stechen nur die Zugereisten. Nächstes Jahr ignorieren sie dich.« Wibkes Zigarettenrauch schob sich als Schleier vor die Sterne.
»So schnell gibst du nicht auf, oder?« Klaudia verschränkte die Arme vor der Brust. Die leichte Brise trocknete den Schweiß auf ihrer Haut und ließ sie frösteln.
»Nicht, wenn es sich lohnt.« Wibke schnippte die Zigarette ins Wasser. Wie ein Glühwürmchen flog sie durch die Nacht, bevor sie mit einem Zischen verlosch.
Klaudia trat zur Seite, um einer Frau Platz zu machen, die gerade die Toilette verließ.
»Danke.« Freundlich lächelnd schob sich die Frau an ihr vorbei. Sie stutzte, als sie Wibke sah, und ihr Lächeln bekam etwas Starres.
»Na? Auch mal wieder abtanzen?«, fragte Wibke.
»Mein Gott, die Wibke.« Die Frau strich sich die blonden Haare aus der Stirn und musterte Klaudias Kollegin wie eine Laufmasche. »Dich hab ich ja ewig nicht gesehen.« Ihre Stimme klang, als hätte sie auch weiterhin gut auf dieses Vergnügen verzichten können.
Klaudia musterte sie neugierig. Die Frau trug die klassische Kombi der guterhaltenen Enddreißigerin: Flip-Flops, weich fallende Bluse, um eventuell vorhandenes Hüftgold zu kaschieren, und knielange Stretchjeans.
»Gut siehst du aus«, sagte die Frau zu Wibke, und der verkniffene Zug in ihren Mundwinkeln vertiefte sich.
»Das macht die Arbeit in den Schutzanzügen«, antwortete Wibke fröhlich. »Eigenschweißbehandlung nennt man das. Solltest du auch mal probieren, Anja. Nicht immer nur die Polen für dich arbeiten lassen.«
Ups, dachte Klaudia und musterte die Kollegin von der Seite. So kenn ich dich ja gar nicht.
Die Frau hob die Augenbrauen. Bevor sie zu einer Entgegnung ansetzte, verließ die nächste Frau die Toilette, und Klaudia war an der Reihe.
Was geht denn hier ab?, fragte sie sich, während sie mit den Knöpfen ihrer Jeans kämpfte. Das war ja eine ganz andere Wibke. Als sie wieder auf den Anleger trat, war die blonde Frau verschwunden.
»War das eine Freundin von dir?«
»Wer? Anja Rohloff?« Lachend schüttelte Wibke den Kopf. »Nicht wirklich. Wir hatten mal den gleichen Männergeschmack.«
An plaudernden Menschengruppen vorbei schlenderten sie am Fließ entlang zur Brücke, die zum Freilichtmuseum führte.
»Und du hast ihr die Liebe ihres Lebens ausgespannt?«
»Eher umgekehrt.«
»Und das nimmt sie dir übel?« Kopfschüttelnd folgte Klaudia der Spusi-Technikerin an einer Gruppe rauchender Männer vorbei, die über Gurkenpreise diskutierten, zurück in den Hecht.
Die Band spielte einen Schmusesong, und nur wenige Paare drehten sich auf der Tanzfläche. Klaudia sah das gelangweilte Mädchen wieder, das mit dem Gurkenbauern getanzt hatte. Engumschlungen glitt sie nun mit einem dunkelhaarigen Jungen über die Tanzfläche, der altersmäßig besser zu ihr passte.
Klaudia griff gerade nach dem Glas, das Wibke ihr reichte, als jemand sie anrempelte und sie gegen ihre Freundin stolperte. Der Inhalt des Glases ergoss sich über Wibkes Kleid, und auch sie bekam eine ordentliche Dusche über Brust und Bauch. Erschrocken hielt sie die Luft an.
»Lass mich!«, sagte eine Frauenstimme hinter ihr. »Ich kann tanzen, mit wem ich will.« Sie klang jung, schrill und wütend.
»Ein deutsches Mädchen mit einem Polacken.«
Verwaschene Vokale. Deutlich angetrunken. Klaudias Nackenhaare richteten sich auf, ihre Muskeln spannten sich.
»Sie will nicht mit dir tanzen. Also lass sie in Ruhe.« Wieder eine männliche Stimme, sympathisch, osteuropäischer Akzent.
Ein Schnaufen gefolgt von einem Schmerzensschrei ließen Klaudia herumwirbeln.
Ein kräftiger Mittzwanziger mit militärisch kurzen Haaren und blauem Hemd trat einem am Boden liegenden Jungen in die Rippen. Klaudia erkannte ihn sofort, es war der Junge, der gerade noch so verträumt seine Wange an die des Mädchens geschmiegt hatte. Die Kleine bückte sich nach ihrem Tanzpartner, als eine Hand sie aus Klaudias Blickfeld zerrte.
»Polackensau.« Noch einmal trat der Typ zu. Ächzend krümmte sich der dunkelhaarige Junge in der Bierpfütze zu Klaudias Füßen.
»Hey, mal langsam.« Sie fingerte ihre Dienst-ID aus der Gesäßtasche und hielt sie dem Kerl unter die Nase. In solchen Fällen wirkte der Ausweis immer wie eine kalte Dusche. »Noch ein Tritt, und du verbringst den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam.«
Die Fäuste geballt, stand der Mann vor ihr. Klaudia ließ ihn nicht aus den Augen. Adrenalin flutete ihr System. Ihr Herz wummerte in den Schläfen, ihr Blickfeld verengte sich, bis sie nur noch den Mann im blauen Hemd sah. Ein Nerv an seinem Auge zuckte, das Kinn schob sich vor. Eine steile Falte wuchs zwischen seinen Augen.
Greif mich an, dachte Klaudia und erschrak selbst, wie sehr sie sich wünschte, diesen Kerl auf die Bretter zu schleudern und ihm die Hand zu verdrehen, bis er wimmerte. Wieder zuckte der Nerv an seinem Auge. Klaudia registrierte die winzige Bewegung des Oberkörpers, die ihr zeigte, dass auch ihr Gegner darauf brannte, es ihr zu zeigen.
Im letzten Moment legte sich eine Hand auf seine Schulter und zog ihn zurück. Für einen Augenblick sah es so aus, als wolle er sie abschütteln, aber dann gab er nach. Jedoch nicht ohne dem am Boden liegenden Jungen noch ins Gesicht zu spucken.
»Hey, stopp!« Klaudia trat einen Schritt vor, streckte die Hand aus, aber plötzlich schoben sich Körper zwischen sie und den Typen im blauen Hemd und versperrten ihr den Weg.
Die Menge bildete eine Gasse, die der Kerl durchschritt wie ein Feldherr. Ihm folgten vier Männer mit ebenso kurz geschorenen Haaren. Klaudia schaute sich um. Demel war schon längst gegangen. Nur Wibke und sie waren noch hier. Keine Chance, den Schläger festzusetzen.
»Scheiße!« Klaudia bückte sich und half dem Jungen auf die Füße. Seine schwieligen Handflächen passten so gar nicht zu diesem schlanken Bürschchen mit dem gegelten Haar. Er schwankte und presste die Hände gegen den Magen.
»Brauchst du einen Arzt?« Sie musterte ihn. Auch einigermaßen ramponiert sah er noch gut aus. Mädchen flogen auf solche Typen. Klaudia erinnerte sich noch gut an ihre eigene Jugend. In genau so einen Bengel hatte sie sich als Fünfzehnjährige unsterblich verliebt. Der Junge war achtzehn gewesen, Lehrling in einer Kfz-Werkstatt und fuhr einen getunten Opel Kadett. Die große Liebe hatte genau drei Wochen angehalten, dann hatte er eine neue Freundin und sie ein gebrochenes Herz.
Ohne zu antworten schüttelte der Junge ihre Hand ab und lief hinaus. Auch vor ihm teilte sich die Menge wortlos.
2. Kapitel
»Lass mich!« Dorina drückte die Fingernägel in die Hand ihres Bruders, die ihren Oberarm wie eine Eisenklammer umschloss. Sie wollte zu Vlad, ihm helfen. Er brauchte sie. Wenn er mit ihr getanzt hätte, und nicht mit Julia, wäre das alles nicht passiert.
»Du bleibst hier«, zischte Dorin, ohne seinen Griff zu lockern. »Siehst du denn nicht, was das für Typen sind?«
Na und, dachte Dorina, gab aber ihren Widerstand auf. Wenn du nicht mit dem Kopf durch die Wand kommst, nimm die Tür, sagte ihre Mutter immer. Und die Tür war in diesem Fall, nachzugeben. Die Rechnung ging auf. Ihr Bruder ließ sie los, und sie rieb sich die Arme. Dorin war eine richtige Plage. Dabei konnte sie gut auf sich selbst aufpassen. Schließlich war sie kein Kind mehr, und außerdem: Was war schon dabei, wenn sie mit Vlad flirtete? Sie schlief ja schließlich nicht mit ihm. So blöd war sie nun auch nicht.
Im Gegensatz zu dir, dachte sie und schaute zu Gabriella hinüber, die gerade vom Händewaschen zurückkam. Dorin schloss seine Freundin in die Arme, und die beiden knutschten, als hätten sie sich Wochen nicht gesehen.
Dorina schüttelte den Kopf. Glaubten die beiden wirklich, dass sie nicht mitkriegte, wenn sie sich nachts aus der Unterkunft schlichen? Wahrscheinlich trieben sie es auf dem Gurkenflieger. Dorina schauderte bei dem Gedanken. Wenn sie am Montag wieder neben den beiden lag, würde sie nichts anderes denken können. Sie würde so etwas nie tun. Aber Gabriella mit ihrem langweiligen hennaroten Dutt, den fahlen Sommersprossen und den breiten Schultern musste sich schon etwas einfallen lassen, damit jemand wie Dorin sie beachtete. Ihr Typ wäre er zwar nicht, aber Dorina verstand, warum Gabriella so bereitwillig die Beine für ihn breitmachte. Dorin hatte das gleiche dunkle Haar wie sie, nur lockte sich seins etwas, während ihres glatt und glänzend bis zur Hüfte reichte. Sie hatten auch beide die dunklen Augen ihrer Mutter. Doch während sie auch ihr schmales Gesicht und den zierlichen Körperbau geerbt hatte, war Dorin grob und breitschultrig wie ihr Vater.
Dorina stellte ihr Glas auf die Theke und wandte sich ab.
»Wohin willst du?«, fragte Dorin sofort.
»Hände waschen«, antwortete sie. Sie achtete darauf, dass ihre Stimme ein wenig piepsig klang.
»Lauf bloß nicht dem Typen hinterher.«
»Gabriella kann ja mitkommen.« Scheinheilig klimperte Dorina mit den Wimpern. Sie wusste genau, dass Dorins Freundin sich auf keinen Fall noch einmal in die Schlange vor dem Damenklo einreihen würde. Es fiel ihr schwer, ihre Ungeduld zu verbergen. Hoffentlich war Vlad nicht verletzt. Dieser Scheißtyp hatte auf ihn eingetreten, als wäre er ein räudiger Köter. Aber für Leute wie den sind wir nichts Besseres, dachte Dorina. Einfach, weil wir dunkle Haare haben und eine andere Sprache sprechen.
Sie verließ den Schankraum und trat auf den Anleger. Unbewusst atmete sie tiefer ein. Die Luft schmeckte nach Entengrütze und sonnenwarmem Holz. Ein Windhauch strich ihr über die Wangen. Sie drehte die Haare zu einem Knoten, den sie am Hinterkopf festhielt, um Luft an ihren Nacken zu lassen.
An Gruppen von rauchenden Männer und Frauen vorbei, die über die Gurkenernte lamentierten, lief sie zur Brücke, die die beiden Ortsteile von Lehde miteinander verband, und stieg hinauf. Die Holzplanken knarrten unter ihren Füßen. Von der Mitte der Brücke aus hatte sie eine gute Rundumsicht. Trotzdem sah sie keine Spur von Vlad. Mit der Enttäuschung schoss Schmerz von ihrem Nacken in die Schläfen. Auf einmal war ihr alles zu viel. Die Musik. Die Gerüche der Nacht. Die lachenden Menschen. Jeder Geruch, jedes Geräusch, selbst der leichte Sommerwind in ihrem Nacken kratzte auf ihrer Haut. Dorina kannte dieses Gefühl. Nicht mehr lange, und ihr Kopf würde sich mit glühenden Kohlen füllen, und ihre Augenlider würden vor Schmerz anschwellen. Sie musste zurück zum Hof. Für einen Moment überlegte sie, Dorin Bescheid zu sagen, aber ihr blieb nicht genügend Zeit. Außerdem war sie alt genug, auf sich selbst zu achten.
Dorina lief über die Brücke zu den Fahrrädern. Kurze Zeit später radelte sie am Fließ entlang. Der Mond spiegelte sich im Wasser, und Irrlichter tanzten durch den Wald. Um Dorina herum raschelte und wisperte es in Unterholz und Schilf. Sie dachte an Oma Asches Geschichten von Wanderern, denen Irrlichter für den Preis eines Schmalzbrotes den Weg wiesen. Aber wehe dem, der nicht bezahlte. Dorina hatte nichts, was sie einem Irrlicht anbieten konnte, außerdem brauchte sie keinen Wegweiser, gab es doch am Fließ entlang nur diesen einen Weg nach Leipe. Der Fahrtwind kühlte den Schmerz, der hinter ihrer Stirn lauerte.
Kurz hinter einer Brücke brachte eine laute Männerstimme sie dazu, abzubremsen. Dem Wasserlauf folgend, machte der Weg an dieser Stelle eine Kehre, so dass sie nicht sehen konnte, wer vor ihr war. Obwohl sie gut Deutsch sprach, verstand sie kein Wort von dem, was die sich überschlagende Männerstimme schrie. Unschlüssig lauschte sie in die Nacht, bevor sie ihr Rad wendete, um zurück nach Lübbenau und von dort die Landstraße entlang nach Leipe zu radeln. Für einen Moment erstarb das Schreien, und sie hörte eine andere, leisere Stimme. Vlad, schoss es ihr durch den Kopf. Es war Vlads Stimme, da war sie sich sicher. Was war hier los? War der Schläger ihm etwa gefolgt? Die andere Stimme schrie Vlad nieder. Sie musste ihm helfen. Nur womit? Mit zitternden Händen kramte sie in der Satteltasche des Rades. Ein Schraubenschlüssel schien ihr das Geeignetste zu sein. Nur lag er viel zu leicht in ihrer Hand. Trotzdem steckte sie ihn in die Gesäßtasche ihrer Jeans und legte ihr Rad an den Wegrand. Vielleicht konnte sie ihn ja werfen. Sie war gut im Werfen.
Leise schlich sich Dorina im Schatten der Bäume an die Streitenden heran. Die beiden Männer standen sich mit gesenkten Köpfen und erhobenen Fäusten gegenüber und beschimpften sich lautstark. Vlads Gesicht konnte sie gut sehen, doch er bemerkte sie nicht. Der andere Mann stand mit dem Rücken zu ihr. Auch wenn sie ihn nur von hinten sah, war Dorina sich sicher, dass es nicht der Typ war, mit dem Vlad sich auf dem Hechtfest geprügelt hatte. Aber warum war er so wütend?
Dorina zog den Schraubenschlüssel aus der Hosentasche und umklammerte ihn. Das Herz wummerte ihr in der Kehle, vergessen der Kopfschmerz, der eben noch an ihren Schläfen genagt hatte. Sie kniff die Augen zusammen, wollte zielen, trat unwillkürlich einen Schritt näher, zögerte. Konnte es wirklich sein?
Sie tat einen weiteren Schritt, eine Hand presste sich auf ihren Mund, auf ihre Nase. Panisch hob Dorina die Hände, zerrte an den Fingern. Der Schraubenschlüssel fiel ihr auf die Füße. Sie trat um sich, traf ein Schienbein und hörte das schmerzhafte Zischen ihres Angreifers.
»Hast du den Verstand verloren?«
Dorinas Widerstand zerplatzte wie ein Ballon. Bleierne Müdigkeit rieselte in ihre Muskeln, machte sie schlapp und wehrlos. Sie kannte die Stimme, seit sie denken konnte. Ihre Beine gaben nach, die Hände fielen ihr auf die Oberschenkel. Widerwillig ließ sie sich von ihrem Bruder zurück zu ihrem Rad zerren, wo Gabriella auf sie wartete.
»Sag mal«, fauchte Dorin. »Hältst du mich eigentlich für blöd?«
»Vlad braucht Hilfe.«
»Vlad kommt gut allein zurecht«, herrschte ihr Bruder sie immer noch flüsternd an. »Und nun komm.« Er zerrte sie weiter. Gabriella folgte ihnen.
»Lass mich.« Dorina riss sich los. Der plötzliche Schmerz hinter ihrer Stirn ließ sie auf den Weg sinken.
»Was ist?« Dorin kniete vor ihr. Er nahm ihr Gesicht in beide Hände und musterte sie im hellen Mondlicht. »Migräne?«
Dorina nickte vorsichtig.
»Bring sie zum Hof«, sagte Dorin zu Gabriella und half Dorina auf die Füße. »Ich kümmere mich um Vlad.«
»Komm.« Gabriella schob das Fahrrad neben Dorina.
Ihr Widerstand verpuffte. Sie nahm ihr Rad und folgte Gabriella. Ihr war, als tanze ein Irrlicht auf dem Weg, aber dann verschwand es zwischen den Bäumen. Die beiden Frauen radelten den Weg zurück, den Dorina gekommen war.
3. Kapitel
… die Fesseln zerren an meinen Gelenken. Schweiß brennt mir in den Augen. Das Herz pumpt gegen den Druck in meiner Brust an. Dunkelheit. Schwärze. Tod.
Panisch riss Klaudia die Augen auf und starrte auf die Schräge über ihrem Bett. In ihrem Ohr quiekte das Nessun Dorma.
Sie hob die Hände vors Gesicht. Sie war nicht gefesselt, war nicht in dem Haus am Fließ. Sie war in ihrer Einliegerwohnung in Uwes Haus. Es war nur ein Traum. Nur ein böser, immer wiederkehrender Traum. Klaudia angelte nach dem dünnen Laken, das vor dem Bett lag, breitete es über sich und boxte ihr verschwitztes Kissen zurecht. Dann schloss sie die Augen und visualisierte ein Stoppschild, um den Aufruhr in ihrem Kopf zu beenden. Wie sie es in der Kur gelernt hatte, malte sie es auf die Innenseite ihrer Lider: achteckig, weißer Rand, knallroter Hintergrund, weiße Schrift. Sie drehte sich auf den Bauch, das morgendliche Zwitschern der Vögel legte sich wie eine Decke über ihren Tinnitus. Klaudia sank tiefer in die Matratze, ihr Atem beruhigte sich, ihr Kopf füllte sich mit Schlaf und … ihre Blase funkte SOS.
»Oh Mann.« Klaudia strampelte das Laken fort und schlurfte ins Bad. Der Wecker, den sie hier deponiert hatte, damit sie nicht ständig in dem Zeitloch versackte, das zwischen Dusche und Wasserkocher lauerte, tickte laut. Erst Viertel nach vier? Gähnend kratzte sie sich einen Mückenstich am Oberarm auf. Apropos versackt. Sie dachte an den gestrigen Abend. Na ja, so richtig versackt war sie nicht. Seit ihrem Hörsturz trank sie nur wenig und auf keinen Fall irgendwelche Schnäpse. Sie wollte nicht noch einmal im Nichts landen. Außerdem war der Abend nach der Schlägerei sowieso gelaufen gewesen. Eigentlich hatten sie und Wibke am Fließ entlang nach Lübbenau zurücklaufen wollen, aber Schiebschick hatte es sich nicht nehmen lassen, sie zu staken. Die nächtliche Fahrt auf dem schwarzen Wasser der Spree, in dem sich das Mondlicht spiegelte, war fast das Beste an dem Abend gewesen.
Sich den Bauch kratzend, kehrte Klaudia ins Schlafzimmer zurück. Ihre Füße verfingen sich in ihrem feuchten Polohemd, das zusammengeknüllt vor dem Einbauschrank lag. Vielleicht war sie doch betrunkener gewesen, als sie gedacht hatte. Obwohl beide Fensterflügel weit geöffnet waren, stank der Raum nach Schwarzbier.
Klaudia ging zum Fenster und schaute hinaus in die ruhige Seitenstraße, in der sie nach der Sache mit Joe wieder wohnte. Vom Markt her verkündete das schüchterne Bimmeln der Kirchenglocken die halbe Stunde. Grau hingen Federwolken am Himmel. Noch hatte es die Sonne nicht über den Horizont geschafft, aber schon malte sie erste pastellrote Streifen in das Morgengrau. Tränen tropften auf Klaudias Zehen. Sie wischte sich die Augen. Die Tränen überfielen sie oft in diesen einsamen Stunden, wenn der Schlaf schon hinter ihr und der Tag noch vor ihr lag. Irgendwo in der Straße schlug eine Tür, und kurz darauf hallten gleichmäßige Schritte über das Kopfsteinpflaster. Gleich würde der alte Dassow mit seinem Border Collie auf seiner frühmorgendlichen Runde vorbeikommen.
Klaudia beugte sich vor und zur Seite, damit sie in den Hof schauen konnte. Uwes Sharan stand nicht auf seinem üblichen Platz. Sie biss sich auf die Unterlippe. Hatte der Wagen eigentlich heute Nacht im Hof gestanden? Sie wusste es nicht mehr. Hoffentlich war nichts mit dem Kleinen. Klaudia fiel es schwer, sich dieses winzige Etwas, das sie ein einziges Mal gesehen hatte, als Menschen vorzustellen. Der Kleine war so unendlich zart gewesen. Viel zu zart, um ohne Hilfe zu überleben, und selbst mit Hilfe wäre es so etwas wie ein Wunder, wenn er ein gesundes Baby würde. Am meisten hatte sie seine durchscheinende Haut erschreckt. Jede Ader hatte sie sehen können.
Seitdem der Kleine auf der Welt war, verbrachte Uwe die meiste Zeit in der Klinik in Berlin. Oft kam er nicht einmal zum Schlafen nach Hause. Aber wahrscheinlich schlief er genauso wenig wie sie. Vielleicht fürchtete er sich ebenso vor seinen Träumen, wie sie es tat. Klaudia verschränkte die Arme vor der Brust. Ob er auch jede Nacht Silkes panisch aufgerissene Augen sah?
Der Moment, bevor sie krampfend in Joes Armen zusammenbrach, hatte sich auf Klaudias Netzhaut gebrannt. Alles andere war ein Wirbel aus Schmerzen, Panik und Blut. Nur dieser eine Augenblick, als Silke die Augen verdrehte und nur noch das Weiße zu sehen war, dehnte sich in ihren Träumen. Obwohl sich die Hitze in ihrer Dachgeschosswohnung staute, fror Klaudia. Tief atmete sie die nach frischem Gras duftende Luft ein, dann trat sie vom Fenster zurück, und der Gestank des Raumes überfiel sie wieder. Erst mal duschen, und dann einen Kaffee. Wenn sie Glück hatte, konnte sie den Tag heute zu Hause verbringen. Vielleicht würde sie später ein wenig um den Hafen spazieren, oder vielleicht auch nach Lübben fahren und am Schloss ein Eis essen. An anderen Tagen fuhr sie nach Burg in die Spreewaldthermen oder traf sich mit Wibke. Dann mieteten sie sich am Hafen ein Kanu und paddelten durch die Gegend. Wibke sei Dank kannte Klaudia nun auch andere als die von Touristenkanus verstopften Wasserwege. Manchmal kamen sie dann auch an dem Fließ vorbei, an dem das Haus stand. Klaudia war sich nicht sicher, ob Absicht dahintersteckte. Aber Wibke ließ sich nie etwas anmerken, und sie bog auch nie in den Flusslauf ein, der zum Haus führte. Vielleicht sollten sie das tun. Vielleicht sollte sie sich endlich ihren Dämonen stellen und einfach hinfahren. Schließlich war es nur ein Haus. Ein freundliches Holzhaus mit eigenem Anleger und Fischkasten. Das freundliche Haus, in dem sie gelebt hatte. Das freundliche Haus, in dem sie Joe erschossen hatte.
Hör auf, rief sie sich selbst zur Ordnung. Fang nicht wieder an zu grübeln. Fast war sie froh, dass sie wegen Thangs Unfall Bereitschaftsdienst hatte. Da blieb ihr weniger Zeit, sich in ihren Gedanken zu verlieren.
Nach dem Duschen entschied sich Klaudia für ein luftiges Sommerkleid, stopfte Polohemd und Jeans in den Wäschekorb, packte gleich noch die feuchten Handtücher und ihre nicht weniger feuchte Bettwäsche dazu und verließ die Wohnung. Die Tür zu Uwes Wohnung im Erdgeschoss war nur angelehnt, und als Klaudia die Kellertür erreichte, wusste sie warum. Annalene hockte auf den Steinstufen, die in den Waschkeller hinabführten. Ihre Arme umschlangen die Knie, und die schwarzgefärbten Haare hingen wie ein Vorhang vor dem Gesicht des jungen Mädchens. Silke würde es hassen, ihre Tochter so zu sehen, da war sich Klaudia sicher: die Haare, den schmuddeligen Schlafanzug.
»Was machst du denn hier?« Sie wechselte den Wäschekorb von der rechten auf die linke Hüfte.
»Die Birne ist kaputt.«
Annalenes Stimme klang, als sei ihr ebenfalls der Lebensfaden durchgebrannt. Klaudia ertrug den Schmerz nicht, den das Mädchen ausstrahlte. Einen irrwitzigen Augenblick lang wollte sie auf dem Absatz kehrtmachen, zurück in ihre Einliegerwohnung laufen und die Tür zwischen ihrem eigenen Schmerz und dem des Mädchens schließen. Was hast du uns nur angetan, Joe? Sie blinzelte die Tränen fort, die ihr die Sicht nahmen. Sie würde einen Teufel tun und Annalene im Stich lassen. Diesmal nicht.
Klaudia stellte den Wäschekorb ab und hockte sich ebenfalls auf die oberste Treppenstufe. Annalenes Haare rochen nach Zigarettenrauch. Seit den Ereignissen im Frühjahr qualmte sie wie ein Schlot. Klaudia schauderte. Die Kälte des Steins drang durch den dünnen Stoff ihres Sommerkleides. Sie umschlang die Knie mit beiden Händen und starrte in die dämmrige Tiefe. Fünf Stufen, eine offenstehende Brandschutztür. Fahl schimmerte das Weiß der Waschmaschine im Dämmerlicht. All das nahm ihr Hirn mit der Präzision einer Kamera auf, nur produzierte es keinen Satz, der dem Mädchen an ihrer Seite helfen würde. Aber irgendetwas musste sie sagen, sollte das Schweigen nicht ebenso bedrohlich werden wie die kühle, nach Waschpulver riechende Dämmerung zu ihren Füßen.
»Ziemlich dunkel, was?« Klaudia gab sich Mühe, ihre Stimme klingen zu lassen, als spräche sie nur über das Wetter oder so etwas. Sie wusste, wie Annalene sich fühlen musste. Nachdem sie das Mädchen aus dem Luftschutzkeller befreit hatten, war Klaudia zurückgekehrt, hatte die Tür zwischen sich und der Außenwelt geschlossen und für die Dauer eines Atemzugs gespürt, wie die Schwärze in sie hineinsickerte. Länger hatte sie es nicht ausgehalten, und Annalene hatte Stunden in dieser absoluten Dunkelheit verbracht. Stunden, in denen sie nicht wusste, wer ihr das angetan hatte und vor allem nicht, was er ihr noch antun würde. Eine fürchterliche Last für jeden Erwachsenen. Wie viel schwerer musste ein Kind daran tragen?
»Ich weiß, dass es nicht wirklich dunkel ist«, presste Annalene hervor. »Nicht so dunkel.«
»Es ist dunkel genug.« Klaudia legte den Arm um die Schulter des Mädchens. Wie knochig sie war. Sie musterte Annalene von der Seite. Trotz der Hitze trug sie einen langärmeligen Schlafanzug. Ihre nackten Füße steckten in Fellpuschen. Viel zu dünn, die Haut blass.
Klaudia schluckte trocken. Wie fragte man eine traumatisierte Vierzehnjährige, ob sie genügend aß? Zum ersten Mal dämmerte ihr, wie großartig ihre Stiefmutter sich ihr gegenüber verhalten hatte und wie wenig sie es ihr gedankt hatte. Für sie war Conny immer nur die Frau gewesen, die mit ihrem Vater ein schönes Leben hatte, während ihre Mutter sich zu Tode soff.
»Ich will das nicht.« Annalene wischte sich mit dem Handrücken die Nase. »Ich mein, das ist voll Scheiße. Das ist … Ist wie … Wie … Bhanu sein.«
»Sie klammert sehr, nicht wahr?« Klaudia hatte das Gefühl, auf sehr dünnem Eis unterwegs zu sein. Das Verhältnis der Schwestern war ihr ein Rätsel. Als Silke noch im Krankenhaus gelegen hatte und Uwe nicht von ihrer Seite wich, hatte Annalene sich wie eine Mutter um ihre jüngere Schwester gekümmert. So als wollte sie ihren Anteil an einem Deal erfüllen, von dem nur sie selbst wusste. Oder vielleicht hatte sie auch nur gedacht, wenn sie lieb sein würde, könnte das Schicksal nicht böse sein. Sie hatte den Haushalt geschmissen und sogar Silkes ausgeleierte Strickjacke getragen. Aber das Schicksal war trotzdem nicht lieb zu ihr gewesen. Nach Silkes Tod war die Strickjacke in irgendwelchen Truhen verschwunden und mit ihr Annalenes Fürsorge.
»Ich könnte dir jetzt ganz viel erzählen, über posttraumatische Belastungsstörung und so«, log Klaudia. Gar nichts konnte sie erzählen. Höchstens von ihren eigenen Dämonen. Aber was würde das helfen? Man konnte nicht das Leid eines Menschen gegen das Leid eines anderen aufwiegen. Annalenes Schmerz würde keinen Deut weniger auf ihrer Seele lasten, wenn sie ihren eigenen Schmerz dazupackte. »Vielleicht solltest du doch mal mit jemandem reden, der dir helfen könnte?« Der Satz kollerte die Treppe hinunter. Klaudia schaute ihm hinterher. Schweigen wäre eindeutig die bessere Alternative gewesen.
»Ich war bei Mama«, brach es aus Annalene heraus. »Auf dem Friedhof.«
Sie schien Klaudias Rat überhaupt nicht wahrgenommen zu haben.
»Das ist gut«, sagte Klaudia vorsichtig. Das Eis unter ihren Füßen knirschte. »Ich glaub, ich hol eine Birne.« Sie stemmte sich in die Höhe, doch Annalenes nächster Satz holte sie auf die Treppenstufen zurück.
»Ich bin schuld, nicht wahr?«
»Red keinen Quatsch.« Eine Mischung aus Schuldgefühlen und Wut presste Klaudia die Luft aus den Lungen. Sie kannte dieses Gefühl, hatte sogar damals mit dem Notfallseelsorger darüber gesprochen, der sich um sie gekümmert hatte. »Joe ist Schuld. Nicht du. Lade nicht seine Schuld auf deine Schultern.« Klaudia ließ den Teil mit Jesus weg, den der Pfarrer noch gesagt hatte.
»Aber wenn ich nicht abgehauen wäre?«
»Das hätte nichts geändert. Nicht für deine Mutter. Du warst …« Klaudia stockte. Ihr fehlten die Worte. »Ein Kollateralschaden«, sagte sie schließlich. »Er war ein Psychopath.«
»Sagt Chantalle auch. Also nicht das mit dem Kollateralschaden.« Annalene kratzte sich am Schienbein. Klaudia sah, wie sich ein Blutfleck auf der Hose ausbreitete.
»Bist du auch so zerstochen?«
»Was?« Verwirrt schaute Annalene auf ihre blutigen Fingernägel, dann schob sie die Hände unter die Achseln.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.