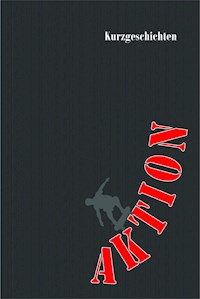Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erlebnisse aus 70 Jahren schildert der Autor humorvoll, aber auch eindringlich. Kindheit Jugend, Berufsleben und das Leben in seiner Umwelt. Als Pflegekind, das Leben bei der Mutter, im Kinderheim, Berufsbildung und die politischen Verwirrungen haben zu den Kurzgeschichten beigetragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Diese Seiten sind gewidmet:
Kerstin
Katja
Marco
Dennis
Janine
(Namensnennung in der Reihenfolge der Geburt)
Es fanden zu wenige Gespräche statt.
Ihr hattet keine Fragen.
Wir sahen uns nicht oft genug.
Euer Paps, Papa und Opa
2014
Vorwort
Wenn ein Leben bereits einige Jahrzehnte andauerte, lohnt es sich darüber nachzudenken. Oder darüber zu schreiben?
Ich hatte mich entschlossen einzelne Episoden zu notieren. Es sind meist Erinnerungen, die als Bilder seit langer Zeit in meinem Gedächtnis liegen.
Wenn sich Erwachsene in meiner Gegenwart unterhielten, war ich natürlich ein aufmerksamer Zuhörer. So bekamen die wortlosen Kopfbilder doch noch Texte.
Es stand irgendwo, irgendwann geschrieben, dass der Mensch nur Ereignisse im Gedächtnis behalten kann, die ein besonders einschneidendes Ereignis betrafen. Durch Aneinanderreihen dieser gespeicherten Ereignisse kam dann meine Lebensgeschichte zusammen.
Sind diese Kurzgeschichten auch nicht spannend, so schildern sie eine Zeit, die geprägt war vom Nachkrieg in Deutschland, vom Herrschaftsanspruch der Besatzungsmächte, von der willkürlichen Trennung der Familien durch die Politik und der Versuch der Deutschen wieder ihr Leben zu normalisieren.
Nach 50 Jahren Einpeitschen von Regeln und Geschichtsfälschungen deutscher und ausländischer Regierungen, hat es meine Generation nicht geschafft die Trennung Deutschlands in den Köpfen zu überwinden. Aber diese Generation hat versucht, die persönlichen Erlebnisse nicht in eine erneute Trennung münden zu lassen.
Aus meiner Sicht wird es noch zwei neue Generationen geben, ehe die Handlungen meiner Generation richtig einordnet sind.
Diese Geschichten wurden in den Jahren 2009 bis 2014 geschrieben.
Inhalt I
1. In Kurzfassung
2. Sind diese Geschichten historisch genau?
3. Befreit, in Etappen
4. Der rote Ziegelsplitter
5. Frau Pastor Lindemuth
6. Die Russen sind da
7. Ein Tag, der so strahlend begann.
8. 21 Uhr. Endlich gibt es etwas zum Essen!
9. Einsegnung 1949
10. Flaggenwechsel
11. Geh'ste wech – da warste schon!
12. Junge, hol' mal'n Brot
13. „Junge, geh doch mal raus!“
14. Junge, was soll ich mit einen Eimer Marmelade?
15. Meine Weihnachtsgeschichte
16. Mit Geld spielt man nicht!
17. Morgen fahren wir hamstern!
18. Mutti hat nichts anzuziehen.
19. Mutti, ich will ins Heim!
20. Na, ihr Pimpfe?
21. Papa, wer warst du?
22. Rosinenbomber
23. Schiebewurst
24. Wie ich zu meinen Eiern kam
25. Wurde ich als Kind zu heiß gebadet?
26. Diener machen
In Kurzfassung
Eltern haben uns gute Wünsche gegeben
Das sollte reichen für ein langes Leben
Es gab nichts zu erben,
außer Trümmer und Scherben.
Wir haben weggeräumt und aufgebaut
Die Zukunft war uns schon geraubt
Bevor wir richtig angefangen
Sind Viele ohne uns gegangen.
Westwärts rollte der Treck
Für den Rest baute man ein Versteck
Hinter Beton und Gräben
Ohne Weg ins neue Leben.
Wir haben unseren Nachwuchs versorgt
Dafür haben wir gespart und geborgt
Wir wollten besser Leben als unsere Ahnen
Doch lebten wir unter vielen Fahnen
Fahnen mit Runenkreuz haben wir verbannt
Hammer und Sichel herrschte im Land
Schwarz-Rot-Gold war ererbt
Leider nutzten wir es verkehrt.
Mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz
Strahlte der Stoff nie im vollen Glanz
Die schlichten drei Streifen
Danach konnten wir greifen
Was wir erschaffen im Leben
Werden wir den Enkeln geben
Nur die Waffen müssen wir zerstören
Das Leben muss allen gehören.
Sind diese Geschichten historisch genau?
Jeder Leser erwartet genaue Informationen, wenn er Geschichten aus der Vergangenheit in die Hand bekommt.
Zu welcher Zeit handelt die Erzählung? Haben die handelnden Personen wirklich gelebt? Sind die geschilderten Erlebnisse genauso verlaufen? Vor allem will der Leser aber wissen, ob die geschilderten Gefühle auch echt sind.
Geht das, so präzise über etwas zu berichten das schon Jahrzehnte zurückliegt? Unser Gedächtnis wird uns wohl einen Streich spielen. Waren die Ereignisse nicht einschneidend, dass sie wie eingebrannt sind, so werden die Erinnerungen geglättet. Sie sind nicht mehr so brutal, wie sie damals empfunden wurden. Die ganzen Emotionen des Augenblicks sind fast nicht mehr nachzufühlen.
Haben wir uns nur erschreckt oder sogar geweint? Oder hat ein Ereignis den weiteren Lebenslauf bestimmt?
Es sind fast immer die Geschichten, die uns besonders erfreut oder geärgert haben. Mit diesen Geschichten sind Personen verbunden, deren Namen man gar nicht nennen will oder darf. Ist das bereits ein Abweichen vom historischen Ereignis?
Die Jahreszahl? Wer kennt sie noch so genau? Eher erinnern wir uns an die Jahreszeit oder welche Mode wir gerade getragen haben.
Lassen wir die Geschichte Geschichten werden. Sie sollen erzählen aus einer vergangenen Zeit. Aus einer Zeit, als das Leben noch so anders war. Ob es besser war kann nur der Betroffene berichten. Der Leser versucht nur in den Zeilen die Gefühle dieser Zeit zu erfahren. Er vergleicht sie mit der Gegenwart und bildet sich sein Urteil zu dieser Erzählung.
Wenn wir die reinen Fakten aus der Vergangenheit erzählen ist es wohl mehr ein Nachschlagewerk, aber niemals eine unterhaltsame Erzählung.
So sind manche Geschichten etwas ausgeschmückt mit zusätzlichen Wörtern, die nicht unbedingt historisch genau etwas wiedergeben, sondern Erlebtes in unterhaltsamer Form darstellen.
So sind wir bei der Antwort, die die Fragen am Beginn beantwortet. Nicht historisch genau wird erzählt, sondern unterhaltsam Geschichte weiter gegeben.
Lassen wir uns gefangen nehmen von den kleinen Schilderungen aus einer gelebten Zeit. War damals die Zukunft wirklich besser? Versuchen wir hier die Antwort zu finden.
Befreit, in Etappen
1. Etappe
Ich schreckte hoch. Ein lang gezogenes Heulen in der Luft. Als ich die Augen öffnete, war es stockdunkel. Ich versuchte mich aufzurappeln, aber ich klebte fast am Bettlaken. Und das Atmen viel mir schwer. Der Brustkorb war wie eingeschnürt. Wum! Ein greller Blitz und Glas schepperte. Mutti schrie: „Junge nu' mach doch mal – wir müssen in den Keller“.
Rasch die gewohnten Bewegungen, rein in die Sachen, ab durch den Korridor, über den 1. Hinterhof und flink durch die eiserne Tür in den Luftschutzkeller. Mutti hechelte mir hinterher mit dem kleinen Koffer in der Hand. „In dem sind die wichtigsten Papiere“ sagte sie immer. Im Keller, an der Decke baumelte eine blaue Glühlampe. In deren Licht konnte ich gerade noch erkennen, ob alle aus den anderen Wohnungen wieder hier waren. Immer dieselbe Runde. Nacht für Nacht. Ich wusste nicht, wie lange das schon ging, aber ich hatte wirklich genug. Nie richtig ausschlafen. Entweder weckte mich das Heulen der Sirenen oder das Pfeifen der Luftminen.
Der Luftschutzwart mit seinem Stahlhelm und der umgehängten Gasmaske knurrte. „Mal sehen ob sie uns heute schaffen“. Der Keller zitterte öfter und das Licht ging nun auch noch aus. Stockdunkel um mich. Ich rutschte dicht an Mutti. Ihre Hand erwischte ich nicht, die hielt fest den kleinen Koffer.
Wenn ich heute beschreiben soll, wie lange eine Ewigkeit dauert, so könnte ich das beschreiben.
Dreimal heulte die Luftschutzsirene. Allgemeines Seufzen. Einige fanden sogar ihre Sprache wieder. Der Luftschutzwart öffnete die Riegel der schweren Stahltür und wir tasteten uns die Kellertreppe hoch.
Im Hof nichts Besonderes. Nur über den Dächern helles Leuchten. Wir gingen auf die Straße, um zu sehen, woher der helle Lichtschein kam. Die Leute rannten zur Christburger Straße. Ich wollte auch, aber Mutti umklammerte meinen Arm. Ein alter Mann sagte laut: „Gott sei Dank, sie haben nichts getroffen“ stimmte jetzt wirklich nicht. Jeder wusste aber was er meinte. Das Gaswerk in der Greifswalder Straße stand noch.
Ich kannte diesen Mann – es war unser „Milchmann“. Bei ihm holte ich immer eine Kanne Milch für meine tägliche Suppe. Er hatte auf dem 3. Hinterhof einen Kuhstall. So musste ich nicht im Laden anstehen und bei jedem Fliegeralarm in einen Keller in der Nähe flitzen.
In der Wohnung machte Mutti schnell den Gaskocher an und wärmte meine Suppe. Wie täglich. Beim ersten „Happs“ knirschte es fürchterlich zwischen den Zähnen – Glas! Ich spuckte in den „Ausguss“. Mutti siebte die Suppe und ich konnte weiter essen. Eine Scheibe im Küchenfenster hatte dem Luftdruck nicht standgehalten.
Heute weiß ich – dieser Lebensrhythmus dauerte etwa 3 Monate.
Kinder fragen immer wieder die Erwachsenen aus um sich zu erklären was sie nur als Bilder behalten haben.
Ich stand gerade an der Ecke Winsstraße/Michaelkirchstraße nach Lebensmittel an, als ein Tiefflieger aus Richtung Alexanderplatz kam und die gesamte Winsstraße entlang feuerte. Blitzartig waren wir alle im Luftschutzkeller. Als wieder Stille war, rannte ich nachhause.
Wir hörten ununterbrochen die Geschütze von der Frankfurter Allee. Der Drahtfunk plärrte einen Marsch und verkündete: „schwere Gegenangriffe unser tapferen Soldaten…“. Mutti schaltete das Radio ein. Bum, bum, bum – ich musste mit unter die Wolldecke, weil ich den verbotenen Sender hören wollte.
In unserer Gegend wurde es still. Erst unmerklich. Dann merkte es auch der Letzte. Der Luftschutzwart stand jetzt öfter in der Toreinfahrt und lugte durch einen Türspalt. Alle warteten gespannt, aber niemand ging weiter, als bis zur Pumpe um Wasser zu holen.
Ich spielte im Hof, als wir Marschschritte hörten: unsere? Die Russen? Es ratterte auf dem Kopfsteinpflaster. Ich guckte jetzt auch durch den Torspalt. Da marschierte eine Maschinengewehr-Einheit der Russen vorbei. Es hörte sich wohl eher wie ein Schlurfen an würde ich genauer sagen. Die „Maxims“ mit ihren Stahlrädern verursachten Lärm. Die Soldatenstiefel weniger. Sie waren nicht „genagelt“ wie die Stiefel der Wehrmacht. Und die Stiefelschäfte waren aus grauem Filz. Die ganze Einheit sah grau aus. Mäntel, Gesichter. So hat sich mir das Bild eingeprägt. Ein Soldat stolperte auf dem Kopfsteinpflaster. „Die Russen sind da!“ krähte ich laut in den Hof zurück. Der Luftschutzwart riss mich gewaltsam in den Hausflur zurück: „Halt die Klappe, Junge, sonst kommen die hier rein!“
„Der Krieg ist zu Ende“ meinten Einige. „Nee, die kämpfen doch noch!“ Die Meinungen waren unterschiedlich. Es waren aber noch Panzerabschüsse zu hören.
Ich ging zu Mutti. Es war Mittag. Ich bekam meine Milchsuppe.
Heute ging keine Sirene. Ich atmete befreit auf.
2. Etappe
Wir wohnten immer noch im Prenzlauer Berg. Aus allen Himmelsrichtungen trafen jetzt unsere Familienangehörigen ein. Mein Bruder Gerold aus Karlshorst. Er hatte dort als 16jähriger Flakhelfer stationiert. Meine älteste Schwester, Edith, aus Frankfurt/Oder. Die anderen Geschwister kamen aus Weißensee. Alle unversehrt. Diejenige, die aus Frankfurt, kam zu Fuß von dort. Meine Mutti zuckte zusammen, als sie Edith erblickte. „Mädel! Bist du bescheuert? Wie kannst du so angezogen 'rumlaufen?“ Das war eine Begrüßung. Edith fing an zu heulen. „Na komm, iss mal erst was“ lenkte Mutti ein. „Dann ziehst du aber das BDM-Zeugs aus!“ Gerold war fixer gewesen. Er war schon in Zivil. Woher die Sachen waren, weiß ich bis heute nicht. Er hatte nie zuhause gewohnt.
Das Leben wurde schnell organisiert. Lebensmittel hatten wir aus den Depots der Wehrmacht „besorgt“ ehe die Russen sie fanden. Die Großen gingen arbeiten. Die Kleinen gingen „besorgen“. Abends trafen sich alle am Tisch und schütteten ihre Beute aus. Eine Mahlzeit sprang immer heraus.
Eine Schwester hatte ein Riesentalent zum Handeln. Sie nahm mich immer mit zum „Schwarzen Markt“. Sie stand in den Ruinen verborgen und ich bot ein Teil der Waren an. Niemand zeigte seine ganzen Schätze. Bei Razzien kümmerte sich auch niemand um mich „Rotzbengel“, während meine Schwester schon „die Socken scharfmachte“.
Das ging einige Monate so. Langsam gingen die Älteren wieder aus dem Haus. Es war einfach zu eng für so viele Personen.
Nur noch zu zweit zogen wir nach Pankow. Mutti hatte dort schon vor dem Kriegsbeginn eine Neubauwohnung bekommen. Mit der Linie 74 fuhren wir nach Heinersdorf. Ich staunte. Hunderte Kleingärten. Niedrige Neubauten. Nur ein Haus hatte ein Loch von einem Granateinschlag. Hier war es schön. Warum nur waren wir bis Kriegsende im Zentrum geblieben? Und dann noch fast am Alexanderplatz.
Jeden Tag fuhren Mutti und ich nun zum Prenzlauer Berg. Sie arbeitete dort. Abends ging es wieder mit der Straßenbahn zurück. Wenn diese fuhr. Eines Abends liefen wir wieder einmal von der Danziger Straße nach Heinersdorf. Dunkel war es. Trotz einzelner Gaslaternen. In der Prenzlauer Allee waren viele Kleingärten auf der linken Seite. Rechts ein Haus und eine Gärtnerei. Hier gingen wir immer sehr schnell. Ich schleppte Holzscheite. Mutti trug Essen im Topf.
Plötzlich sprangen zwei sowjetische Offiziere aus dem Gebüsch und stürzten sich auf meine Mutti. Sie schrie laut. Ich rannte. Ich bekam keinen Ton heraus. Die Beiden zerrten eine Weile an meiner Mutti, bis aus dem alleinstehenden Haus ein Mann herausrannte. In der hoch erhobenen Hand hielt er eine Axt.
Auch er brüllte. Ich guckte dieser ganzen Szenerie stocksteif und stumm zu. Die Soldaten verschwanden. Zu unserem Glück hatten sie nicht zur Waffe gegriffen. Meine Mutter hob noch lange zwei Ausschnitte aus der „Berliner Zeitung“ auf. Diese Meldungen berichteten von einer vollendeten und einer versuchten Vergewaltigung durch sowjetische Offiziere.
Wir waren wieder einmal befreit worden.
3. Etappe
Schule macht ja viel Spaß, aber jeder Spaß geht einmal zu Ende. Die Berufswahl stand an. Wer die Wahl hat, hat die Qual. „Was willst du denn lernen?“ „Feinmechaniker!" Ich wusste, was ich wollte. Also Bewerbung schreiben. Kurze Zeit später kam die Antwort von der „Berufslenkung“. „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Berufswunsch nicht den gesellschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Für diesen Beruf sind überwiegend Mädchen vorgesehen“. Dass saß! Neuer Berufswunsch: Fotograf! „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Berufswunsch nicht den gesellschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Für diesen Beruf sind überwiegend Mädchen vorgesehen“. Hatte die „Berufslenkung“ nur einen Schriftsatz? Lehrer! Schrieb ich zurück. „Sie können Ihr Studium am 1. September beginnen. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Berufswahl“.
Ich atmete befreit auf.
4. Etappe
Das Leben läuft. Ich lief hinterher. Studium war nicht so mein Fall. Abbruch. Also etwas Praktisches lernen. Geschafft. Kind, Ehe, Wehrdienst. Die Reihenfolge stimmt. Nur vom Letzten war ich befreit. Das Leben und ich hielten Gleichschritt. Ich hatte Wichtiges zu tun in meinem Beruf. Meine Geschwister konnte ich nicht sehen. Ich lebte im falschen Land. Briefverkehr ersetzt kein Lächeln beim Wiedersehen.
Die Grenze von Deutschland zu Deutschland wird dicht gemacht. Ich wurde von den „Imperialistischen Machthabern“ und ihr Streben nach Unterjochung befreit.
5. Etappe
Es macht langsam unzufrieden, wenn nichts so richtig nach Wunsch geht. Geld verdient. 13 Jahre zelten im Betriebsferienlager mangels Reiseangebote. Wo blieben meine Träume? Im Geografie Unterricht und im Geschichtsunterricht hatte ich viel erklärt bekommen. Nichts davon hatte ich bisher gesehen. Ein Betriebswechsel musste die Lösung bringen. Ich hätte nach einer Sperrfrist meine Geschwister besuchen können. Vielleicht auch mal eine Reise ins „sozialistische Ausland“?
„Hier kannst du nicht aufhören, wann du willst, Kollege, wir erfüllen volkswirtschaftlich wichtige Aufgaben. Wenn du auf dein Recht auf Kündigung bestehst, schreibe ich dir eine Beurteilung, mit der du dich nirgends wieder in deinem Beruf bewerben kannst“.
Ich kündigte. Ich war vogelfrei.
6. Etappe
Wer jemand kennt, der einen kennt lernt auch mal den Richtigen kennen. Seilschaften hatten mir geholfen. Mein Wunsch nach einer neuen Arbeitsstelle wurde erfüllt. Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen denen, die das Sagen hatten und dem, der auch nur gehorchen musste, löste nun den Knoten in meiner Beurteilung auf. Der berufliche Aufstieg war gesichert. Auch Reisen waren möglich. Nicht dahin wohin ich wollte, aber etwas weiter als vorher. Nach Jahren geschah endlich das erwartete Wunder. Ich reiste zu meiner Schwester in das Ruhrgebiet. Es lag eine Einladung mit einem wichtigen Grund vor: Silberhochzeit und ein Geburtstag mit einer Null.
„Ob der wiederkommt?“ unkte Frau Nachbarin. „Meiner blieb auch weg“. Ich kam zurück. Acht Wochen später fiel die Grenze innerhalb Deutschlands.
Jetzt atmeten mit mir Viele freier.
PS: Wie lange dauert es, bis jedermann frei ist? Gibt es überhaupt diese Freiheit, die alle haben möchten?
Der rote Ziegelsplitter
Ich muss noch nicht tief geschlafen haben. Jedenfalls war ich sofort wach, als Mutti mich rüttelte.
Da hörte ich auch schon die Sirene des Luftschutzes. Durchdringend war ihr Ton. Dieser Ton machte mir immer Angst. Er bedeutete Gefahr. Das wurde mir täglich eingeschärft. Dann sollte es immer ganz schnell gehen.
Schnell bedeutete für mich: im Dunkeln schnell in die Hose und Jacke. Dann nach den Schuhen gefühlt und ab zur Wohnungstür.
Draußen flackerten schon wieder die ersten Brände. Die Fensterscheiben klirrten vom Luftdruck, wenn in der Nähe eine Bombe explodierte. Die Fenster hatten schon viele Druckwellen ausgehalten. Mit Klebebändern und schwarzem Papier waren sie beklebt. Trotzdem sah ich immer noch, wenn es von den Einschlägen grell aufblitzte.
„Komm, Junge!“ zerrte Mutti an mir. Ich flitzte durch den Korridor und war als erster draußen. Mutti hatte den Koffer mit den nötigsten Papieren in der Hand. So ein kleiner Schwarzer war das. Er hatte blanke Ecken und stand immer unter dem Gaszähler.
„Wenn ich mal nicht da bin musst du unbedingt den Koffer mit in den Luftschutzkeller nehmen!“ Das war mein ständiger Auftrag. Ich hörte ihn täglich.
Die Abstände von einem Luftangriff zum Nächsten betrugen nur noch Stunden.
Es gab keinen Tag Pause.
Ob die Russen bombardierten oder die Amerikaner machten nur einen geringen Unterschied.
Russen kamen immer im Tiefflug mit wenigen Bombenflugzeugen. Die Amerikaner flogen höher und es war immer ein riesiger Pulk. Sie bombardierten ganze Stadtteile.
Alle Angriffe, die meine Wohngegend, in Berlin-Prenzlauer Berg, betrafen hatten immer die riesige Gasanstalt an der „Greifswalder Straße“ zum Ziel.
Zwei große Gasometer waren nicht zu übersehen.
Die Kokerei blies riesige Schmutzwolken aus. Das war ein perfektes Ziel.
Bis auf geringe Schäden blieb uns das Gaswerk erhalten. Und so auch eine Alternative zum ständigen Stromausfall. Mit Petroleum- oder Karbidlampen konnte man etwas Licht in die Wohnung bringen. Der Gasherd war aber wichtig für die Zubereitung von Speisen.
Heute lagen die Einschläge wieder sehr dicht.
„Das Gaswerk“ tippten wir.
Mutter rannte über den Hof zum Vorderhaus. Dort war ein Teil der Keller zu einem Luftschutzkeller ausgebaut. Hier trafen sich alle, die es wollten oder noch konnten bei einer blau gefärbten Glühlampe. „Funzel“ hieß sie bei uns.
Vielleicht waren wir etwas spät dran oder der Luftschutzwart ahnte Schlimmes. Jedenfalls machte er sofort hinter meiner Mutter die Stahltür zu. Ich war noch auf dem Hof.
In diesem Moment hörte ich es anschwellend Pfeifen. „Luftmine“ durchzuckte es mich.
Plötzlich Stille. Ich hatte gerade die oberste Stufe der Kellertreppe erreicht als ich keinen Boden mehr unter den Füssen hatte. Bruchteile von Sekunden verlor ich jede Orientierung. Oben oder Unten konnte ich nicht ausmachen.
Ein Schmerz in der Schulter brachte mich wieder in die Wirklichkeit zurück.
Der Luftschutzwart zerrte mich an meinem Arm in den Luftschutzkeller.
Draußen schien die Hölle los. Das Licht ging öfter aus und das Haus wackelte bis in den Keller. Niemand sagte ein Wort.
Die Frau, aus dem Vorderhaus, die uns Seife und die Haushaltsbedarf verkaufte bekreuzigte sich.
Meine Hände zitterten. Damit es niemand merkte setzte ich mich darauf.
„Wo hast du Richard gelassen?“ Mutter flüsterte.
„Der wollte noch den anderen Koffer mitnehmen“ sagte ich leise zurück.
„Dummkopf! Wenn er tot ist hat er auch nichts mehr von den Wertsachen.“ Wieder Stille.
Heute warteten alle bis sich Draußen nichts mehr rührte.
„Ich geh' mal nachsehen“ sagte der Luftschutzwart leise.
Keine Reaktion aus unserer Mitte.
Er schob die Riegel der Stahltür nach oben und steckte vorsichtig den Kopf aus dem Luftschutzraum. Dann verschwand er für lange Zeit.
„Hinten hat's welche erwischt, aber wir können jetzt raus“.
Immer noch wortlos erhoben wir uns und gingen vorsichtig die Kellertreppe hinauf.
Im Hof war nichts zu sehen. Nur der Himmel flackerte hell.
Jeder schlurfte in seine Wohnung.
Wir wohnten im 1. Hinterhof. Quergebäude nannte man das vornehm.
Jetzt kam uns auch Richard entgegen.
Meine Mutter schimpfte sofort los.
„Hinten ist das Haus weg“ meinte er nur.
„Wo hinten?“
„Na, dort wo die Werners wohnen.“
Wir gingen schneller durch unseren Hausflur.
Ich zog mit aller Kraft die schwere Tür zum 2. Hinterhof auf.
Wir guckten stumm.
„Nichts mehr zu machen“ meinte Richard. „Das muss jetzt ausbrennen.“
Wir gingen in unsere Wohnung.
Jetzt schrie Mutti wieder los: „Du Dussel! Du hättest tot sein können. Das hätte wirklich schief gehen können.“
Richard erwiderte ganz ruhig: „Ich hatte mich in den Türrahmen gestellt als unser Haus schwankte.“
Ich hörte nur mit einem halben Ohr zu.
Bisher hatte es immer Menschen in den anderen Straßen getroffen. Ich hatte schon viele Häuser gesehen, die niemand mehr löschte, weil es täglich neue Brände gab.
Ich sah mir jetzt den Schaden in unserer Wohnung an.
Das Wohnzimmer war halbvoll mit Schutt. Er reichte bis zur Oberkante des guten Buffets. Nur der Aufsatz guckte unversehrt heraus.
Wir rissen jetzt das Fenster auf, obwohl das Haus uns gegenüber noch lichterloh brannte.
Der Schutt in unserem Zimmer stammte vom 2. Hinterhaus und vom Seitenflügel. Eine Hausfront war einfach nach vorn gekippt, als die Balken verbrannt waren. Nun bedeckte er unsere Betten, sowie Tisch und Stühle.
Wir drei machten uns sofort an die Arbeit. Mit unseren Händen warfen wir die Mauersteine aus dem weit geöffneten Fenster. Licht hatten wir ja genügend. Das Hinterhaus brannte noch bis den Vormittag hinein.
Dort starben in dieser Bombennacht 6 Menschen. Drei Ehepaare.
Während zwei ältere Ehepaare schon lange nicht mehr in den Luftschutzkeller gingen, weil sie es zeitlich nicht mehr schafften, war ein jüngeres Ehepaar gerade erst zuhause angekommen. Sie taten Dienst bei der Straßenbahn. Müde wie sie waren hatten sie wohl den Fliegeralarm nicht gehört.
Augenzeugen des Bombeneinschlags erzählten Einzelheiten, die mich noch lange in meinen Träumen verfolgten.
Noch Jahrzehnte später gab es im Familienkreis Erzählungen über diese Bombennacht.
Mutter wiederholte jedes Mal die Szenen wie sie mit Richard schimpfte.
Auslöser für diese Rückbesinnungen war ein großer Ziegelsteinsplitter im Nussholzfurnier des Kleiderschrankes. So lange ich mich erinnere steckte dieser rote Stein in der Schranktür. Niemand machte sich die Mühe ihn zu entfernen.
Frau Pastor Lindemuth
Ich habe heute wieder im Bücherregal nach Büchern gesucht, die ich verschenken oder wegwerfen kann. Meine Sammelwut hat sich etwas gelegt. Heute kann ich schon mal ein Buch weiter geben. Anders ausgedrückt: ich will keinen weiteren Bücherschrank.
Immer ein Buch in die Hand nehmen und darin blättern und wieder zurück. Besonders Widmungen und Exlibris erzählen viel über das Buch und den Vorbesitzer.
Ein kleines schwarzes Buch fällt mir in die Hände. Leder mit einer Goldprägung.
Kein Titel; nur ein Kreuz auf dem Deckel. Gleich innen auf dem Frontipiz eine schnörkelhafte Handschrift in Sütterlin: „Dieses Buch gehört Frau Pastor Lindemuth“.
Ich erinnere mich an Frau Pastor. Meine Mutter war dort ab etwa 1942 als Dienstmädchen angestellt. Wir wohnten bei Frau Pastor. Sie hatte eine Etagenwohnung in Halle/Saale, Am Reileck Nr 4 (wenn ich mich recht erinnere). Hübsch sah meine Mutter mit ihrem weißen Schürzchen.aus. Immer beschäftigt flitzte sie durch die riesige Wohnung. Ständig musste ich sie suchen wenn ich sie sehen wollte.
Im langen Flur der Wohnung spielte ich sehr oft. Dort lag ein langer Läufer, der links und rechts blaue Streifen hatte. Viele Meter lang. Mit meiner Holzeisenbahn rutschte ich immer die Streifen entlang. Husch, Husch, husch, tuuuut, tuuuut. Das machte Spaß.
„Junge sei leise, Frau Pastor braucht Ruhe!“
Den Satz hörte ich oft am Tag. Trieb ich es zu toll kam Frau Pastor höchst selbst aus ihrem Salon.
„Knabe, Du siehst derangiert aus. Willst Du nicht endlich zur Ruhe gehen?“ Ich wollte nicht, aber ich musste.
In meinem Zimmer war es immer blitzblank. Ich hatte auch einen Spieltisch – zum aufklappen – nur spielen durfte ich darauf nicht.
„Echt Nussbaum, Junge mach keine Kratzer rein.“
Wie immer, wenn ich einige Minuten auf dem Bett lag, bekam ich Lust auf das Obst, das unter meinem Bett lag. Äpfel und Birnen. Bestes, reifes Obst. Brachten nette Leute aus der Nachbarschaft für Frau Pastor. Mir war es strikt untersagt das Obst auch nur anzusehen. Nur Mutti merkte immer etwas. Die „Griebsche“! Wohin damit, wenn man an die Fenster nicht herankommt?
So ging das nicht mehr. Frau Pastor wurde unwirsch. Ich musste in den Kindergarten. Der war gleich in der nächsten Querstraße. Die katholischen Schwestern nahmen mich in Empfang und setzten mich an einen Tisch. Ich guckte ihnen Ewigkeiten hinterher bis mich Mutti abholte.
„Na, was habt ihr denn Schönes gemacht?“
Wahrheitsgemäß antwortete ich: „Die eine Nonne hat mir ein Glas Tee gegeben.“
Der nächste Tag brachte das Aus. Ich wollte um die Ecke gehen, als plötzlich etwas Großes, Lautes vor mir war. Ich schrie. Eine Frau riss mich vor dem LKW weg und ich rannte heulend nach Hause.
Nun war ich wieder bei Frau Pastor. Später bekam meine Mutter eine Stelle in Berlin.
Die Stadt Halle wurde im Krieg fast völlig zerstört. Am Reileck blieb fast nichts stehen.
Ich weiß nicht, was aus Frau Pastor Lindemuth wurde.
Gott hat sie selig?
Die Russen sind da
Ich schreckte hoch. Ein lang gezogenes Heulen in der Luft. Als ich die Augen öffnete war es stockdunkel. Ich versuchte mich aufzurappeln, aber ich klebte fast am Bettlaken. Und das Atmen viel mir schwer. Der Brustkorb war wie eingeschnürt. Wum! Ein greller Blitz und Glas schepperte. Mutti schrie: „Junge nu' mach doch mal – wir müssen in den Keller“.
Rasch die gewohnten Bewegungen, rein in die Sachen, ab durch den Korridor, über den 1. Hinterhof und flink durch die eiserne Öffnung in den Luftschutzkeller. Mutti hechelte hinterher mit dem kleinen Koffer in der Hand. „In dem sind die wichtigsten Papiere“ sagte sie immer. Im Keller, an der Decke baumelte eine blaue Glühlampe. In deren Licht konnte ich gerade noch erkennen ob alle aus den anderen Wohnungen wieder hier waren. Immer dieselbe Runde. Nacht für Nacht. Ich wusste nicht wie lange das schon ging, aber ich hatte wirklich genug. Nie richtig ausschlafen. Entweder weckte mich das Heulen der Sirenen oder das Pfeifen der Luftminen.
Der Luftschutzwart mit seinem Stahlhelm und der umgehängten Gasmaske knurrte: „Mal sehen ob sie es heute schaffen“. Der Keller zitterte öfter und das Licht ging nun auch noch aus. Stockdunkel um mich. Ich rutschte dicht an Mutti. Ihre Hand erwischte ich nicht, die hielt fest den kleinen Koffer.
Wenn ich heute beschreiben soll, wie lange eine Ewigkeit dauert, so könnte ich das beschreiben.
Dreimal heulte die Luftschutzsirene. Allgemeines Seufzen. Einige fanden sogar ihre Sprache wieder. Der Luftschutzwart öffnete die Riegel der schweren Stahltür und wir tasteten uns die Kellertreppe hoch.
Im Hof nicht Besonderes. Nur über den Dächern helles Leuchten. Wir gingen auf die Straße um zu sehen woher der helle Lichtschein kam. Die Leute rannten zur Christburger Straße. Ich wollte auch, aber Mutti umklammerte meinen Arm. Ein alter Mann sagte laut: „Gott sei Dank, sie haben nichts getroffen“ Stimmte jetzt wirklich nicht. Jeder wusste aber was er meinte. Das Gaswerk in der Greifswalder Straße stand noch. Ich kannte den Mann – es war unser „Milchmann“. Bei ihm holte ich immer meine Kanne Milch für meine tägliche Suppe. Er hatte auf dem 3. Hinterhof einen Kuhstall. So musste ich nicht im Laden anstehen und bei jeden Fliegeralarm in einen Keller in der Nähe flitzen. In der Wohnung machte Mutti schnell den Gaskocher an und wärmte meine Suppe. Wie täglich. Beim ersten „Haps“ knirschte es fürchterlich zwischen den Zähnen – Glas! Ich spuckte in den „Ausguss“. Mutti siebte die Suppe und ich konnte weiter essen. Eine Scheibe im Küchenfenster hatte dem Luftdruck nicht standgehalten.
Heute weiß ich – dieser Lebensrhythmus dauerte etwa 3 Monate.
Kinder fragen immer wieder die Erwachsenen aus um sich zu erklären was sie nur als Bilder behalten haben.
Ich stand gerade an der Ecke Winsstraße/Michaelkirchstraße nach Lebensmittel an, als ein Tiefflieger aus Richtung Alexanderplatz kam und die gesamte Winsstraße entlang feuerte. Blitzartig waren wir alle im Keller. Als wieder Stille war rannte ich nach Hause.
Wir hörten ununterbrochen die Geschütze von der Frankfurter Allee. Der Drahtfunk plärrte einen Marsch und verkündete: „schwere Gegenangriffe unser tapferen Soldaten…“. Mutti schaltete das Radio ein. Bum, bum, bum – ich musste mit unter die Decke weil ich den verbotenen Sender hören wollte.
In unserer Gegend wurde es still. Erst unmerklich. Dann merkte es auch der Letzte. Der Luftschutzwart stand jetzt öfter in der Toreinfahrt und lugte durch einen Türspalt. Alle warteten gespannt, aber niemand ging weiter als bis zur Pumpe um Wasser zu holen.
Ich spielte im Hof, als wir Marschschritte hörten: Unsere? die Russen? Es ratterte auf dem Kopfsteinpflaster. Ich guckte jetzt auch durch den Torspalt. Da marschierte eine Maschinengewehr-Einheit der Russen vorbei. Es hörte sich wohl eher wie ein Schlurfen an würde ich genauer sagen. Die „Maxims“ mit ihren Stahlrädern verursachten Lärm. Die Soldatenstiefel weniger. Sie waren nicht „genagelt“ wie die von der Wehrmacht. Und die Stiefelschäfte waren aus grauem Filz. Die ganze Einheit sah grau aus. Mäntel, Gesichter. So hat sich mir das Bild eingeprägt. Ein Soldat stolperte auf dem Kopfsteinpflaster. „Die Russen sind da!“ krähte ich laut in den Hof zurück. Der Luftschutzwart riss mich gewaltsam in den Hausflur zurück: „halt die Klappe, Junge, sonst kommen die hier rein!“
„Der Krieg ist zu Ende“ meinten Einige. „Nee, die kämpfen doch noch!“ Die Meinungen waren unterschiedlich.
Ich ging zu Mutti. Es war Mittag. Ich bekam, wie immer, meine Milchsuppe.
Heute ging keine Sirene. Ich atmete befreit auf.
Ein Tag, der so strahlend begann
Erinnerung und nacherzählt.
Was ich woher habe, ist für mich heute nicht mehr nachvollziehbar. Ich sehe immer wiederkehrende Bilder von diesem Tag, der strahlend begann und mir als tragischer Tag in Erinnerung blieb.
Es war 1944. Frühjahr oder Herbst? Das weiß ich nicht mehr. Ich denke es war wohl das Frühjahr 1944. Jedenfalls war es ein kühler Tag.
Die Sonne stand tief am Himmel über Berlin. So wurde unser Zimmer im Parterre zum 2. Hinterhof bis zur gegenüberliegenden Wand von den Sonnenstrahlen getroffen.
Das schräg einfallende Licht zeigte, dass es viel Staub im Zimmer gab. Er stammte von den Bombenangriffen und den einstürzenden Häusern rings um unsere Wohngegend im Prenzlauer Berg.
Bis jetzt gab es aber mehr Fehlalarme als nahe Bombardements.
Trotzdem durfte ich fast nie im Freien spielen. Umherliegende Brandbomben oder Bombensplitter sind doch sehr gefährlich für mich, mahnte meine Mutter fast täglich.
Aber in der Wohnung gab es nichts, womit ich spielen konnte. Ich hatte kein Spielzeug. Nichts. Ich war hierhergekommen, weil hier der neue Arbeitsplatz meiner Mutter war. Als ihr Kind war ich dann, bei dieser Art ihrer Anstellung, immer eine Last. So war ich meist, während der Dauer ihrer Anstellung als Dienstmädchen, bei Pflegeeltern untergebracht. Eine eigene Wohnung hätte sich nicht gelohnt. Und die Dienstherren, meist Damen, duldeten selten ein Kind um sich.
Unsere vorige Station war Halle/Saale gewesen. Weil dort die Bombenalarme, schon fast ganztags erfolgten, suchte sich Mutti eine Arbeitsstelle in Berlin. Sie erzählte gern, dass sie das Stellenangebot in der Zeitung gefunden hatte.
Jetzt waren wir schon einige Monate in Berlin.
Und heute strahlte der Himmel. Jetzt am Vormittag war es schön ruhig. Ab und an muhte es aus dem Kuhstall des Hinterhofes im Nebenhaus. Diesen Stall kannte ich gut. Er lag im dritten Hinterhof. Hier holte ich nämlich täglich meine Kanne Milch ab.
Es ist heute fast vergessen, aber damals gab es viel Viehzucht mitten in den Wohnkarrees der Arbeiterviertel. Das reichte von der Selbstversorgung bis zum Handel mit den umliegenden Läden.
Mich hielt es nicht mehr in der Wohnung. Ich bettelte Mutti solange, bis sie ihr Einverständnis gab, dass ich auf dem 2. Hof hinaus kann. Bis aber dort ankam, dauerte es, für mich jedenfalls, eine Ewigkeit.
Hätte ich nur nicht gesagt, dass ich meinen blauen Mantel anziehen möchte. Dieser Mantel und dazu meine blauen, knöchelhohen, Schuhe waren meine Lieblings-Kleidungsstücke.
Warum dauerte es nur so lange, bis Mutti den losen Knopf befestigt hatte? Ich trippelte in der Stube auf und ab und nörgelte herum.
„Junge, so kannst du doch nicht gehen!“ wies sie auf den hängenden, großen, weißen Knopf an meinem Mantel. Wir sind zwar arm, aber deshalb kann man doch sauber sein. Ein Standardsatz. Ich hörte ihn noch viele Jahre.
Endlich war es soweit. Mein Aussehen genügte den musternden Blicken meiner Mutter. Ich trat durch das schwere, zweiflüglige Tor hinaus auf den 2. Hinterhof. Geblendet von der Sonne blickte ich im Hof umher.
Ah, da war noch ein Junge. Ich kannte ihn nicht. Auch vom Stubenfenster hatte ich ihn noch nie gesehen.
Es gab die übliche Phase des Kennenlernens. Woher? Wie lange wohnst du schon hier? Wo wohnst du? Die Frage nach dem Alter gibt es bei Jungen wohl nicht so oft.
Jedenfalls fanden wir Gemeinsamkeiten, um miteinander spielen zu können.
Was Kinder ebenso spielen. Es war schließlich nur ein Hinterhof. Man sollte nicht laut rufen wegen der Schichtarbeiter. Krach im Hinterhof? Das hörten alle in diesem gemauerten Geviert.
Wir hatten jetzt Papier gefunden. Es war wohl ein Stück Zeitungspapier, denn ich erinnere mich, dass es ein Bild von einem Panzer darauf gab. Er trug das Eiserne Kreuz.
Das interessierte uns aber weniger.
Flink hatten wir das Papier geteilt und wir begannen, kleine Schiffchen zu falten.
Hatte ich schon erwähnt, dass es in fast allen Häusern in den Arbeitervierteln auf einem Innenhof einen Löschteich gab?
Bei uns gab es diesen Löschteich genau vor unserem Fenster. Es war ein betoniertes Becken, das ständig mit Wasser gefüllt sein musste. Darüber wachte der Luftschutzwart.
Jetzt ließen wir dort unsere Papierschiffchen über diesen Teich treiben. Angetrieben von unserem ständigen Pusten. Wir pusteten, was die Lunge hergab.
Mir musste wohl die Puste ausgegangen sein. Eines meiner Schiffchen schaffte es nicht bis zum gegenüberliegenden Ufer.
Ich blickte mich nach einem Stock um, damit ich es wieder heranholen konnte.
Endlich fand ich an der Hauswand einen abgebrochenen Zweig vom Baum, der auf dem Nachbarhof stand. Er war wohl von dort zu uns herunter gefallen. Denn eine Mauer trennte die nebeneinanderliegenden Höfe.
Schnell rannte ich wieder zu meinem Papierschiffchen. Es sollte erneut auf weite Fahrt gehen. Dazu musste ich es aber erst noch zurück zum Hafen holen. Ich hockte mich hin und angelte mit dem Stock nach dem Boot. Es war nicht erreichbar. Auch mein Spielgefährte reichte nicht heran. Stock und Arme waren einfach zu kurz.
Noch immer in der Hocke rückte ich vorsichtig an den Beckenrand. Noch nicht! Noch näher an das Wasser. Es nutzte nichts. Mein Schiff war unerreichbar. Nun beugte ich mich noch weiter vor…
Eiskalt empfing mich der Teich. Meine Atmung verkrampfte s Ein Tag, der so strahlend begann.
ich. Ich gab keinen Laut von mir.
„Hoffentlich schimpft Mutti nicht mit mir“ durchfuhr es mich. Es war wohl die Sorge um mein blaues Mäntelchen. Ich sollte ihn schonen. Dann hörte ich eigentlich nichts mehr. Es war kalt und still um mich.
Muttis Stimme drang endlich zu mir durch. Da war sie allerdings schon dabei, mich zu entkleiden.
Aus nachträglichen Erzählungen entstand diese Geschichte meiner Rettung.
Meine Mutter hatte wohl voller Sorge immer wieder meinem Treiben am Löschteich zugesehen.
So konnte sie meinen Unfall sehen. Es war für sie leicht auf den Hof zu kommen. Schnell öffnete sie das Stubenfenster, ein Schritt, sie war auf dem Hof. Parterre-Wohnungen haben nur diesen Vorteil. Schnell hatte sie mich herausgezogen. Ein Mann war noch herbeigeeilt. Aber Mutti war schneller.
In der Wohnung wärmte sich mich auf. Ich hatte mir nicht einmal eine Erkältung zugezogen, erzählte sie später immer wieder.
Und mein blaues Lieblingsmäntelchen hat wohl dazu beigetragen, dass ich nicht so schnell unterging bei meinem unfreiwilligen Bad.
Es hatte ausreichend Luft gespeichert, dass es mich lange genug, bis zur Rettung auf der Oberfläche des Löschteiches treiben ließ.
So jedenfalls wurde es wieder und immer wieder bei Zusammenkünften der Familie erzählt.
Und nur so konnte ich dieses Erlebnis aus Bildern und Erzählungen zusammensetzen und aufschreiben.
21 Uhr.
Endlich gibt es etwas zum Essen!
Alleinerziehende Mutter in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg war Arbeit ohne Ende. Gab es damals das Wort „Alleinerziehend“? Ich denke man sprach damals von „Allein erziehend“. Damit war in den meisten Fällen gemeint, dass der Kindesvater im Krieg gefallen oder noch in der Gefangenschaft war. Auf alle anderen Frauen mit Kind sah man verächtlich herab.
Eine schwere Zeit für die Frauen. Kindererziehung war zur Nebensache geworden. Essen beschaffen war oberstes Gebot. Wer aber keine Arbeit nachweisen konnte bekam „Karte III“. Diese Stufe der Lebensmittelkarte bedeutete, dass man nicht verhungerte, aber ständig Hunger hatte.
Mutter ging also arbeiten. Sie war bis 1945 als Hausangestellte (Dienstmädchen) beschäftigt gewesen. Nun suchte sie natürlich eine Arbeit, die sie sofort ausüben konnte.
Sie hatte Glück. Eine Stelle als „Küchenfrau“ in einer Schule des „Deutschen Zoll“ war frei. Das grenzte schon fast an ein Wunder. Sie wurde als „Schälfrau“ eingesetzt. Kartoffeln schälen, Gemüse putzen. Ab 6 Uhr morgens. 6 Tage in der Woche.
Es machte ihr nicht viel aus die unqualifizierten Arbeiten auszuführen. Hauptsache war: „Ich bin an der Quelle“. Das war immer der Satz mit dem sie ihre Dienststellung entschuldigte. Später war sie dann als Köchin tätig. Es war eine große Küche, die täglich 3.000 Essen kochte. Eine schwere Arbeit. Der Monatslohn betrug anfänglich 216 Rentenmark. Rentenmark waren die Geldscheine, die als Reichsmark ausgegeben waren und nach 1945 einen Kupon bekamen um weiterhin ihre Gültigkeit zu behalten.
Geld nutzte fast nichts um Lebensmittel zu bekommen.
So bekamen wir fast täglich zuhause das gleiche Essen wie die „Zollschüler“. Das war Diebstahl. Das war auch bei der Einstellung im Personalbogen als Verfehlung extra aufgeführt. 'Kein Essen darf das Objekt verlassen!'
Wenn die Kinder zuhause hungern kann keine Mutter Essen in die Abfalltonne werfen.
Mutti kaufte sich eine „Igelit“-Schürze (Plastik). Darin gab sie das gestohlene Essen und steckte es in die große Tasche. Der Pförtner suchte in den Taschen der Angestellten nur nach Gläsern oder anderen Gefäßen. Den Trick mit der Schürze kannte er nicht.
Ich mochte dieses „Mitgebrachte“, wie wir dieses Essen nannten, überhaupt nicht. Alle Zutaten waren vermischt. Gemüse, Tunke, Kartoffeln. Nein, der Pudding nicht. Der kam nicht in die Schürze.
Es sah einfach eklig aus, wenn es kein Nudelgericht war. Und es stank fürchterlich. „Igelit“ hatte einen schlimmen Eigengeruch. Selbst nach Jahren verlor er sich nicht. Auch unsere Schuhe waren aus diesem Material.
Es stank jedenfalls immer, wenn Mutter die Schürze auf dem Tisch ausbreitete. Unsere Weigerung hatte keinen Zweck. „Iss das oder du bekommst gar nichts“ laute der ewige Satz, den Mutter lautstark äußerte.
Sie hatte ja Recht. Seit dem Aufstehen hatte es keinen Happen gegeben. Und jetzt war es schon abends.
Von 1945 bis 1948 ging das so. Wir hatten Essen. Wir waren gesund. Das Wichtigste in dieser Zeit.
Warum es immer erst abends um neun Essen gab? Das ist recht einfach zu erklären.
Auf diese Zeit hatte sich die Familie geeinigt, damit auch jeder etwas zum Essen bekam. Denn jetzt waren erst alle „von der Arbeit“ oder „vom Besorgen“ zurück. Dann stand auch erst fest, ob das Mitgebrachte noch auf den Tisch kam oder für den nächsten Tag als Mahlzeit diente.
Meinen Freunden in der Straße ging es oft schlechter als mir. Abgeben konnte ich auch nicht, aber ich war wenigstens einmal am Tag
Einsegnung 1949
Die Einsegnung meiner Schwester Ingrid stand an. Mutti war katholischen Glaubens, Vater evangelischen Glaubens. Uns Kindern wurde aber immer gesagt: wenn es einen Gott gäbe hätte er diesen Krieg nie zugelassen. Das war auch unsere einzige Erziehung in Glaubensfragen.
Meine Schwester hatte auf ihrem Lyzeum bei ihren Mitschülerinnen gesehen, dass es zur Konfirmation oder Einsegnung Geschenke und neue Kleider gibt. Das wollte sie auch haben. Meist gab es noch ein Festessen in der Familie. Und 1949 interessierte nur ein satter Bauch und Kleidung, die nicht schon vor dem Krieg von älteren Geschwistern oder den Eltern getragen war.
„Warum willst du denn eine Einsegnung? Wir haben doch nichts was du anziehen kannst, Mädel.“
„Ich bin doch aber getauft“.
„Das war damals so üblich. Erst bei Hitler musste man das nicht mehr“.
„Ich war doch aber zum Religionsunterricht“.
„Das war doch Pflicht, damals“.
„Aber alle Mädchen bekommen eine Einsegnung oder Konfirmation“.
„Dann red' mal mit dem Pastor, ob er dich überhaupt noch nimmt. Du warst doch niemals zum Gottesdienst“.
„Danke Mutti“ jubelte Schwesterlein.
Meine Schwester meldete sich artig beim Pfarrer an.
Wäre für sie damit alles gut gewesen - für mich begann der Ärger erst richtig.
„Du kommst natürlich mit“ befahl Ingrid. Was hat ein „kleiner Bruder“ da entgegen zu setzen?
Ich trabte also brav jeden Sonntag um 10:00 Uhr mit Ingrid zum Gottesdienst. Kalte Kirche und immer diese extrem langen Predigten. Ich rutschte auf dieser grau gestrichenen Bank hin und her. Ingrid gähnte und versuchte die Augen offen zu halten. Lange Reihen von Frauen. War ein Mann dabei war er uralt oder kriegsversehrt. Vor mir ein Liederbuch. Lesen machte mir Spaß. Also Gehör auf „Durchgang“ und alle Liedtexte lesen. Manche gefielen mir, aber mit „Halleluja“ und ähnlich hochpreisenden Begriffen konnte ich nichts anfangen. Die hatte ich mir später erklären lassen.
Eine jede Predigt hat einmal ein Ende. Alle standen auf und sangen. Ich bekam plötzlich einen Schubs von Ingrid. Als ich sie erstaunt ansah flüsterte sie; „Du musst erst die Melodie hören und dann nach-singen. Ich glaube in der 24. Strophe hatte ich es fast raus. Vorher kannte ich nur Lieder mit 3 Strophen, außer natürlich Küchenlieder. Die sang Mutti immer. Kannte sie noch aus der Zeit als Dienstmädchen.
Jedenfalls war Gottesdienst nichts für einen quirligen Jungen. Zum Glück war die Gemeinde tolerant. Außer Zischlauten in meine Richtung passierte mir nichts.
Jede Zeit ist einmal zu Ende. Auch verordnete Kirchenbesuche.
Von der eigentlichen Einsegnung bekam ich nichts mit. Ich kann mich jedenfalls an solch wichtiges Ereignis nicht erinnern.
An Ingrids neues Kleid erinnere ich mich.
“Das ist ein Complet“ wurde ich berichtigt.
Aber ich war stolz auf meine bildschöne „große Schwester“. Erst später fiel mir auf, dass meine „Punktkarte“ verbraucht war und ich mindestens ein Jahr nichts Neues zu Anziehen bekam. Der nächste Winter war weit weg.
Niemand in der Familie dachte mehr so richtig an diese Einsegnung. Außer Mutti. Sie erschreckte uns eines Tages mit der Mitteilung, dass am nächsten Tag ein Fotograf kommt und Fotos von uns macht.
„Aber wir haben doch nichts anzuziehen!“ Unser gemeinsamer Aufschrei. Mutti ließ keine Gegenargumente zu. „Morgen 9 Uhr kommt er und Schluss“.
„Aber wir haben doch kein Geld“. Nicht mal dieser Einwand half. „Ich habe mir etwas geborgt von Onkel Richard“.
Der Fotograf war pünktlich. Mutti nicht. Wie immer hatte sie nichts anzuziehen und wir waren auch nicht das, was sie auf dem Foto sehen wollte. Ingrid warf noch ein, dass andere Kinder wohl repräsentativer wären. Das brachte Mutti an den Rand des Wahnsinns. Ich kannte solche Fremdwörter nicht, deshalb maulte ich nur vor mich hin und zog 'ne Schnute. Das brachte mir eine Maulschelle ein. Mutti wusste aber Rat und puderte schnell die roten Fingerabdrücke.
Auf dem Hof vor einem Busch postiert machte der Fotograf die ersten Aufnahmen. Unserer Mutti fehlte etwas. „Junge du spielst doch Flöte und Ingrid kann Akkordeon. Holt mal schnell alles her“. Ingrid guckte mich an und ich trabte los. Als ich wieder kam erntete ich ein großes Lob vom Fotografen: „Das ist aber schlau von dir, dass du den Hocker noch mit gebracht hast, Kleiner“.
Von nun an guckte ich nicht mehr zum Fotografen sondern nur noch in der Gegend 'rum oder auf seine Finger, die die Kamera einstellten.
Der Fotograf zog endlich ab. Mutti war zufrieden und Ingrid und ich vergaßen das alles wieder.
Eine Woche später quietschte meine Mutti auf, als der Fotograf die Bilder ablieferte. „Dieser Idiot! Wie kann der nur so dämlich sein! Nie wieder kommt der mir ins Haus“. Wir standen voller Erwartung, auf die Lösung wartend.
Endlich kam sie wieder zu sich. „Dieser Dussel hätte doch sehen müssen, dass Ingrid das Akkordeon falsch herum trägt“.
Das war alles? Ingrid und ich guckten uns an und schwiegen grinsend.
Die Bilder kamen in die Schublade an der Nähmaschine. Dorthin wo sie nie wieder hin sah.
Aber so haben sie überlebt und sie erzählen mir eine Geschichte aus meinem Leben.
Flaggenwechsel
Endlich konnte ich wieder in die Sonne blinzeln. Ein herrlicher Sonnentag begann. Ich beeilte mich das morgendliche Ritual mit Katzenwäsche und still sitzen, beim Frühstück hinter mich zu bringen. Unsere Wohnungsfenster lagen etwas ungünstig. Die Sonne erreichte uns nur vormittags für kurze Zeit.
Aber ich verfolgte sehr gespannt, wie ihr Schein über den Küchentisch wanderte. Oft rückte ich Wegmarken auf dem Tisch zurecht, um zu verfolgen, wie schnell die Sonne über den Tisch wanderte. Meist war es der Eierbecher, denn ein Frühstücksei gab es fast immer. Die Hühner auf dem Hängeboden machten das möglich.
Die Zwickmühle war für mich die Zeit, die dabei verstrich. Wartete draußen vielleicht schon die ganze Kinderbande unserer Straße auf mich? Wir waren schließlich immer so gut wie verabredet. Oder hatte Mutti doch noch eine kleine Überraschung für mich? Einen kleinen Pudding oder einen Grießbrei? Ich sollte doch groß und stark werden. So sagte sie immer. An meinem Appetit sollte es nicht liegen. Essen konnte ich zu jeder Stunde. Der Krieg war gerade einige Monate beendet. Essen! Das war das wichtigste Wort in diesen Tagen, Monaten, Jahren, die darauf folgten.
Heute wollte ich nicht warten, bis die Sonne auf unserem Küchentisch verschwand. Ich quengelte schon merklich, wie Mutti feststellte.
„Aber geh’ noch einmal auf die Toilette!“ mahnte sie. „Sonst klingelst du gleich wieder an der Tür.“
„Jaaa“ seufzte ich.
Andere Kinder bekamen einen Wohnungsschlüssel um den Hals gebunden. Ich war doch auch schon sechs Jahre alt.
Hände waschen, Toilette, Hände waschen. Eine enorme Zeitverschwendung. So empfand ich das jedenfalls.
Trotzdem trabe ich auf die Toilette.
Mit äußerster Anspannung zielte ich in das kurze Eisenrohr, das aus dem Toilettenboden ragte. Ich hatte aber schon ausreichend Übung. So konnte ich den Zinkeimer, der danebenstand unbeachtet lassen.
„Wir haben kein Toilettenbecken mehr!“ hatte Mutti vor einiger Zeit ausgerufen, als sie von einem Kontrollgang von Berlin-Pankow nach Berlin Prenzlauer Berg zurückkehrte. Ein siegreicher Sowjetsoldat hatte es mitgenommen. Warum er Mehl und Zucker im Küchenschrank zurückließ, blieb den Erwachsenen immer ein Rätsel.
Jedenfalls bedauerte ich die fehlende Klo-Schüssel nicht so sehr. Nur meine Schwester meckerte täglich mit mir. Sie war für die Toilettenreinigung verantwortlich.
Jeder hatte eine feste Aufgabe bei uns. Ich war zum Einkaufen verdonnert. So erzählte ich es jedenfalls immer meinen Kumpels.
Heute bremste aber etwas meinen Spieltrieb. In der Ecke der Toilette stand ein Stock mit Stoff herum gewickelt. Das fiel mir heute erst auf!
Ich knöpfte schnell meinen Hosenschlitz zu und griff nach dem Stock. Gespannt wickelte ich den Stoff ab.
Da kam eine knallrote Fahne mit rundem, weißem Kreis hervor. In der Mitte war ein komisches Gebilde aus schwarzem Stoff. Das kannte ich nicht.
Ich vergaß das Händewaschen.
Flink ging ich die wenigen Schritte in die Küche und zeigte Mutti meinen Fund. Sie sah mich an, sagte aber keinen Ton.
Dann nahm sie mir den Stock aus der Hand und ermahnte mich leise: „Sag’ das nur nicht auf der Straße, was du hier gefunden hast. Das darf niemand wissen. Niemand! Hörst du?“
Sie hatte meine beiden Schultern ergriffen und sah mich streng an.
Ich nickte. Diese Ermahnung kannte ich schon lange. Sie hatte ich immer gehört, wenn wir den „Feinsender“ im Radio einschalteten.
„Wir siegen uns noch zu Tode“ hörte ich vorher immer sagen, wenn aus dem Radio der Wehrmachtsbericht dröhnte.
Am Abend berieten die Erwachsenen am Tisch, was mit dem schönen roten Stoff geschehen solle, den ich gefunden hatte.
„Ich will keinen Fummel aus dem Zeug!“ erklärte meine Schwester kategorisch.
Da sieht man doch bestimmt noch, wo der weiße Kreis vorher war!“
“Quatsch! Das Ding hing noch nie aus dem Fenster!“
Jetzt war ich dran!
„Was ist das, Mutti?“
Mutter beugte sich über den Küchentisch, um den wir immer zusammensaßen, wenn alle zuhause waren: „Das war die Hitlerfahne.“ Flüsterte sie. „Deshalb halt bloß den Mund Junge, sonst holen die uns noch ab.“
Dabei zeigte ihre Hand zum Fenster. Dorthin, wo die sowjetischen Soldaten, also die „Russen“ einen Stützpunkt hatten.
Von hier aus schwärmten sie jeden Tag aus, um in unserem Viertel die Eisenbahner und Postbeamten aus den Wohnungen zu holen.
„Die kennen den Unterschied zwischen der „SS“ und der „Reichsbahn“ nicht klagten die
Nachbarsfrauen. Hauptsache dunkle Uniform, die Idioten. Schwarz und Dunkelblau können die doch nicht unterscheiden“
So richtig habe ich nie erfahren, wohin der schöne rote Stoff verschwand. Jedenfalls stand nun der Stock mit der goldenen Spitze ewige Zeiten in der Toilette herum.
Er hatte bestimmt noch erlebt, wie ein gusseisernes Toilettenbecken montiert wurde, das wir aus den Ruinen gezogen hatten.
Ich denke mir heute, dass er in Lebensmittel umgetauscht wurde.
In der Schule lernte ich eine ganz andere Fahne kennen. Drei Streifen. „Schwarz, Rot, Gelb“. Das sah besser aus. „Gold“ berichtigte mich ständig die Lehrerin. Gold kannte ich nicht, also blieb ich bei Gelb.
Das Lied dazu hatte eine schöne Melodie. Wir lernten das so lange auswendig, bis es jeder fehlerfrei aufsagen und singen konnte.
Dann stieg ich auf. In höhere Klassenstufen. Natürlich nur in der Schule.
Zuhause veränderte sich nicht viel. Das wichtigste Wort war dort noch immer „Essen“.
Eine Fahne sah ich dort nie wieder.
In der Schule zeigten sie mir aber eine neue Fahne. Und dann ging das auswendig lernen schon wieder los. Die Melodie erschien mir nicht so einschmeichelnd, wie im Lied vorher.
Dieses Lied begleitete mich viele Jahrzehnte im Leben. Es wurde oft gesungen, ich hörte es oft. Aber die Melodie und der Text des zuerst gelernten Liedes blieben trotzdem im Gedächtnis.
Und die Fahne zum neuen Lied?
Die hing, flatterte und wehte an allen Masten zu allen obligaten Terminen. Selbst meine Kinder hatten sie als Papiermodell in der Hand.
Ich wurde nie ihr bekennender Freund. Mir kam sie etwas verkorkst vor. Das Schlichte schwarz-rot-gelb war mit Hammer und Zirkel verziert. Dazu noch ein Ährenkranz. Das war nicht diese Fahne, die ich als Schüler kennengelernt hatte. Dort hatte man mir auch den Ursprung dieser Fahne erklärt. Der erschien mir einleuchtender als die neue Bedeutung. Ich konnte oder wollte nicht umlernen. War ich schon zu alt dafür geworden?
Erst fragten mich meine Kinder, warum wir zu staatlich verordnetem „Flagge zeigen“ keine Fahne aus dem Fenster hängten. Dann kamen die Genossen der „Sozialistischen Einheitspartei“, die in unserem Haus wohnten und mahnten an, dass eine Fahne schwarz-rot-gold mit Ährenkranz doch schon preiswert sei. „Gerade mal drei Mark kostet die kleine Ausgabe.“ Und das kann sich doch wohl jeder DDR-Bürger leisten fügte man den dringlichen Mahnungen an.
Ich leistete mir das kleine Ding erst, als mein Abteilungsleiter in einem höchst einseitigen Gespräch mit mir feststellte, dass er mir eine Fahne schenkt und mir dann das Geld dafür von der Jahresendprämie abzieht.
Das hatte mich überzeugt.
Jetzt hingen zweimal im Jahr zwei Fähnchen von meinem Balkon. Die schwarzrot-gelbe mit Ährenkranz und eine Knallrote ohne Insignien.
Viele Jahre blieben nun nicht mehr zum „Flagge zeigen“.
Der neue Flaggenzwang galt jetzt nur noch für öffentliche Gebäude.
Ich habe heute keine Fahne mehr. Egal welcher Farbe. Nicht mal im Klo steht noch ein unbenutzter Flaggenstock herum.
Aber es hängen doch schon wieder Fahnen aus den Fenstern, leuchten vom Balkon und flattern an den Autos. Schwarz-Rot-Gelb. So wie sie erfunden wurde.
Nur der Anlass hat sich geändert.
Sie wird von der Bevölkerung gezeigt, wenn wichtige Anlässe es erfordern.
Besonders aufgefallen sind mir dazu Fußball-Veranstaltungen, überhaupt Sportveranstaltungen und als Ausweis für beginnenden Nationalstolz der Kleingärtner und im Ausland weilenden deutschen Staatsbürgern.
Geh'ste wech – da warste schon!
Heute höre ich diesen Satz fast nie mehr. Es ist ein Satz aus der Vergangenheit. Nur ab und zu taucht er wieder aus der Versenkung auf. Dann, wenn sich ältere Menschen über ihre Kindheit unterhalten.
Sie sind „Zeitzeugen“. Genauer Zeugen aus einer Zeit als Brotbelag eher selten war und es nur um das tägliche Brot ging.