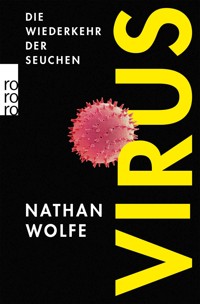
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum Pandemien auf dem Vormarsch sind - und wie sie sich eindämmen lassen. Sars, Ebola, Covid-19: Immer wieder tauchen neue lebensbedrohliche Infektionskrankheiten auf und verbreiten sich in Windeseile. Nathan Wolfe warnte bereits vor Jahren: Wir müssen damit rechnen, dass es in Zukunft noch mehr werden. Aber woran liegt das? Der preisgekrönte Biologe sucht mit detektivischem Spürsinn nach den Erregern rätselhafter Seuchen – in hochmodernen Forschungslabors ebenso wie im zentralafrikanischen Dschungel und auf den Wildtiermärkten Ostasiens. In diesem Buch erklärt er, wie, wo und warum Pandemien wie Corona ausbrechen. Und er stellt sein revolutionäres Konzept vor, mit dem wir sie künftig vorhersagen und verhindern können, statt nur auf sie zu reagieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nathan Wolfe
Virus
Die Wiederkehr der Seuchen
Über dieses Buch
SARS, Ebola, Covid-19: Immer wieder tauchen neue lebensbedrohliche Infektionskrankheiten auf und verbreiten sich in Windeseile. Nathan Wolfe warnte bereits vor Jahren: Wir müssen damit rechnen, dass es in Zukunft noch mehr werden. Aber woran liegt das? Der preisgekrönte Biologe sucht mit detektivischem Spürsinn nach den Erregern rätselhafter Seuchen – in hochmodernen Forschungslabors ebenso wie im zentralafrikanischen Dschungel und auf den Wildtiermärkten Ostasiens. In diesem Buch erklärt er, wie, wo und warum Pandemien ausbrechen. Und er stellt sein revolutionäres Konzept vor, mit dem wir sie künftig vorhersagen und verhindern können, statt nur auf sie zu reagieren.
Vita
Nathan Wolfe, geboren 1970, ist Virologe und Visiting Professor für Humanbiologie an der US-Eliteuniversität Stanford. Als Direktor der von ihm gegründeten Global Viral Forecasting Initiative versucht er, weltweit neuartige Virusinfektionskrankheiten aufzuspüren, bevor sie sich ausbreiten können. Das Magazin TIME nahm ihn in die Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt auf.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel «The Viral Storm. The Dawn of a New Pandemic Age» bei Times Books, Henry Holt and Company, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2020
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Viral Storm. The Dawn of a New Pandemic Age» Copyright © 2011 by Nathan Wolfe
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00917-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einleitung
Pang Thruk in der thailändischen Provinz Kanchanaburi ist ein Dorf wie so viele in diesem Teil der Welt – feucht, üppig grün und erfüllt von den Klängen der Natur. Im Westen des Landes nahe der burmesischen Grenze gelegen, hat Pang Thruk rund 3000 Einwohner, die ihren Lebensunterhalt mit dem Anbau von Zuckerrohr und Reis verdienen.
Im Dezember 2003 wohnte hier auch Kaptan Boonmanuch, ein sechsjähriger Junge, der als einer der Ersten an einem neuartigen menschlichen Virus sterben sollte.
Am liebsten fuhr Kaptan Rad, kletterte auf Bäume und spielte mit seinem Plastikdalmatiner, der drei Welpen in einem winzigen Wagen hinter sich herzog und dabei mechanisch kläffte. Gern half der Junge auch seiner Familie auf dem Bauernhof. Fast jede Familie in Pang Thruk besaß Legehühner, manche Familien hielten darüber hinaus Hähne für Hahnenkämpfe. Kaptans Onkel und Tante wohnten nur ein Stück weit die Straße hinunter; sie hatten einen Bauernhof mit rund 300 Hühnern in Freilandhaltung. Jeden Winter starben im Dorf einige Hühner, vermutlich an Erkältungen oder anderen Infektionen. Doch im Dezember 2003 stieg die Zahl der Todesfälle dramatisch an. In diesem Winter litten die Hühner auf dem Hof von Kaptans Onkel wie auch auf vielen anderen Bauernhöfen unter schwerem Durchfall und Schwäche; zudem verhielten sie sich seltsam. Alle starben entweder an der Erkrankung oder wurden gekeult – und Kaptan half bei der Beseitigung der toten Tiere. Ein oder zwei Tage vor Neujahr nahm der Junge Berichten zufolge eines der kranken, kreischenden Hühner mit nach Hause, ein Weg von nur wenigen Minuten.
Ein paar Tage später bekam Kaptan Fieber. Eine Ambulanz im Dorf diagnostizierte eine Erkältung, aber nach drei Tagen ohne Besserung brachte ihn sein Vater Chamnan, ein Reisbauer, der in Teilzeit als Fahrer arbeitete, in ein öffentliches Krankenhaus. Röntgenaufnahmen ergaben, dass der Sechsjährige an einer Lungenentzündung litt. Man behielt ihn zur Beobachtung im Krankenhaus. Einige Tage später stieg Kaptans Fieber auf gefährliche 40,6 °C. Sein Vater bezahlte umgerechnet 36 Dollar für einen Krankenwagen, um ihn in das mehr als eine Stunde entfernte Siriraj-Krankenhaus nach Bangkok zu bringen, wo er besser versorgt werden konnte.
Bei seiner Ankunft litt Kaptan außer Fieber auch noch an Atemnot. Wie Untersuchungen zeigten, waren beide Lungenflügel stark entzündet; der Junge wurde auf die pädiatrische Intensivstation verlegt und beatmet. Tests auf Bakterien fielen negativ aus, was darauf hindeutete, dass die Infektion wahrscheinlich auf ein Virus zurückging. Genauere Untersuchungen mit Hilfe einer molekularbiologischen Technik, der Polymerasekettenreaktion (PCR), ergaben, dass sich Kaptan wahrscheinlich mit einem atypischen Grippeerreger infiziert hatte, der womöglich noch nicht (oder nur selten) beim Menschen aufgetreten war.
Nach elf Tagen Krankheit begann das Fieber des Jungen schließlich nachzulassen. Doch trotz aller Intensivmaßnahmen verschlimmerten sich seine Atemprobleme. Kurz vor Mitternacht des 25. Januar nahmen ihn die Ärzte vom Beatmungsgerät: Seine Lunge war buchstäblich in Flüssigkeit ertrunken. Kaptan wurde Thailands erstes bekanntes Opfer des Virus H5N1, des Erregers der «Vogelgrippe», wie es bald weltweit hieß.
So schlimm Kaptans Tod war – und die Berichte darüber beschreiben das Begräbnis des Jungen und die Trauer der Familie in tragischen Einzelheiten –, Tatsache ist, dass Kinder in Entwicklungsländern ständig an Erkrankungen wie dieser sterben. Hatten Wissenschaftler in den 1960er Jahren noch vorausgesagt, Infektionskrankheiten würden bald Vergangenheit sein, so gehören sie bis heute zu den wichtigsten Killern. Doch wenn es um globale Risiken geht, sind nicht alle Todesfälle gleich. Stirbt jemand an einer Infektionskrankheit, dann ist dies meistens ein Ereignis von lokal begrenzter Bedeutung, das – wie schrecklich auch immer für das Opfer und seine Familie – für den Planeten insgesamt ein nur begrenztes Risiko darstellt. Doch einige Todesfälle, wie derjenige von Kaptan, signalisieren möglicherweise ein Ereignis, das die Welt verändert: die erste Infektion eines Menschen mit einem tierischen Virus, das in der Lage ist, Millionen oder gar Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt auszuradieren. Die Menschheit hätte fortan ein anderes Gesicht.
Kaptans Bruder hält bei der Beerdigung ein gerahmtes Foto von Kaptan Boonmanuch.
Das Hauptziel meiner Arbeit besteht darin, genau diese ersten Momente bei der Geburt einer neuen Pandemie aufzuspüren und dann zu versuchen, die Ursachen der Infektion zu verstehen und ihre Ausbreitung zu stoppen, bevor sie ein globales Stadium erreicht. Weil Pandemien fast immer mit der Übertragung eines tierischen Erregers auf einen Menschen beginnen, führt mich meine Arbeit um die ganze Welt – von Jagdcamps im zentralafrikanischen Regenwald bis zu Wildtiermärkten in Ostasien. Doch sie bringt mich auch in die hochmodernen Laboratorien der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und in die Zentren zur Bekämpfung von Infektionsausbrüchen bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Suche nach diesen potenziell verheerenden Erregern hat mich veranlasst zu erforschen, wie, wo und warum Pandemien ausbrechen. Ich arbeite daran, Systeme zu entwickeln, um Pandemien im Frühstadium zu entdecken, ihre Tragweite einzuschätzen und mit etwas Glück diejenigen auszumerzen, die das Potenzial haben, eine Katastrophe auszulösen.
Während ich in aller Welt Vorträge über meine Arbeit halte und an der Stanford University Virologie-Seminare gebe, lässt sich kaum übersehen, dass das allgemeine Interesse an dieser Thematik stark gestiegen ist. Jedermann erkennt, mit welcher Urgewalt Pandemien die menschliche Bevölkerung heimsuchen und scheinbar wahllos Tod und Verderben bringen können. Doch angesichts ihrer Bedeutung sind wichtige Fragen ungeklärt:
Wie beginnen Pandemien?
Warum haben wir gegenwärtig unter so vielen Pandemien zu leiden?
Was können wir tun, um Pandemien in Zukunft zu verhindern?
Mein Buch ist der Versuch, diese Fragen zu beantworten und die Teile des Pandemie-Puzzles zusammenzusetzen.
Teil I, «Die Wolken ziehen sich zusammen», stellt unsere Hauptakteure vor, die Mikroorganismen[*], und taucht in die Geschichte unserer Beziehung zu ihnen ein. Er erkundet die unermessliche Welt dieser Lebewesen und rückt diejenigen, die uns bedrohen, ins rechte Licht. In diesem Teil geht es auch um einige der einschneidendsten Ereignisse in der Evolution des Menschen und seiner frühen Vorfahren, und ich möchte versuchen, aus den oft lückenhaften historischen Daten einige Hypothesen darüber zu entwickeln, wie diese Ereignisse unsere Wechselbeziehungen mit Mikroorganismen beeinflusst haben.
In Teil II, «Der Sturm», untersuchen wir, wie es gekommen ist, dass menschliche Populationen heutzutage so überaus anfällig für Pandemien sind und mit welchen Pandemien wir in Zukunft rechnen müssen.
Teil III, «Die Vorhersage», beschreibt die faszinierende neue Welt der Pandemie-Prävention und stellt uns einen neuen Typ von Wissenschaftlern vor. Sie bemühen sich, ein virtuelles globales Immunsystem zu entwickeln, das Pandemien stoppen kann, bevor sie zu einem weltweiten Albtraum werden. Nebenbei werden wir abgelegene, von der Jagd lebende Dörfer in Zentralafrika besuchen, uns mit Malaria bei wilden Orang-Utans auf Borneo beschäftigen, erfahren, wie sich mit Hilfe moderner Werkzeuge zur Gensequenzierung völlig neue Viren entdecken lassen, und sehen, wie Silicon-Valley-Unternehmen möglicherweise die Überwachungsmethoden revolutionieren, die den nächsten größeren Ausbruch ausmachen sollen.
An diesem Punkt fragen Sie sich vielleicht, wie jemand dazu kommt, seine Karriere dem Studium von Seuchen zu widmen. Steckt dahinter der Wunsch, die Welt zu retten? Oder geht es um den wissenschaftlichen Reiz, bislang völlig unbekannte, unsichtbare Lebensformen zu entdecken, die das Potenzial haben, große Teile der Menschheit auszulöschen? Vielleicht ist es der Wunsch, einen Teil der komplexen Ökologie des Menschen in allen Einzelheiten zu verstehen. Womöglich ist es auch der Drang, exotische Plätze in aller Welt zu erkunden, wo diese neuartigen Viren häufig auftauchen. Doch auch wenn ich es mir inzwischen zur Lebensaufgabe gemacht habe, mein Möglichstes zu tun, Pandemien zu verstehen und ihnen Einhalt zu gebieten, war das nicht immer so. Meine Arbeit mit Mikroorganismen begann tatsächlich als kleine Fußnote zu einer Studie, die ich in Zentralafrika mit wilden Schimpansen durchführen wollte.
Schon als Kind wurde mein Interesse an Menschenaffen geweckt, das mich seitdem begleitet. Auslöser war eine National Geographic-Fernsehdokumentation, in der es darum ging, dass Menschen näher mit Menschenaffen (wie Schimpansen und Bonobos) als mit Tieraffen (wie Pavianen und Meerkatzen) verwandt sind. Ein Stammbaum mit Menschen und Menschenaffen als Geschwistern (und Tieraffen als entfernteren Vettern) passte gar nicht zu meinen Erinnerungen an die Geschöpfe, die alle zusammen im «Affenhaus» des Detroiter Zoos eingesperrt waren. Wir Menschen standen vor den Käfigen, und die restliche Verwandtschaft saß darin. Dass Menschenaffen und Menschen eng verwandt waren, hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Meinem Vater zufolge übernahm ich nach dem Dokumentarfilm einige Tage lang die andere Rolle: Ich lief auf allen vieren durchs Haus, versuchte, ohne Worte zu kommunizieren, und bemühte mich auch ansonsten darum, meinen inneren Affen zutage treten zu lassen.
Meine Faszination für Menschenaffen entwickelte sich von kindlicher Neugier zu einem intellektuellen Interesse daran, was unsere nächsten Verwandten uns über uns selbst erzählen konnten. Was als breitgefächertes Interesse an Menschenaffen als Primaten begann, wurde zu einem spezifischeren Interesse an Schimpansen und ihren weniger bekannten Brüdern, den Bonobos – den beiden Affenspezies, die sich mit uns einen eigenen Ast des Stammbaums teilen. Wie hatte die Zeit der Trennung seit unserem letzten gemeinsamen Vorfahren mit diesen Menschenaffenarten unseren Geist, unseren Körper und unsere Welt geformt? Welche Merkmale teilten wir noch immer?
Zusammen mit dem intellektuellen Interesse wuchs der Wunsch in mir, diese Menschenaffen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Deshalb musste ich sie in den zentralafrikanischen Regenwäldern aufspüren, um mit eigenen Augen zu sehen, wie sie wirklich waren. Als es nun darum ging, sich ein Promotionsprogramm auszusuchen, entschied ich mich für eines in Harvard, wo ich mit Richard Wrangham und Marc Hauser, zwei bedeutenden Primatologen, zusammenarbeiten würde. Im ersten Jahr meiner Doktorarbeit sollte ich viele Monate damit verbringen, zu begründen, warum sie mich die wilden Schimpansentrupps studieren lassen sollten, mit denen Wrangham bereits jahrelang im Kibale-Wald im Südwesten von Uganda gearbeitet hatte.
Ich schlug vor, die Selbstmedikation der Kibale-Schimpansen zu untersuchen. Die Vorstellung, dass diese Tiere Pflanzen mit medizinischer Wirkung zu sich nehmen, um ihre eigenen Infektionskrankheiten zu bekämpfen, war damals noch nicht mehr als eine interessante Hypothese. Ich hatte mich im Vorjahr während meines Studienaufenthalts in Oxford mit dieser Idee auseinandergesetzt und bei einer Ausstellung über tierische Selbstmedikation am Oxford University Museum of Natural History mitgearbeitet.
Das Museum der University of Oxford ist ein eindrucksvolles Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Es ist im Stil einer gotischen Kathedrale gehalten, ruht jedoch auf massiven Eisenträgern, die an das Skelett von Säugern erinnern und betonen, dass es sich um eine Kirche der Naturwissenschaften statt der Religion handelt. Dieses Museum beherbergt eine einzigartige Sammlung, darunter auch die Käfer, die Charles Darwin von seiner berühmten Reise mit der Beagle mitgebracht hatte. Hier fand 1860, sieben Monate nach der Veröffentlichung von Darwins bahnbrechendem Werk Über den Ursprung der Arten, die berühmte Debatte zwischen Huxley und Wilberforce über die natürliche Selektion statt. Es ist der perfekte Ort, um über die Stellung des Menschen in der Natur nachzudenken. Ich arbeitete unter Anleitung des renommierten Biologen W. D. Hamilton und seines Kollegen Dale Clayton, eines Experten für die Verhaltensweisen, die Tiere einsetzen, um sich von Parasiten zu befreien, und konnte schließlich zeigen, dass Selbstmedikation im Tierreich weit verbreitet ist. So unterschiedliche Tiere wie Wespen und Kodiakbären nutzen chemische Abwehrstoffe in Pflanzen, um sich von ihren natürlichen Plagegeistern zu befreien.
Das Innere des Museums der Oxford University.
Als ich in Uganda begann, Schimpansen zu studieren, wiesen mich meine Professoren darauf hin, dass man zunächst einmal die betreffenden Infektionskrankheiten verstehen müsse, wenn man beweisen wolle, dass Affen diese mit pflanzlichen Heilmitteln behandeln. Solange ich nicht beweisen konnte, dass der Gebrauch der vermeintlichen Arzneipflanzen die Schwere der Infektion verringerte, würden meine Ergebnisse bestenfalls spekulativ bleiben. Ich musste verstehen, unter welchen Infektionskrankheiten Schimpansen litten. Da ich nur wenig über Mikroorganismen wusste, wandte ich mich an Andy Spielman, Professor an der School of Public Health in Harvard und einer der wenigen, die sich damals für die Ökologie von Mikroorganismen in freier Natur interessierten. Obwohl sein Labor voll mit Doktoranden und Studenten war und sein wissenschaftlicher Schwerpunkt eigentlich in Nordamerika lag statt in der Wildnis von Afrika und Asien, nahm er mich unter seine Fittiche. Damit begann ich zu recherchieren, was über Infektionen bei Schimpansen bekannt war. Als ich einmal begonnen hatte, mich mit Mikroorganismen zu beschäftigen, gab es kein Zurück mehr. Und im Mittelpunkt meiner Studien sollten Viren stehen.
Bei Viren verläuft die Evolution rascher als bei anderen Organismen, doch wir wissen weniger über sie als über irgendeine andere irdische Lebensform.[*] Das Studium von Viren gibt dem Wissenschaftler Gelegenheit, neue Arten zu entdecken und in einer Weise zu katalogisieren, die an die Welt der Naturforscher des 19. Jahrhunderts erinnert, welche mich während meiner Zeit in Oxford so fasziniert hat. Ein Wissenschaftler kann seine ganze Karriere damit verbringen, nach einer neuen Primatenart zu suchen, ohne Erfolg zu haben, doch neue Viren werden jedes Jahr entdeckt. Sie haben zudem einen außerordentlich kurzen Generationszyklus, sodass wir ihre Evolution in Echtzeit beobachten können – ein ideales System für jemanden, der den Evolutionsprozess verstehen möchte. Vielleicht das Beste aus der Sicht eines jungen Wissenschaftlers war, dass es in dieser Disziplin niedrig hängende Früchte gab, die es nur zu pflücken galt, und zwar möglichst schnell: Einige dieser Viren bringen uns um. Daher führen neue Entdeckungen nicht nur zu einem besseren Verständnis der Natur, sondern sie können auch umgehend angewandt werden, um menschliche Krankheiten in den Griff zu bekommen.
Als Anfang 2004 publik wurde, dass Kaptans Tod auf eine Infektion mit H5N1 zurückging, ging es genau darum: Die Ausbreitung der Infektion musste gestoppt werden. Der Tod des Jungen war der erste bestätigte Todesfall durch dieses Virus, das sogenannte Vogelgrippevirus, in Thailand. Tatsache ist, dass sämtliche menschlichen Influenzaviren ursprünglich von Vögeln stammen, auch wenn sie von anderen Tieren auf uns überspringen können; daher ist die gängige Bezeichnung «Vogelgrippe» für Wissenschaftler bisweilen irritierend. Dennoch wurde die «Vogelgrippe» innerhalb eines Monats zum festen Bestandteil der Nachrichtensendungen und zu einem Gesprächsthema für Menschen in aller Welt.
Der wissenschaftliche Name des Virus, das Kaptan tötete, lautet HPAIA (H5N1) und verrät Virologen eine ganze Menge. Er besagt, dass es sich bei dem Virus um ein hochpathogenes Vogelvirus vom Typ A handelt, und nennt die spezielle Hämagglutinin (H)- und die Neuramidase-(N)-Variante, die für diesen Virenstamm spezifisch sind. Doch seine wirkliche Bedeutung ist viel direkter.
H5N1 ist so wichtig, weil dieses Virus bemerkenswert effizient tötet. Die Letalität oder der Prozentsatz an Infizierten, die sterben, liegt bei rund 60 Prozent. Für einen Mikroorganismus ist das unglaublich tödlich. Zum Vergleich können wir die verheerende Influenza-Pandemie von 1918 heranziehen. Zwar sind die Schätzungen für diese Pandemie unzuverlässig, doch man nimmt an, dass rund 50 Millionen Menschen daran starben. Das entspricht etwa 3 Prozent der damaligen Weltbevölkerung, eine fast unvorstellbare Katastrophe. Um die Größenordnung klarzumachen: Bei dieser Pandemie starben vermutlich mehr Menschen als Soldaten in sämtlichen Kriegen des 20. Jahrhunderts zusammengenommen – mehr Todesfälle durch ein einfaches Virus von weniger als 100 Nanometer (nm) Durchmesser und mit nur elf mickrigen Genen als durch alle Schlachten im Ersten und Zweiten Weltkrieg und all den anderen Kriegen dieses kriegsgebeutelten Jahrhunderts. Trotz des gewaltigen Ausmaßes der Seuche von 1918 bewegen sich die höchsten Schätzungen für die Letalität des damaligen Virus nur im Bereich von 20 Prozent, und sie war höchstwahrscheinlich viel geringer; sorgfältigere Schätzungen beziffern sie auf rund 2,5 Prozent.[*] Erinnern Sie sich, dass H5N1 eine Letalität von 60 Prozent hatte, also weitaus höher lag.
Aber so wichtig und dramatisch die Tödlichkeit eines Virus auch ist und sosehr sie für die Medien eine fortwährende Obsession bedeutet, für Mikrobiologen ist sie nur ein Teilchen des Puzzles. Tatsächlich töten einige Mikroorganismen buchstäblich alle Menschen, die sie infizieren: eine perfekte Mortalitätsrate von 100 Prozent. Und dennoch stellen solche Mikroorganismen nicht unbedingt eine kritische Bedrohung für die Menschheit dar. Viren wie der Erreger der Tollwut, der bei einer Reihe von Säugerarten vorkommt, und das Herpes-B-Virus, das einige asiatische Affenarten infiziert, töten alle Menschen, die sich mit ihnen anstecken.[*] Aber sofern Sie nicht tollwütigen Tieren ausgesetzt sind oder mit asiatischen Affen arbeiten, brauchen Sie sich um diese Mikroorganismen nicht weiter zu sorgen. Denn diese Erreger haben nicht die Fähigkeit, sich von Mensch zu Mensch auszubreiten. Um Katastrophen auszulösen, müssen Mikroorganismen das Potenzial haben, zu schädigen oder zu töten und sich auszubreiten.
Anfang 2004 gab es keine Möglichkeit vorherzusagen, wie effizient sich H5N1 ausbreiten würde. Da der Erreger zu den Influenzaviren gehört, also einer Virenklasse, die sich tatsächlich häufig ausbreitet, musste man mit allem rechnen. Und falls sich H5N1 in derselben Weise ausbreiten sollte wie das Influenzavirus von 1918, würde es eine Katastrophe auslösen, wie sie die menschliche Geschichte noch nicht gesehen hat.
Wenn H5N1 als Killer eindrucksvoll ist, so ist es H1N1, die sogenannte Schweinegrippe[*], was ihre Ausbreitungsfähigkeit angeht. Niemand weiß genau, wann die H1N1-Pandemie begann, doch im August 2009, weniger als ein Jahr nach Entdeckung des Erregers, verkündete die WHO, dass das Virus Schätzungen zufolge irgendwann mehr als zwei Milliarden Menschen infizieren könnte – rund ein Drittel der gesamten Menschheit. Das hätte ein Drama unvorstellbaren Ausmaßes bedeutet. Wenn auch dem Augenschein nach weniger dramatisch als andere Naturkatastrophen, stellen Infektionskrankheiten durch ihre Fähigkeit, Menschen auf dem gesamten Planeten in Mitleidenschaft zu ziehen, eine gewaltige Naturkraft dar. Ein Virus, das Anfang 2009 wahrscheinlich nur wenige Menschen infizierte, breitete sich rund um den Globus aus und befiel in weniger als einem Jahr einen bedeutenden Anteil der Weltbevölkerung. Dies geschah, obwohl die Einrichtungen des Weltgesundheitssystems nach Kräften um eine Eindämmung bemüht waren – Einrichtungen, auf die wir normalerweise sehr stolz sind und durch die wir uns geschützt fühlen. Aber obwohl die Letalität von H1N1 auf deutlich unter ein Prozent geschätzt wird und damit im Vergleich zu H5N1 verblasst, hat die schiere Zahl der Menschen, die es infiziert hat, dieses Virus zu einem wahren globalen Killer gemacht. Ein Prozent von zwei Milliarden sind eine Menge Leben.
Um die wahre Gefährlichkeit eines Epidemieausbruchs besser zu verstehen, wollen wir uns einem Konzept in der Epidemiologie zuwenden, das man als R0 oder als Reproduktionsrate bzw. Basisreproduktionszahl bezeichnet. Bei jeder Epidemie ist R0 die durchschnittliche Zahl an Folgeinfektionen, zu der jeder neue Fall führt (im Rahmen einer Population ohne natürliche Immunität und ohne Eindämmungsbemühungen). Wenn jeder neue Fall im Durchschnitt zu mehr als einer Folgeinfektion führt, kann die neue Epidemie wachsen; ist es weniger als eine Folgeinfektion, erlischt sie. Das elegante R0-Konzept hilft Epidemiologen, zwischen Epidemien zu unterscheiden, die wahrscheinlich virulent werden, und solchen, die vermutlich von selbst erlöschen. Es handelt sich im Grunde um ein Skalierungsmaß.
Risiken einzuschätzen ist keine triviale Angelegenheit, weder für die Öffentlichkeit noch für die Politik. Wenn man es im Fall von H1N1 oder H5N1 unterlassen hätte, möglichst schnell einen Impfstoff zu entwickeln oder zu versuchen, die Übertragung des Virus einzudämmen, hätte das katastrophale Kosten auf der ganzen Welt nach sich ziehen können.
Heikel ist, dass Mikroorganismen dynamisch sind – sie existieren nicht in einer Stasis. Wenn das tödliche Vogelgrippevirus H5N1 die richtige Kombination von Mutationen ansammelt, die es braucht, um sich effizient auszubreiten, wird das Ergebnis so desaströs sein, dass selbst das verheerendste Erdbeben wie ein Spaziergang erscheint, auch wenn es spektakulärer aussieht. Und sollte das sich rasch ausbreitende Schweinegrippevirus H1N1 seine Virulenz auch nur minimal erhöhen, wäre sein Potenzial zu töten beachtlich. Keines dieser Szenarien ist unplausibel. Wie in Kapitel 1 noch ausführlich dargelegt wird, verfügen Influenzaviren und eine Reihe anderer Viren über eine unglaubliche Fähigkeit, sich der Umwelt anzupassen, die ihre menschlichen Wirte ihnen bieten. Sie mutieren rasch und tauschen sogar Gene untereinander aus, ein Prozess, den man als Reassortment oder Reassortierung bezeichnet.
Eine solche Reassortierung war es, die mir und anderen Wissenschaftlern 2009 Sorgen bereitete. Als sich das H1N1-Virus mit Windeseile um die Welt verbreitete, bestand ein nicht zu vernachlässigendes Risiko, dass es in Tieren oder Menschen auf H5N1 stoßen und die Bühne für eine potenziell verhängnisvolle Reihe von Ereignissen bereiten würde. Es ist diese Art von Ereignissen, die wir so früh wie möglich – bevor es zu einem Ausbruch kommt – aufdecken wollen. Bei einer Simultaninfektion mit beiden Influenzaviren könnte ein Mensch oder ein Tier zu einem potenten Mischgefäß werden und den Erregern eine perfekte Gelegenheit zum Genaustausch liefern. Wie würde so etwas vor sich gehen? In einer Art sexueller Reproduktion könnten H5N1 und H1N1 mosaikartige Tochterviren produzieren, die einige Gene des einen und einige Gene des anderen Virus tragen. Solche Reassortierungen können in Individuen ablaufen, die mit einer Vielzahl ähnlicher Viren infiziert sind. Wenn das mosaikartige Tochtervirus im Fall von H5N1 und H1N1 von seinem H1N1-Elternteil das Potenzial zur Ausbreitung und von seinem H5N1-Elternteil die Letalität erben würde, wäre das entstandene Virus sowohl höchst ansteckend als auch höchst tödlich – genau die Formel für eine globale Katastrophe, die wir am meisten fürchten.
In den letzten 100 Jahren bestand die Politik der Weltgesundheitsbehörden darin, Hals über Kopf auf Pandemien zu reagieren. Nun vertritt eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Wissenschaftlern, zu der auch ich gehöre, den Standpunkt, dass wir auf Pandemien nicht mehr nur reagieren dürfen, indem wir eiligst Impfstoffe und neue Medikamente entwickeln und unser Verhalten ändern. Dieser traditionelle Ansatz hat sich beim Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) als Fehlschlag erwiesen: Dieses Virus breitet sich auch fast 30 Jahre nach seiner Entdeckung weiter aus, gegenwärtig sind nach dem letzten Stand der Zählung mehr als 33 Millionen Menschen infiziert.
Aber was wäre gewesen, wenn wir HIV vor seiner Ausbreitung hätten eindämmen können? Dieses Virus existierte schon seit mehr als 50 Jahren im Menschen, bevor es seinen Siegeszug um die Welt antrat. Der Erreger breitete sich weitere 25 Jahre aus, ehe er schließlich von den französischen Wissenschaftlern Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier, die dafür später verdienterweise den Nobelpreis bekamen, entdeckt wurde. Wie anders würde die Welt heute aussehen, wenn wir HIV hätten stoppen können, bevor es Westafrika verließ?
Die Vorstellung, dass wir Pandemien vielleicht eines Tages voraussagen können, ist neu. Zum ersten Mal habe ich jemanden vor rund zehn Jahren im Büro von Don Burke darüber reden hören. Don ist ein ehemaliger Sanitätsoberst und ein weltbekannter Virologe vom Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), der sein Leben ursprünglich traditionelleren Ansätzen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten gewidmet hatte, bevor er eine Professur an der Bloomberg School of Public Health der Johns Hopkins University annahm. Er hatte mich ein paar Jahre zuvor als Postdoktorand an die Hopkins geholt, als ich gerade dabei war, meine Doktorarbeit in den Regenwäldern Nordborneos abzuschließen. Dort untersuchte ich, wie Stechmücken und andere blutsaugende Insekten Mikroorganismen zwischen Primatenarten übertragen.
Don war es zwar nicht gelungen, mich selbst aufzutreiben, doch er hatte meine Mutter in Michigan gefunden und sie angerufen. Mit ihr telefonierte ich in unregelmäßigen Abständen von unserer Forschungsstation aus. Jetzt erzählte sie mir aufgeregt, ein «General» der US-Armee habe sie angerufen, und erkundigte sich, in welche Schwierigkeiten ich mich denn manövriert hätte. Zum Glück wollte Don nichts weiter als mich fragen, ob ich ihm bei einem Projekt in Zentralafrika helfen könne, bei dem es darum ging herauszufinden, wie es tierischen Viren gelingt, auf Menschen überzuspringen und sich in der Bevölkerung auszubreiten.
Im Lauf der darauffolgenden Jahre, die wir mit der langwierigen und mühsamen Arbeit verbrachten, Forschungskapazitäten für die Entdeckung neuer Mikroorganismen in Zentralafrika und Asien aufzubauen, unterhielten Don und ich uns stundenlang im Feld und in seinem Büro in Baltimore. Wir schlossen viele Bierwetten auf wissenschaftliche Probleme ab und diskutierten engagiert über die Zukunft unseres Fachgebiets. Ich erinnere mich an den Tag, als Don zum ersten Mal andeutete, dass die Zukunft nicht nur eine Reaktion auf Pandemien bringen würde, sondern auch deren Vorhersage. Es schien eine kühne, aber logische Idee, und bald waren wir dabei zu überlegen, wie so etwas tatsächlich in die Wege geleitet werden könnte. Die damaligen Diskussionen bildeten die Grundlage für die Arbeit, die meine Kollegen und ich heute leisten: Wir errichten und betreiben Lauschposten an mikrobiellen Brennpunkten in aller Welt, um neue Mikroorganismen vor Ort zu entdecken, bevor sie globale Pandemien auslösen.
Zu den Erregern, nach denen wir Ausschau halten, gehören neuartige Influenzaviren wie H5N1 und H1N1. Leider stumpft die Welt gegenüber Gefahren, wie sie von diesen beiden Viren ausgehen, allzu rasch ab. Diese und andere Gefahren verschwinden bald wieder aus dem Blickfeld der Medien. Der größte Teil der Welt beschäftigt sich mit keinem von beiden Viren ernsthaft. Aber keiner von beiden ist verschwunden, und die Bedrohung ist heute vielleicht ebenso groß wie damals, als man die zwei zum ersten Mal bemerkte. Sie infizieren die menschliche Bevölkerung auch heute noch. Beispielsweise führte H5N1 2009 – Jahre nachdem die Medien das Virus vergessen hatten – zu mindestens 73 im Labor bestätigten Fällen. Damit ist die Zahl der tatsächlichen Fälle höchstwahrscheinlich sogar noch wesentlich unterschätzt, und diese Angabe unterscheidet sich nicht wesentlich von der Zahl bestätigter Fälle in vorangegangenen Jahren. Auch H1N1-Fälle gibt es weiterhin. Wir haben sie selbst in den abgelegensten Waldregionen entdeckt, in die wir «hineinhorchen».
Es ist schon erstaunlich: In einer Zeit, in der wir ein ganzes menschliches Genom für weniger als 10000 Dollar sequenzieren und eine Telekommunikationsstruktur aufbauen können, die den meisten Menschen auf der Welt den Zugang zu einem Mobiltelefon ermöglichen wird, wissen wir noch immer überraschend wenig über Pandemien und die Mikroorganismen, die sie auslösen. Noch weniger wissen wir darüber, wie sich Pandemien vorhersagen oder verhindern lassen, bevor sie sich von kleinen Städten in Großstädte und im Rest der Welt ausbreiten. Wie ich in Teil II ausführen werde, wird die Häufigkeit von Pandemien in den kommenden Jahren steigen, denn die Kontakte zwischen menschlichen Populationen und den tierischen Bewohnern unserer Welt werden weiter zunehmen. Ob es ein Mosaikvirus mit der Letalität von H5N1 und der Ansteckungsfähigkeit von H1N1 ist, ein wieder auflebendes SARS-Virus, ein neues Retrovirus wie HIV oder gar ein völlig neuer Mikroorganismus, der uns unvorbereitet trifft – Mikroorganismen werden immer stärker in der Lage sein, uns krank zu machen, Menschen zu töten, die Wirtschaft ganzer Regionen zu zerstören. Sie werden für die Menschheit gefährlicher sein als die heftigsten Vulkanausbrüche, Wirbelstürme oder Erdbeben, die wir uns vorstellen können.
Ein Sturm braut sich zusammen. Ziel meines Buches ist es, diesen heraufziehenden Sturm zu verstehen – das Wesen von Pandemien zu erkunden und zu begreifen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Das Buch wird jedoch kein völlig düsteres Bild zeichnen. In den 100 Jahren, die seit Entdeckung der ersten Viren vergangen sind, haben wir bei ihrer Erforschung große Fortschritte gemacht. Zwar liegt noch viel harte Arbeit vor uns. Aber wenn wir es richtig anstellen, können wir eine Vielzahl moderner Technologien nutzen, um Pandemien vorherzusagen – genauso, wie Meteorologen den Verlauf von Wirbelstürmen vorhersagen –, und im besten Fall können wir verhindern, dass sie überhaupt ausbrechen. Das ist der heilige Gral des modernen Gesundheitswesens, und im Folgenden möchte ich darlegen, dass dieses Ziel tatsächlich in Reichweite ist.
Teil IDie Wolken ziehen sich zusammen
Kapitel 1Planet der Viren
Martinus Beijerinck war ein ernsthafter Mann. Eines der wenigen Bilder, die von ihm überliefert sind, zeigt ihn um 1921 in seinem Delfter Labor, ein paar Tage bevor er widerstrebend in Pension ging. Brille und Anzug tragend, sieht er wahrscheinlich so aus, wie er in Erinnerung bleiben wollte – umgeben von seinen Mikroskopen, Filtern und Flaschen mit Reagenzien. Beijerinck vertrat einige seltsame Überzeugungen, zum Beispiel, dass Ehe und Wissenschaft unvereinbar seien. Zumindest einem Bericht zufolge wurde er seinen Studenten gegenüber ausfällig. Aber obwohl dieser seltsame und ernste Mann in der Geschichte der Biologie kaum Erwähnung findet, waren es seine grundlegenden Studien, die zur Entdeckung der vielfältigsten Lebensform auf Erden führten.
Zu den Dingen, die Beijerinck Ende des 19. Jahrhunderts faszinierten, gehörte eine Krankheit, die Tabakpflanzen schädigte. Beijerinck war das jüngste Kind von Derk Beijerinck, einem Tabakhändler, den diese Pflanzenkrankheit in den Ruin getrieben hatte. Die Tabakmosaikkrankheit führt bei jungen Tabakpflanzen zu Verfärbungen, die auf den Blättern ein typisches Mosaikmuster hinterlassen, und verzögert das Pflanzenwachstum stark. Als Mikrobiologe muss Beijerinck die unklare Ätiologie dieser Krankheit, die seinen Vater bankrottgehen ließ, zu schaffen gemacht haben. Obwohl sie sich wie andere Infektionen ausbreitete, ließ sich im Mikroskop kein bakterieller Auslöser finden. Neugierig geworden, filterte Beijerinck Flüssigkeitsproben einer der erkrankten Pflanzen durch einen feinkörnigen Porzellanfilter. Anschließend bewies er, dass die Flüssigkeit sogar nach einer solchen Filtration die Fähigkeit behielt, gesunde Pflanzen anzustecken. Die geringe Porengröße des Filters bedeutete, dass Bakterien, damals die üblichen Verdächtigen für übertragbare Krankheiten, wegen ihrer Größe nicht in Frage kamen. Irgendetwas anderes musste die Infektion auslösen – etwas deutlich Kleineres als alles, was zu seiner Zeit als Lebewesen bekannt war.
Während viele seiner Kollegen annahmen, ein Bakterium werde sich als Urheber der Tabakmosaikkrankheit erweisen, kam Beijerinck zu dem Schluss, dass eine neue Lebensform dafür verantwortlich sein musste.[*] Er nannte den neuen Organismus Virus, ein lateinischer Begriff, der sich auf Gift bezieht. Der Begriff Virus war seit dem 14. Jahrhundert in Gebrauch, doch Beijerinck war der Erste, der ihn als Bezeichnung für die Mikroorganismen verwandte, die wir heute darunter verstehen.[*] Interessanterweise sprach Beijerinck von Viren als «contagium vivium fluidum», «lösliche lebende Agenzien», und hielt sie ihrer Natur nach für flüssig. Um genau das zu unterstreichen, benutzte er die Bezeichnung Virus – oder Gift. Erst später, bei der Untersuchung des Polio- und des Maul-und-Klauenseuche-Virus, wurde die Partikelnatur der Erreger deutlich.
Dr. Martinus Beijerinck (undatiertes Foto).
Zu Beijerincks Zeiten tat sich für die Forscher eine neue mikroskopische Sicht auf. Der Blick ins Mikroskop und der Einsatz immer feinporigerer Filter ließ diese Mikrobiologen etwas entdecken, das uns noch heute erstaunt: Jenseits unserer auf Menschenmaßstab abgestimmten Sinne gibt es eine riesige, wimmelnde, verblüffend vielfältige und unsichtbare Welt mikrobiellen Lebens.
Ich halte in Stanford ein Seminar ab, das sich Viral Lifestyles nennt. Der Titel sollte angehende Studenten neugierig machen, aber auch eines der Ziele der Veranstaltung beschreiben: lernen, die Welt aus der Perspektive eines Virus zu sehen. Denn wenn wir Viren und andere Mikroorganismen verstehen wollen, und eben auch, wie sie Pandemien auslösen, müssen wir sie erst aus sich heraus begreifen.
Am ersten Tag spiele ich mit meinen Studenten folgendes Gedankenexperiment durch: Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine starke Brille, mit der Sie sämtliche Mikroorganismen sehen können. Wenn Sie diese magische Brille aufsetzten, würden Sie auf der Stelle eine ganz neue und äußerst lebhafte Welt erblicken. Der Boden würde brodeln, die Wände würden pulsieren, und alles würde wimmeln von zuvor unsichtbarem Leben. Winzige Wesen würden sämtliche Oberflächen bedecken – Ihre Kaffeetasse, die Seiten des Buches in Ihren Händen, Ihre Hände selbst. Größere Bakterien wären wiederum von kleineren Mikroorganismen bevölkert.
Diese fremdartige Armee ist allgegenwärtig, und einige ihrer mächtigsten Soldaten sind gleichzeitig die kleinsten. Diese Kleinsten der Kleinen durchdringen die Textur des irdischen Lebens buchstäblich bis in die letzte Faser. Sie sind überall und infizieren unausweichlich jede Art von Bakterium, Pflanze, Pilz und Tier, die es auf der Welt gibt. Sie gehören zur selben Lebensform, die Beijerinck gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte, und sie gehören zu den wichtigsten Vertretern der mikrobiellen Welt. Es sind Viren.
Viren bestehen aus zwei Grundkomponenten, ihrem genetischen Material – entweder RNA oder DNA – und einer Proteinhülle, die dieses schützt. Da Viren nicht über Mechanismen verfügen, die ihnen erlauben würden, selbständig zu wachsen oder sich zu vermehren, sind sie von den Zellen abhängig, die sie infizieren. Tatsächlich müssen Viren zellbasierte Lebensformen infizieren, um zu überleben. Viren befallen ihre Wirtszellen, seien es Bakterien oder menschliche Zellen, mittels eines biologischen Schlüssel-Schloss-Systems. Zur Proteinhülle eines jeden Virus gehören nämlich molekulare «Schlüssel», die in ein molekulares «Schloss» (Rezeptor) auf der Wand (Membran) der angesteuerten Wirtszelle passen. Sobald der virale Schlüssel auf ein passendes zelluläres Schloss trifft, kann er die Tür zur Maschinerie im Zellinneren öffnen. Dann kapert das Virus die Maschinerie der Wirtszelle, um zu wachsen und sich zu vermehren.
Viren sind die kleinsten bekannten Mikroorganismen. Wenn man einen Menschen auf die Größe eines Fußballstadions aufblasen würde, wäre ein typisches Bakterium so groß wie ein Fußball und ein typisches Virus so groß wie eines der hexagonalen Felder auf dem Ball. Obwohl Menschen schon seit eh und je unter Vireninfektionen gelitten haben, ist es daher kein Wunder, dass wir so lange gebraucht haben, um sie zu finden.
Mikroorganismen. Oben: Detailansicht, unten: maßstabsgetreu.
Bis zu Beijerincks Entdeckung vor rund 100 Jahren waren Viren für uns völlig unbekannte Wesen. Vor nicht einmal 400 Jahren gelang es zum ersten Mal, einen Blick auf Bakterien zu erhaschen; damals schuf Antonie van Leeuwenhoek mit Hilfe von Lupen, wie sie Tuchhändler verwendeten, das erste Mikroskop. Dass er damit plötzlich Bakterien sehen konnte, stellte einen unglaublichen Paradigmenwechsel dar – so unglaublich, dass die British Royal Society weitere vier Jahre brauchte, bis sie akzeptierte, dass es sich bei den bis dato unsichtbaren Lebensformen nicht um Artefakte seiner einzigartigen Apparatur handelte.
Bei der wissenschaftlichen Erforschung unsichtbaren Lebens haben wir nur sehr langsam Fortschritte gemacht. Im Vergleich zu einigen anderen wichtigen wissenschaftlichen Durchbrüchen im Lauf der letzten Jahrtausende ist unsere Erkenntnis, dass Mikroorganismen das Leben auf der Erde dominieren, noch recht jung. Zur Zeit von Christi Geburt wussten wir beispielsweise schon Wesentliches über die Rotation der Erde, ihre ungefähre Größe und ihre ungefähre Entfernung vom Mond und von der Sonne – wir waren also recht weit, was das Verständnis für unseren Platz im Universum angeht. Um 1610 hatte Galilei bereits seine ersten Beobachtungen mit Hilfe eines Teleskops gemacht. Van Leeuwenhoeks Mikroskop kam 50 Jahre später.
Replikat von van Leeuwenhoeks Mikroskop, 17. Jahrhundert.
Van Leeuwenhoeks Mikroskop in Gebrauch.
Der Paradigmenwechsel, den van Leeuwenhoeks Entdeckung mit sich brachte, lässt sich kaum überschätzen. Seit Jahrtausenden wussten die Menschen, dass es Sterne und Planeten gab. Die Existenz und Allgegenwärtigkeit unsichtbaren Lebens wurde uns jedoch erst durch die Erfindung des Mikroskops vor Augen geführt. Und bis heute entdecken wir neue Lebensformen, zuletzt die höchst ungewöhnlichen Prionen, deren Identifizierung 1997 mit einem Nobelpreis gewürdigt wurde. Prionen sind eine seltsame, mikroskopisch kleine Sippe; sie kommen nicht nur ohne Zellen aus, sondern ihnen fehlen darüber hinaus auch DNA und RNA, das genetische Material, das alle anderen bekannten Lebensformen auf der Erde als Blaupause benutzen. Dennoch überdauern Prionen, können übertragen werden und rufen unter anderem Rinderwahnsinn hervor. Es wäre anmaßend zu glauben, dass es auf der Erde keine weiteren Lebensformen mehr zu entdecken gibt, und sollten wir fündig werden, dann höchstwahrscheinlich in der Welt des Unsichtbaren.[*]
Wir können das bekannte Leben auf der Erde grob in zwei Gruppen teilen: nicht zelluläres und zelluläres Leben. Unter den nicht zellulären Spielern auf dem Feld sind Viren die wichtigsten. Die dominanten zellulären Lebensformen auf der Erde sind die Prokaryoten, zu denen die Bakterien und ihre Vettern, die Archaebakterien (Archaea), gehören. Diese Lebensformen existieren bereits seit mindestens 3,5 Milliarden Jahren. Sie weisen eine verblüffende Vielfalt auf und machen zusammen einen weitaus größeren Teil der Biomasse des Planeten aus als die anderen und auffälligeren zellulären Lebensformen, die Eukaryoten. Zu ihnen zählen die uns vertrauten Pilze, Pflanzen und Tiere.
Man kann Leben aber auch danach unterteilen, ob es mit bloßem Auge sichtbar bzw. unsichtbar ist. Da unsere Sinne nur die relativ großen Dinge auf der Erde wahrnehmen, ist unsere Sichtweise ziemlich eingeschränkt, wenn wir an den Reichtum des Lebens denken. Tatsächlich ist das unsichtbare Leben – die Welt der Bakterien, Archaebakterien und Viren wie auch einiger mikroskopisch kleiner Eukaryoten – das wirklich beherrschende auf unserem Planeten. Würde eine hochentwickelte außerirdische Spezies auf der Erde landen und eine Enzyklopädie des Lebens danach zusammenstellen, wer oder was am meisten zur Artenvielfalt und Biomasse der Erde beiträgt, so würde sich der größte Teil mit dieser unsichtbaren Welt beschäftigen. Nur ein paar schmale Bände wären dem gewidmet, was wir normalerweise mit Leben in Verbindung bringen: Pilze, Pflanzen und Tiere. Wohl oder übel würden Menschen nicht mehr als eine Fußnote im Band über Tiere ausmachen – eine interessante Fußnote zwar, aber eben höchstens eine Fußnote.
Die Kartierung der Vielfalt von Mikroorganismen auf der Erde steckt noch in ihren Kinderschuhen. Schon wenn man sich auf Viren allein konzentriert, bekommt man ein gewisses Gefühl dafür, was es noch zu entdecken gibt. Vermutlich beherbergt jedwede zelluläre Lebensform mindestens einen Virentyp. Im Grunde gilt: Was Zellen hat, kann auch Viren haben – jede Alge, jedes Bakterium, jede Pflanze, jedes Insekt, jeder Säuger. Alles. Viren bewohnen ein ganzes mikroskopisch kleines Universum.
Selbst wenn jede zelluläre Spezies nur eine einzige Virenart aufwiese, würde dies Viren per Definition zur vielfältigsten Lebensform auf unserem Planeten machen. Und viele zelluläre Lebensformen, einschließlich des Menschen, beherbergen eine ganze Palette verschiedener Viren. Viren gibt es überall – im Meer, an Land, tief unter der Erde. Die dominante Lebensform auf der Erde sind also, wenn es um biologische Vielfalt geht, eindeutig die Mikroorganismen.
Das größte, bisher entdeckte Virus ist noch immer mikroskopisch klein: Das Mimivirus misst 600 nm – Viren sind ihrer Natur nach winzig. Doch ihre schiere Zahl sorgt dafür, dass sie einen signifikanten biologischen Einfluss haben. Eine bahnbrechende Arbeit, die 1989 von Oivind Bergh und seinen Kollegen an der Universität Bergen in Norwegen publiziert wurde, wies mit Hilfe einer elektronenmikroskopischen Zählung bis zu 250 Millionen Viruspartikel pro Milliliter Meerwasser nach. Andere, umfassendere Messungen der viralen Biomasse auf der Erde kommen zu noch unvorstellbareren Ergebnissen. Reihte man sämtliche irdischen Viren Kopf an Schwanz aneinander, so würde die resultierende Kette einer Schätzung zufolge 200 Millionen Lichtjahre weit reichen, also bis weit über den Rand der Milchstraße hinaus. Auch wenn Viren vielfach als Plagegeister gelten, erfüllen sie in Wahrheit eine Rolle, die weit darüber hinausgeht und einen viel größeren Einfluss auf das Leben hat als bisher vermutet – eine Rolle, die die Wissenschaft gerade erst zu verstehen beginnt.
Es stimmt, dass Viren zelluläre Lebensformen infizieren müssen, um ihren Lebenszyklus zu vervollständigen. Doch sie verhalten sich dabei nicht zwangsläufig schädlich oder zerstörerisch. Wie alle bedeutenden Komponenten des globalen Ökosystems tragen Viren entscheidend zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei. Indem sie beispielsweise täglich 20 bis 40 Prozent der Bakterien in marinen Ökosystemen töten, erfüllen sie eine wichtige Funktion, denn dadurch wird organisches Material in Form von Aminosäuren, Kohlenstoff und Stickstoff freigesetzt. Und auch wenn es auf diesem Gebiet bisher nur wenige Untersuchungen gibt, wird zumeist angenommen, dass Viren in sämtlichen Ökosystemen die Rolle der «Kartellbehörde» übernehmen und dafür sorgen, dass keine Bakterienart allzu dominant wird. Damit fördern sie die biologische Vielfalt.
Angesichts der Allgegenwart von Viren wäre es in der Tat überraschend, wenn sie eine ausschließlich destruktive Funktion ausübten. Wahrscheinlich werden zukünftige Untersuchungen die profunde ökologische Bedeutung dieser Organismen deutlich machen und zeigen, dass Viren ihre Wirte nicht nur schädigen, sondern vielen von ihnen auch Vorteile bringen. Seit Beijerincks Entdeckung hat sich ein Großteil der Virenforschung verständlicherweise mit tödlichen Viren beschäftigt. Ebenso wissen wir deutlich mehr über Giftschlangen als über ihre harmlosen Verwandten, obgleich sie einen überraschend kleinen Anteil an der Gesamtzahl aller Schlangenarten ausmachen. Wenn wir in Teil III die Grenzen der Virologie diskutieren, werden wir den potenziellen Nutzen von Viren im Detail erörtern.
Viren infizieren alle bekannten Gruppen zellulärer Lebensformen. Ob ein Bakterium, das unter hohem Druck in der oberen Erdkruste lebt, oder eine Zelle in der menschlichen Leber – für ein Virus ist beides nichts weiter als ein Ort, an dem es leben und sich fortpflanzen kann. Aus seiner Sicht und der anderer Mikroorganismen sind unsere Körper Lebensräume. Genau so, wie ein Wald Vögeln und Eichhörnchen einen Lebensraum bietet, liefert unser Körper die lokale Umwelt, in der diese Organismen leben. Aber das Überleben in diesem Milieu bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Wie alle Lebensformen konkurrieren Viren untereinander um den Zugang zu Ressourcen. Sie stehen ständig unter Druck unseres Immunsystems, das über zahlreiche Strategien verfügt, um ihnen das Eindringen in unseren Körper zu verwehren oder sie unschädlich zu machen und zu töten, wenn es ihnen doch gelingt. Sie müssen sich ständig entscheiden: Sollen sie sich ausbreiten, was die Gefahr birgt, vom Immunsystem attackiert zu werden, oder in Latenz verharren, einer Art viralem Überwinterungszustand, der Schutz bietet, aber den Verzicht auf Nachwuchs verlangt.
Der Lippenherpes («Fieberbläschen»), der vom Herpes-simplex-Virus hervorgerufen wird, veranschaulicht einige der Herausforderungen, denen sich Viren in den komplexen Habitaten unseres Körpers gegenübersehen. Diese Viren finden in Nervenzellen Unterschlupf, die wegen ihrer privilegierten und geschützten Position im Körper nicht dieselbe Aufmerksamkeit unseres Immunsystems genießen wie die Zellen unserer Haut, unserer Mundschleimhaut oder unseres Verdauungstrakts. Aber ein Herpesvirus, das sich in einer Nervenzelle versteckt, ohne sich auszubreiten, würde in einer Sackgasse stecken. Daher wandern Herpesviren von Zeit zu Zeit durch die Nervenzellganglien ins Gesicht, um Lippenbläschen voller Viren zu erzeugen, die ihnen ermöglichen, einen neuen Wirt zu infizieren.
Wie Viren den Zeitpunkt für ihre Ausbreitung wählen, ist weitgehend unbekannt, aber höchstwahrscheinlich überwachen sie dazu die Umweltvariablen ihrer Welt. Viele Erwachsene, die mit Herpes simplex infiziert sind, wissen, dass Stress Lippenbläschen hervorrufen kann. Manchen Erzählungen nach zu urteilen, scheinen auch Schwangerschaften das Risiko für eine Ansteckung zu erhöhen. Zwar sind diese Vermutungen bisher noch spekulativ, doch es wäre nicht überraschend, wenn Viren auf Umweltreize, die großen Stress oder eine Schwangerschaft anzeigen, mit einer Aktivierung reagierten. Da großer Stress auf den möglichen Tod des Wirtes hindeuten kann, könnte es ihre letzte Gelegenheit sein, sich auszubreiten – ein toter Wirt bedeutet auch ein totes Virus. Andererseits bietet eine Schwangerschaft Gelegenheit, entweder durch den genitalen Kontakt mit dem Kind während der Geburt oder durch das zwangsläufige Küssen danach neue Wirte zu infizieren.
Die Übertragung von Wirt zu Wirt ist ein derart grundlegendes Bedürfnis für jeden Infektionserreger, dass einige von ihnen die Sache einen Schritt weiter treiben. Der unglaubliche Malariaparasit Plasmodium vivax hibernans geht so weit, eine Art Kalender zu führen. Malariaparasiten, die um ein Vielfaches größer sind als das Herpesvirus, sind Infektionserreger wie Viren und Bakterien, gehören aber zu den Eukaryoten und sind daher enger mit Tieren als mit Ersteren verwandt. Plasmodium vivax hibernans wird von Stechmücken verbreitet und ist in der Lage, selbst in arktischem Klima zu überleben. In diesen rauen Gegenden kann der Erreger Stechmücken nur während der kurzen Sommermonate infizieren, wenn die Insekten schlüpfen. Statt Energie damit zu verschwenden, fortwährend Nachwuchs zu produzieren, verbringt der Malariaerreger den größten Teil des Jahres «schlafend» in menschlichen Leberzellen; erst im Sommer wird er aktiv und erzeugt infektiöse Stadien, die sich im Blut eines infizierten Menschen verbreiten. Noch ist unklar, was genau den Rückfall auslöst, doch aktuelle Untersuchungen deuten darauf hin, dass es die Stiche der Moskitos selbst sein könnten, die dem Erreger anzeigen, wann die Jahreszeit zur Ausbreitung begonnen hat.
Das sorgfältige Timing, an das sich Viren und andere Mikroorganismen bei ihrer Ausbreitung halten, unterscheidet sich nicht von den Entscheidungen, die andere Organismen treffen. Ob es um die Wahl des richtigen Zeitpunkts für die Fruchtbildung bei einem tropischen Baum oder für die Paarung bei einem Wasserbüffel geht – Lebewesen, die ihre Fortpflanzung richtig terminieren, haben mehr erfolgreichen Nachwuchs. Das bedeutet, dass Merkmale für eine richtige Wahl des Reproduktionszeitpunkts einen Selektionsvorteil bieten und sich durchsetzen. Und wie Mikroorganismen ihr Wachstum innerhalb unseres Körpers zeitlich festlegen, hat auch einen großen Einfluss auf Krankheiten.
Die Mehrheit aller Mikroorganismen, die beim Menschen Infektionen hervorrufen, ist relativ harmlos; einige verfügen aber über eine erstaunliche Fähigkeit, uns krank zu machen. Das kann sich in Form einer Erkältung ausdrücken (hervorgerufen von einem Rhino- oder einem Adenovirus), aber auch als lebensbedrohliche Krankheit wie Pocken (Blattern). Tödliche Mikroorganismen sind für Evolutionsbiologen eine ständige Herausforderung. Denn sie haben die paradoxe Angewohnheit, das Habitat auszulöschen, von dem ihr eigenes Überleben abhängt. Es ist, als ob ein Vogel den Wald zerstörte, in dem er und seine Nachkommen leben. Doch der Prozess der Evolution läuft weitgehend auf der Ebene des Individuums oder gar des Gens ab. Die Evolution schreitet nicht geplant voran, und nichts kann ein Virus hindern, sich so auszubreiten, dass es schließlich in einer Sackgasse landet. In der Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen Wirt und Virus ist es zweifellos wiederholt zum Aussterben des Wirts gekommen, auch wenn das gleichzeitig das Verschwinden des Infektionserregers bedeutete.
Wichtiger aus der Sicht des Virus ist, welche Konsequenz die Erkrankung für die Übertragung hat. Wie in der Einleitung bereits erwähnt, muss ein Erreger für jedes alte mindestens ein neues Opfer infizieren, wenn er nicht sterben will, denn das alte stirbt entweder oder wird wieder gesund und befreit sich von den Erregern. Das ist die Regel der Reproduktionsrate oder R0. Fällt die durchschnittliche Zahl der neuen Opfer pro altes Opfer unter 1, ist das Schicksal des Erregers besiegelt. Da Mikroorganismen weder von einem Wirt zum nächsten laufen noch fliegen können, beeinflussen sie ihren Wirt oft in strategischer Weise, damit er ihre Ausbreitung unterstützt. Aus der Sicht eines Mikroorganismus kann ein Krankheitssymptom ein überaus wichtiges Mittel sein, um sich unserer Hilfe bei der Wirtssuche zu versichern. Mikroorganismen bringen uns oft zum Husten oder Niesen, was ihnen erlaubt, sich per Tröpfcheninfektion auszubreiten; sie sorgen dafür, dass wir Durchfall bekommen, was ihre Ausbreitung durch die lokale Wasserversorgung ermöglicht, oder sie rufen offene Wunden hervor, sodass sie sich durch Hautkontakt verbreiten können. In diesen Fällen liegt es auf der Hand, warum ein Mikroorganismus diese unangenehmen Symptome auslöst. Unangenehme Symptome sind eine Sache, aber Killermikroben sind eine andere.
Den Wirt am Leben zu erhalten und am laufenden Band neue Mikroorganismen zu produzieren hört sich wie ein idealer Plan für einen Erreger an. Und tatsächlich verfolgen einige Erreger eine derartige Strategie. Das Humane Papillomavirus (HPV) infiziert rund 50 Prozent aller sexuell aktiven Erwachsenen irgendwann in ihrem Leben. Gegenwärtig sind rund zehn Prozent aller Menschen infiziert, unglaubliche 650 Millionen Menschen. Zwar können ein paar HPV-Stämme Gebärmutterhalskrebs auslösen, doch für die meisten gilt dies nicht. Diejenigen Stämme, die ihren Wirt tatsächlich töten, infizieren ihn lange Jahre bevor sich die ersten Symptome zeigen. Selbst wenn die gegenwärtigen Impfstoffe, die vor den krebserregenden HPV-Stämmen schützen, allgemein angewandt würden, blieben harmlose HPV-Stämme weiterhin auf hohem Niveau in Umlauf und hätten keine schlimmeren Konsequenzen als gelegentlich ein paar hässliche Warzen. Diese Viren können sich effektiv ausbreiten, ohne zu töten. Andere Mikroorganismen töten hingegen mit erstaunlicher Effizienz.
Bacillus anthracis ist ein bakterielles Pathogen von Weidetieren wie Schafen und Rindern, das gelegentlich auch Menschen infiziert. Es löst Milzbrand (Anthrax) aus, der die Befallenen schnell und wirksam tötet. Nach der oralen Aufnahme von Anthraxsporen beim Grasen wird der Erreger aktiv und verbreitet sich umgehend im Tier, das der Infektion häufig bereits nach kurzer Zeit erliegt. Aber dieser tote Wirt ist keinesfalls eine Sackgasse für den Erreger. Sobald der Bazillus die Energieressourcen seines sterbenden Wirtes zu einer raschen und starken Vermehrung genutzt hat, geht er einfach wieder in die Sporenform über. Der Wind, ein häufiger Faktor auf den Grasebenen, auf denen die Wirte des Erregers weiden, verbreitet diese Sporen dann überall in der Umgebung, wo sie auf neue potenzielle Opfer warten. Im Fall von Anthrax befreit die Bildung widerstandsfähiger Sporen den Erreger von allen negativen Konsequenzen seines Tuns.
Derartige Szenarien sind nicht auf sporenbildende Bakterien beschränkt. Das Cholerabakterium, das zu starkem Durchfall führt, und das Pockenvirus, das eine schwere Virenerkrankung auslöst, töten innerhalb von Tagen oder Wochen. Aber bevor der Tod eintritt, verbreiten die tödlichen Symptome Billionen Erreger und sorgen so für zahllose neue potenzielle Opfer. Der Tod von Menschen, so bedauerlich er für uns ist, ist eine bloße Konsequenz der Bedingungen, die die Erreger für ihre Übertragung auf neue Wirte benötigen.
Aus der Sicht des Mikroorganismus zählt bei den Auswirkungen auf den Wirt nur, welche Bedeutung sie für die eigenen Überlebens- und Fortpflanzungschancen haben. Und eine Veränderung unseres körperlichen Zustands ist lediglich der Anfang. Einige Mikroorganismen beeinflussen sogar unser Verhalten und machen uns zu Zombies, die zu ihrem Nutzen arbeiten. Eines der verblüffendsten Beispiele liefert ein Katzenparasit, Toxoplasma gondii





























