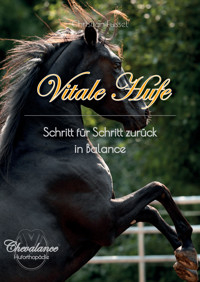
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vitale Hufe ist ein Buch für jeden Pferdefreund und Hufbearbeiter, der (endlich) wissen möchte, wie genau die Hufe von Equiden funktionieren, wie man ihre Funktion erhält oder diese reaktiviert. Kern des Buches sind deshalb zwei detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, eine für die Befundung mit über 120 genau beschriebenen Symptomen, Großteiles bebildert, und eine für die Barhuf-Bearbeitung mit über 50 verständlichen Illustrationen. Grundlage für die beiden Anleitungen ist die Huforthopädie, die für eine optimale Hufgesundheit sorgt und ein problemloses Barhuf-Laufen ermöglicht, auch bei hohen Belastungen. Nahezu alle Hufprobleme können mithilfe der huforthopädischen Bearbeitung gelöst werden. Wie man Hufproblemen zusätzlich vorbeugt, wird im Buch ebenfalls beschrieben. Sollten dennoch einmal Hufprobleme auftauchen, wie beispielsweise ein Hufgeschwür, eine Lederhautentzündung oder Hufrehe, dann hilft das Buch bei der Lösung - natürlich in Abstimmung mit einem Tierarzt. Das Buch beschreibt außerdem alle notwendigen theoretischen Grundlagen: die Anatomie der Hufe, die unterschiedlichen Hufformen, die Hufelemente und vieles mehr. Hunderte Bilder und Illustrationen sorgen für eine optimale Verständlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vitale Hufe
Schritt für Schritt zurück
in Balance
Christian Füssel
2
Inhalt
Impressum
Alle Angaben in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Für einen eventuellen Missbrauch der Informationen in diesem Buch können weder der Autor noch der Verleger oder der Vertreiber des Buchs zur Verantwortung gezogen werden. Eine Haftung für Personen-, Tier-, Sach- und Vermögensschäden ist ausge-schlossen. Die Verwendung des Buches erfolgt auf eigene Verantwortung. Alle regional gültigen Gesetze und Normen müssen eingehalten werden.
Copyright © Christian Füssel
Untere MühleSchloßstraße 497953 Königheim-Gissigheim
www.chevalance.com
1. Auflage April 2024
Das Urheberrecht und sämtliche weiteren Rechte sind dem Autor, Verleger und Vertrei-ber Christian Füssel vorbehalten.
Sowohl der Nachdruck des gedruckten Buches als auch die Kopie des E-Books, auch einzelner Teile, ist verboten. Die Übersetzung, Vervielfältigung und Verbreitung ist ohne vorherige Genehmigung des Autors, Verlegers und Vertreibers unzulässig und strafbar. Das gilt auch für die Speicherung des gedruckten Buches auf elektronischen Datenträgern und Medien wie dem Internet, Servern, Festplatten, Smartphones, DVDs, usw. Die Verwendung oder Speicherung des E-Books außerhalb des Portals, über wel-ches das E-Book erworben wurde, ist ohne vorherige Genehmigung des Autors, Verle-gers und Vertreibers unzulässig.
Autor, Verleger, Vertreiber und IllustratorChristian Füssel
3
Inhalt
Vorwort
Es war einmal, vor einer langen Zeit, als ich an einer renommierten Schule für Hufortho-pädie einen Ausbildungsplatz ergattern konnte. An dieser Schule wurde die Hufortho-pädie nach dem Konzept von Jochen Biernat gelehrt, so war zumindest meine damalige Erwartungshaltung. Das Konzept wird bei Wikipedia wie folgt umschrieben:
„ [...] Etwa um 1980 begann Jochen Biernat, der Begründer der Huforthopädie, durch Beobachtung, Röntgenuntersuchungen und Präparation von Pferdeglied-maßen Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie sich Anomalien und Erkrankungen des Bewegungsapparates auf die Form und Stellung der Hufe auswirken und wie die veränderte Hufform krankhafte Veränderungen des gesamten Bewegungsap-parates nach sich ziehen kann. Die Beachtung der physikalischen Gegebenheiten in Bezug auf die Wirkung der Kräfte, die beim Auffußen, in der Stützphase und beim Abfußen auftreten, sowie die damit einhergehende Abnutzung des Hornes, spielte dabei eine große Rolle. In zahlreichen Langzeitbeobachtungen entwickelte er eine Bearbeitungsmethode, die es in den meisten Fällen ermöglicht, die sich mit zunehmendem Alter der Pferde meist verstärkenden Veränderungen aufzuhal-ten, im günstigsten Fall sogar umzukehren. 1998 begann er, diese Methode durch Lehre zu verbreiten. Die Methode befindet sich noch im Entwicklungsprozess und ist nicht unumstritten. Huforthopäden, Hufschmiede, Hufpfleger und Huftechniker diskutieren vehement über die richtige Bearbeitung des Pferdehufes. [...]“ 1
Wie in diesem Beitrag angegeben, gibt es etliche unterschiedliche Berufsgruppen, die eine Ausbildung zur Bearbeitung und/oder zum Beschlagen von Equiden-Hufen anbie-ten. Überzeugt hatte mich allerdings nur die Huforthopädie bzw. die Resultate meines mich damals betreuenden Huforthopäden, der an einer anderen renommierten Schule seine Ausbildung nach dem Konzept von Jochen Biernat absolviert hatte. Mit Beginn seiner Bearbeitung verbesserte sich der Zustand der Hufe unserer Pferde rapide. Man konnte zusehen, wie deformierte Hufbestandteile immer besser in Form kamen und wie sie ihre Tragfähigkeit zurückerlangten. Der Strahl gewann an Volumen, die Sohle bekam eine harmonische Oberfläche und wirkte stabil, Demarkierungen und Risse ver-schwanden, Ausbrüche waren nur noch selten zu finden und vor allem sah die Hufwand harmonisch, stabil und widerstandsfähig aus. Die Hufe kamen immer mehr in Balance. Das Problem war nur, dass dieser so gut qualifizierte Huforthopäde rund 100 km weit entfernt wohnte, weshalb seine Verpflichtung leider keine Dauerlösung war. Ein anderer Huforthopäde in der Nähe? Fehlanzeige. Also musste ich die Sache selbst in die Hand nehmen, wie viele andere Pferdebesitzer auch, denn die Nachfrage nach guten Hufbear-beitern war wesentlich größer als das Angebot.
Endlich in der Ausbildung angekommen, musste ich leider feststellen, dass sie nicht meinen Vorstellungen entsprach. Kurz gesagt, das Konzept sah eine traditionelle Berufs-ausbildung vor, mit dem Ziel, nach der Ausbildung als Huforthopäde mehr oder weniger
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Huforthop%C3%A4die
4
Inhalt
hauptberuflich zu arbeiten. Mein Ziel war es allerdings, lediglich die Hufe von meinen eigenen Pferden zu bearbeiten. Gerne hätte ich deshalb zunächst einmal die typische Hufbearbeitung erlernt, um mir dann anschließend, bei Bedarf, in Zusatzkursen weiteres Wissen beispielsweise zur Hufrehe oder zu Hufgeschwüren anzueignen. Hinzu kamen die ortsabhängigen Termine, die aufwendig wahrzunehmen waren. Meine Frau muss-te sich zuhause um alles kümmern, während ich unterwegs war. Die Ausbildung war außerdem recht teuer und die didaktische Aufbereitung der zweifelsohne fachlich tollen Inhalte, entsprach ebenfalls nicht meinen Vorstellungen. Viele für mich interessante In-formationen fehlten oder waren schwer verständlich, weshalb ich mich bereits während der Ausbildung umfangreich parallel weiterbildete und über neue Ausbildungskonzepte nachdachte. Ich las etliche Bücher über die Huforthopädie und wissenschaftliche Publi-kationen zu Pferdehufen, schaute Lehrvideos, studierte die Anatomie der Hufe mithilfe von 3-D-Animationen, führte Belastungsversuche zur Hufmechanik durch, dokumentier-te etliche Fallbeispiele und analysierte Präparate, Plastinate und Röntgenbilder.
Was mir in der Ausbildung allerdings vor allem fehlte, war ein ausführliches Symptome-Lexikon zur Befundung eines Hufes und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dessen Bearbeitung. Gerne hätte ich während der Hufbearbeitung immer mal wieder überprüft, ob ich den jeweiligen Huf richtig gelesen und richtig bearbeitet habe. Ohne ein Definition der Symptome und eine entsprechende Schritt-für-Schritt-Anleitung war es aber weder möglich, die exakte Belastungssituation eines Hufes zu bestimmen, noch die notwen-dige korrekte Bearbeitung festzulegen. Immer wieder gab es deshalb an den Praxista-gen der Ausbildung stundenlange Diskussionen darüber, ob ein ziemlich ausbalancierter Huf beispielsweise medial oder lateral mehr belastet wurde. Immer wieder war unklar, ob ein während der Befundung entdecktes und beschriebenes Symptom tatsächlich zu einer bestimmten Belastungssituation passen würde oder nicht. Oft waren sich selbst die erfahrenen Experten nicht einig und diskutierten lange, um dann einen Kompromiss zu finden, mit dem nicht wirklich jeder zufrieden war. Zugegeben: Die Variantenvielfalt der unterschiedlichen Belasungssituationen von Equiden-Hufen ist enorm und diese ver-ständlich zu beschreiben ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Aufgrund der fehlen-den konkreten Anleitung zur huforthopädischen Befundung und Bearbeitung nach dem Konzept von Jochen Biernat, machte ich mich auf die Suche danach, doch ich konnte leider keine finden. Zwar gibt es einige Bücher, in denen die Anatomie, krankhafte Hufsi-tuationen oder huforthopädische Fallbeispiele beschrieben sind, doch die oben erwähnte Anleitung gibt es einfach nicht.
Ich musste mein Problem also selbst lösen, weshalb ich in den letzten Jahren sowohl eine eigene exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Befundung, die man auch als Sym-ptome-Lexikon bezeichnen könnte, als auch eine eigene exakte Schritt-für-Schritt-An-leitung zur Bearbeitung von Equiden-Hufen entwickelt und in diesem Buch beschrieben habe. Als Diplomtechnikredakteur konnte ich nicht anders. Wie nahe meine Anleitungen an den Vorgehensweisen von Jochen Biernat dran sind, ist unklar, da es, wie bereits er-wähnt, davon keine exakte Anleitung gibt. Deshalb entsprechen meine Anleitungen dem Konzept der Chevalance Huforthopädie©von Christian Füssel und nicht dem Konzept
5
Inhalt
der Huforthopädie von Jochen Biernat. Zwei wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Konzepten sind mir allerdings bewusst. Zum einen lehnte Jochen Biernat das so-genannte einseitige mediolaterale Kürzen stets ab, ich tue das nicht. Ein minimales ein-seitiges Kürzen ist in meinem Konzept in bestimmten Fällen vorgesehen, wenn dadurch die Elastizität eines Hufes nicht an ihre Grenzen stößt. Zum anderen wird nach dem Konzept von Jochen Biernat die Tragrandbreite der mehr belasteten Hufwandabschnitte nicht verringert, in meinem Konzept ist das allerdings möglich, wenn auch die mehr belasteten Hufwandabschnitte flach zum Boden ausgerichtet sind und an Tragfähigkeit verloren haben. Was genau in einem solchen Fall beachtet werden muss, wird im Kapitel „Bearbeitung“ ab Seite 215ausführlich beschrieben. Weitere Unterschiede zwischen den beiden Konzepten sind wahrscheinlich.
Zusätzlich zu meinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen habe ich in diesem Buch einige grundlegende Informationen und Erfahrungen zusammengetragen, die für die Cheva-lance Huforthopädie©wichtig sind. Der Anspruch dieser ergänzenden Informationen ist nicht, wissenschaftliche Belege für Tatsachen zu erbringen oder medizinische Details zu beleuchten. Dafür gibt es Spezialisten und Tierärzte, die dazu bereits qualitativ hoch-wertige Literatur und entsprechende Studien veröffentlicht haben. Diese ergänzend zu recherchieren und zu studieren kann ich sehr empfehlen. Nein, der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und auf den dafür notwendigen anatomischen Grundkenntnis-sen. Ergänzend zu diesem Buch biete ich ein umfangreiches Schulungsangebot, in dem alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Chevalance Hufortho-pädie©erlernt werden können, zum Beispiel über die Befundung, die Bearbeitung, die Anatomie, die Hufmechanik, die Hufelemente, die Prävention von Hufproblemen, die typischen Hufarten, Hufgeschwüre, Hufrehe, Sohlenlederhautenzündungen, Strahlfäule, Risse, Flexionen, den Bockhuf und vieles mehr. Das Schulungsangebot unterscheidet sich wesentlich von den traditionellen Angeboten anderer Anbieter, da sich die Interes-senten individuell schulen können, je nach Bedarf. Das Chevalance Schulungsangebot besteht aus einem umfangreichen Grundkurs, weiterführenden Kursen, einigen indivi-duellen Online-Kursen und einer Online-Sprechstunde, in denen ich meine Erfahrungen weitergebe. Mehr dazu auf www.chevalance.com.
Die Gesundheit der Pferde hat sowohl in diesem Buch als auch im kompletten Schu-lungsangebot höchste Priorität! Detaillierte Sicherheitshinweise vor jedem Handlungs-schritt helfen, dass weder das Pferd noch die ausführende Person beim darauffolgenden Handlungsschritt verletzt wird. Hält man sich exakt an die entsprechenden Anleitungen, dann sollte sich der Zustand der Hufe entweder verbessern oder wenigstens erhalten bleiben. Trotz der detaillierten Beschreibung und der aufgeführten Sicherheitshinweise kann dieses Buch nur auf eigene Verantwortung verwendet werden. Alle lokal gültigen Gesetze und Richtlinien müssen auf eigene Verantwortung eingehalten werden.
Einen besonderen Dank gilt meiner Frau Silke, die mir in all den Jahren bei den un-zähligen Arbeitsstunden den Rücken frei gehalten und mich durch unzählige anregende Diskussionen unglaublich unterstütz hat. Deshalb widme ich Dir dieses Buch, Liebling.
6
Inhalt
Inhalt
Huforthopädie 11
Die Huforthopädie allgemein 12
Die Chevalance Huforthopädie©14
Anatomie 19
Sagittalschnitt 20
Knochen & Hufknorpel 22
Hufrollenkomplex 24
Lage- & Richtungsbezeichnungen 26
Hufe 31
Elemente 32
Fessel [a] 34
Hufknorpel [b] 35
Kronrand [c] 36
Hufwand [d] 38
Hufbeinträger [e] 42
Ballen [f] 48
Strahl [g] 50
Sohle [h] 52
Funktionsweise 54
Bei ebenen Böden 58
Bei unebenen Böden 60
Mit und ohne Beschlag 61
Mediolaterale Lastverteilung 62
Longitudinale Lastverteilung 68
Huf-Fessel-Achse ungebrochen 70
Huf-Fessel-Achse nach hinten gebrochen 72
Huf-Fessel-Achse nach vorne gebrochen 76
Typische Hufformen 80
Der Huf in Balance 82
Der einseitige Huf (Vorder- oder Hinterbein) 84
Der Diagonalhuf (Vorderbein) 88
7
Inhalt
Der Platthuf (Vorder- oder Hinterbein) 92
Der Zwanghuf (Vorder- oder Hinterbein) 94
Der Bockhuf (Vorder- oder Hinterbein) 95
Die Bärentatze (Vorder- oder Hinterbein) 98
Auswirkungen eines Hufbeschlages 100
Befundung 103
Einleitung 104
Elemente eines Handlungsschrittes 106
Vergleichende Ansicht 108
Dorsal 112
Huf zur Knochensäule und Fessel [a] 112
Hufknorpel [b] 116
Kronrand [c] 117
Hufwand allgemein [d] 120
Hufwand – Seitenwände [d2] 129
Hufwand – Tragrand [d5] 134
Lateral (medial) 138
Huf-Fessel-Achse [a] 138
Hufknorpel [b] 142
Kronrand [c] 143
Hufwand allgemein [d] 145
Hufwand – Zehenwand [d1] 154
Hufwand – Trachten [d3] 159
Hufwand – Tragrand [d5] 161
Solear 164
Huf zur Knochensäule [a] 164
Hufwand – Trachten [d3] 166
Hufwand – Eckstreben [d4] 168
Hufwand – Tragrand [d5] 173
Hufbeinträger [e] 186
Ballen [f] 190
Strahl [g] 191
Sohle [h] 195
8
Inhalt
Palmar/plantar 198
Hufwand – Seitenwände [d2] 198
Hufwand – Trachten [d3] 202
Hufwand – Tragrand [d5] 204
Ballen [f] 205
Strahl [g] 207
Sohle [h] 211
Bearbeitungsziele festlegen 212
Bearbeitung 215
Einleitung 216
Begriffe für die Hufwandbearbeitung 220
Flacher Hufwandabschnitt 224
Steiler Hufwandabschnitt 228
Sehr flacher Hufwandabschnitt 232
Sehr steiler Hufwandabschnitt 233
Senkrechter Hufwandabschnitt 234
Übersteiler Hufwandabschnitt 235
Voraussetzungen 236
Beschrieben in diesem Buch 238
Selbstständig erfüllen 239
Schutzausrüstung und Werkzeuge 240
Optionales Zubehör 243
1. Beschaffenheit der Sohle prüfen 244
2. Eckstreben bearbeiten 246
Steile, untergeschobene oder eingerollte Trachte 248
Flache Trachte 250
3. Sohle glätten 252
4. Säuberungsschnitt durchführen 254
5. Strahl glätten 256
6. Tragrand innen senkrecht anlegen 260
Flacher Hufwandabschnitt mit weniger Belastung 262
Flacher Hufwandabschnitt mit mehr Belastung 266
Steiler Hufwandabschnitt mit weniger Belastung 270
Steiler Hufwandabschnitt mit mehr Belastung 274
9
Inhalt
7. Tragrand innen schräg anlegen 278
Steiler Hufwandabschnitt mit weniger Belastung 280
Steiler Hufwandabschnitt mit mehr Belastung 282
8. Tragrandbreite von außen verringern 284
Flacher Hufwandabschnitt mit weniger Belastung 286
Flacher Hufwandabschnitt mit mehr Belastung 290
Steiler Hufwandabschnitt mit weniger Belastung 294
9. Tragrandhöhe verringern 296
Huf mit nahezu gleichmäßiger Belastung 298
Huf mit erheblich unterschiedlicher Belastung 300
Huf mit überlasteter Trachte 304
10. Hufwand elliptisch bearbeiten 308
Nachbereitung 312
Beispiele 314
Richtlinien 334
Besondere Hufsituationen 337
Prävention 338
Erkrankungen 342
Hufgeschwür 344
Defekte Lederhaut 354
Abszess 356
Hufknorpelverknöcherung 357
Strahlfäule 358
Hufrehe 362
Sohlenlederhautentzündung 366
Hufrollenentzündung 367
Hufe in Dysbalance 368
Umstellung vom Beschlag auf Barhuf 370
Hilfsmittel 374
Index 377
Quellenverzeichnis 385
10
11
Huforthopädie
12
Huforthopädie
Die Huforthopädie allgemein
Wie bereits im „Vorwort“ ab Seite 3erwähnt, geht die heute allgemein bekannte Huforthopädie auf den Begründer Jochen Biernat zurück, der diesen Begriff geprägt hat, indem er sich bis zu seinem Tod im Jahr 2019 mit der ausführlichen Analyse von Hufen und deren Heilung beschäftigt und seine daraus entwickelte Methode an Interessierte weitergegeben hat. Da die Bezeichnung „Huforthopädie“ weder ein geschützter noch ein eindeutig definierter Begriff ist, wird er sozusagen inflationär verwendet. Etliche Hufbe-arbeiter nennen sich also Huforthopäde, arbeiten aber nicht nach dem Konzept des Be-gründers. Das führt immer wieder zu Missverständnissen. Da es außerdem keine staat-lich zertifizierte Ausbildung zum Huforthopäden gibt, können viele nicht einschätzen, was eigentlich die Huforthopädie genau ist. Deshalb möchte ich etwas Licht ins Dunkel bringen und meine Einschätzung dazu teilen.
In der allgemein bekannten Huforthopädie nach Jochen Biernat geht es darum, einen Huf durch eine regelmäßige Bearbeitung schonend wieder in Balance zu bringen, ohne abrupten Stellungswechsel. Deformierungen sollen gestoppt oder bestenfalls rückgän-gig gemacht werden. Durch eine gezielte Abriebsteuerung sollen die weniger belasteten Hufwandabschnitte nach der Bearbeitung mehr abgerieben werden als die mehr be-lasteten Hufwandabschnitte, wodurch sich der Huf selbstständig ausbalancieren kann. Zusätzlich soll die Tragfähigkeit der weniger belasteten Hufwandabschnitte verbessert werden, damit sie die anderen Hufwandabschnitte entlasten. Hierzu gibt es allerdings mehrere Ansätze von unterschiedlichen huforthopädischen Vereinigungen. Die einen formen die Hufwand geschwungen wie ein Reetdach, die anderen mit geradem Ver-lauf. Ein wesentliches Merkmal der allgemein bekannten Huforthopädie ist außerdem, dass die Hufwand einen ausreichend hohen Tragrand haben soll, damit die dämpfende Funktion der Hufwand in Verbindung mit dem dahinterliegenden elastischen Hufbein-träger die einwirkenden Kräfte abfedern kann. Der Tragrand soll dabei nicht zu hoch sein, damit auf die Hufwand keine deformierenden Hebelkräfte einwirken können. Hohe Tragrandüberstände werden mediolateral (seitlich) gleichmäßig und auf keinen Fall un-gleichmäßig gekürzt, denn die mediolaterale Balance soll durch die oben beschriebene Abriebsteuerung schonend erreicht werden. Die Verwendung eines Beschlages ist nicht vorgesehen.
Wie genau die Bearbeitung der allgemein bekannten Huforthopädie in den vielen unter-schiedlichen Hufsituationen durchgeführt werden soll, ist nach meinen Recherchen weder dokumentiert noch nachzulesen – das gleiche gilt für die exakte Befundung, auf deren Basis die Hufe bearbeitet werden sollen. Dieses Wissen wird durch Lehre weitergegeben und kann nur in einer staatlich nicht geprüften Berufsausbildung zum Huforthopäden bei einer der fünf mir bekannten Organisationen erlernt werden, die es im deutschsprachi-gen Raum gibt. Im Fokus dieser traditionellen Ausbildungsangebote steht der betreute praktische Unterricht auf einem Ausbildungshof mit von den Besitzern zur Verfügung gestellten Pferden. Nach dem theoretischen Unterricht können die Auszubildenden dort
13
Die Huforthopädie allgemein
ihre ersten praktischen Erfahrungen sammeln und unter Aufsicht von erfahrenen Huf-orthopäden ihre handwerklichen Fähigkeiten erarbeiten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Ausbilder können umgehend eingreifen und den Schülern helfen, wenn sie Fragen haben oder praktische Unterstützung benötigen. Während der Ausbildungszeit erstellen die Auszubildenden zusätzlich ein Berichtsheft und absolvieren Praktika, eine Zwischen- und eine Abschlussprüfung, ähnlich wie bei staatlich anerkannten Lehrberufen.
Ein solides Ausbildungskonzept, das aber auch Nachteile hat. Die Teilnehmerzahl ist meist auf eine kleine Gruppe begrenzt, weshalb nur wenige das notwendige Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten der Huforthopädie erlernen können. Das ist schade für die Pferdewelt und ein Geduldspiel, wenn man Huforthopäde werden möchte, aber die Kurse bereits ausgebucht sind oder sehr weit weg vom Wohnort stattfinden. Die Anreise ist deshalb meist aufwendig und die Kursteilnahme teuer. Hinzu kommen didaktische Schwächen. Wird man am Praxistag einmal abgelenkt, könnte man bei der Demonstra-tion eines Ausbilders etwas verpassen. Möglicherweise wird man auch nicht die ganze Zeit betreut, weil die Anzahl der Ausbilder beschränkt ist oder die Aufnahmefähigkeit ab-nimmt, weshalb man nicht alle notwendigen Informationen aufnehmen kann. Ergänzend zu dem beschriebenen, traditionellen Ausbildungskonzept, bieten einige Organisationen Webinare zu bestimmten theoretischen Kenntnissen an. Die detaillierte Befundung und die exakte Bearbeitung werden aber nach meinen Recherchen nicht online unterrichtet.
14
Huforthopädie
Die Chevalance Huforthopädie©
Wie bereits im „Vorwort“ ab Seite 3erläutert, zeichnet sich die Chevalance Hufor-thopädie©vor allem durch eine exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Befundung, die man auch als Symptome-Lexikon bezeichnen könnte, und durch eine exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bearbeitung von Equiden-Hufen aus. Im Gegensatz zur allgemein bekannten Huforthopädie werden Befundung und Bearbeitung damit konkret beschrie-ben, wodurch unzählige Diskussionen über eine unkonkrete Vorgehensweise verhindert werden. Sollte sich außerdem in der Praxis irgendwann einmal zeigen, dass es Lücken oder Schwächen in diesen Anleitungen geben sollte, dann können die Anleitungen wei-terentwickelt und entsprechend verbessert werden. Nur so wird es zukünftig möglich sein, die beste Hufbearbeitungsmethode zum Wohle der Pferde zu entwickeln – eine grundlegende Bestrebung der Chevalance Huforthopädie©. Bisher haben sich die An-leitungen allerdings bewährt, denn mit dem darin beschriebenen Vorgehen konnte ich in den letzten Jahren vielen Pferden zu gesunden, ausbalancierten Hufen verhelfen und ihnen ein schmerzfreies Barhuflaufen ermöglichen.
Da Hufe beim Auftreten physikalischen Einflüssen ausgesetzt sind, sorgen Druck-, He-bel- und Zugkräfte auf unterschiedlichen Untergründen für deren Deformierung. Um dieser Deformierung entgegenzuwirken und dadurch eine optimale Belastungssituation entweder zu erhalten oder wieder herzustellen und außerdem mögliche Probleme zu vermeiden, gibt es die Chevalance Huforthopädie©.
Leben Pferde in einer Herde in der Natur, legen sie viele Dutzend Kilometer am Tag zurück, wodurch ihre Hufe normalerweise ausreichend abgerieben werden. So wirken auf die Hufwand meist nur geringe Hebelkräfte, wodurch die Hufe sich nicht erheblich deformieren. Zwar gibt es in der Natur auch andere Fälle, bei denen die Hufwand weni-ger abgerieben wird und die Hufe dadurch so schlimm deformieren, dass solche Pferde der natürlichen Selektion unterliegen und versterben, doch diese Fälle sind wesentlich seltener.
Die Pferde in der menschlichen Zivilisation leben im Vergleich zu den Naturpferden in einer domestizierten Welt, wodurch ihre Bewegung meist eingeschränkt ist und die Hufe, wie oben beschrieben, oft wenig abgerieben werden und deformieren. Um dieser Proble-matik entgegenzuwirken, verfolgt die Chevalance Huforthopädie©die folgenden Ziele:
Die Hufe von domestizierten Equiden sollen regelmäßig, jede vierte Woche, überprüft und anschließend belastungsgerecht und präzise bearbeitet werden, um Deformie-rungen der Hufe zu vermeiden oder wieder rückgängig zu machen und eine optimale Belastung herzustellen.
Abrupte Stellungsänderungen, die zu einer Überlastung der inneren Hufstrukturen wie beispielsweise der Hufknorpel, der Sehnen, der Bänder, der Lederhaut oder des Hufbeinträgers führen können, müssen vermieden werden.
15
Die Chevalance Huforthopädie©
Stattdessen soll mithilfe einer angepassten Tragrandbreite der Abrieb so gesteuert werden, dass sich der Huf bis zur nächsten Bearbeitung Schritt für Schritt schonend ausbalancieren kann, ohne eine abrupte Umstellung.
Die gleichmäßige Belastung der medialen und der lateralen Hufhälfte soll somit er-reicht werden, die sogenannte mediolaterale Balance.
Außerdem soll die gleichmäßige Belastung der Zehe vorne und der Trachten hinten erreicht werden, die sogenannte longitudinale (Längsrichtung) Balance. Dafür soll die Huf-Fessel-Achse ungebrochen sein und die Spannung der tiefen Beugesehne physiologisch angemessen.
Eine harmonisch rund-ovale Schalenform der Hufwand (abhängig vom individuellen Huftyp) von Trachte zu Trachte soll erreicht werden, um die optimale Stabilität der Hornkapsel1zu erhalten oder wiederherzustellen.
Die auf den Huf einwirkenden Kräfte sollen in der Stützbeinphase mittig in den Huf eingeleitet und somit optimal aufgenommen werden.
Der Tragrand der Hufwand soll in Verbindung mit dem Hufbeinträger optimal die Last des Pferdekörpers tragen und die einwirkenden Kräfte abfedern, so ähnlich wie bei einem Trampolin die Stützen in Verbindung mit den Gummibändern und dem Sprungnetz.
Hebelkräfte, die auf die Hufwandabschnitte einwirken, sollen auf ein Minimum redu-ziert werden.
Nicht immer können diese Ziele vollumfänglich erreicht werden, zum Beispiel dann, wenn sich die inneren Strukturen eines Hufes oder der Knochensäule darüber bereits wesentlich der bisherigen Belastung angepasst haben (siehe „Mediolaterale Lastvertei-lung“ ab Seite 62). In solchen Fällen soll stattdessen das individuelle Optimum des Hufes angestrebt werden, das automatisch erreicht wird, wenn ein Huf regelmäßig huf-orthopädisch bearbeitet wird, wie im Kapitel „Bearbeitung“ ab Seite 215beschrieben.
Bei all diesen Bestrebungen ist das wichtigste Ziel der Chevalance Huforthopädie© aber das Folgende: Ein Pferd soll nach der Bearbeitung besser oder wenigstens genauso gut Laufen wie zuvor!
Leider kann auch dieses Ziel nicht immer erreicht werden, beispielsweise bei einer Um-stellung von Beschlag auf Barhuf (siehe „Umstellung vom Beschlag auf Barhuf“ ab Seite 370) oder nach der ersten Bearbeitung eines Hufes mit extrem langen und deformier-ten Hufwandabschnitten. In diesen Fällen stößt die Elastizität eines Hufes manchmal durch eine ungewollte Stellungsveränderung einmalig an ihre Grenzen. Spätestens ab der zweiten Bearbeitung sollte das beschriebene Ziel aber unbedingt erreicht werden.
1 Zur Hornkapsel gehören alle Horne, die das Hufbein umhüllen: Saumhorn, Wandhorn, Lamellenhorn, Hufbeinwand- und Huf-knorpel-Horn, Hufbeinrandhorn, Sohlenhorn, Strahlhorn und Ballenhorn.
16
Huforthopädie
Haben Personen das komplette Ausbildungsprogramm der Chevalance Huforthopädie©durchlaufen, sollten sie außerdem einem Tierarzt auf dessen Anweisung hin in bestimm-ten Situationen helfen können. Durch ihre detaillierten anatomischen Kenntnisse vom Huf und durch ihre erlernten handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sollten sie in der Lage sein, einen Huf entweder belastungsgerecht und verletzungsfrei zu bearbeiten oder einen notwendigen Verband anzulegen. Solche Situationen könnten beispielsweise Hufrehe, Hufgeschwüre, Hufrollenentzündungen, Sohlenlederhautentzündungen oder Strahlfäule sein. Diese und weitere Situationen sind im Kapitel „Besondere Hufsituatio-nen“ ab Seite 337beschrieben.
Aufgrund der im Abschnitt „Huforthopädie“ ab Seite 11aufgezeigten Herausforderun-gen eines traditionellen Ausbildungsmodells, wurde das Ausbildungsprogramm der Che-valance Huforthopädie©um Online-Kurse, Webinare, eine Online-Sprechstunde und um dieses Buch ergänzt. Mithilfe dieser Angebote, die umfangreiche Lehr-Videos enthal-ten, soll es interessierten Personen ermöglicht werden, sich selbstständig die notwen-digen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen – verständlich, zeitlich und geografisch unabhängig und durch entsprechende Gefahrenhinweise mit dem höchstmöglichen Maß an Sicherheit für alle Beteiligten.
17
18
19
Anatomie
20
Anatomie
Sagittalschnitt
Hufpräparat mit einem Sagittalschnitt.
21
Sagittalschnitt
Die vorherige Abbildung zeigt einen Sagittalschnitt, also einen Schnitt durch das Pferde-bein in Längsrichtung. Der Sagittalschnitt zeigt nahezu alle notwendigen Elemente eines Hufes, die für ein grundlegendes anatomisches Verständnis notwendig sind. Die Elemen-te sind in der Abbildung nummeriert und im Folgenden aufgelistet:
Röhrbein [1]
Fesselgelenk [2]
Fesselbein [3]
Gemeinsamer Zehenstrecker [4]
Krongelenk [5]
Kronbein [6]
Hufgelenk [7]
Hufbein [8]
Lederhäute und Hufbeinträger [9]
Hufwand [10]
Sohle [11]
Hufrollenschleimbeutel [12]
Strahlbein-Hufbein-Band [13]
Strahlbein [14]
Strahl [15]
Ballen [16]
Strahlpolster [17]
Tiefe Beugesehne [18]
Gerades Sesambeinseitenband [19]
In einem Sagittalschnitt nicht zu sehen sind vor allem die so wichtigen Hufknorpel, die deshalb im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
22
Anatomie
Knochen & Hufknorpel
Laterale/mediale Ansicht.
Palmare/plantare Ansicht.
23
Knochen & Hufknorpel
Soleare Ansicht.
Die vorherigen Illustrationen zeigen die wesentlichen Knochen und die Hufknorpel, die für ein grundlegendes anatomisches Verständnis wichtig sind. Die Elemente sind in den Illustrationen nummeriert und im Folgenden aufgelistet:
Röhrbein [1]
Fesselbein [4]
Kronbein [6]
Hufbein [8]
Strahlbein [17]
Hufknorpel [24]
Sesambeine (Gleichbeine des Fesselgelenks) [25]
Die Knochen sind zur besseren optischen Unterscheidung eingefärbt. In Wirklichkeit sind die Knochen natürlich mehr oder weniger weiß.
24
Anatomie
Hufrollenkomplex
Laterale/mediale Ansicht.
Laterale/mediale Ansicht im Detail.
25
Hufrollenkomplex
Lateral-/soleare-/palmare Ansicht.
Die vorherigen Illustrationen zeigen die wichtigsten Elemente des Hufrollenkomplexes, die für ein grundlegendes anatomisches Verständnis wichtig sind. Die Elemente sind in den Illustrationen nummeriert und im Folgenden aufgelistet:
Strahlbein [17]
Beugesehne des tiefen Zehenbeugers (tiefe Beugesehne) [18]
Hufrollenschleimbeutel [26]
Der Hufrollenkomplex spielt sowohl bei der huforthopädischen Bearbeitung als auch bei der ärztlichen Diagnostik eine wichtige Rolle, da sich die Elemente bei einer dauerhaften Überlastung der tiefen Beugesehne entzünden können (siehe „Hufrollenentzündung“ ab Seite 367).
Die Knochen und die Schleimbeutel sind zur besseren optischen Unterscheidung einge-färbt. In Wirklichkeit sind diese Elemente natürlich mehr oder weniger weiß.
26
Anatomie
Lage- & Richtungsbezeichnungen
Die folgenden Lage- und Richtungsbezeichnungen sind elementar, um die Position von Hufelementen und Symptomen benennen zu können. Zum Verständnis des Buches und zum Austausch mit anderen ist das äußerst wichtig.
Dorsal: Zum Hand- bzw. Fußrücken hin (Ansicht von vorne)
Lateral: Seitlich von der Medianebene weg (Ansicht seitlich von außen)
Medial: Innen zur Medianebene hin (Ansicht seitlich von innen)
Solear: Sohle bzw. Hufunterseite (Ansicht von unten)
Palmar: Handflächenseitig (Ansicht von hinten beim Vorderhuf)
Plantar: Fußflächenseitig (Ansicht von hinten beim Hinterhuf)
Proximal: Zum Körperzentrum hin (von unten nach oben)
Distal: Vom Körperzentrum entfernt (von oben nach unten)
Die folgende Abbildung entspricht der dorsalen Ansicht (von vorne), mit deren Hilfe die ersten Symptome bei der Befundung eines Hufes identifiziert werden, um dessen Be-lastungssituation einschätzen zu können.
Dorsale Ansicht (von vorne).
Typische Symptome der dorsalen Ansicht sind beispielsweise eine flache Seitenwand oder ein angestauter Kronrand. Mehr dazu in „Befundung“ ab Seite 103.
27
Lage- & Richtungsbezeichnungen
Die nächste Abbildung entspricht der lateralen Ansicht, also der Ansicht von der Seite. Zusätzlich zur Bezeichnung palmar (handflächenseitig) des hier dargestellten Vorder-hufes wird die Bezeichnung plantar (fußflächenseitig) aufgeführt, obwohl diese Bezeich-nung bei einem Hinterhuf verwendet wird.
Laterale Ansicht (seitlich von außen).
Typische Symptome der lateralen Ansicht sind beispielsweise untergeschobene Trachten oder Ausbrüche am Tragrand. Mehr dazu in „Befundung“ ab Seite 103.
Die nächste Abbildung entspricht der solearen Ansicht, also der Ansicht des Hufes von unten, aus der in der Regel die meisten Symptome zur Bewertung der Belastungssitua-tion abzulesen sind.
28
Anatomie
Soleare Ansicht (von unten).
Typische Symptome der solearen Ansicht sind beispielsweise ein verbreiterter Hufbein-träger im Bereich des Zehenabweisers oder die Position der angelaufenen Zehenrich-tung. Mehr dazu in „Befundung“ ab Seite 103.
Abschließend entspricht die nächste Abbildung der palmaren Ansicht, also die Ansicht eines Vorderhufes von hinten.
29
Lage- & Richtungsbezeichnungen
Palmare Ansicht (Vorderhuf von hinten).
Typische Symptome der palmaren Ansicht sind beispielsweise eine flache Trachtenend-kante oder eine lange Hornstrecke der Seitenwand medial. Mehr dazu in „Befundung“ ab Seite 103.
Auf eine Abbildung der medialen Ansicht wird hier verzichtet, da sie vergleichbar ist mit der lateralen Ansicht. Bei der Befundung haben beide Ansichten die gleiche Bedeutung.
30
31
Hufe
32
Hufe
Elemente
Der Huf eines Equiden besteht aus den folgenden Elementen, die bei Anwendung der Chevalance Huforthopädie©entweder bearbeitet oder von der Bearbeitung beeinflusst werden (siehe „Befundung“ ab Seite 103). Für die Befundung spielen alle Elemente eine Rolle (siehe „Bearbeitung“ ab Seite 215).
Fessel [a]
Hufknorpel [b]
Kronrand [c]
Hufwand [d]
Zehenwand [d1]
Seitenwände [d2]
Trachtenwände [d3]
Eckstreben [d4]
Tragrand [d5]
Hufbeinträger [e]
Ballen [f]
Strahl [g]
Sohle [h]
Welche Eigenschaften diese Elemente haben, wie ihr Optimalzustand sein sollte, welche Bedeutung sie bei der Befundung haben und ob sie bearbeitet werden müssen oder nicht, ist in den folgenden Abschnitten erläutert.
33
Elemente
Elemente aus der lateral Ansicht.
Elemente aus der solearen Ansicht.
34
Hufe
Fessel [a]
Beschreibung
Die Fessel, die sich proximal des Kronrandes befindet, besteht im Wesentlichen aus dem Fesselbein, den Sesambeinen und dem Fesselgelenk zwischen Fessel- und Röhrbein. Zur Fessel gehören zusätzlich einige Bänder, Sehnen, Schleimbeutel, Haut und Haare.
Wie bei den meisten Gelenken eines Equiden-Beines, handelt es sich beim Fesselgelenk um ein Scharniergelenk, welches durch Beugung und Streckung Bewegungen in Längs-richtung ermöglicht. Seitliche Bodenunebenheiten können solche Gelenke nicht ausglei-chen. Mehr dazu in „Funktionsweise“ ab Seite 54.
Optimalzustand
Optimal ist es, wenn der Huf von dorsal betrachtet möglichst zentral unter der Fessel positioniert ist und die Fessel auf beiden Seiten gleichmäßig verläuft. Von lateral und medial betrachtet sollte die Huf-Fessel-Achse ungebrochen sein (also gerade verlaufen). Mehr dazu in „Longitudinale Lastverteilung“ ab Seite 68.
Wenn sich die inneren Strukturen eines Hufes bereits einer ausgeprägten Deformierung angepasst haben, kann es sein, dass dieser Optimalzustand nicht erreicht werden kann. Der Optimalzustand darf deshalb durch die Bearbeitung eines Hufes nicht erzwungen werden, lediglich das individuelle Optimum sollte in einem solchen Fall angestrebt wer-den.
Befundung
Über die anatomische Funktion hinaus spielt die Fessel für die Befundung eines Hufes eine wichtige Rolle. Von dorsal betrachtet lassen sich Rückschlüsse auf die mediolaterale Belastungssituation schließen, von lateral oder medial betrachtet auf die longitudinale Belastungssituation durch eine Bewertung der Huf-Fessel-Achse. Die Fessel könnte bei-spielsweise auf der einen Seite steil und auf der anderen Seite flach verlaufen. Die Huf-Fessel-Achse könnte nach hinten oder vorne gebrochen sein. Mehr dazu in „Befundung“ ab Seite 103.
Bearbeitung
Die Fessel wird selbstverständlich nicht bearbeitet, kann aber positiv durch die Bearbei-tung beeinflusst werden. Wie das geht, wird im Kapitel „Bearbeitung“ ab Seite 215beschrieben.
35
Elemente
Hufknorpel [b]
Beschreibung
Die beiden Hufknorpel sind flächige, elastische Elemente, die jeweils am Ende der bei-den Ausläufer des Hufbeines positioniert sind. Sie befinden sich somit zwischen Trach-tenwand und Eckstrebe und hinter den Ballen (siehe „Knochen & Hufknorpel“ ab Seite 22). Beide Hufknorpel ragen nach proximal etwas über den Kronrand hinaus und sind somit von außen als kleine Rundungen am Übergang des Kronrandes zur Fessel erkenn-bar.
Die Hufknorpel sind wesentlich für die Elastizität eines Hufes verantwortlich und ermög-lichen zusammen mit weiteren Elementen das Ausgleichen von seitlichen Bodenuneben-heiten. Mehr dazu in „Funktionsweise“ ab Seite 54.
Optimalzustand
Optimal ist es, wenn die natürliche Elastizität der Hufknorpel durch das Barhufgehen und eine belastungsgerechte Bearbeitung erhalten bleibt und sie somit voll funktionsfähig sind – was bei einem einigermaßen ausbalancierten Huf der Fall sein sollte.
Wenn sich die inneren Strukturen eines Hufes bereits einer ausgeprägten Deformierung angepasst haben, kann es sein, dass dieser Optimalzustand nicht erreicht werden kann und die Hufknorpel verknöchern (siehe „Hufknorpelverknöcherung“ ab Seite 357). Der Optimalzustand darf deshalb durch die Bearbeitung eines Hufes nicht erzwungen wer-den, lediglich das individuelle Optimum sollte in einem solchen Fall angestrebt werden.
Befundung
Sind bei der Befundung die oben bereits erwähnten Rundungen hart, extrem ausgeprägt oder gar nicht mehr vorhanden, lassen sich Rückschlüsse auf die Belastungssituation ziehen. Welche Bedeutung diese Symptome haben, wird im Kapitel „Befundung“ ab Seite 103beschrieben.
Bearbeitung
Die Hufknorpel werden selbstverständlich nicht bearbeitet, können aber positiv durch die Bearbeitung beeinflusst werden. Wie das geht, wird im Kapitel „Bearbeitung“ ab Seite 215beschrieben.
36
Hufe
Kronrand [c]
Beschreibung
Der Kronrand liegt am oberen Ende der Hornkapsel. Wie die beiden folgenden Illustratio-nen zeigen, gehören zum Kronrand sowohl die Saumlederhaut (Dermis limbi, 9.11) als auch die Kronlederhaut (Dermis Coronae, 9.12).
Palmare/plantare Ansicht der Lederhäute.
Laterale/mediale Ansicht der Lederhäute.
37
Elemente
Die schmale Saumlederhaut befindet sich proximal der Hufwand, am Übergang zur Haut, palmar/plantar geht sie in die Ballenlederhaut über (siehe vorherige Illustrationen 9.10). Die Saumlederhaut produziert das weiche und elastische Saumhorn, das die Kronleder-haut und deren Produktion des Wandhorns schützt. Die im Vergleich zur Saumlederhaut etwas breitere Kronlederhaut befindet sich zwischen der Saumlederhaut proximal und der Lamellenlederhaut (siehe vorherige Illustrationen 9.13) distal. Die Kronlederhaut läuft palmar/plantar um die Hufknorpel herum und geht dort, am Ende der Eckstreben, in die Sohlenlederhaut über (siehe vorherige Illustrationen 9.9). Die Kronlederhaut pro-duziert das sehr stabile und harte Wandhorn, das aus Röhrchen besteht und pro Monat um etwa 1 cm aus der Lederhaut herauswächst, abhängig von der Hornproduktion des jeweiligen Huftyps. Mehr dazu im Abschnitt „Hufwand [d]“ ab Seite 38.
Optimalzustand
Ein optimaler Kronrand verläuft harmonisch und gleichmäßig von der einen bis zur an-deren Trachtenendkante, ohne durch bestimmte Hufwandabschnitte nach proximal an-gestaut zu werden. Wenn sich die inneren Strukturen eines Hufes bereits einer aus-geprägten Deformierung angepasst haben, kann es sein, dass dieser Optimalzustand nicht erreicht werden kann. Der Optimalzustand darf deshalb durch die Bearbeitung eines Hufes nicht erzwungen werden, lediglich das individuelle Optimum sollte in einem solchen Fall angestrebt werden.
Befundung
Der Verlauf des Kronrandes liefert für die Befundung und somit über die Belastungssi-tuation von Hufen wesentliche Informationen. Der Kronrand kann bspw. angestaut sein, von der einen zur anderen Seite abfallen, er kann mit Falten in der Hufwand korrespon-dieren oder divergieren. Welche Bedeutung diese Symptome haben, wird in „Befundung“ ab Seite 103beschrieben.
Bearbeitung
Der Kronrand wird selbstverständlich nicht bearbeitet, kann aber positiv durch die Be-arbeitung beeinflusst werden. Wie das geht, wird im Kapitel „Bearbeitung“ ab Seite 215beschrieben.
38
Hufe
Hufwand [d]
Beschreibung
Die Hufwand, die von der Kronladerhaut produziert wird (siehe „Kronrand [c]“ ab Seite 36), ist das präsenteste und zweifelsohne das wichtigste Element der Hornkapsel. Sie schützt nicht nur das Hufinnere, sondern trägt außerdem durch ihre rund-ovale Form und durch ihre Stärke entscheidend zur Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Horn-kapsel bei. Die Hufwand sorgt darüber hinaus mit ihrer innigen Verbindung mit dem Hufbeinträger für eine Dämpfung der einwirkenden Kräfte.
Die Hufwand lässt sich in die folgenden Abschnitte unterteilen:
Zehenwand lateral, zentral und medial [d1]
Seitenwand lateral und medial [d2]
Trachtenwand lateral und medial [d3]
Eckstrebe lateral und medial [d4]
Tragrand [d5]
Zehenwand [d1] und die Seitenwände [d2]
Die Zehenwand hat im Vergleich zu den Seitenwänden eine besondere Bedeutung, da sie vor allem beim Abfußen mehr beansprucht wird. Aufgrund ihrer Stärke und ihrer runden Form wurde die Zehenwand optimal von der Natur für diese Belastung konzipiert. Die eher ovalen und schmalen Seitenwände können mit dieser Stabilität nicht mithalten. Analysen von Plastinaten, Präparaten und eines 3-D-Modells zeigten, dass die dickere Zehenwand auf einen breiteren Verlauf der Kronlederhaut proximal der Zehe zurückzu-führen ist.
39
Elemente
Die Zehenwand nimmt außerdem im Vergleich zu den anderen Hufwandabschnitten eine große Fläche ein, weshalb ihr Verbund mit dem Hufbeinträger wesentlich großflächiger ist als dessen Verbund mit den Seiten- und den Trachtenwänden (siehe „Hufbeinträger [e]“ ab Seite 42). Die schonende und belastungsgerechte Bearbeitung der Zehe ist also extrem wichtig und wesentlich für die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit der Hornkapsel.
Trachtenwände [d3]
Die Trachten sind die beiden hinteren Abschnitte zwischen den Seitenwänden und den Trachtenendkanten. Die Trachten sind für die Stabilität im hintern Bereich des Hufes ver-antwortlich, wobei sie von den Eckstreben unterstützt werden. Den Trachten kommt vor allem bei der Optimierung der Huf-Fessel-Achse eine besondere Bedeutung zu. Durch ein leichtes Kürzen kann beispielsweise eine nach vorne gebrochene Huf-Fessel-Achse verbessert werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass die tiefe Beugesehne nicht überlastet wird. Belässt man hingegen die vorhandene Trachtenhöhe, kann eine nach hinten gebrochenen Huf-Fessel-Achse etwas begradigt werden, wobei darauf ge-achtet werden muss, dass die Trachten dadurch nicht überlastet werden und somit un-terschieben oder einrollen. Mehr dazu in „Longitudinale Lastverteilung“ ab Seite 68.
Eckstreben [d4]
Die Eckstreben sind ebenfalls Bestandteile der Hufwand, die von der Trachtenendkante entlang der seitlichen Strahlfurchen in Richtung Strahlspitze verlaufen und in die Sohle übergehen. Wie der Name schon sagt, verstreben die Eckstreben die Ecken der Huf-wand, also die Trachtenwände. Sie tragen somit wesentlich dazu bei, dass die gesamte Hufwand ihre äußerst stabile rund-ovale Form erhält und nicht im Trachtenbereich über-lastet wird, was zu unphysiologischen Deformierungen im hinteren Bereich eines Hufes führen würde.
Tragrand [d5]
Das distale Ende der Hufwand wird dann als Tragrand bezeichnet, wenn die Hufwand beim Auftreten auf einen ebenen Untergrund diesen anstatt der Sohle berührt. Eine Huf-wand mit Tragrand ist beim Auftreten also näher am Boden als die Sohle am Übergang zum Hufbeinrandhorn, das im Abschnitt „Hufbeinträger [e]“ ab Seite 42beschrieben ist.
Der Höhenunterschied zwischen dem distalen Ende des Tragrandes und dem Übergang der Sohle zum Hufbeinrandhorn (siehe „Hufbeinträger [e]“ ab Seite 42) wird als Trag-randhöhe (h) bezeichnet, wie die folgende Illustration zeigt.
40
Hufe
Die Tragrandhöhe (h) reicht vom distalen Ende der Hufwand bis zum Übergang der Sohle zum Hufbeinrandhorn.
Optimalzustand
Die optimale Form der Hufwand hängt zwar wesentlich von der jeweiligen Hufsituation, den Haltungsbedingungen und dem Zustand der anderen Hufelemente ab, dennoch lässt sich durchaus ein Zielbild formulieren. Im optimalen Fall verlaufen die Hornwände har-monisch und leicht elliptisch (konvex)





























