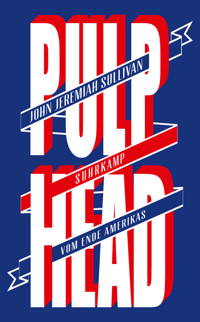19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Gegen Ende seines Lebens wird der altgediente Sportreporter Mike Sullivan von seinem Sohn gefragt, was ihm aus drei Jahrzehnten auf nordamerikanischen Pressetribünen am deutlichsten in Erinnerung geblieben sei. Die Antwort überrascht: »Ich habe 73 Secretariat beim Derby rennen sehen. Das war reine … Schönheit, verstehst du?«
John Jeremiah Sullivan versteht gar nichts. Also verbringt er die nächsten zwei Jahre damit, der väterlichen Begeisterung nachzugehen – für Secretariat, dieses mythische, geniale Rennpferd, und für Pferde überhaupt. Er reist kreuz und quer durchs Land, kriecht durch prähistorische Höhlen, vergräbt sich in der Kulturgeschichte des Equus caballus, verbringt Wochen auf runtergerockten Pferderennbahnen und besucht Gestüte, wo die Jungtiere auf die Saison vorbereitet und für Millionen Dollar versteigert werden. Und bei alledem versucht er, dem inzwischen verstorbenen Vater nachträglich doch noch nahezukommen.
Memoir, Reportage, historische Erkundung: J. J. Sullivan hat ein schillerndes, wunderbar eigensinnig bebildertes Buch geschrieben, über Herkunft, über das Verhältnis zu seinem Vater und über Pferde – in unserer Geschichte, Kultur und kollektiven Fantasie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
John Jeremiah Sullivan
Vollblutpferde
Aus dem Englischen von Hannes Meyer
Suhrkamp Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Blood Horses bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
Erste Auflage 2022Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© 2004, John Jeremiah SullivanAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werksfür Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: nach einem Konzept von Willy Fleckhaus
Umschlagfoto: Von Pharaoh Hound - Horseracing Churchill Downs.jpg, eigenes Werk, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1685436
eISBN 978-3-518-77379-6
www.suhrkamp.de
Motto
Er hatte aufrichtige Ehrfurcht vor den Tieren um uns, und er sah sie als grundsätzlich ebenbürtig an, nah verwandt – aber nicht etwa durch die Evolution, die Religion des kleinen Mannes, sondern durch das geteilte Schicksal.
Joachim Seyppel, Tierthema und Totemismus bei Franz Kafka, 1954
Vollblutpferde
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Der Bursche
Das Kind Europas
Ein Reiter will ich werden
Schönheit
Achtzehn Pferde in einer Reihe
Herausforderungen
»Achtzehn Whiskey pur«
Von unbekannter Geburt
Ashland
Morgenarbeit
Unter den Jährlingen
Blut
Unter den Jährlingen
II
Dunhallow, County Cork
Auf die Felder des Jubels
Eine Wolkensäule in der Nacht
Eine gewisse mystische Qualität
Sinnbild
Der erste Freitag im Mai
Dunkelheit
Auf der Zielgeraden
Krieg
Noch einmal stürmt, noch einmal
Frieden
Hört es euch an
Wieder auf der Bahn
Der Prinz
Wettfieber
Der Reiter ist verloren
Größer
Das letzte Rennen
Reiter, schau kalt
Rest
Ein Jahr später
Anmerkungen
Quellen
Weitere zitierte Ausgaben
Abbildungsnachweise
Danksagung
Informationen zum Buch
Der Bursche
Es war der Mai vor drei Jahren, und ich stand an einem Krankenhausbett in Columbus, Ohio, wo mein Vater sich von einer Operation erholte, die ein fünffacher Bypass hätte sein sollen, dann aber ein sechsfacher wurde, als der Chirurg das Herz sah. Mein Vater war blass. Er war so dünn wie seit Jahren nicht. Auf dem Schoß hatte er schief einen Teddybären liegen, den die Schwestern ihm geliehen hatten; wenn mein Vater aufstand oder sich hinsetzte, sollte er ihn an sich drücken, damit die Naht in der Brust nicht riss. Als ich hereinkam, gratulierte ich ihm zu dem Bären, und er ließ die Kinnlade runterklappen, schielte und verdrehte die Augen. Das Gesicht machte er in allen möglichen Situationen, aber es bedeutete immer dasselbe: Ist das denn zu fassen?
Das Riverside Methodist Hospital (der Fluss war der Olentangy): Meine Familie hat hier Geschichte, oder wenigstens mein Vater und ich. Hierhin hatten sie mich mit zwölf nach dem Little-League-Football-Spiel gefahren, in dem ich zum ersten Mal in der ganzen Saison den Ball bekam, bevor ich beide Unterschenkelknochen des rechten Beins in so einer Weise gebrochen bekam, dass ich mich nach dem Pfiff aufsetzte, an mir runterschaute und die Fußspitze exakt 180 Grad in die falsche Richtung zeigen sah, woraufhin ich mich dort an der Fünfzig-Yard-Linie unter leichtem Schock zurück ins Gras sinken ließ und die Wolken bestaunte. Nur das Gesicht des Schiedsrichters versperrte mir die Sicht. Er sagte immer wieder: »Pass auf, was du sagst, Junge«, was ich lustig fand, denn soweit ich wusste, hatte ich kein Wort gesagt.
Ich erinnere mich oder habe gefolgert, dass mein Vater langsam von der Seitenlinie herankam und mir mit seiner außerordentlichen Ruhe in Notfällen die Hand auf den Arm legte und mir gut zuredete, obwohl er bestimmt selbst ein bisschen schockiert vom Zustand meines Fußes war – und vielleicht auch ein bisschen reumütig, weil er, der Sportreporter, der selbst bis in seine Zwanziger ein großer Sportler und später mehrfacher Little-League-Coach gewesen war, hätte wissen müssen, dass ich gar nicht erst auf dem Feld hätte stehen sollen. Die einzige mögliche Position für mich war Running Back, denn wenn der Coach mich irgendwo auf der Offensive Line eingesetzt hatte, war ich im Zweifel vor den anderen Spielern zurückgewichen. Mein einziger Vorzug war meine Schnelligkeit; ich hatte immer noch einen präpubertären Läuferkörper und war der Schnellste im Team. Dem Coach war aufgefallen, dass ich Sprints meistens gewann, also witterte er eine Gelegenheit. Dabei übersahen wir aber beide, dass ein Running Back nicht bloß den Guards davonrennen muss – was überhaupt nur bei perfekt ausgeführten Spielzügen infrage kommt –, sondern dass er sich auch an ihnen vorbeikämpfen, sie beiseitestoßen muss. Ich hatte keine Chance.
Fairerweise muss ich sagen, dass der Coach andere Sorgen hatte. Unserem namenlosen Team fehlte es sowohl an Talent als auch an »Drive«, wie er es nannte. Auf der Heimfahrt nach unseren ersten beiden Spielen spürte ich, dass mein Vater kein Wort über die Ereignisse auf dem Spielfeld fallen ließ, weil wir jämmerlich waren – und zwar nicht jämmerlich wie das Team aus Die Bären sind los, wir rissen uns nämlich nicht irgendwann auf einmal zusammen, »wollten es« oder gaben alles. Beim Training reagierten viele der anderen Spieler mit solcher Gleichgültigkeit auf den Rat vom Coach, dass es einem vorkam, als wären sie nur da, um ihre Sozialstunden abzuleisten.
Kyle, der Sohn vom Coach, war unser erster Quarterback. Wenn es beim Training nicht so lief, wie Kyle wollte, wenn er nicht mehr auf dem Feld war, weil der zweite Quarterback eingewechselt wurde, der übrigens sehr stark war, oder wenn Kyle zwar auf dem Feld war, aber keine guten Würfe hinbekam, dann fing Kyle an zu weinen. Und keine Kindertränen, bei denen ich mich gefragt hätte, wie es wohl beim Coach zu Hause zuging, bei denen ich vielleicht ein bisschen Mitgefühl mit Kyle gehabt hätte, sondern er weinte bittere Tränen, viel zu bittere für einen Zwölfjährigen. Und dann machte Kyle etwas Bemerkenswertes: Er schmiss seinen Helm weg und rannte die vierzig Meter zum Auto vom Coach, einem beigefarbenen Cadillac El Dorado, der immer auf dem Fußballplatz nebenan stand. Kyle stieg ein, startete den Motor, ließ alle vier Fenster runter und spielte – immer noch weinend, nahm ich an, vielleicht dort im Wagen seines Vaters sogar schluchzend – Aerosmith-Kassetten auf Lautstärken, für die die Anlage des El Dorado bei weitem nicht ausgelegt war. Die Lautsprecher knarzten. Fünf oder zehn Minuten lang ignorierte der Coach diese Darbietung demonstrativ und brüllte uns eben etwas lauter an, als wollte er zeigen, dass so etwas im Football nun mal vorkam. Aber bald nahm sich der verzweifelte Kyle die Hupe vor, die er erst ein paarmal drückte, bevor er sie ganz festhielt. Dann streckte er die Faust mit erhobenem Mittelfinger aus dem Fahrerfenster. Nun ließ der Coach uns zurück und ging ganz langsam zum Wagen. Während wir anderen auf dem Feld standen, sprach er mit Kyle. Bald verstummte der Motor. Als die beiden zu uns zurückkehrten, ging das Training weiter, und Kyle war wieder Quarterback.
Nichts davon erschien mir damals außergewöhnlich. Wir waren neu in Columbus, gerade aus Louisville hergezogen (unser Haus war am anderen Flussufer gewesen, in den Hügeln über New Albany, Indiana), und ich brauchte Freunde. Also sah ich es mir alles mit dumpfer, animalischer Duldsamkeit an, obwohl ich spürte, dass es nicht gut ausgehen konnte. Und dann hatte mir an jenem letzten Samstag Kyle plötzlich den Ball gegeben, als etwas sehr Kurzes, Heftiges passierte und ich einen großen, muskulösen Halbwüchsigen von mir aufspringen und wegsprinten sah, als wäre er neben einer Klapperschlange aufgewacht. Ich habe noch seine Augen vor mir, als sie mein Bein sahen. Er war schwarz und hatte einen Afro, der sich aufbauschte, als er sich den Helm runterriss. Er wirkte ernsthaft verwirrt darüber, wie leicht ich zu zertrümmern war. Während die Sanitäter mich auf die Trage luden, kam er herüber und entschuldigte sich.
Im Riverside Hospital schienten sie mein Bein falsch. Das Röntgenbild zwei Wochen später zeigte, dass ich den Rest meines Lebens hinken würde, wenn man es nicht wieder brach und neu schiente. Dazu schickte man mich zu einem Arzt namens Moyer, einem Spezialisten, den andere Krankenhäuser einfliegen ließen, um einem Farmer die Hand wieder anzunähen und so weiter. Er strahlte Wärme und Ruhe aus. Aber aus Gründen, die sich mir nie ganz erschlossen, bekam ich keine Vollnarkose für die Prozedur. Man spritzte mir ein Beruhigungsmittel, wohl ein ziemlich schwaches, denn ich war bei vollem Bewusstsein, als Dr. Moyer meine Wade mit der einen und die Ferse mit der anderen Hand packte und sagte: »John, die Knochen sind schon wieder etwas zusammengewachsen, deshalb tut es jetzt gleich ein bisschen weh.« Mein Vater war da gerade zum Rauchen auf dem Parkplatz, und er erzählte mir hinterher, dass man meine Schreie bis draußen hören konnte. Das war mein erster Monat in Ohio.
Zwei Jahre nachdem die Verletzung verheilt war, saß ich gerade in meinem Zimmer oben in unserem Haus im Nordwesten von Columbus, als ich aus dem Erdgeschossflur ein einzelnes, ersterbendes »Oh!« hörte. Mein Vater und ich waren allein zu Hause, und erschrocken rannte ich die Treppe hinunter. Als ich um die Ecke kam, wäre ich fast über seinen Kopf gestolpert. Er lag bewusstlos auf dem Rücken, lang ausgestreckt, zur Hälfte im Flur, mit den Beinen im Bad. Alles war voller Blut, sein ganzer Kopf klebte davon, aber ich fand die Wunde nicht. Ich bekam ihn auf die Beine, brachte ihn zum Sofa und rief den Rettungsdienst. Die Sanitäter untersuchten ihn ein bisschen und sagten, sein Blutdruck »spiele verrückt«. Also hoben sie ihn auf eine Trage und fuhren ihn ins Riverside Hospital.
Wie sich herausstellte, war er einfach beim Pinkeln bewusstlos geworden, was bei Männern Mitte vierzig schon mal vorkomme, wie sie uns versicherten (er war damals fünfundvierzig). Er hatte sich beim Sturz die Nase am Waschbecken angeschlagen, die alles vollgeblutet hatte. Der Vorfall jagte ihm so einen Schrecken ein, dass er wieder einmal versuchte, mit dem Rauchen aufzuhören – oder sich den Versuch wenigstens vornahm, einer seiner vielen zum Scheitern verurteilten Vorsätze.
Mein Vater war unrettbar zigarettenabhängig. Ich kann kaum an ihn denken, mich kaum an ihn erinnern, ohne dass mir geisterhafte Rauchschwaden in die Nase steigen, und wenn ich sein Bild nicht klar vor Augen bekomme, kann ich es schärfen, indem ich mir die gelbe Haut an Mittel- und Zeigefinger seiner linken Hand vorstelle, oder wie seine rotbraunen Schnurrbarthaare den Filter der Zigarette streiften, wenn er sie an den Mund führte, oder wie er die Lippen spitzte und das Kinn einzog, wenn er den Rauch durch die Nase ausblies, was er in Gesellschaft immer tat. Einmal Mitte der Neunziger zündete er sich auf der Toilette eines Auslandsfluges eine an (ein Verbrechen, meine ich). Eine Stewardess meldete es noch während des Fluges den Behörden, und nach der Landung wäre er wohl festgenommen worden, hätte der Coach des Teams, mit dem er reiste, ihm nicht geholfen, sich aus der Situation rauszuwinden. Es gab noch weitere kleine Erniedrigungen: wenn man uns irgendwo rauswarf, wenn er im falschen Moment plötzlich verschwand. Außerdem war er zerstreut, was mit dem allgegenwärtigen Feuer eine gefährliche Mischung ergab. Wieder und wieder kam ich von der Schule nach Hause und fand ein neues Brandloch in seinem Lieblingssessel. Und einmal fing in der Garage ein Müllsack Feuer, in den er einen Aschenbecher geleert hatte, sodass meine Mutter ihn wieder einmal mit halb ernster, halb hoffnungsloser Miene daran erinnern musste, dass er uns alle in Gefahr brachte.
Etwa einmal im Jahr beschloss er aufzuhören, aber er schaffte es selten länger als einen Tag, ohne ein bisschen zu »paffen«, und von da aus war der vollständige Rückfall nie weiter als eine düstere Laune entfernt. Er wollte sein Scheitern verheimlichen, nahm sogar unsere Glückwünsche für zwei Tage oder eine ganze Woche ohne Qualm an, obwohl er den Versuch schon nach Stunden aufgegeben hatte, wie ich mit dem weniger treuherzigen Blick des Erwachsenen feststellen muss: die langen Spaziergänge »zum Entspannen«, von denen er mit Kaugummi im Mund wiederkam, oder das kleine Päckchen, das er sich in die Tasche stopfte, wenn er aus dem Laden kam. Früher oder später wurde ihm diese Posse aber immer zu anstrengend, und er holte einfach eine Packung heraus, während wir alle im Wohnzimmer saßen, und dann gab es einen Moment, der mit der Zeit vertrauter wurde, in dem wir ihn mit kaum verhohlener Enttäuschung ansahen, während er mit ebenso wenig verhohlener Scham den Fernseher anstarrte, und wenn die Spannung fast so weit war, dass jemand gesprochen hätte, zündete er sich eine Zigarette an, und das war's. Dann wandten wir uns wieder unseren Büchern zu.
Aber der Krankenhausaufenthalt – oder vor allem sein Schwur, als er wieder nach Hause kam, dass er jetzt endlich genug habe – wirkte anders. Bis zu diesem Nachmittag hatte sein Körper seltsam unverwundbar gewirkt. Mein Vater war ein Mann, dem niemals kalt war, und dessen Lunge ein Radiologe nach dreißig Jahren Kettenrauchen als »pink« bezeichnete, was meiner Mutter Tränen der Empörung in die Augen getrieben hatte. Aber jetzt hatte die gesamte Nachbarschaft gesehen, wie er in den Krankenwagen geladen wurde, und das strenge Schweigen über das Thema Gesundheit – das vor allen Konsequenzen schützen würde, wenn es nur aufrechterhalten wurde – war gebrochen.
Vier oder fünf Tage hielt er durch. Glaube ich zumindest. Meine Mutter erwischte ihn in der Garage, das »Pflaster« auf dem Arm und eine Kool Super-Long im Mund (seine Lieblingszigarette, seit er vierzehn war – er behauptete gerne, er sei der letzte Weiße in Amerika, der noch Kools rauchte). Diese doppelte Nikotindosis konnte schnell zum Herzinfarkt führen, hatte man uns gewarnt, also warf er die Pflaster weg und rauchte wieder knapp über zwei Packungen am Tag.
Über einen Mann wie meinen Vater sagt man oft, »er hat sich nicht um sich gekümmert«, was auf viele Sportreporter zutrifft. Mir fallen nicht mehr als ein, zwei im konventionellen Sinne gesunde Dinge ein, die er in seinem ganzen Leben getan hat, wenn man seinen starken Hang zu Mittagsschläfchen und zum Lachen nicht mitzählt (seine hohe, sirenenartige Lache ging Hiii Hi hi hi, Hiii Hi hi hi, machte manchen Kindern Angst und war so laut, dass sich im Kino das gesamte Publikum nach ihm umdrehte, was dem Rest der Familie tödlich peinlich war). Neben dem Kettenrauchen trank er auch gern und viel, bestellte Bier meist pitcherweise und hatte immer eine regelmäßig ausgewechselte Flasche Whiskey auf dem Kühlschrank stehen, auch wenn sich bei ihm die Wirkung des Alkohols – wenn überhaupt – nur auf sehr gutmütige Weise zeigte. So wie viele Menschen mit irischen Genen musste er erst beschließen, dass er betrunken sein wollte, bevor er sich betrunken fühlte, und das geschah selten. Dennoch trug der Alkohol sicher dazu bei, dass er die Fitness seiner Jugend verlor. Dazu aß er noch schlecht und reichlich, manchmal überreichlich, doch behielt er sein Leben lang die schlanken Beine und kraftvollen Waden eines Läufers, was unerklärlich erscheint, weil er keinerlei Sport trieb. Er war einer der Menschen, die einfach nicht zum Dicksein gemacht waren, und er war überrascht, als sein Körper schließlich schwächelte: Er hatte ihm doch immer treue Dienste geleistet.
Jeder, der einen Elternteil mit fatalistischen Gewohnheiten hat, weiß, dass die Kinder solcher Eltern in der Schule besondere Schrecken erleben, wenn die Lehrer ihre Horrorgeschichten abspulen, wozu eine Vernachlässigung des Körpers führen kann; diese Angst grenzt an Kindesmisshandlung. Ich weiß noch, wie ich mich mit fünf oder sechs Jahren sonntagmorgens ins Elternzimmer schlich, wo er lang ausschlief, und ich einfach vor dem Bett stand und ewig seine Gestalt unter der Decke anstarrte, ob er auch wirklich noch atmete; ein paarmal, oder mehr als ein paarmal, hatte ich geträumt, er sei gestorben, und kam zu ihm ins Zimmer gerannt, weil ich es wirklich glaubte. Eines Nachts lag ich in meinem Bett und konzentrierte mich unter dem Einfluss eines vergessenen Werks populärer Pseudowissenschaft so sehr ich konnte, weil ich glaubte, dann würde sich mir sein Todesalter offenbaren: Die Ziffern Sechs und Drei schwebten mir vor Augen. Das erschien mir weit genug in der Zukunft und bot mir seltsamerweise bis zu seinem Tod acht Jahre vor dieser magischen Zahl einen gewissen Trost.
Wir flehten ihn natürlich an, mehr auf sich zu achten – wenn auch stets mit einer gewissen Beklommenheit, denn das Thema nervte ihn, und wenn man darauf beharrte, wurde er manchmal wütend. Meistens kam es überhaupt nicht dazu, so geschickt konnte er mit einem Scherz ablenken: Wenn ein Mann mit sichtlich erhöhtem Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Krebsrisiko den Rest seiner fünfzehn Zentimeter langen Mentholzigarette ausdrückt, bevor er sich über ein todbringendes Abendessen aus Frittiertem hermacht (»eine zünftige Mahlzeit«, wie er es genannt hätte), Messer und Gabel zusammenklirren lässt, einem zuzwinkert und mit warmem Akzent sagt: »Herzenssache!«, dann ist man entwaffnet. Ich habe einen Brief von ihm, geschrieben weniger als einen Monat vor seinem Tod, eine Antwort auf meine Frage, ob er sich nun mehr bewege, wie es ihm der Arzt empfohlen hatte. In typischem Attributivstil (seiner großen Schwäche) schrieb er: »Vor drei Tagen erst bewegte ich in gediegener Manier diese meine geschmeidigen Glieder um den Rundkurs des Antrum Lake von vollen zwei Kilometern – hei, was sprangen da die widerlich gestählten ›Fitnessjünger‹ in die Büsche und kauerten furchtsam nieder, als ich den Toyota um die Kurven jagte!«
Und trotzdem ermutigten wir ihn weiter, sich zu mäßigen, mit uns spazieren zu gehen, den Salat zu bestellen. Ich bat ihn, mein Bruder und meine Schwestern baten ihn, meine Mutter flehte ihn geradezu an, bis sie sich irgendwann scheiden ließen. Sein eigener Vater war jung an einem Herzinfarkt gestorben; seine Mutter an Lungenkrebs, als ich ein Kind war. Aber es half nichts. Er hatte sein Schicksal. Er hatte seine Gewohnheiten, so selbstmörderisch sie auch waren, und uns stand die Forderung nicht zu, dass er sie änderte.
Es erleichterte die Sache auch nicht, dass er beruflich jedes Jahr mehrere Monate auf Achse war, sodass keine Routine außer der zwanghaftesten aufrechtzuerhalten war, oder dass die Arbeit sich um Deadlines und Nervenspannung drehte, dass er zwischen dem vierzehnten Inning, der zweiten Verlängerung oder was auch immer und dem vorgegebenen Abgabetermin seinen Artikel runtertippen musste. Zu meinen lebhaftesten Kindheitserinnerungen zählen die Abende, wenn ich mit meinem Vater nach Heimspielen der Louisville Redbirds auf der Pressetribüne im Cardinal Stadium sitzen durfte (die Redbirds waren das Nachwuchsteam der St. Louis Cardinals, aber eine kurze Zeit lang begeisterten sich die örtlichen Fans genauso für die Redbirds wie für die erste Mannschaft und brachen 1985 den Zuschauerrekord der Liga). Während des Spiels saß ich neben ihm und beobachtete fasziniert, wie er und die anderen Reporter ihre Notizbücher mit den nur wahren Kennern vertrauten Geheimzeichen füllten, einem Buchstaben, einer Zahl oder Form für selbst das geringfügigste Ereignis auf dem Spielfeld. Immer mal wieder flog durchs Fenster ein Ball herein, knapp an unseren Köpfen vorbei, und mein Vater stand auf und winkte mit seinem unvermeidlichen weißen Stofftaschentuch aus dem Fenster, woraufhin ein Raunen durch die Menge ging.
Meine regelmäßige Anwesenheit dort oben kann die anderen Reporter nicht gefreut haben, aber meinem Vater zuliebe sagten sie nichts. Alle paar Monate bekomme ich einen Brief von einem seiner alten Kollegen, der mir erzählt, wie langweilig der Job ohne ihn ist. Letztes Jahr fand ich im Louisville Magazine einen Artikel von John Hughes, der mit ihm beim Courier-Journal gearbeitet hatte. »In den Redaktionen von damals passierten Sachen, die in unserer journalistisch korrekten Zeit nicht mehr möglich wären«, erinnert sich Hughes. »Zum Beispiel der Neujahrsabend, als der damalige Sportreporter vom C-J, Mike Sullivan, sich aus der Papiertüte von meiner Bierrunde einen Hut machte und ihn die ganze Zeit aufbehielt, während er über den Tackle schrieb, der Woody Hayes' Trainerkarriere beendete.« Das war typisch. Einmal, als ich mit meinem Vater in der Zeitungsredaktion war – ich war wohl etwa fünf –, sah er, wie spannend ich das Rohrpostsystem fand, über das die verschiedenen Ressorts damals miteinander kommunizierten, also stachelte er mich an, meine Schuhe und später auch meine Socken in die Transportbüchsen zu legen und an mehrere seiner Freunde zu schicken. Als dann die Durchsage kam: »Wer auch immer da gerade die ganze Scheiße durch die Rohre jagt, hört jetzt bitte mal damit auf!«, krümmten wir uns zusammen, um uns nicht durch lautes Gelächter zu verraten. Auf der Pressetribüne ließ er mich Witze erzählen, die ich gelernt hatte. In einem davon kam das Wort »adipös« vor, und als ich bei der Stelle ankam, hielt ich inne und fragte höflich: »Wisst ihr alle, was adipös heißt?« Der Raum brach in Gejohle aus. Für ihn war es, als hätte sein Sohn den nationalen Buchstabierwettbewerb gewonnen.
Es schmerzte meinen Vater sicher, dass die Spiele selbst mir nichts gaben. Wie viele Männer hätten sich die Finger nach der Gelegenheit geleckt, ihre wackeren amerikanischen Söhne dem Profisport in solchem Maße auszusetzen, wie ich es als alltäglich wahrnahm? Perlen vor die Säue. Ich weiß noch, wie ich auf der Pressetribüne bei den Redbirds Pee Wee Reese kennenlernte. Sein Sohn Mark arbeitete mit meinem Vater beim Courier-Journal, und Pee Wee kam bei ihm reinschauen. Mitte der Fünfziger hatte mein Vater am Ebbets Field neben seinem Vater gesessen und ihn als Shortstop für die Brooklyn Dodgers spielen sehen, und er stellte ihn mir vor wie einen Monarchen. Ich war hauptsächlich verlegen und drehte mich weg, als ich ihm die Hand gegeben hatte. Diese Szene wiederholte sich mit diversen Sportlegenden bis in meine Jugend.
Auch als Sportler war ich eine Enttäuschung. Zwar zeigte sich ein gewisses Können, das mir mein Vater vererbt hatte, aber meine Konzentration kam und ging. Die Feinheiten waren mir zu hoch. Einmal pfiff der Schiedsrichter eins meiner Basketball-Spiele in der sechsten Klasse ab, um mir die Drei-Sekunden-Regel zu erklären. Er hatte nämlich keine Lust mehr, mich deswegen dauernd zu maßregeln. Er legte mir die Hand auf die Hüften, schob mich in den Freiwurfraum und wieder heraus und erklärte mir, wo dieser anfing und wie lange ich mich dort aufhalten durfte, während die Zuschauer und die anderen Spieler stumm zuschauten. Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete, und wurde bald ausgewechselt.
Baseball lag mir mehr, der Lieblingssport meines Vaters. Er war außer sich vor Freude, wenn ich in der Little League ausgewählt wurde, als vierter Batter meine Freunde nach Hause zu schlagen, auch wenn ich das wie die meisten Dinge mit quasi autistischer Hyperkonzentration anging: Da ist der Ball. Jetzt schlagen. Ich schlug zwar routinemäßig Homeruns, blieb aber trotzdem mit dem Ball im Handschuh an der Base stehen, wenn ich eigentlich einen Runner rausticken sollte, oder ich rannte nach einem gefangenen Foul Ball nicht zum »tag up« zurück zu meiner Startposition, sondern schlitterte siegessicher auf die nächste Base, wo mich dann einer der Infielder lässig raustickte. Fußball hasste ich mit Inbrunst. Aber schon nach ein paar Wochen hatte ich herausgefunden, dass man nur die Hand heben musste, wenn man erschöpft war oder einen Krampf hatte, und dann sofort ausgewechselt wurde. Also tat ich das immer, sobald der Coach mich auf den Platz geschickt hatte. Einmal brüllte er mich dann von der Seitenlinie an: »Meine Fresse, John, jetzt spiel doch!« Ich sah ihm in die Augen. Und behielt die Hand oben.
Meine Beteiligung an jeglichem organisierten Sport endete in einem Taekwondo-Verein in der Innenstadt von Louisville. Warum ich mir bei meinem speziellen Handicap ausgerechnet einen Sport ausgesucht habe, der dafür bekannt ist, absolute Konzentration zu erfordern, weiß wohl keiner. Ich wollte mich mit niemandem anlegen und fürchtete mich vor jeglichem Schmerz. Mein Trainer, Master Gary, war ein kratzbärtiger Vietnam-Veteran, der wütender war, als es jemand sein sollte, der mit Kindern arbeitet. Seine Taekwondo-Stunden waren beherrscht von einem stetig anwachsenden Regelwerk mit eingestreuten koreanischen Begriffen, das mich vor Verwirrung lähmte. Ich zucke heute noch zusammen, wenn ich an den Abend denke, als ich während der »Meditationszeit« beschloss, meine »Technik« zu üben. Die anderen Jungs und Mädchen knieten schweigend in perfekten Reihen, die Hände gefaltet, die Augen geschlossen. Master Gary kniete ihnen genauso gegenüber. Aus irgendeinem Grund stand ich irgendwann auf, ging in die Ecke und fing an auf den Sandsack einzuprügeln. Mein Vater, der etwas früher zum Abholen gekommen war, zischte mir schließlich zu, ich solle aufhören. Master Gary machte nicht mal die Augen auf. Zwei Wochen später lehnte ich an einer Wand, um unsichtbar zu werden, als seine Nummer zwei, eine knallharte Jugendliche mit kurzen, dunklen Haaren und leichtem Schnurrbart, sich vor mir aufbaute. Sie brüllte mich an und erschreckte mich so, dass ich sie bitten musste, es noch mal zu wiederholen. Also brüllte sie es noch lauter: »Im Dojo wird nicht angelehnt!«
Auch wenn ich all das hauptsächlich tat, um meinem Vater zu gefallen – eine andere Erklärung fällt mir nicht ein –, gab er mir doch nie das Gefühl, großen Wert darauf zu legen, wie gut ich war. Während des Spiels jubelte er laut und ärgerte mich mit meinen Spitznamen – so sehr ich ihn auch anbettelte, damit aufzuhören: Ich war Prodge (kurz für progeny, Nachkomme) und Beamish (aus Lewis Carrolls »Jabberwocky«: Ich winkte bald nur noch ab, wenn meine Mitspieler herüberkamen und fragten: »Wie hat der dich gerade genannt?«). Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals zu so einem klischeehaften wütenden Schweigen nach einer Niederlage gekommen wäre, sondern eher lag dann Erleichterung in der Luft, weil die Sache endlich durchgestanden war. Und auch wenn mir all der Profi-Baseball, dem ich mit perfekter Aussicht von hoch oben zuschaute, wie Modern Dance vorkam – faszinierend, aber undurchschaubar –, waren wir vor allem zusammen. Mir war nie langweilig, wenn ich bei meinem Vater war.
Aber so richtig ging für mich der Spaß erst nach dem Spiel los; wenn ich mit meinem Vater in der Umkleide gewesen war, wo er pflichtbewusst seine Fragen stellte, während ich hinter ihm stand und Panik vor all den entblößten Riesenphalli hatte, die auf Augenhöhe an mir vorbeiwippten; wenn die anderen Sportreporter wieder nach Hause oder ins Hotel gefahren waren (mein Vater war die ganze Saison für die Redbirds zuständig, also musste er manchmal zwei Artikel abgeben, bevor er Schluss machen konnte); wenn er sich wieder an seinen Platz gesetzt und den Notizblock aufgeklappt hatte, dessen lange, schmale, linierte Seiten nun voll mit seiner geschwungenen Kurzschrift waren. Dann hatte sich das Stadion allmählich geleert, und aus den Schatten kamen die Penner, die es irgendwie an den Sicherheitsmännern vorbeigeschafft hatten, arbeiteten sich im Zwielicht wie Lumpensammler zwischen den Sitzen vor und leerten die halbgetrunkenen Biere. Wenn ich dann von der Pressetribüne runterschaute, staunte ich, wie schnell sich über das eben noch tosende Stadion auf einmal tiefe Kathedralenstille gelegt hatte. Ich ging über den Metallsteg, der zwischen der Pressetribüne und dem Zuschauerbereich hing, und spielte alleine auf den Rängen, wobei es hin und wieder zu steifen, unangenehmen Gesprächen mit einem der Obdachlosen kam. Nach ein paar Monaten nahm ich meinen Mut zusammen und traute mich auf das leere Spielfeld, lief die Bases ab, warf einem Geisterbatter unsichtbare Bälle zu, rief nach meinem Vater hoch über mir hinter dem Fenster der Pressetribüne, damit er mir zuschaute. Dann winkte er. Als mir an einem dieser Abende nichts Besseres einfiel, lernte ich, wie man das Schloss zum Getränkestand der Pressetribüne mit einer geradegebogenen Büroklammer knackte. Von da an gab es nach Feierabend unbegrenzt Karamellpopcorn für mich und Freibier für meinen Vater, dessen Freude über mein Geschick mich unendlich stolz machte. Da saß er dann, ein offenes Bier neben seinem PortaBubble (einem frühen Laptop, der so viel wog wie ein vierjähriges Kind) und eine brennende Zigarette zwischen den Fingern, während er eigentümliche, geistreiche Geschichten über belanglose Spiele schrieb. Es gab dort auch einen leicht zurückgebliebenen Hausmeister, der mich eines Abends mit aufs Dach der Pressetribüne nahm und mir die Sternbilder zeigte. Während der Himmel dunkler wurde, kamen Armadas grüner Riesenkäfer durch die Fenster rein, die wegen des Rauchs gekippt waren. Dann rollte ich ein Programmheft auf und jagte die Viecher, raste herum und klatschte an die Wände, während mein Vater mit dem Rücken zu mir dasaß und tippte und rauchte und tippte und trank.
Ich kann die Gefühle von damals immer noch nacherleben: Ich war glücklich. Mein Vater und ich sprachen dabei kaum miteinander, oder ich stellte ihm manchmal eine Frage, und er hörte mich nicht, und wenn doch, antwortete er erst nach den zwanzig Sekunden Pause, die in unserer Familie ein Running Gag waren, fuhr plötzlich mit dem Kopf herum, wenn ich die Frage selbst schon vergessen hatte, und sagte: »Hmm, nein«, oder: »Klar, Junge.« Aber für mich steigerte diese Distanz die Intimität irgendwie. Es war kein Ausflug in den Zoo. Er ließ sich nicht zu mir herab und war nicht mein Babysitter. Sondern ich war in seinem Element, wo er mysteriöse Arbeit tat, und das – diese Nähe – war wichtiger, als gesehen oder gehört zu werden.
Als ich älter wurde, kam zwischen uns eine andere Art von Distanz auf, eine, die wir beide bemerkten und die uns beide störte. Ich war jahrelang wütend auf ihn, weil er die Ehe mit meiner Mutter in die Auflösung hatte driften lassen, weil man ihm dabei zusehen konnte, wie er sich langsam, aber sicher umbrachte. An dem Abend in seinem Zimmer im Riverside Hospital schwebte zwischen uns ein unausgesprochenes Gefühl von »Da haben wir's«, das vielleicht die etwas makabre – man könnte auch sagen, kühne – Frage erklärt, die ich ihm stellte, einem Mann von gerade mal fünfundfünfzig. Im Jahr zuvor hatte es schon die Aneurysma-Operation gegeben, dann die (erfolglose) Operation, den von ersterer verursachten Leistenbruch zu beheben. Fast ein ganzes Jahr lief er mit einer kanonenkugelgroßen und -förmigen Ausbeulung vor dem Bauch herum. »Meine Reihe von Gebresten«, wie er es in einem Brief ausdrückte, »führt mir nunmehr recht deutlich meine Sterblichkeit vor Augen.« Ansonsten war es eigentlich keine düstere Szene. Die letzte Operation war erfolgreich gewesen, und es ging ihm allem Anschein nach unverdient gut. Wegen des abklingenden Beruhigungsmittels und wohl auch wegen der vierundzwanzig Stunden ohne Zigaretten war er angespannt, aber bereit zu reden, wobei wir flüsterten, weil sein älterer Zimmergenosse schon schlief.
Ich bat ihn, mir zu erzählen, woran er sich aus all den Jahren als Sportreporter erinnerte, denn er hatte in seinem Leben viel gesehen, hatte über Michael Jordan bei den North Carolina Tar Heels geschrieben, über einen jugendlichen John McEnroe, über Bear Bryant und Muhammad Ali. Er hatte die Big Red Machine in Cincinnati verfolgt und war gerade für die Cleveland Indians zuständig, als sie in den Neunzigern ihre vierzigjährige Flaute überwanden und wieder siegten. Er hatte Preise gewonnen und über Skandale berichtet. Als ich vor ein paar Jahren beruflich mit Fay Vincent, dem ehemaligen Commissioner of Baseball, zu tun hatte, fragte er mich, wer denn mein Vater sei, und als ich es ihm sagte, erwiderte er: »Ach, ja. Ich weiß noch, dass er damals sehr fair mit der Rose-Sache umgegangen ist.« Ich musste mich später an einen befreundeten Baseball-Experten wenden, mit dem ich darauf kam, dass Vincent die Story über Pete Rose meinte, der 1989 als Manager der Cincinnati Reds auf seine eigenen Spiele gewettet hatte.
Zu Hause hörten wir kaum jemals von alledem. Ich hatte diese idyllischen Abende mit ihm im Stadion in Louisville, aber das war zweite Liga in einer nicht besonders wichtigen Stadt (weshalb ich überhaupt nur mitkommen durfte, wie ich rückblickend verstehe). Mein Vater sah es so, dass über die Arbeit reden arbeiten bedeutete, und das tat er schon mehr als genug. Sportreporter sind es gewohnt, dass im Restaurant oder bei Elternversammlungen Leute auf sie zukommen und sich über Sachen beschweren, die sie in ihrer Kolumne geschrieben oder in einer Radiosendung gesagt haben. Aber mein Vater reagierte so empfindlich auf jegliche Bewertung – eigentlich schon auf jede Erwähnung – seiner Texte, dass man ihm fast schon einen körperlichen Schmerz ansah, was wohl daran lag, dass er mehr oder weniger rückwärts zu dem Beruf gekommen war. Der typische Sportreporter glüht für das Thema und kann dazu vielleicht einen geraden Satz schreiben, aber mein Vater hatte Schriftsteller werden wollen (Lyriker sogar), und mit Sport kannte er sich eben aus, also kam er irgendwie dazu, damit sein Geld zu verdienen. Seine Artikel waren dicht, voller Anspielungen und hin und wieder mit einem pedantischen Humor befrachtet, wie man es nennen könnte. Außerdem waren sie gut, wie ich merkte, als er fort war – zu seinen Lebzeiten hatte ich sie nur selten gelesen.
Er hatte immer den Anspruch, interessante Texte zu schreiben, so weit er dazu auch vom eigentlichen Thema abschweifen musste. Manche seiner Leser liebten ihn dafür, aber andere – und das kann man ihnen kaum vorhalten – schickten wutentbrannte Briefe, warum die Zeitung nicht einfach jemanden anstellen konnte, der ihnen das Ergebnis sagte und das mit den großen Worten bitte sein ließ. Jahre solcher Briefe in seinem Postfach hatten meinen Vater verbittert, doch nie so sehr, dass seine Muse verstummt wäre. Als The Other Paper, eine alternative Wochenzeitung in Columbus, eine reguläre Kolumne namens »The Sully« einführte, in der sie seinen vermeintlich verschrobensten Satz der vergangenen Woche auswählten und kommentierten (z. B.: »›Die Second Base ist ein undefiniertes Gebiet, das wir noch nicht ganz im Begriff haben‹, so John Hart, General Manager der Cleveland Indians, der klingt wie jemand, dem man gleich das halbe Gesicht abbeißt«), staunten wir, wie gequält mein Vater reagierte. Jedem anderen wäre das Kompliment hinter der Stichelei offensichtlich gewesen, aber ihm kam das Blatt nicht ins Haus.
Zusätzlich zu seiner Empfindlichkeit, die unbestreitbar auf seinen Stolz zurückzuführen war, machte mein Vater keine große Sache aus seinem Sportwissen (das erstaunlich war selbst für einen Baseballreporter, der qua Spezies schon ein wandelndes Lexikon statistischen Nischenwissens ist), was ihn verstummen ließ, wenn er sich einem der allgegenwärtigen »Sportfreaks« mit ihrer Begeisterung und ihren leidenschaftlichen Theorien gegenübersah. Die Reaktion war oft schwer anzusehen, denn der Sportfreak – mit seiner Teamkappe, seinem langen Atem und seinem Willen, neunmal zu wiederholen, dass Henderson ein Idiot war, weil er mit zwei Outs zur Dritten warf – will oft nichts als Bestätigung. Doch wenige Leute verstehen, dass der Sportreporter, der wahre Sportreporter, nie ein Fan ist. Seine Leidenschaft für das Spiel ist abstrakter. Schließlich muss er bis Mitternacht dableiben, ob sein Team gewinnt oder verliert, und sein Team wandelt sich und trägt viele Farben. Er betrachtet das Spiel – oder das Rennen oder das Match oder das Turnier – mit kühlerem Blick; und er hat keinen Anreiz, die Ereignisse aufzubauschen oder zu verzerren. Der Fan wähnt sich beim Spiel im Theater; es gibt Helden und Bösewichte, gerechte und ungerechte Ergebnisse. Aber sosehr der Sportreporter sein Thema auch in der Sprache des Theaters präsentiert, bleibt es in seinem Kopf doch etwas anderes, kein Wettstreit zwischen denen, die würdig oder weniger würdig sind, sondern zwischen solchen, die können oder weniger können, beziehungsweise Glück oder weniger Glück haben. Der Wettstreit, und nur der Wettstreit, überdauert in seinen Einzelkomponenten: im Wurf, im Lauf, im Spielzug, in derer aller Nähe zu oder Entfernung von ihrer perfekten Ausführung.
Ich war nie ein Fan. Ich war etwas anderes: ein Ignorant. Und am Ende war das für meinen Vater wohl leichter. Wir hatten anderes, worüber wir reden konnten; ihn plagten nie die peinlichen Schwierigkeiten, die Arbeit hinüber ins Reich der Laien zu bringen, denn ich hätte sowieso nie mithalten können. Die wenigen Male, die ich es versuchte – »Was für ein Spiel gestern Abend«, wenn ich es zufällig gesehen hatte –, lachte er nur wie zum Dank für meine Mühen.
Doch dieser Abend war anders. Ich wollte es wirklich wissen, weil die Gelegenheiten zu schwinden schienen. Ich wollte hören, woran er sich erinnerte. Und er erzählte mir das hier:
Ich war bei Secretariats Derby '73, im Jahr bevor du auf die Welt gekommen bist – da warst du wohl noch nicht mal gezeugt. Das war einfach … pure Schönheit, weißt du? Am Anfang war er Letzter, das war meistens so. Ich habe über das zweitplatzierte Pferd geschrieben, das dann Sham wurde. Bis in die letzte Kurve sah es aus, als hätte Sham das Rennen in der Tasche, meine ich. Sham war ein schneller, schöner Hengst, musst du wissen. In einem anderen Jahr hätte er die Triple Crown geholt. Und man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass es überhaupt einen Schnelleren geben konnte. Alle haben nur ihm zugeschaut. Es war mehr oder weniger gelaufen. Und plötzlich war da so eine … bloß wie eine Störung im Augenwinkel, am Rande des Sichtfelds. Und dann, bevor du sehen konntest, was es war, kam Secretariat. Und dann war Secretariat an ihm vorbei. Noch nie hatte man einen so laufen sehen – das haben auch die älteren Kollegen gesagt. Es war, als wäre er eine ganz neue Tierart. Bis er dann nach Belmont kam, hat er die anderen quasi überrundet.
Das hatte mein Vater vorher noch nie erwähnt. Obwohl ich Minuten von den Churchill Downs entfernt aufgewachsen bin, wusste ich vom Kentucky Derby eigentlich nur, dass jeden Mai ein neues Souvenirglas davon im Schrank auftauchte, das meist irgendwer, oft ich, in Scherben schmiss, bevor das nächste kam. Ich weiß, dass er über ein Jahrzehnt lang jedes Jahr beim Rennen war und manchmal meinen großen Bruder mitnahm, aber mich fragte er nur, auf welches Pferd er meine zwei Dollar setzen solle, ansonsten sprach er nicht mit mir darüber.
Ich schrieb auf, was er mir erzählt hatte, als ich wieder in seiner Wohnung war, wo meine Schwester und ich übernachteten. Er lebte noch zwei Monate, aber es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.
Ein Jahr danach ging ich in die New York Public Library und suchte mir die Artikel heraus, die er an dem ersten Samstag im Mai 1973 für das Courier-Journal (damals Courier-Journal & Times) geschrieben hatte. Es gab zwei von »Mike Sullivan, Sportreporter«: den Rennbericht über Sham (samt Interview mit dem Jockey Laffitt Pincay, in dem dieser zugibt, Secretariat sei zwar »am Ende davongezogen«, was mein Vater als »herrlichen, dramatischen Zielsprint« beschreibt, aber in Preakness werde Sham ihn kriegen), und einen anderen, seltsameren Text, tief im Sportteil vergraben, der eines Tages Historiker des Zeitungsgeschäfts interessieren dürfte, und wenn auch nur, weil er zeigt, wie tief der New Journalism Anfang der Siebziger in die Provinz vorgedrungen war. Darin beschreibt mein Vater, wie er sich am Morgen des Derbys auf den Churchill Downs nach einem Thema umsieht.
Etwa zur Mitte der Story taucht »Der Bursche« auf, »lässig, … in alten Jeans und Turnschuhen … nicht ganz glattrasiert, sah er recht so aus wie ein Pferdepfleger oder Stallbursche«. Mein Vater trug zum Derby immer einen weißen Leinenanzug wie sein großer Held Mark Twain, auch wenn sein Kollege und Freund, der bekannte Pferdejournalist Billy Reed einmal schrieb, er sehe eher aus wie ein irrer Colonel Sanders, was ihn für einen Hippie auf Abwegen wohl nahbar wirken ließ.
»Bist du nicht vielleicht ein Pferdeknecht oder so was?«, fragt mein Vater, aber Der Bursche erwidert: »Nee, ich bin äh, … reingeschlichen.« Der Bursche erklärt, dass er die ganze Nacht durch nach Louisville gefahren ist, weil er auf einer Mission ist, für seinen »Kumpel« zu Hause ein Autogramm von Pincay zu kriegen. Es folgt ein schräger Post-Sechziger-Dialog. Mein Vater rät ihm, sich nicht wie geplant als Pferdepfleger auszugeben (sonst schnappe ihn noch die Staatsgewalt), sondern sich lieber »nach dem Rennen ganz vorne an den Zaun zu stellen« und es da mit dem Autogramm zu versuchen. Dann wird mit dem Burschen ein Treffpunkt nach dem Derby vereinbart. »Zu diesem Zeitpunkt«, schreibt mein Vater, »würde er mir verraten, ob er das Autogramm bekommen hat.«
Der nächste und letzte Satz erschien mir aus irgendeinem Grunde eigenartig und seltsam rührend, als ich ihn im Surren und Leichenhauslicht des Mikrofilmbetrachters las. Er lautet: »Falls Der Bursche mit seiner Mission scheiterte, dann endet die Geschichte hier.«
Das Kind Europas
Es war in Nürnberg am Unschlittplatz (wo die Metzger der Stadt beim Unschlittamt den beim Schlachten angefallenen Talg verkaufen mussten); der 26. Mai 1828, ein Pfingstmontag, später Nachmittag. Ein Junge von etwa sechzehn Jahren, der in allen Berichten als »von vollen Lippen« beschrieben wird, kommt den Hügel herabgestolpert. Michael Newton zufolge, dem Autor von Wilde Kinder (worin die detaillierteste und lesbarste Schilderung einer Geschichte enthalten ist, die häufig und oft widersprüchlich erzählt worden ist), ist der Junge »wie ein Stallbursche« angezogen, trägt »eine graue Hose, die ihm viel zu weit ist«, und hat im Gesicht »die ersten Anzeichen eines Bartes«. Zwei Schuhmacher treten an ihn heran, denen sein seltsames Äußeres aufgefallen ist, aber als sie ihn befragen, zeigt sich, dass er nicht richtig sprechen, sondern nur immer wieder einen Satz aufsagen kann: »A Reuta möcht ich waehn, wie mei Votta waehn is.« Seine Füße sind weich »wie die eines Säuglings« und wund, als wäre er vor diesem Tage noch nie auf ihnen gegangen. In der einen Hand hält er einen Brief, der an »den Rittmeister der 4. Eskadron des 6. Chevauxlegers-Regiments zu Nürnberg« adressiert ist, und in der anderen ein Buch, das er nicht lesen kann, mit dem Titel Geistliches Vergißmeinnicht. Die Schuhmacher versuchen, ihm weitere Informationen zu entlocken, bringen ihn aber nur zum Weinen. Er sinkt erschöpft zu Boden und wird dem kanadischen Historiker Martin Kitchen zufolge »in den Stall getragen, wo sich der Fremde sogleich auf einen Strohhaufen warf«.
Der Rittmeister kommt, hat das Findelkind aber weder jemals zuvor gesehen noch von ihm gehört, und ebenso wenig wird er aus dem wirren Brief schlau, also gibt man dem Jungen einen Stift, mit dem er das Einzige schreibt, was er schreiben kann, nämlich seinen Namen: »Kaspar Hauser«. Wieder wollen sie mehr aus ihm herausbekommen, und wieder ereifert er sich zu Tränen. Nun, so Newton, fängt der Junge an, in flehendem Ton wieder und wieder das Wort »Ross« zu sagen. Die braven Bürger Nürnbergs sind ratlos und sperren Hauser zu seinem eigenen Schutze in einen Gefängnisturm. Dort liegt er auf seiner Pritsche und lauscht dem Schlagen der Stadtuhr. Jahre später, als man ihn das Schreiben gelehrt hat, berichtet er, was ihm damals durch den Kopf ging:
Ich hörte das nähmliche, was ich zum erstenmal hörte, ich meinte aber doch, es ist etwas anders, weil ich es viel stärker hörte; es ist auch nicht das nähmliche gewesen, sondern (statt) dass die Uhr geschlagen hat, war es geläutet worden. Dieses hörte ich sehr lange; aber nach und nach hörte ich immer weniger, und wie meine Aufmerksamkeit weg war sagte ich jene Worte »dahi weis, wo Brief highört« womit ich sagen wollte: er möchte mir auch ein solches schönes Ding geben und möchte mich nicht immer so plagen … Ich fing wieder an zu weinen und sagte die gelernten Worte; damit wollte ich sagen: warum denn die Pferde so lang nicht kommen und lassen mir immer so wehe tun?
»Dieser Abschnitt bietet uns einen seltsamen Einblick in Hausers Denken«, schreibt Newton. »Zusammenhängend findet nur der Wunsch statt, Schönheit zu besitzen, und er wird wieder und wieder wiederholt …«
Hauser war in den folgenden Tagen, die er im Vestner Turm verbrachte, weiterhin verwirrt, aber er war friedlich. Einer der Wachsoldaten war von Hausers Sehnsucht nach Pferden beeindruckt und schenkte dem Jungen ein kleines Holzpferd – wahrscheinlich hatte er es aus einem der Spielzeugläden, für die Nürnberg damals berühmt war. Der Junge war so hingerissen vor Freude und andererseits so übermäßig traurig darüber, dass er es beim Zubettgehen weglegen musste, dass man ihm am nächsten Tag noch einige weitere Holzpferdchen schenkte. Von dem Augenblick an spielte Hauser unaufhörlich mit seinen Holzpferden, war ganz darin versunken und nahm nicht wahr, was um ihn herum passierte.
Später, als Hauser in ganz Europa berühmt war und sich seine Sprachfähigkeiten verbessert hatten, konnte er die Geschichte seiner Jugend erzählen, die er – bis zu jenem Nachmittag auf dem Un