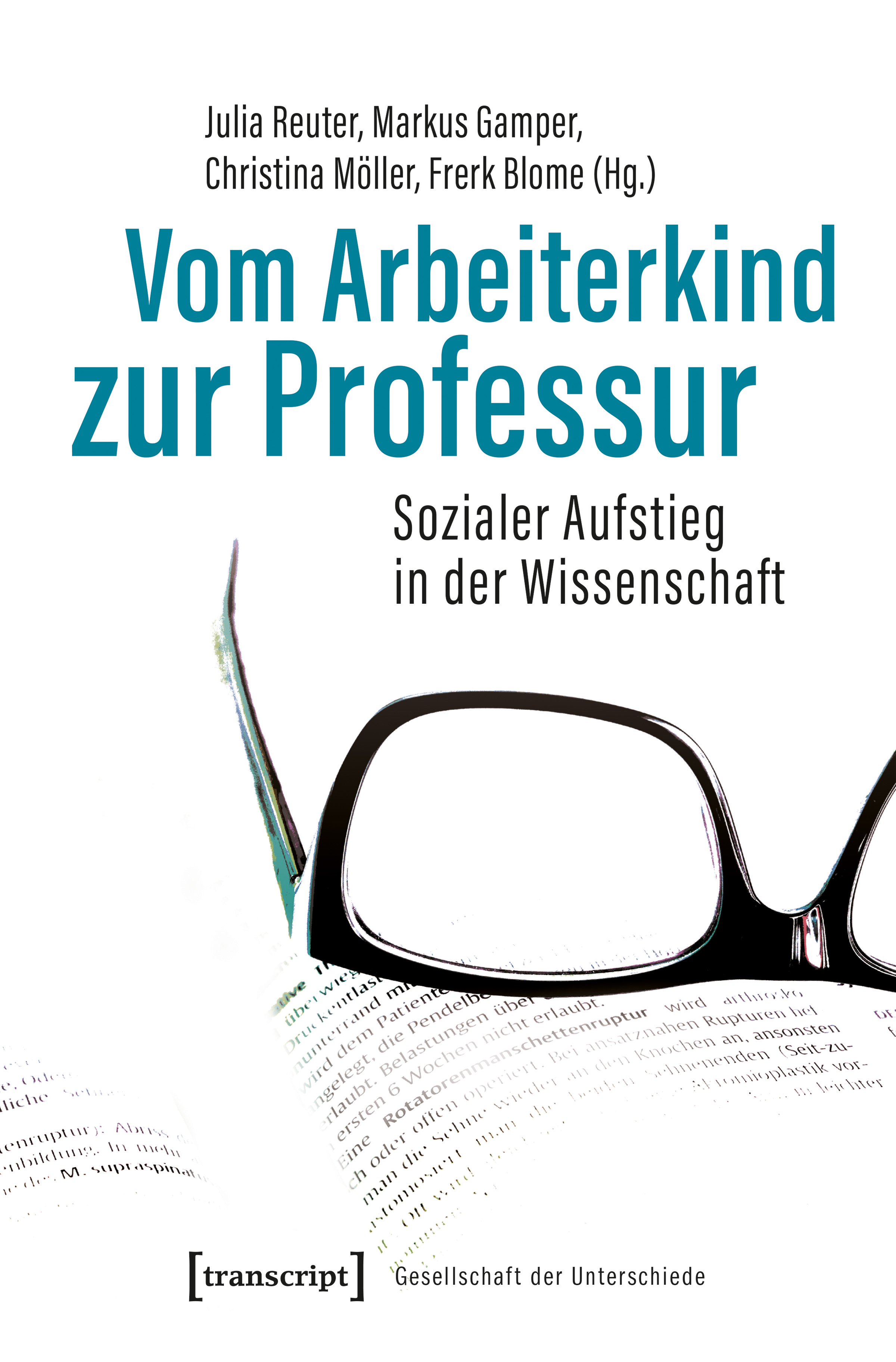
Vom Arbeiterkind zur Professur E-Book
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesellschaft der Unterschiede
- Sprache: Deutsch
Noch immer gibt es große Hürden für einen Bildungsaufstieg – nach wie vor stammt nur eine Minderheit der Professor*innen aus der Arbeiterklasse. Was bedeutet es diesen Aufsteiger*innen, eine Professur erreicht zu haben? Wie erleben sie die Universität und das Versprechen der Chancengleichheit? Und wie haben ihre eigenen Aufstiegserfahrungen sie als Wissenschaftler*innen geprägt?
Erstmals äußern sich in diesem Buch Professor*innen unterschiedlicher Fächer zu ihrem »Klassenübergang« und zur Verknüpfung von sozialer Herkunft und Wissenschaft. Gerahmt werden die persönlichen Schilderungen durch ausgewählte Beiträge aus der Ungleichheitsforschung, u.a. von Christoph Butterwegge, Michael Hartmann und Andrea Lange-Vester.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Julia Reuter (Dr. phil.), geb. 1975, ist Professorin für Erziehungs- und Kultursoziologie an der Universität zu Köln. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Allgemeinen Kultursoziologie, der Migrations- und Wissenschaftssoziologie. Sie hat u.a. zur wissenschaftlichen Karriere als Hasard publiziert.
Markus Gamper (PD Dr. phil.), geb. 1975, ist Akademischer Rat für Erziehungsund Kultursoziologie an der Universität zu Köln. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kultursoziologie, der Migrations- und Religionssoziologie sowie der Netzwerkforschung.
Christina Möller (Dr. phil.), geb. 1970, ist Vertretungsprofessorin für Soziologie an der Fachhochschule Dortmund. Zu ihren Forschungs- und Lehrschwerpunkten zählen soziale Ungleichheit und soziale Mobilität, Bildungssoziologie, Hochschulforschung. Sie hat u.a. die soziale Herkunft von Universitätsprofessor* innen untersucht.
Frerk Blome, geb. 1989, promoviert am Leibniz Institut für Wissenschaft und Gesellschaft. Seine Forschungsinteressen umfassen die Biographieforschung, die Ungleichheitssoziologie und die Vergleichssoziologie. In seiner Dissertation vergleicht er die Auswirkungen sozialer Hintergründe auf die Karrierewege von Professoren verschiedener Fachrichtungen.
JULIA REUTER, MARKUS GAMPER, CHRISTINA MÖLLER, FRERK BLOME (HG.)
Vom Arbeiterkind zur Professur
Sozialer Aufstieg in der Wissenschaft.
Autobiographische Notizen und soziobiographische Analysen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 transcript Verlag, Bielefeld
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Korrektorat: Rosa Aue, Bielefeld
Print-ISBN 978-3-8376-4778-5
PDF-ISBN 978-3-8394-4778-9
EPUB-ISBN 978-3-7328-4778-5
https://doi.org/10.14361/9783839447789
Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de
Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Vom Arbeiterkind zur Professur
Gesellschaftliche Relevanz, empirische Befunde und die Bedeutung biographischer Reflexionen
Christina Möller / Markus Gamper / Julia Reuter / Frerk Blome
I. Sozialwissenschaftliche Rahmung
Sphärendiskrepanz und Erwartungsdilemma
Migrationsspezifische Ambivalenzen sozialer Mobilität
Aladin El-Mafaalani
Bildungsaufstieg – Realität, Utopie und/oder Ideologie?
Christoph Butterwegge
Literarische Zeugnisse von Bildungsaufsteiger*innen zwischen Autobiographie und Sozioanalyse
Julia Reuter
II. Autobiographische Notizen
Gleich und doch verschieden. Erinnerungsbruchstücke
Klaus-Michael Bogdal
»Wo gehöre ich hin?« Gedanken eines Arbeiterkindes
Manfred Brill
Solidarität als Bedingung von sozialer Mobilität
Zoe Clark
Autobiographische Notizen eines ›Aufsteigers‹ – ›Wege einer anderen Bildung‹
Reinhard Damm
Soziale Herkunftserfahrung als Sensibilisierung für Chancengleichheit und Diversität
Martin Eisend
Das Professorenkostüm
Christine M. Graebsch
Von wo ich herkomme
Sabine Hark
»Hintertreppen zum Elfenbeinturm«
Ein Beitrag zur Enttabuisierung der sozialen Herkunft von Bildungsaufsteiger*innen
Elke Kleinau
Vom Bauernsohn zum Prorektor
Rückblick und Ausblick eines Mathematikers
Aloys Krieg
»Was soll aus dem Mädchen denn werden – alte Tante auf dem Hof?«
Oder: Der lange Weg von der ländlichen Hauswirtschaftsgehilfin zur Universitätsprofessorin
Doris Lemmermöhle
Die Entdeckung am Sonnentor von Tiahuanaco
Martin Lörsch
Statuspassagen im Lebensverlauf
Eine autobiographische Annäherung
Rainer Müller
»Mach was aus dir, aber bleib’ der Alte!« – Von Auswärtsspielen am Rande erfolgreicher Wege
Jürgen Prott
Putzfrau oder Professorin: Hat man die Wahl?
Rosa Maria Puca
Herkunft versus Zukunft
Pakize Schuchert-Güler
Von der Hauptschule an die Hochschule
Ahmet Toprak
Keine Rückkehr nach Wattenscheid
Jürgen Vogt
Das UNTEN spürst Du immer
Klaus Weber-Teuber
Dem weißen Kaninchen gefolgt…
Andreas Wrede
III. Soziobiographische Kommentierung
Vom ›Arbeiterkind‹ zur Professur – Merkmale eines erfolgreichen Aufstiegs
Michael Hartmann
Über Habitusmuster und Milieuherkunft von Bildungsaufsteiger*innen im akademischen Feld
Andrea Lange-Vester
IV. Im Dialog
»Auch der Homo academicus hat eine Herkunft!«
Im Dialog mit Initiativen von und für Arbeiterkinder in der Wissenschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft über herkunftssensible Nachwuchsförderung
Autor*innenverzeichnis
Vom Arbeiterkind zur ProfessurGesellschaftliche Relevanz, empirische Befunde und die Bedeutung biographischer Reflexionen
Christina Möller / Markus Gamper / Julia Reuter / Frerk Blome
»Heute bin ich Professor.
Als ich meiner Mutter erklärte, dass man mir eine Stelle angeboten hatte,
fragte sie ganz gerührt:
›Und was für ein Professor wirst du, Philosophie?‹
›Eher Soziologie‹.
›Soziologie?‹ erwiderte sie, ›hat das was mit der Gesellschaft zu tun?‹«
(Didier Eribon in Rückkehr nach Reims 2016: 238)
Der zitierte Gesprächsausschnitt bildet den Abschluss von Rückkehr nach Reims, einem Buch, das vom sozialen und Bildungsaufstieg des französischen Soziologen Didier Eribon handelt. Ihm gelingt es, als Kind eines Fabrikarbeiters und einer Putzfrau, trotz fehlender Vorbilder und zahlreicher Widerstände im familiären und schulischen Umfeld ein Studium aufzunehmen; später arbeitet er als erfolgreicher Journalist und wird schließlich im fortgeschrittenen Alter auf eine Professur für Soziologie an der Universität Amiens berufen. Aber den Weg dorthin beschreibt Eribon als außerordentlich mühsam und kräftezehrend – insbesondere, weil sein Aufstieg aus seiner Sicht nur durch die Verleugnung seiner Herkunft und mit dem Abbruch der familiären Kontakte möglich war. 30 Jahre lang kehrt Eribon seiner Herkunftsfamilie den Rücken, erst nach dem Tod des Vaters sucht er seine Mutter in Reims auf. Dies ist Ausgangspunkt einer umfassenden Reflexion über die sozialpolitischen Zustände in seiner Heimat Frankreich als Klassenanalyse und gleichzeitig eine soziobiographische Rekonstruktion seines Werdeganges.
Der Erfolg des Buches verdankt sich nicht zuletzt dem Umstand, dass hier eine Person des öffentlichen Lebens über die Mühen des Aufstiegs als Arbeiterkind erzählt. Durch die Mischung aus reflektierter Analyse und affektgeladener Erinnerung ermöglicht es entlang autobiographischer Szenen einen sehr persönlichen Einblick in das Leben und Leiden eines homosexuellen Professors aus dem proletarischen Milieu. Eribon offenbart sich als verletzliche, unsichere Person, deren Herkunftsscham bis ins hohe Alter ihre Spuren im Selbstbewusstsein und -empfinden hinterlassen hat. Selbst als erfolgreicher Wissenschaftler und Schriftsteller wird er in bestimmten Situationen und Kontexten nach wie vor von Gefühlen der Unzulänglichkeit und Scham geplagt. Wenngleich Herkunftserzählungen Gelehrter vor allem in Frankreich eine gewisse Tradition haben (u.a. Camus 1994; Sartre 1975; Bourdieu 2002), bewegt Eribons Selbsterkundung durch ihre Offenheit, nicht zuletzt, weil durch das Einräumen von persönlichen Schwächen der Mythos vom souveränen ›Homo academicus‹ entzaubert wird. Obwohl ihm der soziale Aufstieg aus einer proletarischen Familie zum Universitätsprofessor letztlich gelingt, ist Rückkehr nach Reims weniger Erfolgsstory, als vielmehr Lehrstück über soziale Klassenunterschiede und ihre Reproduktion durch das Bildungssystem. Und auch wenn Eribons Aufstieg in die Zeit der großen Bildungsreformen der 1960er und 1970er Jahre fällt, bleibt er eine Ausnahme. Insbesondere in Frankreich hat der Anspruch auf Chancengleichheit nicht die Idee der elitären Auslese im Bildungssystem verdrängt. Spitzenpositionen – wie es die Professur für die Wissenschaft ist – werden nach wie vor aus den Nachfahren der französischen Elite rekrutiert, für die das System exklusive Bildungseinrichtungen vorhält.1
Auch in Deutschland sind Arbeiterkinder, die Hochschulprofessor*innen werden, die Ausnahme. Hiesige Bildungsinstitutionen sind dafür bekannt, gesellschaftliche Ungleichheiten nicht zwangsläufig zu kompensieren, sondern eher zu reproduzieren und daher besonders sozial selektiv zu sein. Was bereits in den 1960er Jahren von öffentlichen Intellektuellen wie Ralf Dahrendorf angemahnt wurde, war spätestens mit den internationalen Schulleistungsvergleichen und dem sogenannten PISA-Schock 2001 nicht mehr zu übersehen: Deutschland gehörte und gehört zu denjenigen Ländern, die einen sehr hohen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Bildungserfolgen aufweisen (Klemm 2016). Daher vermag es kaum verwundern, dass einer aktuellen Erhebung zufolge lediglich etwa jede*r zehnte Professor*in an deutschen Universitäten ein Arbeiterkind2 ist (Möller 2015). Auch die insgesamt geringen Anteile von Personen aus Angestelltenfamilien mit ausführenden Tätigkeiten oder Beamt*innenfamilien des einfachen und mittleren Dienstes unter Professor*innen (ebd.) zeigen, dass das verlautbarte gesellschaftliche Versprechen ›Aufstieg durch Bildung‹ zumindest für die Nachkommen dieser aufgeführten Personengruppen nicht gleichermaßen oder nur eingeschränkt galt. Vielmehr ist zu konstatieren, dass diese ›weiten‹ sozialen Aufstiege durch Bildung, die aufgrund ihrer sozialstrukturellen Distanz als soziale Langstreckenmobilität (Geißler 2014: 315) oder auch Extremaufstiege (El-Mafaalani 2012) gedeutet werden, nicht nur äußerst selten sind, sondern soziale Aufwärtsmobilität insgesamt zunehmend unwahrscheinlicher wird (Pollak 2010).
1.Von der ›Illusion der Chancengleichheit‹ in den Bildungsinstitutionen
Die Bildungsexpansion der 1960er und 1970er Jahre hat zunächst den Möglichkeitskorridor für soziale Aufstiege nicht nur für Bildungsbenachteiligte, sondern für alle Herkunftsgruppen deutlich erweitert. Die Bildungsexpansion war u.a. ein Resultat aus dem sogenannten ›Sputnik-Schock‹ Ende der 1950er Jahre, der dem Westen seine technologische Unterlegenheit im Spannungsverhältnis zum damaligen ›Ost-Block‹ offenbarte. Angestoßen durch die 1964 von Georg Picht ausgerufene »Bildungskatastrophe« (Picht 1964), in der das Fehlen hochqualifizierter Fachkräfte als ökonomische Wohlstandsgefährdung der (west-)deutschen Gesellschaft problematisiert wurde, und einer sich parallel formierenden gesellschaftlich-liberalen Forderung nach »Bildung als Bürgerrecht« (Dahrendorf 1966) wurden Reformen zum langfristigen und flächendeckenden Ausbau des Bildungswesens eingeläutet.3 So wurden nicht nur weitaus mehr Gymnasien und Universitäten gebaut und Gemeinschaftsschulen (wie in einigen Bundesländern die Gesamtschulen) konzipiert, sondern auch neue Institutionen zum nachholenden Erwerb der Hochschulreife und Fachhochschulen geschaffen. Diese sorgten sowohl für eine Höherqualifizierung der Gesellschaft und neue akademische Berufsgruppen als auch für einen erleichterten Zugang für vormals ausgeschlossene gesellschaftliche Gruppen zu höheren Bildungsabschlüssen (Miethe et al. 2015). Das Honnefer Modell bzw. das heutige BAföG sollte ab den 1970er Jahren zudem der ökonomischen Kompensation dienen, indem mittels staatlicher Förderung das Studieren für finanziell schlechter gestellte Gruppen erleichtert bzw. überhaupt erst ermöglicht wurde. Das langfristige Ausmaß dieser Reform und des enormen Ausbaus des Bildungswesens lässt sich an der Bildungsbeteiligung ablesen: Vormals Hort einer privilegierten Minderheit besuchten im Schuljahr 2016/17 knapp 34 Prozent der Schüler*innen eines Jahrgangs ein Gymnasium (Statistisches Bundesamt 2018c: 13), während die Hauptschule (Anfang der 1950er Jahre noch namentlich als ›Volksschule‹ von mehr als Dreiviertel der Schüler*innen besucht, Geißler 2014: 335) als Schulform ein Auslaufmodell ist und in einigen Bundesländern bereits abgeschafft wurde. Noch 1960 begannen lediglich 6 Prozent einer Jahrgangskohorte ein Universitätsstudium in (West-)Deutschland (Geißler 2011: 275), bis zum Jahr 2018 ist die Studienanfängerquote (bundesweit) auf 56 Prozent angestiegen (Statistisches Bundesamt 2019).
Trotz dieser enormen Expansion des Bildungswesens zeigen sich nach wie vor Disparitäten zwischen den sozialen Gruppen, wenn auch in unterschiedlicher Merkmalskonstellation: Die historische Figur der »katholischen Arbeitertochter vom Lande« (Dahrendorf 1965; Peisert 1967), die noch in den 1960er Jahren von höherer Bildung ausgeschlossen war, ist heute weitgehend obsolet; man spricht vielmehr vom »Migrantensohn aus bildungsschwachen Familien« (Geißler 2008: 95), der als tragische Polarisierungsfigur für Bildungsbenachteiligung gilt. Während sich also Bildungschancen im Laufe der Zeit zwischen den verschiedenen Ungleichheit generierenden Strukturkategorien verschoben haben – vor allem Mädchen bzw. Frauen gelten als Bildungsgewinnerinnen der letzten großen Bildungsexpansion (ebd.) –, bleibt die soziale Herkunft ein wirkmächtiges Differenzmerkmal.
1.1Bildungsbeteiligungsquoten und Bildungschancen gestern und heute
Seit nunmehr über 50 Jahren wird in Deutschland über eine bessere Bildungsteilhabe von Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status4 diskutiert. Ungleichheitsforscher*innen in der Tradition von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron, die in ihrem Schlüsselwerk noch während der Zeit der großen Bildungsreformen Chancengleichheit als Illusion (1971) entzaubert haben, werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass die Bildungsexpansion nicht zu einem Abbau von sozialen Barrieren im Bildungssystem geführt habe, sondern vielmehr zu einer selektiven Verbesserung von Bildungschancen. So haben die höheren Klassen am meisten und die untersten Klassen am wenigsten von der Bildungsexpansion profitiert (Vester 2005), sodass sich der Abstand zwischen diesen Gruppen eher vergrößert hat (Krais 1996). Angesichts der Expansion insbesondere höherer Bildungsgänge und der weit verbreiteten ›Illusion der Chancengleichheit‹ war das Ungleichheitsparadigma insbesondere in den 1990er Jahren (u.a. angeregt durch die Individualisierungstheorien, die davon ausgingen, dass sich Klassen und entsprechend auch Klassenungleichheiten immer mehr auflösen, Beck 1983) auch in den soziologischen Diskursen aus dem Blick geraten. Erst im Gefolge der Diskussion um die Befunde internationaler Schulvergleichsstudien (vor allem seit PISA 2000, Baumert 2001) wurde die Diskussion um den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg, der sich in Deutschland als besonders eng herausstellte (Hartmann 2018), Anfang der 2000er Jahre erneut aufgegriffen. Seitdem sind hinsichtlich der auf soziale Faktoren zurückzuführenden Bildungsungleichheiten graduelle Verbesserungen eingetreten (PISA 2018), jedoch ist Chancengleichheit eine nach wie vor weitgehend unrealisierte Forderung.
Die herkunftsbezogenen Pfadabhängigkeiten im Bildungsverlauf zeigen sich bereits an den Beteiligungsquoten in vorschulischen Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung, der Einschulung, Rückstufungen sowie Schulerfolgen in der Grundschule und besonders in den Schulformentscheidungen und -empfehlungen beim Übergang zu den weiterführenden Schulen; sie verstetigen sich aber auch auf höheren Bildungsstufen. Daher gilt nach wie vor: »Je weiter man in der Bildungshierarchie nach oben klettert, desto mehr dominieren die mittleren und oberen Schichten der Sozialstruktur.« (Schwinn 2007: 33) Aktuell besuchen über Zweidrittel der Schüler*innen mit hohem sozialen Status das Gymnasium und nur 3 Prozent die Hauptschule, während Schüler*innen mit niedrigem Sozialstatus sich vornehmlich auf Hauptschulen und integrierten Schulformen wiederfinden und nur 14 Prozent auf einem Gymnasium (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 174). Auch wenn sich im Zeitverlauf der Anteil von Schüler*innen mit niedrigem Sozialstatus auf dem Gymnasium erhöht hat, ist von gleichen Chancen noch lange nicht auszugehen.
Ähnliche Tendenzen zeigen sich beim Weg zur Hochschule: Zwar ist die Studierwahrscheinlichkeit vor allem in mittleren, aber auch in unteren Sozialgruppen angestiegen, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Studienaufnahme für Nachkommen akademischer Gruppen am höchsten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018). Studierende an deutschen Hochschulen stammen zwar mittlerweile knapp zur Hälfte aus nicht-akademischen Elternhäusern (Middendorff et al. 2017: 28), aber in Relation zur Akademiker*innenrate der deutschen Erwerbsbevölkerung, die 2017 22 Prozent beträgt (Bundesagentur für Arbeit 2019: 8), zeigt sich, dass deren Nachkommen an den Hochschulen mit 52 Prozent deutlich überrepräsentiert sind.
Der sogenannte Bildungstrichter veranschaulicht, wie die Wahrscheinlichkeiten für die hohen und höchsten Bildungsabschlüsse von der Grund- bis zur Hochschule in Deutschland verteilt sind: Von 100 Akademikerkindern beginnen 74 ein Hochschulstudium, 63 schließen den Bachelor ab, 45 einen Master und zehn erwerben einen Doktortitel. Ausgehend von 100 Kindern aus Nicht-Akademiker*innenfamilien sind es lediglich 21, die ein Studium beginnen, 15 schließen einen Bachelor, acht einen Master ab und lediglich eine Person gelangt bis zum Doktortitel (Krempkow 2017). Trotz der relativ groben Kategorien der ›Akademiker*innen-‹ und ›Nicht-Akademiker*innenfamilien‹, die jeweils heterogene Subgruppen versammeln5, werden die Dimensionen der objektiven ungleichen Wahrscheinlichkeiten dadurch sehr deutlich vor Augen geführt.
1.2Ursachen, theoretische Erklärungsansätze und empirische Befunde
Das deutsche Bildungssystem zeichnet sich im internationalen Vergleich durch eine hohe Differenzierung an Schulformen und einer vertikalen, selektiven Struktur aus. Insbesondere an den sogenannten Gelenkstellen, den Übergängen zwischen Institutionen, lassen sich teils enorme soziale Selektionen nachzeichnen, die zu den bereits skizzierten Bildungsbeteiligungsquoten an den verschiedenen Schulformen führen. Hierzu zählen besonders die Übergänge zwischen Kindergarten und Einschulung, zwischen Grundschule und weiterführender Schule sowie zwischen dieser und dem Hochschulbereich oder dem (Ausbildungs-)Beruf.
Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I gilt als wesentliche Gelenkstelle für weitere Bildungschancen, da sich erstens für den Besuch unterschiedlicher Schulformen ein Schereneffekt in der Kompetenzentwicklung nachweisen lässt.6 Zweitens gelten Wechsel auf eine höhere Schulform innerhalb der Sekundarstufe I als relativ selten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018: 95) und werden drittens eher von sozioökonomisch privilegierten Kindern vollzogen, während Kinder aus ›bildungsarmen‹ Familien umgekehrt mit höherer Wahrscheinlichkeit schulisch absteigen (Kurz/Böhner-Taute 2016).
Die Ursachen ungleicher Bildungsverläufe und damit auch Bildungserfolge nach sozialer Herkunft – so ist an dieser Stelle bereits vorwegzunehmen – lassen sich nicht auf wenige eindeutige Faktoren zurückführen. Es muss vielmehr von einem komplexen Bündel und zusammenhängenden Ursachen ausgegangen werden, die gleichzeitig eng mit der gegliederten Struktur des deutschen Bildungssystems verbunden sind (Leemann et al. 2016; Berger/Kahlert 2013). Dies ist deshalb zu betonen, da ungleiche Bildungschancen nach wie vor bildungspolitisch weitgehend individualisiert und meritokratisch legitimiert werden, wobei der in Deutschland herrschende »Strukturkonservatismus […] angesichts der Erfolge anderer Länder« (Solga/Powell 2006: 180), die einhergehend mit Einheitsschulkonzepten auch deutlich höhere Kompetenzen in der Breite und mehr Chancengleichheit vorweisen können (Beispiel Finnland oder Kanada), dabei verwundern mag (vgl. auch Geißler 2012).
Es liegt eine Vielzahl an wissenschaftlichen Befunden vor, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln, theoretischen Perspektiven und methodischen Zugängen generiert werden. Im Folgenden wird daher versucht, die wesentlichen Forschungsstränge zu Ungleichheiten im Bildungswesen zu bündeln und zentrale Befunde zu dokumentieren, die angesichts der Vielzahl an vorliegenden Studien nur exemplarisch zu verstehen sind. Aus der Forschungslage lassen sich mit den Theorien rationaler Bildungswahl, institutioneller Diskriminierung und kultureller Reproduktion drei dominante Erklärungsansätze destillieren.7
1.2.1Rationale Bildungswahl
In quantitativen Forschungssträngen wird häufig auf die Überlegungen von Raymond Boudon (1974) zurückgegriffen, der – angelehnt an ökonomische Humankapitaltheorien – ungleiche Bildungsverläufe vorrangig als Resultate individueller Bildungsentscheidungen und rationaler Kosten-Nutzen-Abwägungen in Familien begreift. Diese Bildungsentscheidungen fallen je nach sozialer Herkunftslage unterschiedlich aus. Zentral sind dabei primäre und sekundäre Herkunftseffekte: Als primäre Herkunftseffekte werden die Entwicklung klassenspezifischer Kompetenz- und Leistungsunterschiede begriffen. So führten ungleiche familiäre Ressourcenausstattungen zu ungleichen Entwicklungsbedingungen und Schulleistungen.
Kinder, die in Armut aufwachsen, sind dabei auf unterschiedliche Weise benachteiligt. Negative Auswirkungen habe die Armutslage auf ihre gesundheitliche Entwicklung (vgl. Bradley et al. 1994; Seccombe 2000), die schulischen Erfolge, ihre Sozialbeziehungen und Sozialkompetenzen sowie ihr Selbstwertgefühl (vgl. Schiek et al. 2019). Es sei im Wesentlichen die mit Armut einhergehende finanzielle Belastung, die in diesen Familien zur Beeinträchtigung sozialer Beziehungen und Interaktionen führe (Walper et al. 2001; Lutz/Frey 2012). Die Auswirkungen der erfahrenen Benachteiligung stiegen, je länger sie andauern, während die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Resilienz abnehme (vgl. Schiek et al. 2019).
Grundschüler*innen aus Arbeiter*innenfamilien weisen im Verhältnis zu jenen aus oberen Dienstklassen einen Leistungsunterschied bei den Lesekompetenzen von durchschnittlich einem Lernjahr auf (Hußmann et al. 2017: 214), bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen sogar von ein bis zwei Lernjahren (ebd.: 310). Bezogen auf weiterführende Schulen verweisen die aktuellen PISA-Studien zwar auf einen positiven Trend, dennoch erbringen sozial bessergestellte Schüler*innen im Durchschnitt höhere Leistungen als sozial Benachteiligte (PISA 2018).
Doch auch bei gleichen oder ähnlichen Leistungen lassen sich ungleiche Bildungsverläufe nachweisen, die im Sinne Boudons als sekundäre Herkunftseffekte wirken: So nehmen nachweislich weniger Abiturient*innen aus unteren Sozialgruppen mit der Hochschulreife ein Studium auf und beginnen häufiger eine Berufsausbildung, während für jene aus oberen Sozialgruppen ein Hochschulstudium eher der selbstverständliche Bildungsweg ist (Becker/Hecken 2008; Schindler/Reimer 2010). Sekundäre Herkunftseffekte umfassen daher soziale Unterschiede bei der Bildungsentscheidung, die auf den jeweiligen Bildungsaspirationen und dem konkreten Entscheidungsverhalten basieren. Je nach sozioökonomischer Ausstattung gelten in der Regel unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für die Kosten-Nutzen-Kalkulationen: »Die Familie eines Rechtsanwalts wird andere Kosten- und Nutzenbewertungen vornehmen als die Familie eines Industriearbeiters, und zwar auch dann, wenn sich die Kinder in ihrer schulischen Performanz nicht voneinander unterscheiden.« (Maaz 2006: 53) Demgegenüber steht der Nutzen durch den höheren Bildungsweg (ggf. höheres Einkommen nach dem Bildungsabschluss), aber auch das Risiko eines Studienabbruchs, die Kosten des Besuchs höherer Bildungsinstitutionen (z.B. Schulmaterialien, Studiengebühren, Miete usw.) sowie versäumte frühe Einkommen, die aus einer Berufsausbildung resultieren würden.
Doch ausschließlich Kompetenzunterschiede (als Resultat unterschiedlicher Ressourcen im Elternhaus) sowie unterschiedliche individuelle Entscheidungen als Erklärung für ungleiche Bildungserfolge zu deuten, verstellt den Blick auf Mechanismen und Benachteiligungsprozesse, die in der Gesellschaft und in ihren Institutionen selbst verortet sind. Problematisch erscheint insbesondere, dass Bildungsungleichheiten aus Sicht der ›Theorien rationaler Bildungswahl‹ auf individuelle Entscheidungen reduziert werden, sodass die Verantwortung für ungleiche Chancen eher an die benachteiligten Familien selbst delegiert wird.
1.2.2Institutionelle Diskriminierung
Ein zweites Erklärungsmodell fokussiert daher auf Formen institutioneller Diskriminierungen (Gomolla/Radtke 2009). Hierbei wird davon ausgegangen, dass durch »überindividuelle Sachverhalte wie Normen, Regeln und Routinen sowie […] kollektiv verfügbare Begründungen« (Hasse/Schmidt 2012: 883) bestimmte soziale Gruppen überproportional negativ betroffen und daher benachteiligt werden (Gomolla 2013). In einem anderen Vokabular könnte man auch von einem »institutionellen Habitus« (Reay et al. 2009: 3) sprechen, um damit einerseits deutlich zu machen, dass es umfassende pädagogische Handlungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsprogramme sind, die im Hintergrund von Bildungseinrichtungen wirksam sind, und um andererseits den Blick weg von einzelnen Personen und Institutionen auf die in der Regel miteinander vernetzten Institutionen zu richten. Denn in der Perspektive der institutionellen Diskriminierung ist es nicht die einzelne Bildungseinrichtung, die diskriminiert, sondern das Ergebnis des Zusammenwirkens von vielen miteinander verkoppelten Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Behörden, Jugendämter, Schulärzte, Beratungseinrichtungen, Hochschulen u.Ä.).
Mit einem solchen Zugriff lässt sich untersuchen, wie die Mitglieder von Bildungseinrichtungen interagieren, unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten mitbringen und schließlich realisieren, aber auch wie im Zusammenwirken verschiedener Bildungsinstitutionen eine überproportionale Überweisung von Schüler*innen aus Arbeiter*innenfamilien – und Migrationsfamilien – an Förderschulen, Hauptschulen oder Gesamtschulen im Licht meritokratischer Prinzipien und Förderkonzepte als ebenso notwendige wie gerechtfertigte Maßnahme erscheint (vgl. Reuter/Berli 2017: 12). Exemplarische Belege finden sich beispielsweise in den alle drei Jahre erscheinenden IGLU-Studien, die u.a. die Übergangsempfehlungen von Lehrkräften an Grundschulen untersuchen: So haben Schüler*innen aus un- und angelernten Arbeiter*innenfamilien auch bei gleichen Kompetenzen eine dreifach geringere Chance, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten als Schüler*innen aus oberen Dienstklassen (Stubbe et al. 2017: 244f.). Zudem müssen Schüler*innen aus un- und angelernten Arbeiter*innenfamilien für eine Gymnasialempfehlung im Durchschnitt höhere Kompetenzwerte beim Lesen erbringen (ebd.), sodass »die Auslese nach Leistung bei Kindern aus unteren Schichten erheblich schärfer greift als bei anderen« (Geißler 2014: 371). Häufig werden Kinder bereits aufgrund ihrer Vornamen von Grundschullehrer*innen als verhaltensauffällig und leistungsschwach bewertet (Kaiser 2010).
Es zeigt sich also auch mit dieser Mesoperspektive, dass soziale Selektionen im Bildungssystem nicht mit einer reinen Leistungsauslese gleichgesetzt werden dürfen. Vielmehr sorgen auch leistungsfremde Filterkriterien wie die soziale Herkunft sowie damit verknüpfte Vorurteile und negative Leistungszuschreibungen von Akteur*innen im Bildungswesen für Ermutigungs- und Entmutigungsphänomene und somit für ungleiche Bildungsverläufe. Zudem gilt angesichts der in Deutschland stark gegliederten Struktur des Bildungssystems: Je mehr Übergangsstellen ein Bildungssystem aufweist und je früher die selektive Trennung, desto eher reproduzieren sich soziale Ungleichheiten (Hofstetter 2017; Becker/Lauterbach 2010; Geißler 2014).
1.2.3Kulturelle Reproduktion
Der dritte Erklärungsansatz wird als soziale und kulturelle Reproduktionstheorie bezeichnet und geht auf Pierre Bourdieu zurück, in dessen Tradition auch der eingangs zitierte Didier Eribon steht. Bourdieu verweist bei der Aufklärung dauerhafter Bildungsungleichheiten sowohl auf die Bedeutung klassenspezifischer Herrschaftsverhältnisse (Makroebene), auf das Bildungssystem mit seinen expliziten und impliziten gesellschaftlichen Überformungen (Mesoebene) als auch auf die familialen Reproduktionsstrategien unterschiedlicher Milieus (Mikroebene) (Bourdieu/Passeron 1971). Die Bildungsexpansion schaffe keine Chancengleichheit, sondern konstruiere eher die Illusion derselbigen, da Bildungsinstitutionen keine neutralen Akteur*innen seien und selbst Einfluss auf Bildungshierarchien nähmen. Die Herausforderungen von Nachkommen aus nicht-akademischen und statusniedrigen Herkunftsmilieus im Bildungssystem ergeben sich vor allem aus den relativen Abständen zu jenen, die bereits in oberen und akademischen Milieus sozialisiert worden sind. So strich Bourdieu den kaum einholbaren Wettbewerbsvorteil einer bildungs- und erfolgsaffinen familiären Primärsozialisation heraus, des damit verfügbaren kulturellen Kapitals und eines Habitus, der eher den oberen Gruppen eigen ist. Mit dem (klassenspezifischen) Habitus-Begriff werden jene Dispositionen und mentale Muster angesprochen, die sich insbesondere auf sozialisationsbedingte Prägungen zurückführen lassen (vgl. auch Lenger et al. 2013). So bringen Kinder aus akademisch geprägten Elternhäusern eher Eigenschaften, Verhaltensweisen, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten – kurzum habituelle Dispositionen – mit, die für höhere Bildungsgänge und für den Erfolg an Hochschulen gewinnbringend eingesetzt werden können bzw. die implizit erwartet werden. Daher erweist sich diese Transmission von Kulturtechniken als ein »Privileg der gebildeten Klassen« (Bourdieu/Passeron 1971: 39). Hinzu kommt die Selbstexklusion unterer Klassen, für die ein Hochschulabschluss häufig kein primäres Ziel darstellt und die aus Mangel an Ressourcen und Unwissenheit über die Bedeutung verschiedener Bildungsgänge andere – niedrigere – Bildungsziele wählen. Herkunftsspezifische Einstellungen und Erwartungen gepaart mit Chancenungleichheit durch das Bildungssystem selbst sorgen dafür, dass Akteur*innen aus niedrigen Klassen sich letztlich häufig selbst ausschließen (Bourdieu/Passeron 1971: 35) und auf untere Bildungslaufbahnen abgedrängt werden, während obere Klassen innerhalb des Bildungssystems auf ein familiäres Erbe zurückgreifen können, das sie privilegiert. Das Bildungssystem biete demnach die beste Lösung zur Stabilisierung von Macht und Privilegien, »indem es dazu beiträgt, die Struktur der Klassenverhältnisse zu reproduzieren, und indem es hinter dem Mantel der Neutralität verbirgt, daß es diese Funktion erfüllt« (Bourdieu 1973: 93): Es konserviert Ungleichheiten und legitimiert durch das Ignorieren der kulturellen Privilegien bestimmter sozialer Gruppen die Wirksamkeit der konservativen Effekte.
Empirische Studien, die auf Bourdieus Theorien rekurrieren, arbeiten beispielsweise den herkunftsmilieuspezifischen Habitus von Schüler*innen, Studierenden und Lehrenden (Brändle 2019; de Moll 2018; Hild 2019; Helsper et al. 2014; Lange-Vester/Sander 2016; Schmitt 2010 u.v.m.) oder symbolische Ordnungen und ungleichheitsgenerierende Strukturen und Mechanismen im hochschulischen bzw. wissenschaftlichen Feld heraus (Engler 2001; Lange-Vester/Teiwes-Kügler 2013; Möller 2015; Reuter et al. 2016; Zimmer 2018 u.v.m.). Entsprechende Perspektiven und daraus resultierende Erkenntnisse werden in den nächsten Kapiteln vorgestellt.
2.›Arbeiterkinder‹ an den Hochschulen und die Herausforderungen eines sozialen Aufstiegs zur Professur
Im idealtypischen Sinne haben Hochschulen nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern verkörpern als Wissenschaftsorganisationen auch ein Funktionssystem, das sich stets auf der Suche nach abgesichertem Wissen befindet und sich dabei an spezifischen Methoden und an einem spezifischen wissenschaftlichen Ethos orientiert (Merton 1985). In der Wissenschafts- und Karriereforschung werden jedoch auch die Entstehungs- und Herstellungsbedingungen von Erkenntnissen sowie ihre soziale Bedingtheit untersucht und damit auch die Akteur*innen, die Wissen generieren und die in diesem Funktionssystem wissenschaftliche Karrieren machen. Somit kommen spezifische »Ungleichheitsregime« (Acker 2006) in den Blick, die nicht nur mit tief eingelagerten Diskriminierungspraktiken zum Erhalt von Macht und Kontrolle von Zielen, Ressourcen und Ergebnissen einhergehen, sondern auch mit der Konstruktion von bestimmten Idealen bzw. Idealtypen – z.B. der »wissenschaftlichen Persönlichkeit« (Engler 2001; Beaufaÿs 2003) oder des »perfekten Lebenslaufs« (Metz-Göckel 2016). Diese besitzen aus Sicht der Organisation Selektionsfunktionen, aus Sicht der Subjekte dienen sie aber auch der Identifikation. Wissenschaftssoziologische Arbeiten betonen die Relationalität von Struktur und Subjekt und lenken den Blick weg von den einzelnen Akteur*innen hin zur Funktionsweise des wissenschaftlichen Feldes und ihrer Verkörperung in der sozialen Praxis. Folgt man der Einsicht, dass Wissenschaft kein feststehendes Gebilde, sondern eine sich alltäglich vollziehende praktische Auseinandersetzung mit Forschungsgegenständen, Kolleg*innen, sozialen Organisationsstrukturen, Prüfungsverfahren und Anerkennungssystemen einer Scientific Community ist (Beaufaÿs 2003: 18), rückt man an ein Verständnis von Wissenschaft heran, das Pierre Bourdieu mit dem Begriff des sozialen Feldes gefasst hat. Ein Feld ist ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen (Bourdieu/Wacquant 1996: 127), die durch die aktuelle und potenzielle Verfügbarkeit und Distribution von unterschiedlichen Kapitalien bestimmt werden. Felder sind also immer auch Machtfelder, weil in ihnen hierarchische Kämpfe um Anerkennung und Positionen stattfinden (Bourdieu 1998); im Fall des wissenschaftlichen Feldes konkurrieren die Akteur*innen beispielsweise um Dauerstellen, Drittmittel, wissenschaftliche Preise und damit um Reputation, d.h. um sogenanntes wissenschaftliches Kapital. Die soziale Herkunft spielt dabei weiterhin eine Rolle: Denn auch die spezifische Feldsozialisation ist je nach sozialer Herkunft unterschiedlich erfolgreich, weil die Anschlussfähigkeit an ein erfolgreiches Studium und an Karrierepfade in der Wissenschaft sowie die Anerkennung von Leistungen – so die Annahme – von herkunftsbedingten, daher ›mitgebrachten‹ Kapitalien und Habitus beeinflusst werden.
Durch die Öffnung des Hochschulsystems im Zuge der Bildungsexpansion begannen zwar auch Arbeiterkinder und andere vormals ausgeschlossene untere Sozialgruppen, die die Selektionsprozesse auf den vorherigen Bildungsstufen überwunden haben, ein Studium und – wenn auch nur wenige von ihnen – machten im Hochschulsystem Karriere. Nach wie vor aber sind diese Sozialgruppen nicht nur angesichts ihres Bevölkerungsanteils an den Hochschulen (vor allem an den Universitäten, etwas weniger an Fachhochschulen, Middendorff et al. 2017: 28, und vgl. Kap. 2.2) unterrepräsentiert. Es zeigen sich bereits in den frühen Phasen, die einer möglichen Wissenschaftskarriere vorausgehen, herkunftsbedingt ungleiche Ausgangsbedingungen, die im weiteren Verlauf zu (Selbst- und Fremd-)Selektionen führen können. Bereits im Studium existieren Unterschiede wie beispielsweise im Hinblick auf die Anzahl von Auslandsaufenthalten oder Studienabbruchquoten; bemerkenswert ist auch die ungleiche Rekrutierung für studentische Hilfskraftstellen. Oder anders ausgedrückt: Soziale Aufsteiger*innen machen seltener Auslandserfahrungen im Studium, die in der wissenschaftlichen Karriere eine immer wichtigere Rolle spielen (Lörz et al. 2016), sie werden auch seltener auf Hilfskraftstellen rekrutiert, die gleichsam als wichtige Sozialisationsinstanz ins wissenschaftliche Feld und daher als ›Sprungbrett für eine wissenschaftliche Karriere‹ betrachtet werden (Schneickert 2013; Jaksztat/Lörz 2018), und brechen insgesamt häufiger ihr Studium ab (Heublein et al. 2017).
Trotz der aus den Befunden recht eindeutig hervorgehenden Schlechterstellung von niedrigeren Sozialgruppen auf allen Stufen einer wissenschaftlichen Laufbahn wäre es zu kurz gegriffen, von einem linearen Zusammenhang zwischen sozialstruktureller Ferne der Herkunft und dem Inklusionsgrad ins Wissenschaftssystem auszugehen. Vielmehr existieren verschiedene »Habitus-Struktur-Konflikt-Konstellationen« (Schmitt 2010: 269), die sich für soziale Aufsteiger*innen im Studium ergeben und mit denen die Betroffenen auf unterschiedliche Art und Weise umgehen. Neben Exklusion, Anpassung oder (Über-)Kompensation kann sich aus der Differenz zwischen Feld und Habitus der Studierenden aus unteren Klassen ebenso die Notwendigkeit einer Neupositionierung im Feld der Hochschule ergeben (Reay et al. 2009). Beispielsweise greifen Akteur*innen auf ihre vorher erworbenen habituellen Strukturen zurück, indem sie einen akademischen Erfolg vor allem durch harte Arbeit, die der Arbeiter*innenklasse zugeschrieben wird, zu erreichen suchen (und damit auch ihre Identität aufwerten, vgl. hierzu auch Lehmann 2009: 639f.). Diese Studierenden
»have developed almost superhuman levels of motivation, resilience and determination, sometimes at the cost of peer group approval. They have managed to achieve considerable success as learners and acquire the self-confidence and self-regulation that accompanies academic success against the odds.« (Reay et al. 2009: 1115)
Erst durch die Verbindung von ›außerordentlichen‹ akademischen Dispositionen und einem sehr reflexiven Habitus werden die Chancen auf einen akademischen Erfolg erhöht. Während die Studierenden für die Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, dankbar sind, positionieren sie sich dennoch kritisch gegenüber der Universität und bemängeln beispielsweise die Homogenität der (anderen) Studierenden. Die befragten Studierenden sind damit zwar Fremde an der Universität, aber vertraute Fremde, da sie das Selbstbild der hegemonialen Norm zugleich nachahmen und spiegeln (ebd.).
Auch Milieustudien über Studierende an deutschen Universitäten zeigen, dass soziale Aufsteiger*innen an der Hochschule keineswegs eine homogene Gruppe darstellen oder sich gleichsam grundsätzlich »fehl am Platz [fühlen] und entsprechend beurteilt werden« (Bourdieu/Passeron 1971: 31), sondern durchaus verschiedene Passungskonstellationen zu den Anforderungen eines Hochschulstudiums mitbringen (Brändle 2019; Hild 2019; Lange-Vester 2015). So zeigen sich beispielsweise neben arrivierten Bildungsaufsteiger*innen, die viel mehr mit Studierenden aus Oberklassenmilieus gemein haben und »keine nennenswerten Akkulturationsprobleme« (Lange-Vester 2015: 118) äußern, ebenso »Bildungsunsichere« aus unterprivilegierten Milieus, die im Hochschulalltag eher unsichtbar bleiben (möchten) und deren Schwierigkeiten im Studium kaum wahrgenommen werden (ebd.: 119).
Neben dieser grundsätzlichen Heterogenität innerhalb der Gruppe der sozialen Aufsteiger*innen sind es ebenso die Fachkulturen und Hochschultypen, die zu ungleichen Zugangschancen und Distributionen führen.
2.1Die Offen- und Geschlossenheit von Fachkulturen
Soziale Aufsteiger*innen und Studierende aus akademischen Herkunftsgruppen sind in den jeweiligen Fächern sehr ungleich repräsentiert. Wissenschaftliche Fachkulturen lassen sich in diesem Zusammenhang als verschiedene soziale Subfelder deuten, als kleine »relativ autonome Mikrokosmen« (Bourdieu 1998: 16), die von unterschiedlichen Logiken und Fachhabitus geprägt sein können (Huber 1991). Auch innerhalb und zwischen den Fächern existiert eine dynamische hierarchisch-angeordnete Beziehungsmatrix (Alheit 2014), die Ausdruck unterschiedlicher symbolischer Kapitalien der einzelnen Fächer ist (Bourdieu 1998). Zum Fachhabitus zählt Friebertshäuser eine »Synthese aus biographisch erworbenen Dispositionen der Studierenden, studentischem Lebensstil, akademischem Selbstverständnis und zukunftsweisendem Professionsverständnis, in dem gesellschaftliche Positionierungen und Zustände präsent sind« (Friebertshäuser 2013: 262). Ebenso wird auf die Distinktionspraktiken des professoralen Fachhabitus verwiesen (Alheit 2014; Knuth 2019) sowie auf epistemologische Logiken (wie die Vier-Felder-Tafel »rein« vs. »angewandt«, »hart« vs. »weich«, Becher 1987). Studierende und besonders Nachwuchswissenschaftler*innen müssen sich in diesen Feldern mit ihren unterschiedlichen Ausgangskapitalien und habituellen Prägungen positionieren und sind daher unterschiedlich an die jeweiligen disziplinären Anforderungen anschlussfähig. Nach Leemann sind (in Anlehnung an Bourdieu)
»in Fachbereichen, die näher beim gesellschaftlich dominierenden Pol verortet sind und die über ein großes Gesamtvolumen an Kapital verfügen, […] natürliche Vertrautheit mit der legitimen Kultur, Sprachgewandtheit, intellektuelle Orientierung und ein gesundes Selbstbewusstsein, kurz gesagt, soziale Kompetenzen wichtig, um sich zu integrieren. Der Besitz von ererbtem kulturellem und ökonomischen Kapital ist bedeutungsvoll, weil die damit verknüpften grundlegenden Einstellungen, die notwendigen Verhaltensweisen und Interessen auf die Erfahrungen einer zeitlich nur langwierig und persönlich anzueignenden Kunst zurückzuführen sind und nicht in objektivierter Form als Lernstoff innerhalb von Bildungsinstitutionen bereit stehen.« (Leemann 2002: 108)
So ziehen prestigeträchtige (und mit hohem Numerus Clausus versehene) Studiengänge wie Medizin eher Kinder aus privilegierten Elternhäusern an. Kinder aus nicht-akademischen Herkunftsfamilien finden sich eher in den angewandten Wissenschaften (wie beispielsweise Lehramtsstudiengänge) und in risikoärmeren, kürzeren Studiengängen wider, weil sie beispielsweise Bildungsfehlinvestitionen vermeiden wollen (Günther 2018) und ihnen die Vertrautheit mit höheren Bildungsinstitutionen und den symbolischen Werten von Bildungsabschlüssen fehlt (Bourdieu et al. 1981: 169). Zudem zeigt sich, dass in prestigeträchtigen Studienfächern wie der Rechtswissenschaft insgesamt hohe Studienabbruchquoten herrschen, wobei auch hier soziale Aufsteiger*innen häufiger als Studierende akademischer Herkunft ihr Studium abbrechen (Heublein et al. 2017).
Die Rechtswissenschaften sind auch in der Professur von einer hohen akademischen Reproduktion geprägt: 79 Prozent stammen aus der gehobenen und hohen sozialen Herkunftsgruppe und lediglich 21 Prozent aus der niedrigen und mittleren8 (Möller 2015). Ähnlich sozial geschlossen erscheint die Medizin mit 72 Prozent aus den beiden oberen Gruppen, gefolgt von Sport (68 Prozent) und Kunst/Musik (66 Prozent). Die These einer relativen Geschlossenheit von Fächern und Professionen, die nahe am gesellschaftlich dominierenden Pol (»old established professions«, Bourdieu 1992) verortet sind, kann daher auch und vor allem anhand der dominanten höheren sozialen Herkunftsgruppen in Jura und Medizin bestätigt werden, während die relative Geschlossenheit im Fach Sport ebenso mit einer gewissen Exklusivität und geringer Promotionsquote und Kunst/Musik eher mit der sozialstrukturellen Nähe zur bürgerlich exklusiven Kultur zu erklären ist. Danach folgen die Ingenieurwissenschaften (62 Prozent), Sprach- und Kulturwissenschaften (61 Prozent), Mathematik und Naturwissenschaften (59 Prozent), Wirtschaftswissenschaften (57 Prozent), Sozial- und Politikwissenschaften (56 Prozent), Psychologie/Erziehungswissenschaft/Sonderpädagogik (54 Prozent) und Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (40 Prozent). Bessere Möglichkeitsstrukturen für soziale Aufsteiger*innen existieren nach Bourdieu,
»je weniger die erforderlichen Fertigkeiten und Dispositionen bei der Produktion und Reproduktion des Wissens (insbesondere beim Erwerb der produktiven Fertigkeiten) Erfahrung gleich welcher Art und intuitive, auf einen längeren Prozess der Vertrautheit beruhende Erkenntnis voraussetzen und je stärker sie formalisiert sind, das heißt, je rationeller – also universeller – sie vermittelt und erworben werden können.« (Bourdieu 1992: 117)
Daher gelte beispielsweise in der Mathematik: »Wenn Sie einen Mathematiker ausstechen wollen, muss es mathematisch gemacht werden, durch einen Beweis oder eine Widerlegung« (Bourdieu 1998: 28). In vielen anderen – vor allem geisteswissenschaftlichen – Fächern ist es »vor allem die persönliche Glaubwürdigkeit des Forschers und die narrative Konsistenz seiner Darstellung, die für die Verlässlichkeit der Resultate bürgen« (Heintz 2000: 224), sodass sozialen Zuschreibungsprozessen und dem Habitus einer Person in sozialen Anerkennungsprozessen der Scientific Community mehr Gewicht zukommt (Krais 2000: 41). Höhere Repräsentanzen von sozialen Aufsteiger*innen in den sozial- und erziehungswissenschaftlichen Disziplinen, die zu den sozial offensten gehören, erscheinen vor diesem Hintergrund hingegen vor allem als Resultat früher Kanalisierungseffekte. In die mit wenig prestigereichen Professionen versehenen Domänen können Aufsteiger*innen leichter vordringen, wobei Pädagogik und weitere sozialwissenschaftliche Fächer seit jeher als Aufstiegsfächer gelten (Schlüter 1992).
2.2Soziale Differenzierung nach Hochschultypen
Von den etwa 2.850.000 Studierenden an deutschen Hochschulen im Wintersemester 2017/18 entfielen etwa 1.750.000 auf Universitäten und fast eine Million auf Fachhochschulen (Statistisches Bundessamt 2018b: 103). Obwohl also die Fachhochschulen ebenso einen großen Anteil der Studierenden ausbilden und sich Universitäten und Fachhochschulen in den letzten Jahren zunehmend annähern9, bezieht sich die Forschung zu herkunftsspezifischen Ungleichheiten an Hochschulen vornehmlich auf Universitäten. Dabei haben sich die Verhältnisse in den letzten Jahren verändert. So hat etwa die Bologna-Reform teilweise zu einer Konvergenz der Bildungsabschlüsse zwischen den Hochschulformen geführt (Enders 2016), indem die formale Unterscheidung zwischen Universitäts- und Fachhochschuldiplom abgeschafft wurde. Zugleich zeigt sich eine Annäherung des Sozialprofils von Studierenden der Fachhochschulen und Universitäten. Auch wenn Universitätsstudierende gegenüber den Fachhochschulstudierenden ein privilegiertes Sozialprofil aufweisen (vgl. Tabelle 1), nehmen diese Unterschiede im Vergleich zu früheren Sozialerhebungen leicht ab.
Tabelle 1: Das Sozialprofil von Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen 2016 in Prozent
Bildungsherkunft*
Universitäten
Fachhochschulen
niedrig
11
14
mittel
31
44
gehoben
30
26
hoch
28
16
Quelle: in Anlehnung an Middendorf et al. 2017: 28.
*Bildungsherkunft: Das Konzept der Bildungsherkunft ist ein neueres Konzept und verwendet lediglich die Bildungsabschlüsse der Eltern (nicht deren Berufspositionen wie bei den ›sozialen Herkunftsgruppen‹). So finden sich in der Bildungsherkunft ›niedrig‹ Familien, in denen zumindest ein Elternteil eine Berufsausbildung erworben hat, in der Gruppe ›mittel‹ haben beide einen (nicht-akademischen) Beruf erlernt. In der Gruppe ›gehoben‹ hat ein Elternteil ein Hochschulstudium absolviert, in der Gruppe ›hoch‹ beide Elternteile (Glossar zur 21. Sozialerhebung: 9f.).
Diese herkunftsspezifischen Differenzen der Hochschulwahl werden vor allem mit Bezug auf Theorien rationaler Wahlentscheidungen erklärt. Noch in früheren Forschungen wurde unter dem Stichwort des »Ablenkungseffektes« auf die kürzeren Ausbildungszeiten an Fachhochschulen und die damit verbundenen geringeren Kosten und Risiken als ein Grund für die Präferenz der Fachhochschule für Arbeiterkinder verwiesen (Müller/Pollak 2016: 353f.). Kosten-Nutzen-Überlegungen werden zwar weiterhin angeführt, beziehen sich hinsichtlich der höheren Fachhochschul-Präferenzen von Arbeiterkindern aber eher auf Argumente einer antizipierten höheren Studienerfolgswahrscheinlichkeit (Reimer/Schindler 2010: 257) sowie einer höheren beruflichen Sicherheit (ebd.: 269). So würde die Wahl der Hochschulform zwar durchaus von schulischen Leistungsdifferenzen, welche herkunftsspezifisch variierten, beeinflusst, indem bessere Noten im Abitur die Wahrscheinlichkeit eines Universitätsstudiums erhöhten. Unabhängig davon aber zeigten sich klassenspezifische Präferenzen hinsichtlich der Hochschulform, sodass mit höherer Klassenzugehörigkeit die Wahrscheinlichkeit eines Universitätsstudium steigen würde (Maaz 2006; Reimer/Schindler 2010: 266). Andere Argumente für die ausgeprägte Neigung zur Fachhochschulwahl von Angehörigen unterprivilegierter Familien beziehen sich auf die Praxisnähe der dort vermittelten Inhalte, die Nähe zur Herkunftsfamilie durch eine breite Standortpräsenz von Fachhochschulen sowie ein habituell vermitteltes persönliches Zugehörigkeitsgefühl zu dieser Institution (Merkel 2015: 39). Dass sich das Masterstudium als neue herkunftsspezifische Selektionsinstanz begreifen lässt, wird als von der Hochschulform unabhängiger Mechanismus angeführt (Auspurg/Hinz 2011). Dennoch würden »Nicht-Akademikerkinder« nach Abschluss des Bachelors auf Fachhochschulen seltener an Universitäten wechseln (Lörz/Neugebauer 2019). Auch nehmen Fachhochschulstudierende im Vergleich zu Universitätsstudierenden seltener ein Masterstudium auf, was mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen der Eltern von Fachhochschulstudierenden zusammenhänge (Roloff 2019).
In qualitativen Studien zu Bildungsaufsteiger*innen finden Fachhochschulstudierende selten Berücksichtigung (Ausnahmen etwa Miethe et al. 2014; Merkel 2015). Evertz und Schmitt (2016) formulieren nach einer explorativen Auswertung von Interviews mit »Studienpionieren« an Fachhochschulen die Hypothese, dass der für die Forschung über Bildungsaufsteiger*innen an Universitäten gängige Befund habitueller Passungsprobleme an Fachhochschulen nicht zu finden sei und dies mit kleineren Seminargrößen, Abholangeboten durch Lehrende und persönliche Foren begründet werden könne. Nicht zurückzuführen sei dieser Befund auf eine quantitative Dominanz von Studienpionier*innen an Fachhochschulen (vgl. ebd.: 176).
Die hier erwähnten Angleichungsdynamiken zwischen den Hochschulformen sollen aber nicht über die weiterhin bestehenden Unterschiede – insbesondere auf Ebene der Hochschullehrenden – hinwegtäuschen. Fachhochschulprofessor*innen haben mit 18 Semesterwochenstunden gegenüber Universitätsprofessor*innen ein deutlich höheres Lehrdeputat bei zudem häufig längeren Vorlesungszeiten (Schiller/Mahmud/Kenkel 2015: 12; Enders 2016: 507) und werden nur selten in höhere Besoldungsgruppen eingestuft (Statistisches Bundesamt 2018a: 36). Zudem weisen Fachhochschulen eine niedrigere finanzielle Ausstattung auf und verfügen kaum über einen akademischen Mittelbau (Enders 2016: 507; Hüther/Krücken 2016: 91). Konterkariert wird die Losung »andersartig, aber gleichwertig« (Enders 2016: 5) von Fachhochschulen und Universitäten nicht nur durch diese objektiven Ungleichheiten. Auch in der Wahrnehmung der Hochschulakteur*innen zeigen sich erhebliche Differenzen des Prestiges zwischen den Hochschulformen, die mit einer symbolischen Abwertung der Fachhochschulprofessur einhergehen (Blome 2017).
Die Karrierewege an Fachhochschulen und Universitäten unterscheiden sich auch hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen. So sind die rechtlichen Anforderungen für die Berufung auf eine Fachhochschulprofessur zum einen bestimmt über die besondere Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten – die wie an Universitäten auch in der Regel über die Promotion nachzuweisen ist. Zum anderen wird eine mehrjährige Berufspraxis vorausgesetzt, welche in den meisten Bundesländern fünf Jahre beträgt und von denen drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs erbracht werden müssen (In der Smitten et al. 2017: 6). In Einzelfällen wird anstatt dessen auch eine Habilitation anerkannt.
Während universitäre Wissenschaftskarrieren verhältnismäßig stark beforscht und prekäre Beschäftigungsverhältnisse hinsichtlich geringer beruflicher Sicherheiten und langen Qualifizierungswegen auch medial thematisiert werden, gilt dies nicht für Fachhochschulkarrieren (ebd.: 3). Auch werden herkunftsspezifische Ungleichheiten an Fachhochschulen auf Ebene der Studierenden seltener und auf Ebene der Professor*innen fast gar nicht erforscht. Sozialstrukturelle Einblicke in die Fachhochschulprofessur gibt Monika Schlegel (2006) in ihrer Dissertation, einer Vollerhebung der Professor*innen von damals sechs staatlichen Fachhochschulen in Niedersachsen. Sie weist, jedoch kaum differenziert nach Kohorten oder Disziplinen, die höchsten Bildungsabschlüsse der Väter und Mütter dieser Professor*innen aus. In ihrem Sample dominieren dabei nicht-akademische Bildungsabschlüsse, wobei nicht der jeweils höchste Bildungsabschluss der Eltern angegeben wird, sondern diese voneinander unabhängig ausgewiesen werden. Bei etwa einem Drittel der Väter und 45 Prozent der Mütter ist dies der Hauptschulabschluss. Fasst man die von Schlegel jeweils angeführten akademischen Abschlüsse zusammen (Hochschulabschlüsse, Promotion, Habilitation), so verfügen etwa 30 Prozent der Väter und 6 Prozent der Mütter der Fachhochschulprofessor*innen über einen akademischen Abschluss (vgl. Schlegel 2006: 64f.).
2.3Zur sozialen Exklusivität der Qualifizierungspassagen und der Professur
Bezogen auf wissenschaftliche Qualifizierungsphasen gilt die Promotion als die erste und wesentliche Zugangspassage in die wissenschaftliche Karriere zur Universitäts- und Fachhochprofessur. Häufig ist die Promotion mit einer Beschäftigung an einer Hochschule verbunden. Sie gilt als besonders selektiv (Lenger 2008). Der Übergang in die Promotionsphase hängt nicht nur mit der unter den Sozialgruppen ungleichen Teilhabe an Hilfskraftstellen zusammen, sondern wird auch von anderen Einflussfaktoren, wie beispielsweise den Promotionsquoten des jeweiligen Studienfachs oder den Noten, beeinflusst (de Vogel 2017; Jaksztat 2014; Jaksztat/Lörz 2018). Kahlert (2016) geht davon aus, dass sich die Bedeutung der Klassenzugehörigkeit im Rahmen wissenschaftlicher Karrieren darin zeigt, dass Gatekeeper in der Rekrutierung von Promovierenden implizit bestimmte Kapitalien wie eine ausgeprägte internationale Orientierung, ideengeschichtliche Bildung und/oder Sprachästhetik bei den Nachwuchswissenschaftler*innen voraussetzen. Die Promotion hat sich über alle Fächer hinweg – trotz ansteigender Promotionsquoten – in den letzten Jahrzehnten zunehmend sozial geschlossen (Jaksztat/Lörz 2018). Diese Geschlossenheit hat sich bis in die Professur verstetigt (Möller 2015).
Hinsichtlich weiterer Qualifikationsstufen, die einer Berufung auf eine Universitätsprofessur vorgelagert sind10, liegen bislang nur wenige Daten hinsichtlich der sozialen Herkunft der Nachwuchswissenschaftler*innen vor (vgl. zusammengefasst in Möller 2015: 49f.).
Eine aktuelle retrospektive Langzeitanalyse zeigt, dass Studierende aus akademischen Haushalten erstens häufiger eine Promotion beginnen, zweitens diese auch häufiger abschließen (24 zu 7 Prozent) und drittens dreimal so häufig eine Post-Doc-Position antreten (3 zu 1 Prozent, Lörz/Schindler 2016: 23). Zwar wird einerseits vermutet, dass vornehmlich auf den vorgelagerten Bildungsstufen nach sozialer Herkunft selektiert wird (ebd., Enders/Bornmann 2001). Andererseits wird anhand aktueller Langzeitanalysen eine zunehmende soziale Schließung beim Übergang zu Post-Doc-Positionen ausgemacht, so dass die Frage aufgeworfen wird, ob sich die Schließungseffekte nicht zunehmend auf spätere Karrierepassagen verlagern (Lörz/Schindler 2016). Inwieweit auch die langjährig unsicheren Karrierewege zur Professur – die nicht erst heute (Berli/Hammann/Reuter 2019), sondern auch bereits zu Max Webers Zeiten aufgrund prekärer Arbeitsbedingungen und unzureichenden Karriereaussichten als Glücksspiel problematisiert wurden (Weber 1919) – zu dieser sozialen Schließung beitragen, wird zunehmend diskutiert (Laufenberg 2016; Möller 2018; Keil 2019).
Auch innerhalb der Professor*innenschaft zeigen sich die Schließungstendenzen: An den NRW-Universitäten stammen die Professor*innen generationenübergreifend mit 34 Prozent am häufigsten aus der hohen sozialen Herkunftsgruppe, während nur 11 Prozent der niedrigen und je rund 27 Prozent den mittleren und gehobenen Herkunftsgruppen angehören (Möller 2015: 192). Der Anteil der Arbeiterkinder unter Professor*innen stieg zwar in Folge der Bildungsexpansionen zunächst an, sank in den jüngeren Geburtskohorten aber erneut ab (ebd.: 213). Bei den so genannten Wissenschaftseliten – verstanden als mit den höchsten wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnete Wissenschaftler*innen (Prestigeelite) sowie als Inhaber*innen exponierter Spitzenpositionen in der Wissenschaft (Positionselite) – zeichnet sich ein noch exklusiveres Szenario ab:
»Zwei von drei Inhabern wissenschaftlicher Elitepositionen in Deutschland sind in Familien aufgewachsen, die den obersten 3,5 Prozent der Gesellschaft angehören, jeder Vierte stammt sogar aus großbürgerlichen Verhältnissen, den obersten 0,5 Prozent der gesamtgesellschaftlichen Hierarchie.« (Graf 2017: 131)
Hingegen sind gerade einmal 2,7 Prozent aller untersuchten Wissenschaftler*innen in einer Arbeiter*innenfamilie aufgewachsen. Darüber hinaus entstammt über die Hälfte einer Akademiker*innenfamilie, hat also familiär schon eine enge Verbindung zur Wissenschaft (ebd.).
Die zunehmenden Berufungen von Professor*innen der hohen Herkunftsgruppe (Anstieg von 30 Prozent auf 38 Prozent in den letzten zwei Jahrzehnten) und der Rückgang von sozialen Aufsteiger*innen aus der niedrigen Gruppe (Rückgang von zwischenzeitlich 13 Prozent in den 1980er Jahren auf 10 Prozent in den 2000er Jahren, Möller 2015: 206) erhöht die Relevanz der Klassenfrage bezüglich der Teilhabe an hoher Bildung und Wissenschaftskarrieren. Auch andere Studien zeichnen für verschiedene Fächer den Trend einer sozialen Schließung in Wissenschaftskarrieren nach (Hartmann 2002; Nagl/Hill 2010). Zudem wird konstatiert, dass soziale Öffnungen auf der Ebene der Studierenden nicht gleichsam automatisiert zu einer Öffnung auf höheren Statuspassagen führt, sondern dort vielmehr Schließungseffekte zeitigen können (Möller/Böning 2018; Blome et al. 2019).
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass soziale Aufsteiger*innen – auch wenn sie eine wissenschaftliche Karriere bewältigt haben – ungleich häufiger eine außerplanmäßige (APL-)Professur11 besetzen als beispielsweise eine C4/W3- oder C3/W2-Professur. So haben insgesamt 17 Prozent aus der niedrigen sozialen Herkunftsgruppe eine APL-Professur, aber nur 11 bzw. 10 Prozent eine C4-/W3- bzw. C3/W2-Professur (Möller 2015: 238). Ebenso sind die Anteile der Professor*innen mit weniger geradlinigen Bildungswegen (z.B. mit Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg nach einer Berufsausbildung) nach einem zwischenzeitlichen Anstieg von rund 4 Prozent auf rund 7 Prozent erneut auf rund 4 Prozent zurückgegangen. Ungerade Bildungswege kommen ungleich häufiger bei Personen der unteren Herkunftsgruppen vor. Diese beginnen im Durchschnitt mit höherem Lebensalter ein Studium und werden mitunter mit einem teils rigiden impliziten Altersbegrenzungsregime (z.B. bei Stipendien, bei der Besetzung von Juniorprofessuren oder bei Verbeamtungen im Falle einer Berufung) konfrontiert (ebd.: 280). Ihre Langstreckenmobilität wird hierdurch zusätzlich erschwert und vorherige Berufsausbildungen (und Erfahrungen außerhalb des sog. Elfenbeinturms) eher abgewertet anstatt anerkannt.
Dem Faktor Zeit wird auch in anderen Studien eine hohe Bedeutung beigemessen: So müssten wissenschaftliche Mitarbeiter*innen aus unteren Statusgruppen häufig mehr Einsatz und Zeit aufwenden, um Karrierestrategien auszubilden, die sie aufgrund ihrer sozialstrukturellen Ferne zu hohen Positionen erst erwerben müssen, wo Personen privilegierter Herkunft gewisse Spielarten für schnellere Reputationsgewinne und für die Akkumulation wissenschaftlichen Kapitals bereits mitbrächten (Hasenjürgen 1996; vgl. auch Grimes/Morris 1997). Aufgrund fehlender Karrierestrategien in der konkurrenzbasierten, hochselektiven Wissenschaftskarriere arrangieren sich soziale Aufsteiger*innen zudem häufiger mit unteren und zuarbeitenden Positionen (Lange-Vester/Teiwes-Kügler 2013).
Der Faktor Zeit wird auch als wichtiges Vorteilsmerkmal in der Juniorprofessur angeführt, die enorm sozial geschlossen ist: Nach dem sozialen Herkunftsgruppenmodell, in denen die Berufspositionen verglichen werden, stammen lediglich je 7 Prozent aus der niedrigen und mittleren Herkunftsgruppe, 24 Prozent aus der gehobenen und 62 Prozent aus der hohen Herkunftsgruppe (Möller 2015: 238; ähnliche Geschlossenheit auch nach Bildungsherkunft bei Zimmer 2018, Burkhardt/Nickel 2015). Zimmer (2018) macht für die soziale Geschlossenheit die hohe Selbständigkeit in einer relativ frühen Karrierephase aus, die sich als begünstigend für Nachkommen der oberen Klassen erweist. Juniorprofessor*innen müssten nicht nur früh nach der Promotion ein Berufungsverfahren erfolgreich durchstehen, sondern auch
»eigenständig einen Lehrstuhl aufbauen und leiten. […]. Die beschriebenen Erfordernisse bedürfen bestimmter Denk- und Handlungsdispositionen, die sich im inkorporierten Habitus manifestieren, klassenspezifisch gebrochen und damit an die (Herkunfts-)Position im sozialen Raum rückgebunden sind. Die Regeln und Wertigkeiten des Bildungssystems im Allgemeinen und des wissenschaftlichen Feldes im Besonderen sind in ihrem Grundtenor abgestimmt auf den Habitus der herrschenden Klassen.« (Ebd.: 126f.)
Zudem profitieren Aufsteiger*innen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Laufbahn seltener von institutionellen (finanziellen und immateriellen) Förderungen (z.B. in Form von Stipendien) (vgl. hierzu auch Middendorff et al. 2009). Auch unter den Professor*innen an den nordrhein-westfälischen Universitäten gaben mehr Professor*innen aus den oberen Herkunftsgruppen an, bei ihrer Promotion und Habilitation eine institutionelle Förderung erhalten zu haben als jene aus unteren (Möller 2015: 291). Die sozialen und ökonomischen Kompensationen liegen zwar bei sozialen Aufsteiger*innen etwas höher als bei Personen aus der hohen Herkunftsgruppe (23 zu 21 Prozent), dagegen erhalten sie mit 22 zu 27 Prozent seltener eine Promotions- und mit 14 zu 18 Prozent auch seltener eine Habilitationsförderung (ebd.).
Diese hier dargestellten (und bisher kaum beachteten) Benachteiligungen für Personen unterer Sozialgruppen lassen sich als Effekte indirekter institutioneller Diskriminierung (Gomolla 2013) fassen, d.h. als jene institutionellen absichtlichen oder auch unabsichtlichen Verfahrensweisen, die Mitglieder bestimmter Gruppen überproportional negativ treffen. Diese Effekte werden zwar in der erziehungswissenschaftlichen Bildungs- und Schulforschung häufiger, im Kontext der Hochschulforschung bislang aber nur recht zögerlich diskutiert. Wenn überhaupt, dann vor allem im Kontext einer intersektionalen Rassismuskritik (Ha 2016; Heitzmann 2019; Mecheril/Klinger 2010), die sich unter der Frage der demokratischen Legitimierung von Wissenschaft und Wissensproduktionen mit der systematischen Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen und Wissensformen beschäftigt. Überlegungen zur institutionellen Diskriminierung im Kontext Hochschule finden sich aber auch in einer stärker arbeitswissenschaftlich geprägten Personal- und Diversityforschung, die angesichts der in Studienbedingungen, Beschäftigungsverhältnissen, Personalauswahlverfahren und Karrieremodellen an Hochschulen eingeschriebenen impliziten Persönlichkeits- und Lebenslaufnormen ebenfalls auf die unterschiedlich dimensionierte Benachteiligung von Personen eingeht (exemplarisch Vedder 2006).
Implizite und daher verdeckte Benachteiligungen durch eine benachteiligende soziale Herkunft hängen auch mit dominanten Diversitätsdiskursen an Hochschulen zusammen. Diese werden bei der Gruppe der Studierenden (Gerhards/Sawert 2018) als auch in wissenschaftlichen Karrieren hauptsächlich auf das Merkmal ›Geschlecht‹ begrenzt (Möller 2017). Andere Faktoren wie soziale Herkunft, Alter, Ethnie, Religionszugehörigkeit oder Behinderung sind eher randständig.
2.4Angekommen an der Spitze und das Leben in zwei Welten
Soziale Aufstiege zur Professur lassen sich häufig als sogenannte »Treppenstufenaufstiege« (Schmeiser 1996) verstehen: Von vornherein wird nicht das große Ziel ›Professur‹, sondern immer nur die nächste Stufe bzw. die nächste Statuspassage anvisiert, weil die Professur als Position zu unrealistisch und als »fern der Vorstellungskraft« (Böning/Möller 2019: 74) erscheint. Hierbei wirken habituelle Selbstbegrenzungen aufgrund der Statusdistanz zwischen der Herkunft und einer Führungsposition in der Wissenschaft (ebd.).12 Retrospektive Analysen bringen zudem zutage, dass sich bei den Aufsteiger*innen nicht primär intendierte Aufstiegsmotive im Sinne eines Strebens nach Macht und ökonomischem Reichtum finden. Vielmehr machten sie sich aus einem starken Veränderungs- und Autonomiebedürfnis heraus auf den Weg ›nach oben‹, ohne langfristige Ziele im Blick zu haben. »Die persönliche Weiterentwicklung, die Ausweitung von Denk- und Handlungsspielräumen, das Streben nach Wissen, ästhetischen Erlebnissen oder moralischen Ansprüchen usw. bilden in den Aufstiegsbiographien zentrale Ankerpunkte« (El-Mafaalani 2012: 325), sodass sich zwar hoher Fleiß und Anstrengung, aber kaum Aufstiegspläne und -strategien rekonstruieren lassen, was angesichts des fehlenden familiären Wissens über einen realistischen Aufstieg durch die Institutionen nicht verwundern mag (ebd.: 325f.).
Korrespondierend damit kommen ermutigenden Unterstützungspersonen und sozialen Netzen eine enorme Bedeutung zu: So können wissenschaftliche Mentor*innen und Betreuer*innen als »soziale Paten« (ebd.) fungieren und »in freiwilliger Verpflichtung in loco parentis jene Funktionen wahrnehmen, (vgl. auch Alheit/Schömer) die die leiblichen Eltern […] nicht wahrnehmen können« (Schmeiser 1996: 140; Alheit/Schömer 2003: 420). Auch unter den nordrhein-westfälischen Professor*innen messen jene aus unteren Sozialgruppen rückblickend ihrem jeweiligen Doktorvater bzw. ihrer jeweiligen Doktormutter eine höhere Bedeutung im Prozess der Wissenschaftskarriere zu als Professor*innen aus oberen Sozialgruppen (Möller 2015: 295).13
In den letzten Jahren mehren sich Autobiographien von Bildungsaufsteiger*innen mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, die sich in hohen Positionen befinden und sich mit Klassenübergängen sowie deren Bedingungen wie Folgen befassen. Verbreitung fanden vor allem literarische Sozioanalysen wie die bereits angeführte von Didier Eribon (2016) und weitere wie von Annie Ernaux (2018) und Édouard Louis (2016) im französischen Raum oder die im deutschsprachigen Raum erschienenen biographischen Darstellungen von Oskar Negt (2016), Ahmet Toprak (2017) oder Jürgen Prott (2018). Sie thematisieren nicht nur strukturelle Hindernisse beim sozialen Aufstieg, sondern auch die damit verbundenen Emotionen und Konfliktlagen.
Soziologische Arbeiten verwiesen bereits auf zwischen den sozialen Klassen vorhandene Distinktionsgefühle (Burkhart 2007), auf soziale Scham (Neckel 1991) und die hidden injuries unterer Klassen (Sennett/Cobb 1973). Sie knüpfen häufig an die klassentheoretischen Konzepte Bourdieus an und erweitern sie um emotionssoziologische Erkenntnisse, die als Affekte und stabile Ressentiments bestehende Herrschaftsverhältnisse stabilisieren. Sie machen deutlich, dass Herrschaftsverhältnisse auf eine »emotionale Fundierung durch Distinktionsgefühle angewiesen [sind] und damit auch wirkungsvoller legitimiert« (Burkhart 2007: 159) werden. Hierbei sind vor allem Bindungsgefühle innerhalb von Klassen, Gefühle der Unter- und Überlegenheit (z.B. Stolz und Scham, Verachtung und Neid) und Abgrenzungsgefühle als Ausdruck von Klassendistanzen gemeint, die gerade in modernen Konkurrenzgesellschaften auftreten, in denen das meritokratische Ideal stark ausgeprägt ist (ebd.). »Distinktionsgefühle sind Gefühle, die soziale Abgrenzungen als ›natürlich‹ legitimieren helfen, weil sie den Eindruck vermitteln, man stünde auf ganz selbstverständliche Weise an seinem jeweiligen Platz im Statusgefüge der Gesellschaft.« (Ebd.: 164) Neckel verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die gesellschaftliche Wirksamkeit von sozialer Scham und gesellschaftlichen Bewertungssystemen, die stigmatisierende Effekte erzeugen, da sie z.B. »Unterlegenheitsgefühle bei denjenigen [verursachen], deren soziale Lage, Lebensform oder Kompetenz vor dem Hintergrund geltender Normen als persönlich minderwertig charakterisiert wird« (2008: 24). Untere Klassen sind daher permanent mit einer symbolischen Gewalt bzw. Herrschaft (Bourdieu/Passeron 1973; Schmidt/Woltersdorf 2008) konfrontiert, die sich auf eine »inkorporierte Wertehierarchie« (Rehbein et al. 2015: 15) stützt, welche mal mehr oder weniger explizit erfahrbar wird.
»Jede Macht zu symbolischer Gewalt, d.h. jede Macht, der es gelingt, Bedeutungen durchzusetzen und sie als legitim durchzusetzen, indem sie die Kräfteverhältnisse verschleiert, die ihrer Kraft zugrunde liegen, fügt diesen Kräfteverhältnissen ihre eigene, d.h. eigentlich symbolische Kraft hinzu.« (Bourdieu/Passeron 1973: 12)
Als hidden injuries of class deuteten Sennett und Cobb (1972) das Dilemma US-amerikanischer Arbeiter*innen in den 1970er Jahren, die ihre eigene Herkunft und damit verbundene Werte und Zugehörigkeiten verleugnen mussten, um sozial aufsteigen zu können (vgl. auch Wakeling 2010). Ähnliche Erfahrungen mit sozialer Scham thematisiert auch Eribon, wenn er als heutiges Mitglied der akademischen Intelligenz über die eigene Herkunft als Arbeiterkind aus Reims nachdenkt:
»›Warum bin ich, der ich so große soziale Scham empfunden habe, Herkunftsscham, wenn ich in Paris Leute aus ganz anderen sozialen Milieus kennenlernte und sie über meine Klassenherkunft entweder belog oder mich zu dieser nur in größter Verlegenheit bekannte, warum also bin ich nie auf die Idee gekommen, dieses Problem in einem Buch oder Aufsatz anzugehen?‹ Sagen wir es so: Es war mir leichter gefallen, über sexuelle Scham zu schreiben als über soziale.« (2016: 19)
Die Ambivalenz zwischen Zugehörigkeitsgefühlen zum Herkunftsmilieu sowie (mitunter reziproken) Abstoßungseffekten und Entfremdungsprozessen vom Herkunftsmilieu, aus dem man sich mehr oder weniger entfernt (Jaquet 2018: 78), erweist sich häufig bereits während des Studiums als strukturelle und emotionale Herausforderung (Spiegler 2015; Schmitt 2010; King 2008; Truschkat 2002), insbesondere dann, wenn Haltepunkte und Beziehungen im neuen Milieu, in das man aufstrebt, fragil bleiben (El-Mafaalani 2012). Studien über Habitustransformationen, d.h. langfristige Veränderungen der Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungshorizonte, die für einen sozialen Aufstieg nötig werden, zeigen, dass die damit verbundenen Persönlichkeitsveränderungen mitunter Konflikte mit Eltern und anderen Familienmitgliedern bedeuten und zu unterschiedlichen Graden von Verwerfungen führen können (ebd.).14 El-Mafaalani zeichnet hierzu zwei Modi der Habitustransformationen im Aufstiegsprozess nach. Beim Modus empraktischer Synthesen werden alte und neue Praxismuster »in Beziehung gesetzt […] und Differenzen durch Ausbalancieren bewältigt« (El-Mafaalani 2015: 80). Hierbei werden »kreative Mittelwege« (ebd.) gesucht, um die Konflikthaftigkeit abzumildern. Beim Modus der reflexiven Opposition dominiert ein selbstbewusstes »In-Opposition-Treten« (ebd.) gegen das Herkunftsmilieu. Beide Modi werden gewöhnlich in drei Phasen modelliert: Während in der Phase der Irritation »habituelle Grenzerfahrungen« (ebd.: 79), z.B. bei akuten biographischen Krisen oder bei biographisch relevanten Entscheidungen, gesammelt werden, sodass bisherige Praxismuster verändert und neu angepasst werden müssen, erfolgt in der Phase der Distanzierung die Ausbildung neuer Praxisformen und neuer sozialer Bezüge, die gewöhnlich mit einer mehr oder minder großen Distanzierung zum Herkunftsmilieu einhergehen. Aber erst in der Phase der Stabilisierung, d.h. beim weit fortgeschrittenen oder bereits gesicherten Aufstieg, werden »spezifische Formen im Umgang mit der eigenen Herkunft« entwickelt (ebd.: 82; vgl. auch El-Mafaalani in diesem Band).15 In explorativen Interviews mit Professor*innen der Rechts-, Sozial- und Erziehungswissenschaften zeigte sich, dass vor allem Frauen zum Teil noch größeren Vorbehalten ausgesetzt sind, wenn sie die von der Familie eher begrenzten Selbstverwirklichungsvorstellungen durch den Erwerb des Doktortitels und durch die Berufung auf eine Professur übersteigen. Das Durchbrechen dieser Klassengrenzen »führte zu Sanktionen in Form von fehlender Unterstützung und Ermutigung bis hin zu Ignoranz, Verleugnung der Bildungstitel und offener Feindseligkeit« (Böning/Möller 2019: 77f.).
Neben der beschriebenen zum Teil schmerzlichen Loslösung aus dem gewohnten Milieu und den damit einhergehenden Verlusten von Freundschaften wie Familienbeziehungen sowie aufkeimenden Fremdheitsgefühlen im Feld der Bildung zeigt eine Analyse von autobiographischen Essays von Akademiker*innen aus der Arbeiter*innenklasse, die über einen Zeitraum von 32 Jahren veröffentlicht wurden, dauerhafte Herausforderungen beim sozialen (Langstrecken-)Aufstieg (Warnock 2016). Diese erstrecken sich beispielsweise von der Erfahrung des ungleichen kulturellen Kapitalbesitzes gegenüber anderen Akademiker*innen (beispielsweise Sprache, Kommunikationsverhalten, Dresscodes und Wissen um herrschende Stereotype) und damit verbundenen Mikroaggressionen, über ein starkes Bewusstsein gegenüber Ausbeutungsverhältnissen und Schuldkomplexen gegenüber Nicht-Aufgestiegenen bis hin zum sogenannten Hochstapler- oder Impostor-Syndrom. Bei diesem zweifeln die betroffenen Personen trotz Leistungserfolgen an ihren Fähigkeiten und leben mit der Angst, dass andere ihre, ihnen vermeintlich nicht zustehenden, Erfolge und Positionen ›entlarven‹ und ihnen Anerkennung entzogen wird. Für diese soziokulturellen Akkulturationsleistungen und Balanceakte zwischen den Klassen und eine damit möglicherweise verbundene langfristige ›habituelle Heimatlosigkeit‹ werden mitunter ausgeprägte Ambiguitäts- und Trennungskompetenzen benötigt (El-Mafaalani 2012).
Aus dem von Spannungen und Widersprüchen beherrschten »gespaltenen Habitus« (Bourdieu 2002: 116) kann auch der Anspruch entstehen, »gleichzeitig anspruchsvoll und ›bescheiden‹ Wissenschaft zu betreiben« (ebd.), wie es Bourdieu in seinem soziologischen Selbstversuch beschreibt.
»Vielleicht ist in diesem Fall gerade die Tatsache, aus jenen Klassen zu kommen, deren Lebensverhältnisse man gerne ›bescheiden‹ nennt, für bestimmte Fähigkeiten verantwortlich, die in Handbüchern der Methodologie nicht gelehrt werden: das Fehlen einer jeden Geringschätzung für empirische Genauigkeit, eine Aufmerksamkeit für die scheinbar nebensächlichsten und ›minderwertigsten‹ Untersuchungsgegenstände, […] ein Aristokratismus der Zurückhaltung, der in eine Mißachtung aller Erwartungen an jene intellektuelle Brillanz mündet, wie sie von an akademischen Institutionen und heute in den Medien belohnt werden.« (Ebd.: 116f.)
Es entstehen womöglich besondere Kompetenzen, Interessen, Feinfühligkeiten, Motivationen und Möglichkeiten des Verstehens, die anderen, die diese ›beiden Welten‹ nicht kennen, nicht oder zumindest weniger gegeben sind (vgl. Grabau 2020). Soziale Aufsteiger*innen stellen dann in dieser Perspektive – ähnlich wie Personen unterschiedlicher Geschlechter, Ethnien, Altersgruppen o.ä. – eine Bereicherung für die Erkenntniswelt der Wissenschaft dar. Entgegen dem allgemeinen Ethos einer Neutralität und Objektivität verpflichteten Wissenschaft zeigt sich vielmehr, dass Forschende und Lehrende unterschiedliche Perspektiven, Standpunkte und Motive einnehmen und diese von »Faktoren wie Alter, Geschlecht, soziale Lage [und] biographische Erfahrungen der Forschenden« durchaus beeinflusst sein können (Friebertshäuser 2013: 272). Bei ihrem Vergleich von Akademiker- und Arbeiterkindern an der Universität stellte Haas beispielsweise heraus, dass Arbeiterkinder »die vorrangig krisenreicheren und verunsichernden Werdegänge« bei entsprechenden Reflexionsleistungen zu einem Vorteil ausbauen können, indem sie in der Lage seien, »mehr Flexibilität und schnellere Umstellungsleistungen gerade in Krisensituationen zu erbringen« (1999: 234). Ferner zeigen Arbeiterkinder, wie zuvor bereits erwähnt wurde, zum Teil eine starke Reflexionskraft hinsichtlich ihrer eigenen Rolle im Bildungssystem (Reay et al. 2009).
Auch Bourdieu stellt einen Zusammenhang her zwischen seiner Herkunft aus der französischen Provinz im Südwesten Frankreichs und der sozialstrukturellen Ferne zu den Pariser Intellektuellen, seiner kritischen Positionierung zum wissenschaftlichen Feld und seiner Verteidigungshaltung für »die Autonomie der Forschung gegen die gesellschaftlichen Moden« (Bourdieu 2001: 176f.), indem er dies auf eine »Neigung« zurückführt,
»immer auf der Gegenspur, immer gegenläufig zu sein. […] Dieser Widerspruchsgeist hängt wahrscheinlich mit meinem sozialen Werdegang zusammen, mit meinen sozialen Wurzeln, sogar meiner regionalen Herkunft. […] Die Tatsache, Provinzler zu sein, einerseits freiwillig und andererseits erzwungenermaßen schlecht in die Pariser Welt integriert zu sein, all das ist sicherlich sehr wichtig.« (Ebd.)
Hier zeigt sich zum Teil etwas, was in der Forschungsliteratur häufig unter dem Stichwort des ›erkenntnistheoretischen Bruchs‹ gefordert wird: eine Distanz zum Feld aufzubauen, um die eigene Position im akademischen Raum zu hinterfragen und damit zusammenhängend über die sozialen Bedingungen der eigenen Klassifikationskriterien und Werturteile nachzudenken. So reflektiert Bourdieu in einem Interview aus dem Jahr 1992:
»Ich versuche wie viele Intellektuelle der ersten Generation, die zwei Seiten meines Lebens zusammenzubringen. Andere versuchen es mit anderen Mitteln – sie finden die Lösung z.B. im politischen Handeln, einer Art sozialer Rationalisierung. Mein Hauptproblem ist zu verstehen, was mit mir passiert ist. Meine Laufbahn erscheint mir wie ein Wunder – ein Aufstieg zu einem Platz, wo ich nicht hingehöre. Und dazu, wie es mir möglich ist, in einer Welt zu leben, die nicht meine ist, muss ich beides verstehen: was es heißt, einen akademischen Verstand zu haben – wie so etwas erzeugt wird –, und zugleich, was bei dessen Erwerb verloren ging. Und obgleich mein Werk – mein gesamtes Werk – eine Art Autobiographie ist, so ist es aus diesem Grunde doch auch ein Werk für Menschen mit einem ähnlichen Werdegang und einem ähnlichen Bedürfnis zu verstehen.« (Bourdieu [1992] 2012: 59)
Die soziale Mobilität von Aufsteiger*innen kann also eine psychologische Beweglichkeit mit sich bringen, wie es Georg Simmel ([1908] 1958) und Robert Ezra Park (1937) in ihren Soziologien des Fremden hervorgehoben haben.16 Inwiefern solche Tugenden im wissenschaftlichen Feld auf Anerkennung stoßen, bleibt in den Studien jedoch zumeist offen.
3.Kontingenzgeschichten und soziale Reproduktion – Zum Aufbau des Buches
Hier setzt unser Buch an, das gezielt die Aufsteiger*innen in der Wissenschaft zu Wort kommen lässt, die mit eigenen Worten ihren Weg an die Hochschule und die damit verbundenen persönlichen Herausforderungen schildern. Der im Titel des Buches plakativ benutzte Begriff des ›Arbeiterkindes‹ wird von einigen der Biograph*innen als Selbstbezeichnung relativ selbstverständlich aufgegriffen, andere grenzen sich bewusst von ihm ab, weil er ihnen für die Charakterisierung des nicht-akademischen Herkunftsmilieus, das nicht allein aus Berufsgruppen auf dem Niveau gering bezahlter Lohnarbeit besteht, zu undifferenziert erscheint. Manche empfinden den Begriff sogar als Stigma, weil er abwertend, disqualifizierend wirkt. Der Begriff zwingt zum Hinschauen, er irritiert und regt zum Nachdenken an und genau in dieser ›befremdenden‹ Hinsicht haben wir ihn für das vorliegende Buch eingesetzt. Er fungiert daher weniger als deskriptiver noch analytischer Begriff, sondern eher als Sammelbegriff für soziale Aufsteiger*innen aus unterschiedlichen Herkunftsmilieus, deren (kleinster) gemeinsamer Nenner ist, dass keine*r der Elternteile einen Hochschulabschluss aufweist. Die Geschichten, die sie für unser Buch erstmals in dieser Form erzählen, zeigen, wie der Bildungsaufstieg zugleich auch Klassenübertritt bedeutet und wie unterschiedlich dieser erlebt wird: Für manche ist der Schritt aus dem Herkunftsmilieu hinaus in die akademische Welt gefühlt weniger groß, für andere ein regelrechter Wechsel des Universums, das sich im Gefühl der Fremdheit niederschlägt, dessen Abbau zur Lebensaufgabe wird. Nicht allein deshalb, sondern auch aufgrund der zum Teil recht unterschiedlichen Herkunftskontexte und Erfahrungen, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass das ›Arbeiterkind‹ keine eindeutige Kategorie, sondern eine Konstruktion ist, die in Diskursen unterschiedlich Verwendung findet (Boger 2015). Es wäre daher fahrlässig, ›Arbeiterkindern‹ aufgrund ihrer ähnlichen sozialen Eingruppierung eine geteilte ›Heimat‹ oder Gruppenidentität zu attestieren, ebenso wie es in der neuen akademischen Heimat keine geteilte Identität von Professor*innen mit Arbeiter*innenhintergrund gibt. Entsprechend schwer fiel es unseren Autor*innen, sich durch unser Anschreiben dieser vermeintlichen Professor*innengruppe zuordnen zu lassen, da es bislang weder eine politisch initiierte noch gefühlte Solidarität von Professor*innen als Arbeiterkinder an Universitäten gibt. Ferner sind Professor*innen aus statusniedrigen Klassen per se keine ›besseren‹ Forscher*innen, Dozierende oder Wissenschaftler*innen. Es bedeutet auch nicht, dass sie nach dem Aufstieg Studierende aus unteren Klassen grundsätzlich besser verstehen können. Dennoch: »[T]he success of first-generation college students who enter the professoriate can contribute to the success of accessibility initiatives for successive generations of students.« (Kniffin 2007: 50)





























