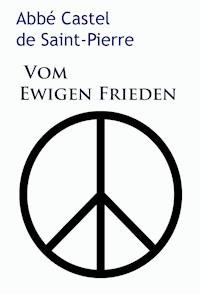
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Sprache: Deutsch
Was aber dem Werke Saint-Pierre einen besonderen Platz innerhalb der gesamten Literatur über den ewigen Frieden zu sichern scheint, das ist die ungeheure Energie, mit der er den Stoff erfaßt und als ein breit ausgearbeitetes System den Zeitgenossen vorgelegt hat. Es gibt wahrscheinlich keine andere Schrift von gleicher Ausführlichkeit über dasselbe Thema. Saint-Pierre war ein Fünfziger, als der Plan des Werkes in seinem Geiste entstand. Von da an hat er über drei Jahrzehnte lang dafür geeifert, geschrieben, gekämpft, er hat die Gelehrten wie die Staatsmänner dafür zu gewinnen gesucht und hat geduldig ihren Spott ertragen, ohne an seiner Sache jemals irre zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
w
Der Traktat
Vom ewigen Frieden
1713
Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Wolfgang Michael
Deutsche Bearbeitung von Friedrich v. Oppeln-Bronikowski
idb
ISBN 9783961505777
Einleitung.
Der beglückende Traum vom Frieden auf Erden ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Die antiken Dichter haben, in ihrem Wunsche, das, was nie gewesen, dennoch als Wirklichkeit erscheinen zu lassen, ein goldenes Zeitalter gemalt, darin es nicht Helm, nicht Schwert gab,
»... und sorglos lebten und friedsam Ohne des Kriegers Bedarf in behaglicher Ruhe die Völker.«
Auch die edelsten Geister des Mittelalters und der Neuzeit haben der großen Frage ihre Teilnahme gewidmet. Dante meint, das Kaisertum müsse es sein, das, indem es den ganzen Erdball umspanne, den Menschen auch den Weltfrieden gebe. Kant fordert einen Föderalismus freier Staaten, der sich allmählich auf alle erstrecken und endlich zum ewigen Frieden führen möge.
Das Ziel ist bis heute nicht erreicht. Denn auch durch die ernsthaften Versuche der Staatsmänner scheint es der Verwirklichung kaum näher gebracht zu sein.
So wird die friedensbedürftige Menschheit immer von neuem hingewiesen nicht allein auf das Studium des historischen Lebens, sondern auch auf die Vertiefung in jene so zahlreichen Schriften, die im Laufe der Jahrhunderte dem Thema vom ewigen Frieden gewidmet worden sind. Ihre Lehren, ihre Gründe, vor allem ihre Irrtümer gilt es kennen zu lernen, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu ermessen, die der Lösung des Problems im Wege stehen.
Eine dieser Schriften, die Arbeit eines Franzosen, ist es, die hier dem deutschen Publikum vorgelegt wird. Die Bedeutung derselben im Rahmen der Geschichte ihrer Zeit darzulegen, soll die Aufgabe der folgenden einleitenden Abschnitte sein.
***
Das einst so viel genannte Friedensprojekt des Abbé Saint-Pierre ist heute fast vergessen. In allen seinen Teilen und Ausgaben ist es kaum noch auf einigen öffentlichen Bibliotheken vollständig zu finden. Und nicht als eine schöpferische Leistung verdient es der Vergessenheit entrissen zu werden. Es ist überhaupt nicht schöpferisch, es wiederholt, es erweitert, es umschreibt nur fremde Ideen, und endlich erklärt der Autor selbst, er wolle nur eine vor seiner Zeit berühmtere Behandlung desselben Themas zum Allgemeingut machen. Auch von künstlerischer Darstellung ist nicht viel zu spüren. Saint-Pierre ist zwar einer der fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, aber sein literarisches Können tritt in keinem seiner Werke weniger zutage als in diesem. Und was vollends den praktischen Erfolg seines Planes betrifft, so haben die Staatsmänner der Epoche kaum Notiz davon genommen. Der Versuch, ihn zu verwirklichen, ist nie gemacht worden, und selbst bei den großen Schriftstellern des Aufklärungszeitalters, die doch allen Fragen des Staates und der Gesellschaft so kritisch gegenüberstanden, sie so gründlich zu durchleuchten, die alle Neuerungsvorschläge so begierig zu ergreifen pflegten, auch bei ihnen hat der Plan Saint-Pierres mehr Staunen als Bewunderung erregt und meist nur lächelnde Ablehnung gefunden.
Was aber dem Werke Saint-Pierre einen besonderen Platz innerhalb der gesamten Literatur über den ewigen Frieden zu sichern scheint, das ist die ungeheure Energie, mit der er den Stoff erfaßt und als ein breit ausgearbeitetes System den Zeitgenossen vorgelegt hat. Es gibt wahrscheinlich keine andere Schrift von gleicher Ausführlichkeit über dasselbe Thema. Saint-Pierre war ein Fünfziger, als der Plan des Werkes in seinem Geiste entstand. Von da an hat er über drei Jahrzehnte lang dafür geeifert, geschrieben, gekämpft, er hat die Gelehrten wie die Staatsmänner dafür zu gewinnen gesucht und hat geduldig ihren Spott ertragen, ohne an seiner Sache jemals irre zu werden. Und so vielen anderen Gegenständen er auch seine nie rastende Feder noch geliehen hat, immer wieder kommt das große Projekt zum Vorschein. Er ward nicht müde, es der Welt als das Allheilmittel anzupreisen, so lange, bis der Tod dem Fünfundachtzigjährigen die Feder aus der Hand nahm.
***
Europa stand, als man 1712 von dem Plane Saint-Pierres zum ersten Male hörte, am Ende eines Kriegszeitalters. Seit mehr als vier Jahrzehnten war der Friede immer wieder gestört worden durch den Ehrgeiz Ludwigs XIV. und die Vergrößerungsabsichten der französischen Nation. Die absolute Monarchie hatte die Kräfte Frankreichs gesammelt und in einer Reihe von Kriegen und Friedensschlüssen das Staatsgebiet ausgedehnt, abgerundet, militärisch gesichert. Dieses Frankreich, mit seinen Armeen von Hunderttausenden, den besten Truppen der Zeit, mit dem eisernen Gürtel der Vaubanschen Festungen an seinen Grenzen im Süden, im Osten und im Norden, geführt von dem Einen, dem die besten Köpfe der Nation als seine Diener und Gehilfen zur Seite standen, war unstreitig die erste Macht der Zeit. Aber es hatte auch den Widerstand des gesamten Weltteils herausgefordert. Seit 1688 hatten sich, geführt von dem Oranier Wilhelm III., dem Staatsoberhaupte beider Seemächte, Koalitionen gebildet, um dem lastenden Übergewicht Frankreichs und seiner gefährlichen Eroberungssucht entgegenzutreten. 1697 war der Friede zu Rijswijk geschlossen worden, der den Wendepunkt bezeichnet, dessen Bedeutung ein deutscher Historiker in die Worte gefaßt hat: »Nach mehreren Jahrzehnten kehrten französische Heere zum ersten Male aus einem Feldzuge heim, ohne ihrem Könige die Schlüssel gewonnener Festungen und die Huldigungen eroberter Provinzen zu überliefern.« Aber die kurzen Jahre des Friedens, welche folgten, galten nur der Sammlung der Kräfte zu neuem Kampfe. Als der letzte der spanischen Habsburger starb, entzündete sich durch die allerseits erhobenen Ansprüche auf die Erbschaft ein wahrer Weltkrieg. Er ist in vielen Ländern Europas und jenseits des Atlantischen Ozeans geführt worden, er hat der Macht Frankreichs die ersten schweren Niederlagen gebracht. Ludwig XIV. hat sich zum Verzicht auf manchen seiner stolzen Pläne bequemt, und die ersten Friedensverhandlungen führten nur deshalb nicht zum Ziel, weil seine Gegner ihre Forderungen überspannten. Aber das Schicksal selbst fällt ihnen in den Arm und mahnt sie zur Mäßigung. Der Stimmungsumschwung im englischen Volke, der die dem Frieden geneigte Partei der Tories ans Ruder bringt, der Tod Josephs I., der die Reiche der österreichischen wie der spanischen Habsburger wieder, wie in Karls V. Zeiten, in eine Hand bringen zu sollen scheint, das waren die Ereignisse, die den sinkenden Stern Frankreichs vor dem Verlöschen bewahrten. In dieser Lage der Dinge begannen die Utrechter Friedensverhandlungen. Und das war auch die Zeit, wo unser Abbé Saint-Pierre zum erstenmal einen Einblick erhielt in das diplomatische Treiben. Wir dürfen ihn uns vorstellen, wie er zwar mit gespannter Aufmerksamkeit, aber doch ohne tieferes Verständnis dem Schauspiel beiwohnte, wie das, was er vernahm, gerade hinreichte, um ihm eine oberflächliche Kenntnis des Staatenlebens zu verschaffen und ihn den großartigen Gedanken eines auf ewige Zelten vorhaltenden Friedens unter den Völkern fassen zu lassen, während doch die Natur der Staaten damals wie zu anderen Zeiten eine ganz andere war, als wie sie sich im Kopfe eines Saint-Pierre malte.
***
Treten wir der Person unseres Autors ein wenig näher. Charles-François – er selbst nannte sich seit seiner Konfirmation nur noch vielversprechend Charles-Irénée – Castel von Saint-Pierre, der Sprößling einer alten normännischen Adelsfamilie, war am 13. Februar 1658 geboren in dem kleinen Orte Saint-Pierre-Eglise, der zwischen Cherbourg und Barfleur in der Normandie gelegen ist. Als jüngerer Sohn des Hauses hätte er zwischen dem Stande des Geistlichen und des Offiziers zu wählen gehabt, wäre ihm nicht die militärische Laufbahn durch seine zarte Gesundheit verschlossen gewesen. Aber dieser Mann im geistlichen Gewande, wie die Welt ihn sah, hatte sich innerlich früh vom Katholizismus, ja von jeglicher Religion kühl losgesagt. Wissenschaft in jeglicher Gestalt war es, die ihn anzog und der er sich widmete. Die Naturwissenschaften halten ihn nicht lange fest, er wendet sich der Sittenlehre zu, aber neben dieser ist es die Politik, die Lehre vom Staat und der Gesellschaft, der er sich mit völliger Hingebung, ja mit wahrer Leidenschaft widmete und die ihn sein ganzes langes Leben hindurch in ihren Fesseln gehalten hat. Werfen wir schon hier einen Blick auf die ungeheure Zahl und Mannigfaltigkeit der Schriften, die er während seines langen Lebens verfaßt hat, so ist allen gemeinsam die Liebe zur Menschheit, der Wunsch, sie zu erretten aus aller Not. Nicht als Geistlicher will er den Weg weisen zum Heil der Seelen: hienieden will er helfen als irdischer Reformer, er ergreift das Wort über alle Verhältnisse seiner Mitmenschen, über Steuern und Finanzen, über Sprache und Rechtschreibung, über Erziehung und Armenpflege, über die Regierung des Staates und seine Beziehungen zum Auslande, über alles, was nur die Schriftsteller der Aufklärung behandeln, denn er selbst ist einer der frühesten und vielseitigsten aus der ganzen Schar.
Sein Verkehr in dem berühmten Salon der Frau von Lambert öffnete ihm die Pforten der französischen Akademie, eine Stelle bei Hofe sollte ihm Einblick gewähren in das Leben der Großen. Er ward 1692 der erste Almosenier von Madame, d. h. der Herzogin von Orleans, der Schwägerin des Königs. Die hohe Frau, der er also nahe trat, war keine andere als Elisabeth Charlotte, die berühmte pfälzische Prinzessin und Briefschreiberin, deren freundliche und kluge Art auch Saint-Pierre immer wieder rühmen mußte. Aber noch wichtiger war ihm die Berührung mit dem höchsten Kreise der französischen Gesellschaft. »Ich habe,« schrieb er später scherzend an Frau von Lambert, »nur eine kleine Loge gekauft, um aus nächster Nähe die Schauspieler beobachten zu können, die oft, ohne es zu wissen, auf dem Welttheater jene für die anderen so wichtigen Rollen agieren.«
So hat er sich mit den verschiedensten Kreisen der französischen Gesellschaft, hinauf bis zur höchsten Sphäre, am wenigsten wohl mit ihren untersten Schichten, vertraut gemacht. Er will alles schauen, kennen lernen und kritisieren. So wagt er es auch, als zufälliger Teilnehmer an den Utrechter Verhandlungen den dilettantischen Vorschlag zu machen, nicht nur für dieses Mal Frieden zu schließen, sondern das Kriegführen gleich für alle Zeiten aus der Welt zu schaffen.
***
Die dem Aufklärungszeitalter eigene Leidenschaft der Kritik beginnt schon unter Ludwig XIV. die Geister zu erfüllen. Die Stimme Saint-Pierres ist nur eine einzelne aus dem bald immer stärker anschwellenden Chor. Auf politischem, aus religiösem, auf wirtschaftlichem Gebiete hat diese Kritik sich bemerkbar gemacht. Sie tritt noch nicht so offen, so ungeschminkt hervor, wie nachher in der Zeit der großen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, sie vermeidet es oft noch, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen, die Autoren verbergen sich gern hinter Pseudonymen, und an die hohe Figur des Herrschers wagen sie sich kaum heran.
Von den Fragen der inneren und der Kirchenpolitik brauchen wir hier nicht zu reden. Auch die Schriften, in denen Vauban und Boisguillebert das herrschende Wirtschaftssystem kritisierten, interessieren uns nicht. Die große auswärtige Politik, die vielen Kriege mit ihren verhängnisvollen Folgen, sie sind das wichtigere Thema. Fénelon ist der erste berühmte Schriftsteller, der es behandelt. Freilich kommt es ihm nicht in den Sinn, um das gleich hervorzuheben, den Krieg an sich verwerflich zu finden. Ein Verteidiger des ewigen Friedens ist Fénelon nicht gewesen, nur ein Verurteiler des ungerechten Krieges und der Eitelkeit der Fürsten. Diesen Gedanken hat Fénelon, der Prinzenerzieher, in seinen Gesprächen der Toten oft zum Ausdruck gebracht. Er läßt etwa die Schatten zweier Könige, Heinrichs III. und Heinrichs IV., einander begegnen. Beide haben zu ihren Lebzeiten Kriege geführt und rühmen sich ihrer Siege. Aber Heinrich IV. darf nicht nur behaupten, daß er den Kampf kraftvoll geführt und einen soliden Frieden geschlossen habe. Er hat auch seinen Staat gut verwaltet und ihn zur Blüte gebracht, er hat den Edelgesinnten vertraut und seinen Ruhm darin gesucht, die Lasten der Völker zu erleichtern. Oder man liest einen Dialog zwischen Philipp II. von Spanien und seinem Sohne Philipp III. »Während meines Lebens«, sagt der Vater, »haben die Höflinge mich zum Himmel erhoben.« Zu spät erkennt er seine falsche Politik und daß es nichts Schlimmeres für die Könige gibt, als durch Ehrgeiz und Schmeichelei verführt zu werden.
Auch im Telemach, der berühmten Erziehungsschrift Fénelons, kehren dieselben Gedanken wieder. Da ist ein König Idomeneus, der gerührt und dankbar die Ratschläge vernimmt, die ihm in Mentors Gestalt die Göttin der Weisheit selbst erteilt. »Wie Minerva höher steht als Mars, so ist kluge und weitblickende Tapferkeit wertvoller als zügelloser, wilder Kampfesmut ... Zuerst, o Idomeneus, sage uns, ob der Krieg gerecht ist; dann, gegen wen du ihn führst, und endlich, ob deine Kräfte ausreichen, um ihn zu glücklichem Ausgang zu bringen.« Aber noch besser ist es freilich, den Krieg ganz zu vermeiden. Idomeneus klagt, daß die Götter nicht aufhören, ihn zu verfolgen. Er habe noch nicht gelernt, erwidert ihm Mentor, was er zu tun habe, um es nicht zum Kriege kommen zu lassen (Buch 9). Gewiß ist es nicht richtig, wie manche wollten, in Idomeneus das Abbild Ludwigs XIV. zu erblicken, viel eher soll er ein Gegenstück des Sonnenkönigs sein, ein Fürst, der gierig nach Wahrheit schmachtet. »Habe Mitleid«, so sagt er zu Mentor, »mit einem Könige, den die Schmeichelei vergiftet hat und der nicht einmal im Unglück edle Menschen gefunden hat, die ihm die Wahrheit sagen.« (Buch 10.)
Es ist das Schicksal Ludwigs XIV., das hier warnend angedeutet wird. Und wenn anders Fénelon wirklich auch jenen ihm zugeschriebenen anonymen Brief verfaßt hat, worin dem Könige die bittersten Wahrheiten herausgesagt werden, so hat er auch dem Herrscher selbst gegenüber die Rolle des Mentor anzunehmen gewagt. Er stellt ihm vor, daß der holländische Krieg von 1672 aus einem Motiv des Ruhmes und der Rache entsprungen, daß er darum nicht ein gerechter Krieg und eben deshalb die Quelle aller folgenden gewesen sei. »Es folgt daraus, daß alle Grenzerweiterungen, die Sie durch diesen Krieg gewonnen haben, in ihrem Ursprung ungerechte Erwerbungen darstellen.«
Solche Wahrheiten mögen dem absoluten Monarchen wohl auf Umwegen zu Ohren gekommen sein. Seinen Sinn haben sie nicht gewandelt. Erst vom letzten Krankenlager Ludwigs XIV. weiß uns Saint Simon jene ergreifende Szene zu berichten, wie der sterbende König seinen Nachfolger, den fünfjährigen Dauphin zu sich kommen läßt und zu ihm die Worte spricht: »Mein Kind, du wirst bald ein mächtiger König sein; folge nicht meinem Beispiel in dem Hange, den ich für die Errichtung von Bauten gehabt habe und nicht in der Leidenschaft für den Krieg. Versuche lieber, Frieden zu halten mit deinen Nachbarn.«
***
Kehren wir zu den Utrechter Verhandlungen zurück. Sie spielen sich durchaus in den gewohnten Formen ab. Das Bedürfnis nach dem Frieden ist auf allen Seiten stark, nicht nur bei dem gedemütigten Frankreich, sondern kaum weniger bei dem siegreichen, aber finanziell erschöpften England. Noch kurz vor dem Abschlusse schreibt der sehr wohlunterrichtete Jonathan Swift [*] : »Es war unmöglich, den Krieg länger fortzusetzen; wer das nicht zugibt, weiß entweder nichts von den Schulden der Nation, oder er leugnet es aus Parteigeist.« Aber trotz aller Friedenssehnsucht findet man bei keinem der beteiligten Staaten, bei keinem ihrer Beauftragten etwas von der Auffassung, als ob es sich um etwas anderes handle, als um einen gewöhnlichen Friedensschluß, als ob es etwa darauf ankomme, den zu schließenden Frieden zu einem ewigen zu machen. Und als man fertig ist, beherrscht keine andere Stimmung die Geister als die übliche offizielle Glückseligkeit über den eben erreichten Abschluß. Selbst Fénelon, der ehedem so strenge Kritiker der Kriegspolitik Ludwigs XIV., empfindet dieses Mal nur noch Stolz und Genugtuung. »Sie haben«, schreibt er an Villars nach der Unterzeichnung des Rastatter Friedens [*] , »das größte Werk des Jahrhunderts zum Abschlusse gebracht. Unsere Feinde, nachdem sie uns den Frieden verweigert hatten, sind gezwungen worden, uns darum zu bitten. Alle Nationen zollen uns ihre Hochachtung. Der Ruhm der Waffen des Königs erstrahlt hell. Man erkennt seine ehrliche Mäßigung.«
Auch bei den Gegnern Frankreichs ist man froh und zufrieden. Prinz Eugen legt dem Kaiser seine Glückwünsche zu Füßen und betet, »daß dieser Friede so beständig als dero unsterblichen Namen glorreich und dem Wachstum und Aufnahme des römischen Reiches sowohl, als Ihrer getreuesten Vasallen, Untertanen und Erblanden mehr und mehr gedeihlich und vorteilig sein möge.« Der englische Staatssekretär Lord Bolingbroke erhebt sich zu einer Wendung, die man eher von dem Lord Protector des 17. Jahrhunderts als von dem Aufklärungsschriftsteller des 18. Jahrhunderts zu hören erwarten würde, wenn er schreibt [*] : »Ich kann nur sagen, dies ist das Werk des Herrn und es ist wie ein Wunder vor unseren Augen.« Auch im englischen Volke war der Jubel groß. Der zu Utrecht geschlossene Friede wurde am 5. Mai 1713 in London proklamiert, »aber mit lauteren Akklamationen und stärkeren Freudenkundgebungen des Volkes als man es je bei ähnlichen Gelegenheiten erlebt hatte [*] .«
Das ist die allgemeine Freude über das im Augenblick Erreichte. Immerhin bemerkt man bei den Staatsmännern dieser Epoche auch gelegentlich die Neigung, sich mit den Wirkungen des einmaligen Friedensschlusses nicht zu begnügen, sondern etwas Dauerndes zu schaffen und eine Saat des Friedens auszustreuen, deren Frucht noch in späterer Zeit der Ruhe des Erdteils zugute kommen möge. Als die beiden großen Feldherren Eugen und Villars, das Schwert mit der Feder vertauschend, das Friedenswerk zu Rastatt und Baden zu Ende gebracht haben, findet auf den Wunsch Eugens noch eine vertrauliche Besprechung der beiden Häupter statt. Kein anderer, auch keiner ihrer ersten Sekretäre, ist anwesend. Prinz Eugen deutet an, man wisse am Kaiserhofe, daß Ludwig XIV. ein Testament gemacht habe. Man sei gewiß, daß ein so weiser Fürst bei diesem Schritte von der Absicht geleitet wurde, die Ruhe ganz Europas zu befestigen. Diesen Wunsch hat auch der Kaiser. »Wäre es nicht das sicherste Mittel zu seiner Erfüllung, wenn Seine Kaiserliche Majestät in den Inhalt des Testaments eingeweiht würde?« Aber Villars lehnt ab. Der König hat erklärt, daß niemand von diesem Testamente Kenntnis besitze und es solle geheim bleiben bis nach seinem Tode.
Derselbe Gedanke der dauernden Sicherung des Friedens lag ferner den zwischen beiden Männern gepflogenen Erörterungen einer engen Verbindung der Häuser Bourbon und Habsburg zugrunde. »Sie entwarfen«, so erzählt Villars in seinen Memoiren [*] , »die ersten Pläne einer Union, welche, allem Anschein zufolge, den Ruhm und die Machterhöhung der erlauchten Häuser von Frankreich und Österreich gefördert haben würde.«
Aber die einzige Wirkung dieser Gespräche bestand in der Wiedereröffnung der lange unterbrochenen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden großen Staaten, der baldigen Entsendung von Botschaftern, die in Wien und Paris beglaubigt wurden. An dauernde Einrichtungen, an eine internationale Organisation zur Erhaltung des Friedenszustandes in Europa, haben auch Eugen und Villars und andere Staatsmänner dieser Epoche niemals gedacht.
***
Es muß gesagt werden, daß diesen praktischen Politikern gegenüber der Abbé Saint-Pierre doch nur der weltfremde Schwärmer ist, der von den Anschauungen im Kreise der Staatsmänner und auch der Völker nichts ahnt. An einen ewigen Frieden denken diese so wenig nach den Utrechter Verträgen wie vorher. Im Gegenteil: In England erwägt der Staatssekretär Stanhope noch 1714, gleich nach der Thronbesteigung Georgs I., eine Erneuerung des Krieges. Und ein Jahr später, beim Tode Ludwigs XIV., findet der englische Gesandte in Paris, Lord Stair [*] , die Lage Frankreichs reduziert genug, um einen neuen Waffengang zu lohnen und die Unvollkommenheiten des Utrechter Friedens auszugleichen. Wieder ein paar Jahre später richtet sich die Politik Spaniens, geleitet von dem ehrgeizigen Alberoni, auf die Rückeroberung der durch den Erbfolgekrieg verlorenen Nebenlande ein. Nun raffen sich die anderen Mächte, England, Frankreich, Osterreich auf, um Spanien in seine Schranken zurückzuweisen und es zur Beobachtung der geschlossenen Verträge zu zwingen. Sie erreichen es in der Tat durch ihre Politik und durch die Erfolge ihrer Waffen. Die genannten drei Mächte, vereinigt in der fälschlich sogenannten Quadrupel-Allianz, geben sich als die Fortsetzer der Friedenspolitik von 1713. Sie stellen einen neuen Plan auf zur Herstellung des allgemeinen Friedens in Europa, eine Ordnung, mit der sich alle Staaten, die großen wie die kleinen, zufrieden geben sollen. Aber einen pazifistischen Charakter, um die Idee Saint-Pierres schon einmal mit dem modernen Namen zu bezeichnen, nimmt auch diese Friedenspolitik nicht an. Sie versteigt sich wohl einmal [*] zur Verkündung der Theorie, daß die Notwendigkeit der Herstellung und Sicherung eines dauernden Friedenszustandes den großen Mächten das Recht gebe, auch über das Schicksal der kleineren, selbst gegen ihren Willen, zu verfügen. Aber diese Behauptung wird nur von englischer Seite aufgestellt. Sie wird zwar von Frankreich angenommen, aber von Österreich prompt abgelehnt. Und selbst der darin ausgesprochene Gedanke ist kein pazifistischer. Es sollen nicht Vorkehrungen getroffen, nicht ein System gefunden werden, um jeden Krieg unmöglich zu machen. Man will den Frieden nur sichern, solange es eben möglich ist.
Überhaupt ist zu unterscheiden zwischen praktischer Friedenspolitik, welche im einzelnen Falle die Kriegsgefahr zu beschwören sucht, und der grundsätzlichen Friedenspolitik, die den Krieg überhaupt aus der Welt schaffen möchte. Die erstere arbeitet mit Friedensschlüssen und Verträgen, die letztere mit lustigen Projekten.
***
Die Theoretiker der Weltfriedensidee konnten auf den Boden von Dantes Schrift » De Monarchia« nicht mehr zurückkehren. Die Verwirklichung der Universalmonarchie, sei sie von weltlichem oder geistlichem Charakter, war an der Schwelle der Neuzeit durch das Aufkommen nationaler Staaten unmöglich geworden. Daß damit auch die Vermeidung der Kriege nur noch schwerer geworden als früher, haben jene Schriftsteller nicht einsehen wollen. Angesichts der Vielheit der Staaten suchen sie die Lösung des Problems fortan in irgendwelchen Formen der Zusammenfassung aller, wenigstens wo es auf die friedliche Beilegung kriegsdrohender Streitigkeiten ankommt. Der Gedanke des Schiedsgerichts als einer dauernden oder vorübergehenden Einrichtung entsteht. Die Organisierung aller Staaten in einer föderativen Gemeinschaft, sagen wir: der Völkerbundsgedanke, kommt hinzu. Und damit sind die Elemente gegeben, auf denen die im einzelnen noch vielfach voneinander abweichenden Systeme sich aufbauen. Der Originalität der politischen Denker ist nicht mehr allzu viel Raum gelassen. Von einem gewissen Schema kommen sie nicht los. Es ist denn auch wenig verlockend, bei jedem von ihnen zu forschen, wieviel er etwa von seinen Vorgängern übernommen habe.
Bei Saint-Pierre hat man gefunden [*] , daß sein großer Friedensplan nur die Fortentwicklung der 1623 erschienenen Schrift »Der neue Kineas«, verfaßt von einem Mönche namens Crucé, gewesen sei. Saint-Pierre selbst beruft sich freilich nicht auf diesen, sondern aus den in Sullys Memoiren mitgeteilten angeblichen » Grand Dessein« Heinrichs IV., und dieses offensichtlich nur, um den für jedes französische Ohr wohlklingenden Namen des berühmten Königs für die Richtigkeit seiner Idee ins Feld führen zu können, wie er auch nicht unterläßt, hinzuzufügen, daß Elisabeth von England und viele andere hochfürstliche Zeitgenossen den Plan des Königs von Frankreich vortrefflich gefunden hätten. Merkwürdig genug ist freilich dieser Plan, der die Völker Europas in einem Bunde vereinigen, sein Friedenswerk aber mit der Niederwerfung des allzu mächtigen Hauses Habsburg beginnen, dazu die Türken und, wenn sie nicht etwa dem Bunde beitreten werden, auch die Russen aus Europa vertreiben will. Was aber Saint-Pierre, wie wir gleich hören werden, vorschlug, war doch von diesem » Grand Dessein« sehr verschieden. Der Abbé ist überdies, wie wir heute wissen, das Opfer einer Täuschung geworden. Nicht Heinrich IV., sondern Sully allein ist der Erfinder des »Grand Dessein«. Denn so scheint das letzte Ergebnis der neueren Forschungen [*] zu sein, aus dem wir zugleich die beruhigende Gewißheit schöpfen, daß ein so kluger Fürst wie Heinrich IV. nicht als der Urheber eines so chimärischen Planes anzusehen ist.
***
Saint-Pierre hat sich mit den Hauptgedanken seines Werkes lange beschäftigt, ehe er sie niederschrieb. Ein Unfall, den er bei einer Reise durch seine normannische Heimat im Jahre 1707 erlebte, ein zerbrochener Wagen und ein unfreiwilliger Aufenthalt wurden nicht nur die sehr verständliche Veranlassung zu einer Schrift über die Verbesserung der Straßen, sondern gaben ihm plötzlich die Überzeugung ein von dem Werte eines dauernden Schiedsgerichtshofes für die europäischen Souveräne [*] . Den anfangs still im Busen verschlossenen Gedanken beginnt er erst 1711 zu Papier zu bringen, wird von den Leuten ausgelacht, läßt sich aber von der Fortsetzung nicht abhalten [*] . 1712 läßt er in Köln ein » Mémoire pour rendre la paix perpétuelle en Europe« drucken. Ein Jahr später erscheinen in Utrecht, in der Stadt, wo eben der Friede geschlossen wurde, zwei Bände mit dem aus der früheren Schrift fast wörtlich wiederholten Titel: » Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe«. Auf dem Titelblatt fehlt der Name des Autors. Aber der Herausgeber will ihn, wie sein Avis au lecteur erzählt, noch kurz vor der Vollendung des Druckes erfahren haben, und der zweite Band, obwohl noch anonym, ist bereits mit dem Bilde Saint-Pierres geschmückt. 1716 läßt der Abbé den beiden erschienenen Bänden noch einen dritten folgen. Dann wird er freilich gewahr, daß schon der Umfang des Werkes seiner Verbreitung im Wege stehe. 1729 gibt er einen nach seiner Meinung knappen Abriß des Stoffes in einem Abrégé heraus, und endlich läßt er diesen in verbesserter und vermehrter Gestalt noch einmal 1738 erscheinen.
Wenn wir im folgenden den Leser mit den Hauptgedanken Saint-Pierres bekannt zu machen und eine Würdigung derselben zu geben versuchen, so halten wir uns dabei vorzüglich an die ersten zwei Bände. Denn sie enthalten die volle Darlegung des Stoffes, das eigentliche System des Werkes.
***
Auch Saint-Pierre gehört zu jenen Geistern, die sich innerlich von dem System Ludwigs XIV. abgewendet haben. Er lebt in einer andern Welt. Wie er einer der frühen Bewunderer Englands und seiner Verfassung ist, so ist er, ähnlich wie Fénelon, zu einer scharfen Verurteilung der Kriegspolitik des Sonnenkönigs gelangt. Aber er bleibt nicht bei dem Standpunkte Fénelons, der nur den ungerechten Krieg verwirft. Es soll überhaupt in Zukunft keine Kriege mehr geben. Nicht daß Saint-Pierre weitblickender wäre als Fénelon. Er ist im Grunde ein unpolitischer Kopf. Er ist nicht einer von denen, die mit überlegener Kritik die Verhältnisse ihrer Zeit durchschauen, er ist auch nicht ein großer Schriftsteller wie Montesquieu, der im Prophetenton neue Wahrheiten verkündet, oder wie Voltaire, der mit witziger Kritik vorhandene Schäden beleuchtet. Saint-Pierre ist der Fanatiker einer Idee, die ihn so ganz beherrscht, daß ihm alle Zweifel schwinden an ihrer Kraft und Durchführbarkeit.
Er lebt in einem Zeitalter, das er als guerre presque inaltérable nicht unrichtig bezeichnet. Er ist erschüttert von dem Unglück, das dadurch in die Welt gekommen ist, und er meint, es bessern zu können. Nicht mit dem von jedermann im Munde geführten Gleichgewichtssystem kann der Friede gesichert werden. Bei einem Gleichgewicht zweier oder auch dreier mächtiger Fürstenhäuser würden Ruhe und Sicherheit auf die Dauer der Zeit nicht zu erhalten sein. Ehrgeiz und Machthunger lassen sich nicht stillen, jedes dieser Fürstenhäuser würde zuletzt danach trachten, den ganzen Besitz der anderen an sich zu reißen, und der Autor nimmt sogar den ihm naheliegenden Fall an, daß Frankreich selbst es wäre, das nach Ablauf von 200 Jahren, also im Jahre 1913, Herr von ganz Europa würde, alle anderen nur Provinzen Frankreichs. Er kann sich ein solches Europa wohl vorstellen, denn Augustus und seine Nachfolger haben ein noch größeres Reich besessen. Aber was würde weiter erfolgen? Nun käme die Auflösung von innen heraus. Katastrophen innerhalb der herrschenden Häuser, Gift und Dolch, Intrige und Verschwörung würden ihr unheimliches Werk vollbringen, und die Allmacht des einen großen Staates würde in sich zusammenbrechen. Oder ein anderes Bild, und wieder geht Saint-Pierre von dem Frankreich seiner Zeit aus. Eine Liga, wir würden sagen eine Koalition steht gegen Frankreich auf. Auch diese Möglichkeit haben die Zeitgenossen gesehen, denn sie ist seit 1688 Ereignis geworden und beherrscht die europäische Geschichte. Und wie leicht könnte Frankreich daran zugrunde gehen.
Um aber auf Saint-Pierres eigenen Vorschlag zu kommen, so stellt er einmal zur Kennzeichnung des bestehenden Zustandes eine eindrucksvolle Erwägung an. Der einzelne Privatmann innerhalb eines Staates, sagt er, ist besser daran als der Herrscher. Sein Besitz, seine Familie, sein Leben sind in Sicherheit, nicht so die des Herrschers. Der Grund dafür: jener lebt in einer societé permanente, dieser in einer non-societé. Die Lage der Herrscher (sie sind ihm schlechthin die Repräsentanten des Staates) wird sich nicht bessern, bis sie zu Gliedern einer societé nouvelle entre pareils geworden sind. So will er einen Bund unter allen christlichen Staaten schaffen, die gleichgeordnet nebeneinander stehen. Dieser Bund ist zu denken als Ersatz für die höhere Gewalt, ohne die, wie er wohl weiß, die Erfüllung aller Verträge unsicher bleibt.
Für die Bildung dieser societé permanente de l'Europe hat er ein Vorbild. Es ist kein anderes als das Heilige Römische Reich, das Deutschland seiner Zeit, so wie er es sich vorstellt.
Wer den Sinn, oder sagen wir lieber den fehlenden Sinn Saint-Pierres für die Wirklichkeit des Lebens, für die Tatsachen der Geschichte erkennen will, der möge nur alle die Stellen nachlesen, wo der Autor über Deutschland spricht, über Kaiser und Fürsten, über deutsche Verfassung und deutsche Geschichte. Hier ist so ziemlich alles Phantasie. Ein deutsches Reich, wie es hier erscheint, hat nie existiert. Saint-Pierre weiß von der Gegenwart, von dem Deutschland seiner Zeit, so wenig wie von deutscher Vergangenheit. Auch in dem großen Plan Heinrichs IV. war von Deutschland die Rede gewesen, auch hier las man sehr verschwommene Formulierungen, und die Wiedergabe deutscher Verfassungsfragen war so völlig mißlungen, daß man den wahren Tatbestand in dem Bilde gar nicht wiedererkennt, und daß der deutsche Übersetzer in Schillers Sammlung Historischer Memoiren sich nicht einmal herabließ, an dieser Stelle sich in Anmerkungen und Berichtigungen zu ergehen, weil, sagt er, gewiß niemand seine Kenntnis des deutschen Staatsrechts aus fremden Memoiren werde sammeln oder berichtigen wollen. Aber durch Saint-Pierre wird Sullys Unkenntnis noch weit übertroffen. Dennoch dürfen wir an den fraglichen Partien des Saint-Pierreschen Werkes nicht so rasch vorübereilen. Denn sie bilden einen zu wichtigen Bestandteil des ganzen Systems, ja sie sind recht eigentlich die Grundlage desselben.
Die deutsche Reichsverfassung, so wie Saint-Pierre sie versteht, ist aber nicht nur das Vorbild seiner künftigen Staatenordnung. Sie soll auch den Kern derselben bilden, denn sie soll einfach zur europäischen Staatenordnung erweitert werden. Das deutsche Reich – er nennt es Union des Allemands oder noch häufiger Union Germanique – stellt er sich vor als einen Staaten- oder Fürstenbund, zu dem seine Glieder sich eines Tages frei vereinigt haben. Er schätzt die Zahl der Reichsmitglieder auf etwa 200. Zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Malen, nacheinander haben diese 200 sich vereinigt und einen Vertrag ( le traité Germanique) unterzeichnet. Ihre eigenen Souveränitäten haben sich auf den Trümmern der Kaisermacht erhoben. Ehedem waren sie in unaufhörlichen Streitigkeiten und Kämpfen im Innern und nach außen begriffen. Bald war diese, bald jene Gegend, bald das ganze Land ein Bild der Verwüstung. Dem Kaiser aber fehlte es am Willen wie an der Macht, Abhilfe zu schaffen. In dieser allgemeinen Not war es geschehen, daß der Plan der Union Germanique gefaßt wurde. Fortan sollten alle eine einzige Körperschaft miteinander bilden, zum Schutze des Friedens und der Verträge, zur Sicherheit ihrer Staaten und zum Wohle ihrer Untertanen.
Fragt man nach dem wirklichen historischen Vorgange, der so umschrieben sein könnte, so würde man etwa an die sogenannten Reformen Maximilians zu denken haben, an die Begründung des Landfriedens und des Reichskammergerichts, an die Versuche eines Reichsregiments und an die Kreiseinteilung, überhaupt an jene Periode, in der das Reich, nach einer durch Jahrhunderte fortgesetzten Schwächung der Zentralgewalt, auf ständischer Grundlage neu begründet wurde. Das ist aber keineswegs die Meinung Saint-Pierres. Er gibt zwar ebenso wenig ein genaues Datum, wie er von bestimmten gesetzgeberischen Handlungen redet. Aber die Vorgänge, die er im Auge hat, sollen sich vor 500-600 Jahren, das wäre im Laufe des 12. Jahrhunderts, abgespielt haben. Er wisse nicht, so sagt er, ob der Plan im Kopf eines Fürsten oder eines Privatmannes entsprungen sei. Doch redet er immer wieder von dem »klugen Erfinder«, dem »großen Genius«, »dem weisen Deutschen«, dem »Solon Deutschlands«. Also ein einziger ist es doch gewesen. (S. 160.)
Aber dieser Eine, meint Saint-Pierre, hat leider nicht ganze Arbeit getan. Er ist zufrieden gewesen, das Kaisertum wählbar gemacht, den Übergriffen eines erblichen Monarchen gesteuert zu haben. Die Monarchie gänzlich zu beseitigen, konnte er sich nicht entschließen. Es ging ihm wie dem Architekten, der seinen Neubau selbst verdirbt, indem er zuviel von dem alten Bau übernimmt. Ein verhängnisvoller Fehler. Hätte Deutschland statt des Kaisers, d. h. eines dauernden Oberhauptes, einen wechselnden Präsidenten erhalten, den man aus der Zahl der Deputierten seiner verschiedenen Mitglieder hätte nehmen können, so würde der Bund sich längst erweitert haben. Die Schweiz nebst Genf, die meisten Fürsten und Staaten Italiens, die Republik Holland, England in der Zeit des Bürgerkrieges unter Karl I., sie alle würden den Eintritt begehrt haben. Und Frankreich selbst: ist es nicht im 16. Jahrhundert am Rande des Abgrundes gewandelt? Hätte Heinrich III., um allen Nöten zu entgehen, nur einem Bunde beizutreten brauchen, der ihn von aller Furcht befreit und ihn dazu mit offenen Armen ausgenommen hätte, würde er einen Augenblick geschwankt haben? Nicht anders Polen, Dänemark, Schweden oder auch Portugal. Wäre der Bund der deutschen Staaten in einer Form konstituiert worden, daß er seit fünf oder sechs Jahrhunderten von allen großen Ereignissen der Staatengeschichte Europas hätte Vorteil ziehen können, so würde dieser Bund unmerklich zu eben dem europäischen Bunde geworden sein, den Saint-Pierre empfiehlt. Aber da jene Staaten und Herrscher gewahr wurden, daß sie in den deutschen Bund nicht anders Aufnahme finden konnten, als indem sie den Kaiser als ihren Herrn oder doch dauernd als einen Höheren anerkannten, so hat diese Erwägung, und sie allein, sie von diesem Beitritt abgehalten. Und so geschah es, daß die Union Germanique sich nicht erweitert, sondern im Gegenteil Einbuße erlitten hat an seinen Gliedern und an seinem Territorium.
Auf einer so barocken Geschichtskonstruktion baut sich Saint-Pierres Plan auf, der ganz Europa zu einer Gemeinschaft vereinigen und den ewigen Frieden gewährleisten soll.
Dabei ist Saint-Pierre nicht ohne Stolz auf seine Kenntnis der Geschichte. Hier wirkt er manchmal komisch. Die historischen Tatsachen, die er braucht, sind einmal die Entstehung des deutschen Staatenbundes und ferner die Motive, die einen Heinrich IV. von Frankreich, Elisabeth von England und 16 oder 17 weitere Potentaten des 17. Jahrhunderts bestimmt haben, den Plan des europäischen Bundes zu entwerfen oder ihn anzunehmen. Nun ist zu seinem Unglück das erste Phantasie und das zweite Legende. Die Schwierigkeiten, mit diesen geglaubten Tatsachen zu operieren, erblickt er nur nach der Seite ihrer Motive. Sie gilt es wiederzufinden. Nun, die Sache liegt für ihn einfach genug. Die Motive sind dieselben, die er für seinen eigenen Plan geltend macht. Er selbst hat jene wiedergefunden, indem es ihm gelungen ist, diesen so überzeugend, wie er meint, in seiner Wahrheit und Unfehlbarkeit zu entwickeln und zu beweisen. »Sehet nur,« so ruft er aus, »hier sind sie alle in ihrer glücklich wiedergefundenen Wesenheit.«
***
Die Verfassung des Bundes soll enthalten sein in zwölf Fundamentalartikeln, die Saint-Pierre selbst entwirft. Er will damit denjenigen, die eines Tages den Vertrag zu entwerfen haben, die Arbeit ersparen. Er will eine Skizze, ein Schema geben, an dem sie, wie er hofft, wenig zu ändern finden, nur hier und da ein Wort hinzuzufügen oder wegzunehmen haben werden. Ihr grundlegender Charakter aber geht schon daraus hervor, daß sie nur durch den einstimmigen Beschluß aller Mitglieder abgeändert werden dürfen.
Wir werden nicht umhin können, diesen zwölf Artikeln eine kurze Betrachtung zu widmen, denn das Wesen des Bundes und die Schwächen des Saint-Pierreschen Planes können wir aus ihnen am leichtesten erschließen. Doch soll diese Betrachtung weder abschließend sein, noch soll sie sich streng an die Reihenfolge der Artikel halten, da diese bei Saint-Pierre in der Tat etwas willkürlich ist.
Die Mitglieder des Bundes werden, wie der erste Artikel besagt, durch ihre Deputierten auf einem Kongresse oder Senat vertreten.
Ganz Europa wird dem Bunde angehören, die einzelnen Staaten sind seine Mitglieder. Auch der russische Zar, so fern er auch dem inneren Leben der abendländischen Staatenwelt noch gegenüberstand, wird als Mitglied gedacht. Etwas anders ist das Verhältnis zur Türkei. Sie kann nicht einem Bunde angehören, der nur christliche Souveräne und Republiken umfaßt. Doch wird mit den benachbarten, mohammedanischen Herrschern ein System von Offensiv- und Defensivverträgen in Aussicht genommen, wodurch auch sie dem großen Friedenssystem angegliedert werden. Der eigentliche Bund aber umfaßt 24 Mitglieder.
Der neunte Artikel beschäftigt sich mit der Rolle, die die Einzelnen auf dem Kongresse spielen werden, nämlich mit der Stimmenverteilung. Saint-Pierre unterscheidet große und kleinere Staaten. Die großen erhalten je eine Stimme, die kleineren werden zu Truppen zusammengefaßt, von denen jeder eine Stimme zukommt. So erhalten wir das aus der deutschen Verfassungsgeschichte wohlbekannte System der Viril- und Kuriatstimmen. Saint-Pierres Vorbild ist offenbar der deutsche Reichstag, dem ja auch sein ganzer Staatenbund nachgebildet ist. Eine Virilstimme erhält jeder Staat von mindestens 1 200 000 Einwohnern. Aber er erhält auch nicht mehr, selbst wenn er dieses Mindestmaß der Einwohnerzahl um ein Vielfaches übertrifft. So werden freilich die kleineren Gebilde mit ihren Viril- oder Kuriatstimmen eine viel wichtigere Rolle spielen, als es ihrer Bevölkerungszahl entspricht. Aber, meint Saint-Pierre, sie bedürfen dessen auch mehr, denn der ganze Bund hat für sie mehr Bedeutung als für die großen. Dies mag richtig sein, doch ist damit die Frage nicht beantwortet, und Saint-Pierre hat wirklich keine Antwort darauf, warum denn die großen Mächte sich eine solche Gleichstellung mit den kleinen gefallen lassen müssen. Warum der König von Frankreich bereit sein sollte, sich, ebenso wie der Herzog von Savoyen, mit einer einzigen Stimme zu begnügen, ist wirklich nicht einzusehen.
Einiges Kopfzerbrechen hat es Saint-Pierre gekostet, die Form zu finden, wie das Heilige Römische Reich in seinem Staatenbunde unterzubringen sei. Er hat auf die Lösung zuletzt ganz verzichtet. Statt des Ganzen nimmt er nur die Teile, und zwar wiederum entweder einzeln oder in Gruppen zusammengefaßt. Österreich, Preußen und Sachsen erhalten je eine eigene Stimme, die übrigen, also z. B. auch Bayern, Hannover, die geistlichen Kurfürsten, werden sich mit Anteilen an einer Kuriatstimme zu begnügen haben.
Die Begabung auch der größten Staaten mit nur je einer Stimme, und die Zusammenfassung aller übrigen zu den beschriebenen Staatenbünden, ergibt nun eine Gesamtzahl von 24 Teilnehmern. Nicht viel für ganz Europa. 24 Deputierte, 24 Stimmen auf dem Kongreß, eine so mäßige Zahl, daß man an ihre Fähigkeit, zu regieren, weit eher glauben könnte, als bei einer zahlreicheren Versammlung – natürlich unter der Voraussetzung, daß Saint-Pierres europäischer Bund und sein Kongreß überhaupt lebensfähig gewesen wären, was heute niemand mehr behaupten wird.
Nach Artikel 4 übernimmt der Bund die Garantie für den Territorialbestand seiner Mitglieder. Von ihren Gebieten darf nichts abgetrennt, es darf auch nichts hinzugefügt werden, also auch Erwerbungen durch Erbschaft, Schenkung, Abtretung, Kauf, Eroberung, Unterwerfung sind ausdrücklich ausgeschlossen. Kein Souverän darf auch in Zukunft ein anderes Gebiet besitzen, als das er zur Zeit des Vertragsschlusses inne hat. Nur ein Austausch von Gebieten darf unter den einzelnen Mitgliedern sich vollziehen, aber auch das nur mit Zustimmung einer Dreiviertelmajorität des Bundes.
Was damit bewirkt wird, ist die für alle Zeiten geltende Festlegung der augenblicklichen, zeitlichen Grenzen. Es kann nichts geben, was mehr als bloßes Schema, als weltfremde, papierene Weisheit erschiene. Die Frage, wodurch denn die politischen Grenzen entstehen oder wechseln, wird nicht einmal gestreift. Nationale Übereinstimmung, Gemeinschaft der Geschichte, des Rechtes, der Kultur, vor allem die Gesamtheit der wirtschaftlichen Fragen, lauter staatenbildende Elemente – Saint-Pierre weiß nichts von ihnen, er bedenkt nicht, daß Welt und Menschen sich fortwährend verändern. Er weiß nicht, daß der Wechsel das einzig Dauernde im Leben der Völker ist. So vermißt er sich, den zufälligen Stand der Staatenwelt von 1713 zur ewigen Norm zu erheben und zur Versteinerung zu verdammen. Das historische Leben soll stille stehen, weil der Abbé Saint-Pierre es so befiehlt.
Fast noch willkürlicher, als der vorhergehende, greift der fünfte Artikel in die Rechte der Staaten und der Dynastien ein. Er besagt, daß kein Souverän in Zukunft zwei souveräne Staaten besitzen darf, weder durch Erbrecht, noch auf Grund einer Wahl. Ein Souverän, dem durch Erbrecht ein größerer Staat zufällt, kann diese Erbschaft annehmen oder ablehnen. Nimmt er sie an, so verzichtet er damit auf seinen bisherigen Besitz.
Wie sehr auch dieser Artikel aller Wirklichkeit spottet, dafür möge nur ein zeitgenössisches Beispiel genannt werden. Durch die Act of Settlement war 1701 die künftige Thronfolge Großbritanniens der Kurfürstin Sophie von Hannover und ihrer Nachkommenschaft übertragen worden. In Gemäßheit dieser Bestimmung bestieg Sophiens Sohn, Kurfürst Georg Ludwig, 1714 als Georg I. den englischen Thron. Er hätte, nach Saint-Pierres Artikel 5 damals auf sein deutsches Stammland verzichten müssen. Doch niemand hat gewagt, ihm dergleichen zuzumuten, so wenig froh die Herzen der Engländer auch über die Personalunion mit Hannover waren. Unter dem Zwange, auf Hannover zu verzichten, wäre der Kurfürst sicherlich nicht nach England gegangen. Überhaupt wendet sich ja dieser Artikel 5 gegen jegliche Personalunion. So hätten denn, wenn die Société Européenne verwirklicht wurde, auch die schon bestehenden aufgehoben werden müssen. August II. hätte sich zu entscheiden gehabt, ob er König von Polen oder Kurfürst von Sachsen bleiben wolle. Die Stellung des Königs von Dänemark in Holstein, Schwedens in Pommern, hätten, um von anderen zu schweigen, leicht unter den Zwang des Artikels 5 gebracht werden können. Und wenn nicht zufällig schon einige Jahre zuvor die englisch-schottische Union zum Gesetz erhoben worden wäre, so hätte vielleicht noch Königin Anna es erlebt, daß man sie vor die Wahl stellte, ob sie auf England oder auf Schottland verzichten wolle.
Hat also der Autor im fünften seiner 12 Grundartikel jede Personalunion grundsätzlich abgelehnt [*] , so kommt er im sechsten auf einen besonderen Fall zu sprechen, auf das Verhältnis von Frankreich zu Spanien. Hier ist er ganz Franzose, ganz Diener der Politik Ludwigs XIV., ja er gibt sich auch als Mitarbeiter des Utrechter Friedenskongresses. Das wichtigste Thema desselben, die Behauptung der Bourbonischen Dynastie in Spanien, um die in Utrecht noch gestritten wurde, – Saint-Pierre erhebt sie zu einem der Fundamentalsätze seines europäischen Bundes. »Das Königreich Spanien wird niemals dem Hause Bourbon, der heute in Frankreich herrschenden Dynastie, entzogen werden, solange es zwei männliche Vertreter dieses Hauses gibt.« Die ganze Politik der Bourbonischen Sekundogenituren in Spanien und Italien scheint hier in ihrem Kern bereits angedeutet. Saint-Pierre gibt in der Erläuterung dieses Artikels auch offen zu, daß in demselben ein mächtiger Antrieb für das Haus Frankreich liegen würde, den Europäischen Bund zu errichten. Andererseits fällt er freilich mit diesem Artikel vollkommen aus der Rolle. Denn das europäische Interesse an dieser Frage ist nicht zu erkennen, und mit welchem Rechte der unter die Fundamentalartikel versetzt wird, ist noch weniger einzusehen.
Das wichtige Kapitel der Wirtschafts-, insbesondere der Handelspolitik bildet den Gegenstand des siebenten Grundartikels. Schon an den hier getroffenen Bestimmungen würde wahrscheinlich der ganze europäische Bund gescheitert sein. Die Deputierten aus dem Kongresse werden sowohl den Charakter der allgemeinen Handelspolitik wie die besonderen Handelsbeziehungen zwischen den einzelnen Nationen gesetzlich festlegen. Von seiten des Bundes werden Handelskammern in verschiedenen Städten eingesetzt, um den Handel der Nationen zu überwachen und etwa zwischen den Mitgliedern entstehende Streitigkeiten von größerer Bedeutung zu schlichten. Die Entscheidung ist, wenn es nottut, mit Gewalt zu erzwingen.
Diese Anordnung bedeutet einen so gewaltigen Eingriff in die Rechte der einzelnen Staaten, daß von der Souveränität nicht mehr viel übrig bleiben würde. Das ganze Gebiet der Wirtschaftspolitik wird den Einzelstaaten aus der Hand genommen und an den Bund verwiesen. Und das im Zeitalter des Merkantilismus, wo der Staat so tief eingreift in das Wirtschaftsleben der Gesellschaft, wo die Nationen sich durch unübersteigliche Zollschranken, durch Ein- und Ausfuhrverbote gegeneinander absperren. Es sei nur daran erinnert, daß eben 1713, in dem Erscheinungsjahr des Saint-Pierreschen Werkes, außer dem in Utrecht geschlossenen Frieden zwischen England und Frankreich auch ein Handelsvertrag zwischen denselben Mächten ins reine gebracht wurde. Er sollte einen freieren Verkehr der beiden Nationen auf Grund der gerade jetzt aufkommenden Meistbegünstigungsklausel eröffnen. Aber siehe da: Die Staatsmänner waren den Anschauungen ihrer Zeit vorausgeeilt. Der Vertrag war ordnungsgemäß von den Bevollmächtigten unterzeichnet und von den Souveränen – Ludwig XIV. und Königin Anna – ratifiziert worden. Als aber dem englischen Parlamente ein Gesetzesvorschlag zu entsprechender Beschlußfassung über die neuen Tarife vorgelegt wurde, lehnte das Parlament die Bill ab und brachte damit das ganze Vertragswerk nachträglich zum Scheitern.
So dachten in Wahrheit die Zeitgenossen Saint-Pierres, der unschuldig kühn das ganze Wirtschaftsleben der Nationen an die Entscheidungen eines internationalen Gesandtenkongresses binden zu können vermeinte.
Mit der Unterzeichnung dieser Grundartikel – er hat sie später in seinem Abrégé von 1729, in fünf kürzere zusammengedrängt, als das » Elixir merveilleux« des ganzen Probleme bezeichnet – möchte Saint-Pierre seinen europäischen Staatenbund ins Leben einführen. Er ist sicher, daß der letzte Zweck, der ewige Friede, damit unfehlbar erreicht wird. »Man sage mir doch,« so ruft er triumphierend aus, »wie es zugehen sollte, daß nach der Unterzeichnung eines solchen Vertrages jemals wieder ein Krieg in Europa entstehen könnte.«
***
Seinen 12 Grundartikeln will Saint-Pierre den Charakter des Unabänderlichen geben, wenigstens in ihrem Inhalt, nicht ihrer Zahl, da man im Laufe der Zeiten wohl noch den einen oder anderen Artikel hinzufügen könnte, wenn man nämlich zu einstimmigem Beschlusse darüber auf dem Kongresse zu gelangen vermöchte. Weniger feierlich treten die anderen Sätze auf, die teils als Articles importants, teils als Articles utiles aufgeführt werden. Sie zu ändern bedarf es nicht der Einstimmigkeit, sondern nur des Beschlusses einer Dreiviertel-Majorität.
In ihrer Gesamtheit geben diese »wichtigen« und »nützlichen« Artikel ein vollständiges Bild davon, wie Saint-Pierre sich die Einrichtung des Bundes, des Kongresses und sein Wirken vorstellt. Sie lesen sich nicht schlecht, diese Artikel, es ist mancher praktische Vorschlag darin enthalten, und es hätte sich, wenn der Bund je ins Leben getreten wäre, viel leichter über diese Punkte reden und verhandeln lassen, als über die so viel bedenklicheren Grundartikel, die dazu noch mit ihrem unumstößlichen Charakter der künftigen Erörterung fast völlig entzogen waren.
Zum Sitz des künftigen permanenten Friedenskongresses wird Utrecht vorgeschlagen, also dieselbe Stadt, in der soeben die Diplomaten tagten, die sich um den Friedensschluß nach dem spanischen Erbfolgekriege bemühten. Aber Saint-Pierre will nicht erst dadurch zur Wahl des Ortes bestimmt worden sein. Er hat eine große Vorliebe für die Stadt Utrecht. In seinen politischen Annalen hat er später behauptet, sie schon in einer Denkschrift von 1710 zur Stätte eines dauernden Schiedsgerichts für alle Souveräne Europas im Sinne des großen Plans Heinrichs IV. vorgeschlagen zu haben. Das freie Holland, das nach aller Welt Handel treibende Volk, die Atmosphäre der Arbeit, die Nähe des großen Weltmarktes Amsterdam, endlich der in Utrecht bereits tagende Diplomatenkongreß, auch die religiöse Toleranz der Holländer, die der katholische Abbé rühmend hervorhebt, nicht zu vergessen, das sind lauter Gründe, die ihn für Utrecht einnehmen.
Ein anderer Artikel ordnet an, daß der Kongreß oder Senat seinerseits bei den einzelnen Mitgliedern des Bundes diplomatisch vertreten sein soll. Er wird bei jedem derselben einen





























