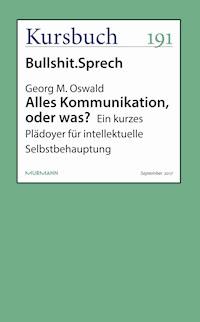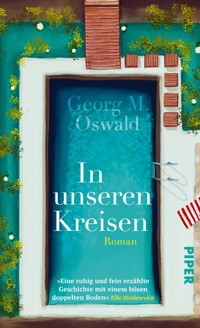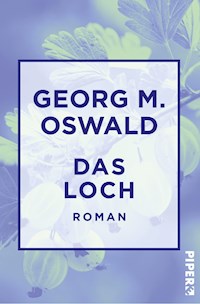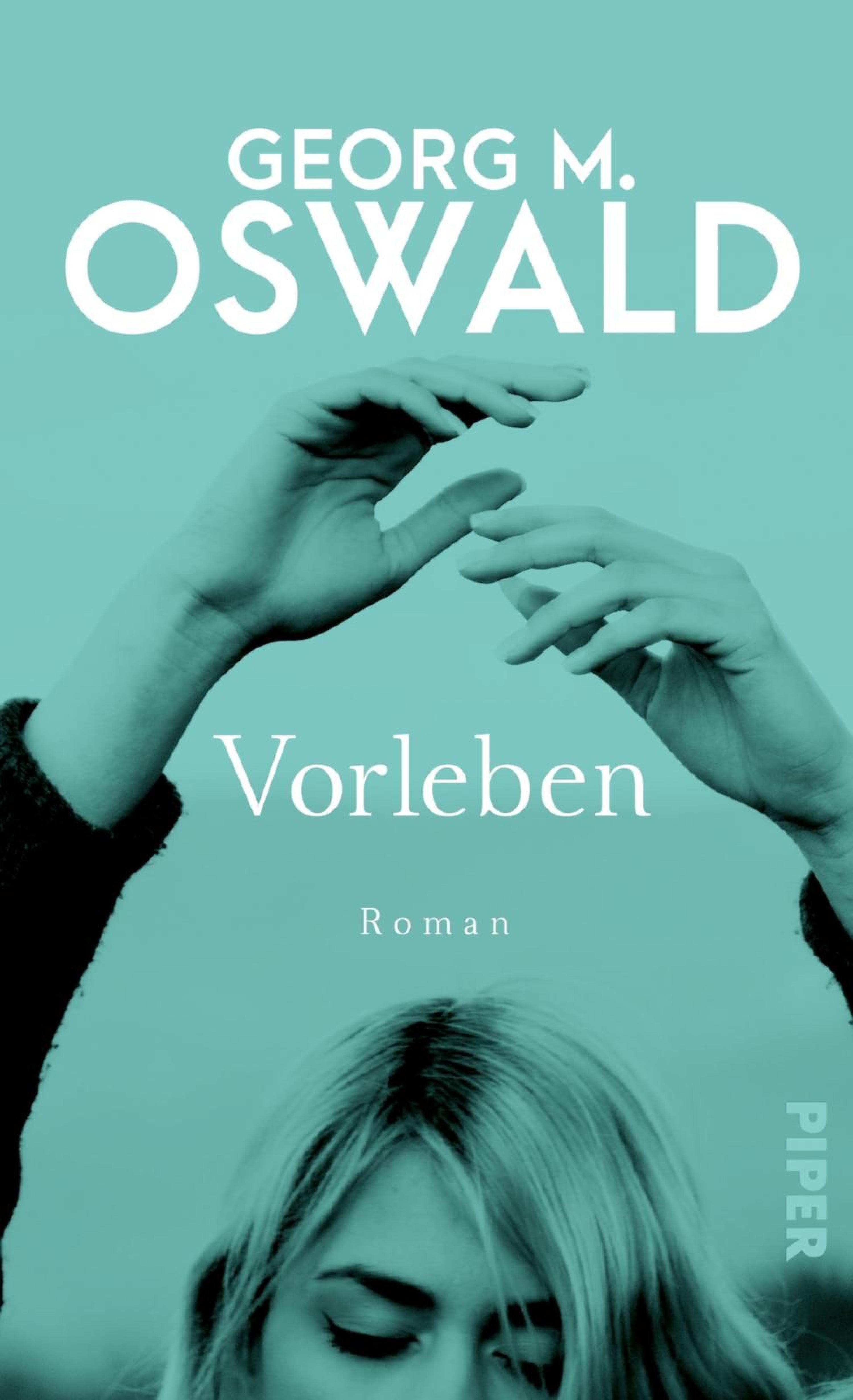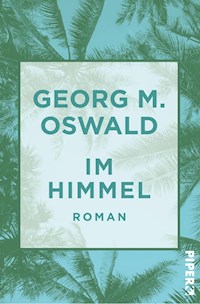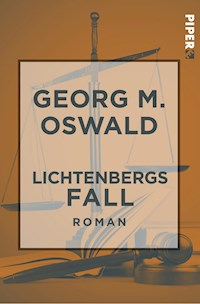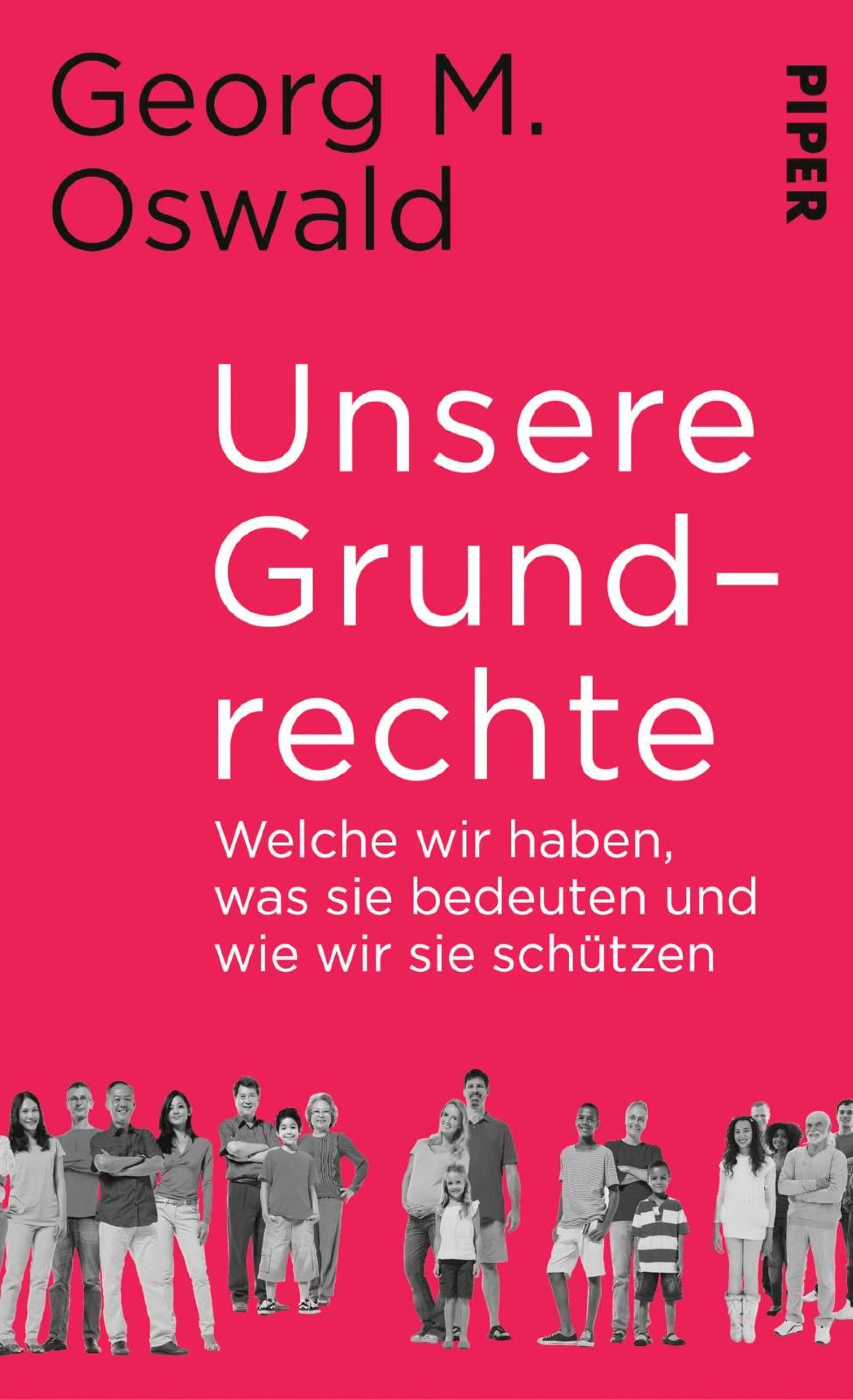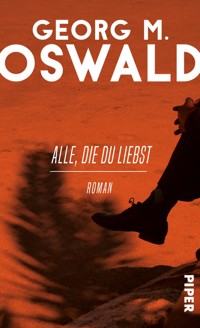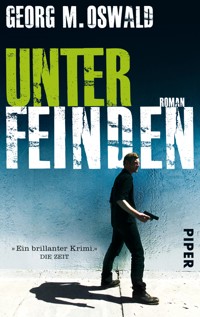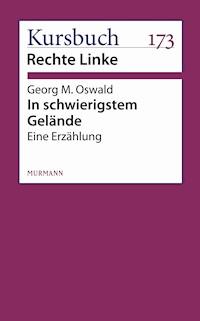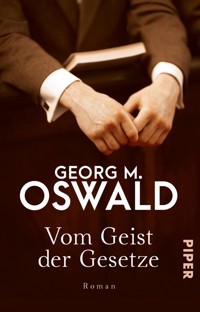
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerechtigkeit ist etwas für Schwächlinge. »Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand«, sagt ein Sprichwort, und doch will ein jeder seine Geschicke selbst lenken. Da ist der ebenso eingebildete wie brillante Strafverteidiger Georg Heckler. Da ist eine Anwältin, seine Frau, der übel mitgespielt wird, die sich jedoch zu wehren weiß. Und da sind: der melancholische Provinzpolitiker Schellenbaum und der erfolglose Drehbuchautor Ladislav Richter, der unter Schreibhemmung leidet. Als er vor Schellenbaums silbernen BMW gerät, der nicht schnell genug bremsen kann, führt dieser kleine Unfall sie alle vor die Schranken des Gerichts. Mit feiner Ironie erzählt Georg Oswald in seinem schillernden Milieuroman von Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher :www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2020© Georg Oswald 2007Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: plainpicture/Millennium/Lee Avison
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
I. Begegnungen
1. – Wie auf die Bühne …
2. – Kurt Schellenbaum …
3. – Ladislav Richter kam …
4. – »Was haben Sie sich …
5. – Während Frau Merk, …
6. – Frau Koboll führte …
7. – »Also los, ruf sie an!« …
8. – Eine Stunde später, …
9. – In Hochstimmung saß …
10. – Kristina Stelling war …
II. Kanäle
11. – Philomena Heckler …
12. – Thomas Gärtner war …
13. – »Mein Mann und ich …
14. – »… ich hätte nur gern …
15. – Sebastian Spring besaß …
16. – Thomas Gärtner verließ …
17. – Philomena Heckler …
18. – Schellenbaum und …
19. – Einige Tage nach …
20. – Ludwig Heckler war …
III. Anklagen
21. – Die Geschicke hatten …
22. – In ihrem wunderbaren …
23. – Philomena Heckler …
24. – Ladislav Richter fuhr …
25. – Der hintere Teil des …
26. – In einem anderen …
27. – »Mein Vater hat …
28. – Wochen später trafen …
29. – »Nun kommen Sie …
30. – »Ich möchte sagen: …
IV. Prozesse
31. – Neuer Ärger für den …
32. – Thomas Gärtner hatte …
33. – Ludwig Heckler war …
34. – Es war Sonntag, und …
35. – Kurt Schellenbaum …
36. – Schellenbaum informierte …
37. – Der Zeuge Ladislav …
38. – In Justizgebäuden …
39. – Einige Wochen später, …
40. – Richter lag auf dem …
V. Urteile
41. – »Es war so einer von …
42. – Der Prozess war …
43. – Stefan Girst kam am …
44. – Der Wirt des L 17 …
45. – Ladislav Richter saß …
46. – »Er ist einer der …
47. – »Ich glaube, man …
49 – » Gut gemacht!« …
49. – Spring kam in die …
50. – Kristina und Richter …
Zitat
Mich beschäftigen die Fragen: wer bekommt es mit den Gerichten zu tun? warum bekommt man es mit den Gerichten zu tun? wie muss man es anstellen, nicht mit den Gerichten zu tun zu bekommen? mit wem bekommt man zu tun, wenn man mit den Gerichten zu tun bekommt?
Walter Rode
I. Begegnungen
1. – Wie auf die Bühne …
Wie auf die Bühne einer Verwechslungskomödie führten zwei Türen in Ludwig Hecklers Büro.
Durch die eine gelangte man zu einem gläsernen Besprechungstisch mit zwölf Stühlen aus Chrom und Leder im hinteren Teil des Raumes. Trat man durch die andere, stand man vor einem gewaltigen Schreibtisch aus dunklem Holz und Stahl, an dem, mindestens sechzig Stunden die Woche, Dr. Ludwig Heckler, LLM (Harvard), Seniorpartner der Kanzlei »Heckler Rechtsanwälte« saß. Ein hölzernes Schildchen, das er zum viele Jahre zurückliegenden Abschluss seines amerikanischen Studienjahres bekommen hatte, stand vor ihm und vermeldete in goldenen Lettern auf schwarzem Grund seinen Namen, seine Titel. Ein kleiner Scherz auf Kosten seiner Besucher, denn jeder, der die Erlaubnis erhielt, in diesem Zimmer vor ihn hinzutreten, wusste nur zu gut, wen er vor sich hatte und dass tausend Euro pro Stunde der Preis waren, mit ihm zu sprechen.
Das war nicht zu viel, immerhin war er einer der großen Strafverteidiger des Landes. Keiner, dessen Name beinahe jede Woche in den Boulevardzeitungen genannt wurde, weil er sich mit Vorliebe jenen Angeklagten angedient hätte, die wegen besonders grausiger Taten vor Gericht standen. Bereits überführte, aber noch nicht abgeurteilte Räuber, Vergewaltiger, Mörder benötigten Fürsprecher, welche die Dreistigkeit besaßen, auch angesichts einer überwältigenden Beweislage effektvoll von der Unschuld ihrer Mandanten zu sprechen, von deren Nöten, deren Menschenrechten. In ihrer Unverfrorenheit ähnelten sie darin nicht selten den Verbrechern, die sie vertraten. Heckler hingegen war der Anwalt jener, die beabsichtigten, ihre Namen, die zumeist Gold wert waren, aus den Medien und überhaupt aus jedem Zusammenhang, den sie nicht selbst hergestellt hatten, herauszuhalten. Auch solche Leute konnten nicht immer verhindern, dass sich die Strafjustiz mit ihnen befasste. Dann war ihnen daran gelegen, einen Advokaten zu bestellen, der wusste, dass ein geschickter und diskreter Handel besser vergolten wurde als ein flammendes Plädoyer. Wer Ludwig Heckler beauftragte, war nicht überführt noch geständig, sondern wollte lediglich ein bedauerliches Missverständnis durch ihn ausräumen lassen. Die angebliche schwere Körperverletzung eines Fotografen durch einen Hochadeligen, die nie bewiesene Trunkenheitsfahrt eines Vorstandsvorsitzenden, die fälschlich behauptete Steuerhinterziehung durch einen Filmstar, der haltlose Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche gegen einen Aufsichtsrat waren sein Metier.
Ludwig Heckler war von mittlerer Größe, eine schlanke und feine Erscheinung, anders als viele seiner Berufskollegen beeindruckte er nicht durch Wucht, sondern durch Vornehmheit. Sein Kopf war bis auf einen schmalen Kranz kurzgeschorener dunkelgrauer Haare kahl, doch wohlgebräunt. Wann immer es ihm möglich war, besuchte er am Wochenende seine Finca auf Mallorca, wo er Oliven anbaute, aus denen er köstliches Öl herstellte, flog freitagabends hin, sonntagabends wieder zurück, oft mit Frutado oder Dulce aus eigener Produktion im Gepäck, das er verschenkte oder für spektakuläre Kreationen in der Küche verwendete, denn er war ein exzellenter Koch. Wenn er für Mallorca keine Zeit hatte, legte er sich im Fitnessraum seines Hauses in Neuhausen auf die Sonnenbank, aber nicht so oft, dass die Gleichmäßigkeit seiner Bräune ihre künstliche Ursache je verraten konnte.
Der Oktober brachte unvermutet noch einmal Sonnenschein, und trotz der herbstlichen Kühle der Luft sorgte er für eine letzte Erinnerung an den Sommer, der eigentlich schon seit einem Monat zu Ende war. Heckler trug passend zur Jahreszeit einen schokoladenbraunen Anzug aus feiner, seidiger Schurwolle, ein kleinkariertes, rot-weißes Hemd und eine rotbraune Krawatte mit Gelbtönen darin, dazu milchkaffeebraune Slipper. Er saß in orthopädisch vorbildlich aufrechter Haltung an seinem Schreibtisch vor dem großen, leuchtend roten abstrakten Ölbild mit dem Titel »Kraftquelle«, das ihm seine dritte Frau vor einigen Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte. Obwohl es von einem jungen, unbekannten Maler stammte, mochte er es gerne, denn es steigerte, wie er sich vorstellte, die Wirkung seines Anblicks.
Durch seine Halbbrille mit zierlichem Goldgestell betrachtete er eine Bewerbungsmappe, die ihm ein junger Mann geschickt hatte, der in diesem Augenblick – und schon seit längerem – vor der vorderen Tür zu seinem Büro wartete. Meist stand diese Türe offen, denn Heckler begriff sich als Freund der freien Rede und erwartete von seinen Partnern und Mitarbeitern, dass auch sie sich nicht scheuten, ihre Debatten mit gegnerischen Anwälten, Richtern, Staatsanwälten, Behörden und wem auch immer vor allen zu führen, denn wer mutig stritt, brauchte Publikum nicht zu fürchten. Falls Mandanten oder andere Menschen ohne professionelles Verhältnis zur Verschwiegenheit in der Kanzlei auftauchten, schlossen sich die Türen, und kein Laut mehr drang hinter ihnen hervor. Wurde ein Bewerber hereingebeten, was selten genug vorkam, erreichte die Diskretion einen ihrer Höhepunkte, denn bevor nicht klar war, wie weit der Neue vorgelassen wurde, betrachtete man ihn als Eindringling, der zwar vorübergehend zu dulden, dem aber nicht zu trauen war.
Heckler hatte den jungen Mann für neun Uhr bestellt, hatte um neun Uhr fünfzehn durch den hinteren Eingang sein Büro betreten, um neun Uhr sechzehn zwängte sich, um ihren Chef vor unbefugten Blicken zu schützen, Frau Koboll, die Sekretärin, mit einer schwarzen, ledernen Unterschriftsmappe, in der sich die Bewerbungsmappe aus weißem Kunststoff befand, durch die vordere Tür, verließ das Zimmer durch die hintere Tür, und nun las Heckler und las wieder, betrachtete das Foto des Bewerbers und versuchte sich einzureden, dass er ihn brauchen könne, er vielleicht sogar ein echter Fang sei.
Aber er wusste, dass es so nicht war.
Vergangene Weihnachten hatte er seinem Studienfreund Werner Kehl, Direktor in der Landesbankzentrale, auf einer Karte »in tiefempfundener kollegialer Verbundenheit« für die gute Zusammenarbeit gedankt, denn im Sommer davor hatte Kehl ihm geholfen, für einen Klienten einen großen Geldbetrag aus der Schweiz zu transferieren, ohne dass es zu den lästigen Überprüfungen kam, die das Geldwäschegesetz und andere im Allgemeinen sicher sinnvolle Regelungen vorsahen, Regelungen, die in diesem speziellen Fall einzuhalten, da waren sich alle, Heckler, Kehl, der Klient, einig, jedoch leerer Formalismus gewesen wäre.
Dafür hatte Kehl bei Heckler, wenn das auch niemals ausgesprochen worden war, etwas gut, zumindest einen Gefallen. Zwei Wochen zuvor hatte er bei ihm angerufen und gesagt: »Siehst du, mein Neffe ist nicht gerade ein juristisches Genie, aber er hat seine Examina mit Anstand hinter sich gebracht. Gib ihm eine Chance, Ludwig. Er wird dir seine Bewerbungsunterlagen schicken.« Kehl hatte das Wort »bitte« nicht verwendet und kein zweites Mal angerufen. Das war nicht nötig. Heckler wies Frau Koboll an, sorgfältig darüber zu wachen, dass ihm die Bewerbungsunterlagen eines gewissen Sebastian Spring, sobald sie einträfen, sofort vorgelegt würden, gleich, wie unzulänglich sie sein mochten.
Hunderte Studienabgänger bewarben sich alljährlich unaufgefordert bei Heckler Rechtsanwälte, einer Kanzlei, die noch nie inseriert hatte, doch dass einer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden war, lag zwei Jahre zurück, und dass einem ein Angebot gemacht wurde, vier Jahre. Heckler legte keinen Wert darauf zu expandieren, ihm genügte ein kleines Team hochklassiger Experten, und über ein solches verfügte er bereits. Jemand, der, um es in Kehls Worten zu sagen, »seine Examina mit Anstand hinter sich gebracht« hatte, bekam seine Bewerbung mit einem höflichen, aber derart demütigenden Ablehnungsschreiben zurück, dass er einen weiteren Versuch nicht wagte. Frau Koboll verwahrte die Textvorlage dafür in ihrem Computer, änderte Datum und Anrede selbständig und war in den eindeutigen Fällen auch zur Unterschrift befugt.
Die Bewerbungsmappe ödete Heckler an. Er dachte an die Legionen von Aspiranten, die in seinem Leben an ihm vorübergezogen waren wie die Angehörigen einer besiegten Armee, mit stumm um Milde flehenden Gesichtern. Er gewährte sie ihnen gerne und ließ sie ziehen. Wer jedoch für ihn arbeiten wollte, musste anders beschaffen sein, musste bereit sein, sich zu quälen, sich zu überwinden. So, wie er selbst es jeden Tag tat und immer schon getan hatte.
Sebastian Spring, was für ein unglücklicher Name für einen jungen Rechtsanwalt, dachte Heckler. Springen würde er müssen, und das nicht zu knapp, da wirkte der Name nur wie eine überflüssige Direktheit.
Seine Noten verrieten gar nichts. Durchschnittlich intelligent, durchschnittlich fleißig oder faul, keine besonderen Leidenschaften, keine besonderen Fähigkeiten, geeignet für alles und nichts. Als seine Hobbys gab er allen Ernstes an: Lesen, Sport, Musik. Das konnte einen direkt neugierig machen, genau wie das Bewerbungsfoto, auf dem er dreinblickte, als habe er sein Gehirn auf Urlaub geschickt. Das war nicht ungewöhnlich, die meisten Menschen sahen auf diesen Bildern so aus, vermutlich glaubten sie, der Eindruck eselhafter Duldsamkeit wirke auf Arbeitgeber stimulierend.
Unter keinen Umständen hätte Heckler erwogen, auch nur eine Sekunde seiner Zeit einem solchen Menschen zu opfern, doch er schuldete in »tiefempfundener kollegialer Verbundenheit« einen Gefallen.
Es half also alles nichts, es war Viertel vor zehn, bestimmte Dinge waren in Angriff zu nehmen, Telefonate zu führen, Kontakte herzustellen, zu erneuern oder zu unterbinden, Stimmungen auszuloten und zu manipulieren, Entwicklungen zu überwachen und einzuschätzen, es galt zu hören und zu sehen und, wenn nötig, einzugreifen, kurzum: zu arbeiten. Für neun Uhr hatte er Spring herbestellt, seit einer Dreiviertelstunde wartete der, ohne einen Mucks von sich zu geben. Schafsgeduldig würde er wohl den Rest des Tages draußen vor sich hin dämmern oder sich vielleicht vor Aufregung den Hosenboden auf dem Stuhl blank reiben, das machte keinen Unterschied, denn die Initiative ergreifen, einfach hereinkommen oder doch irgendetwas unternehmen, um vorgelassen zu werden, würde er nicht. Wer das nach einer Dreiviertelstunde nicht tat, tat es auch nach drei Stunden nicht, tat es nie. Was für eine lahme Ente hatte Kehl ihm da geschickt. Es hatte wirklich alles im Leben seinen Preis.
Heckler drückte eine Taste an seinem Telefon und sagte, als hätte seine Sekretärin ihn überredet:
»Schicken Sie ihn rein, Frau Koboll.«
Einen Augenblick später öffnete sie die Tür, hielt sie auf, und vorsichtig betrat ein sportlich aussehender junger Mann das Zimmer, Spring, kein Zweifel, der in natura um einiges lebendiger aussah als auf dem Bewerbungsbildchen. Heckler wies ihm, selbstverständlich ohne aufzustehen, mit einer eleganten Handbewegung einen Stuhl ihm gegenüber zu, auf den Spring sich setzte. Er lächelte sympathisch, ungemein sympathisch, nicht einstudiert, nicht verkrampft, nicht ängstlich – Heckler, der mit natürlichem Charme nicht gerechnet hatte, lächelte ebenfalls. Vielleicht war mit diesem Jungen doch etwas anzufangen. Das würde er schnell herausfinden. Er beendete das Lächeln und setzte den Blick auf, mit dem er Gegner ins Visier zu nehmen pflegte, einen strengen, durchdringenden, aber auch etwas spöttischen Blick, und fragte:
»Was haben Sie sich eigentlich gedacht, als Sie die letzten fünfundvierzig Minuten da draußen gesessen sind?«
2. – Kurt Schellenbaum …
Kurt Schellenbaum zog sich den Badeslip an, den Lea? – natürlich Lea!, wer denn sonst? – ganz und gar unerwartet auf den Hocker in seinem Ankleideraum gelegt hatte, sodass er nicht zu übersehen war. Glitzerndes, dunkelblaues Material mit roten Streifen an der Seite, ziemlich enganliegend – er konnte sich ein Schmunzeln nicht verwehren, während er sich im Spiegel betrachtete und dabei den Bauch einzog. Sean Connery als James Bond trug solche Badehosen, doch das war schon eine ganze Weile her.
Sollte er folglich so, wie er war, gleich ins Schlafzimmer zurückgehen und seine Frau im Schlaf überraschen? Sich in seiner neuen, ihm von ihr offenbar in romantischer Absicht geschenkten Badehose so an sie schmiegen, wie sie das vielleicht von ihm erwartete? Oder erwartete sie das gar nicht von ihm? Das konnte man vorher nie wissen, doch allein, dass ihr nach einer solchen Geste zumute gewesen war und er daraufhin einen solchen Schritt erwog, wertete er als Umschwung, zarten Neuanfang, man hätte vielleicht sogar sagen können: als Durchbruch. Das, dachte Schellenbaum, sollte eine Weile so stehenbleiben. Wie leicht konnte man romantische Annäherungen durch allzu forsches Werben vermasseln, auch und gerade gegenüber der eigenen Ehefrau!
Seit siebzehn Jahren waren sie ein Paar, seit zwölf Jahren verheiratet, Lea kannte ihn in- und auswendig, jedenfalls in einiger Hinsicht, und sie hatte es sich nie nehmen lassen, ihren Schellenbaum zu erziehen, wie sie sagte, und war sie mit ihm zufrieden, was selten genug der Fall war, bekam er Geschenke, und zwar zumeist figurbetonende Kleidungsstücke. In taillierten Hemden, enganliegenden T-Shirts, auf der Hüfte sitzenden Hosen oder eben einer – wenn man ehrlich war – deutlich zu knappen Badehose sah er so furchtbar lächerlich aus, dass er diese Dinge um keinen Preis der Welt vor anderen Menschen getragen hätte, aber er verstand doch, was Lea mit diesen Gaben auszudrücken versuchte, nämlich dass sie ihn begehrte, ihn, jawohl, sexy fand, obwohl sie ihn oft und gerne auch vor anderen Leuten tadelte, dass er so zugenommen hatte. In der politischen Arena hingegen störte sich niemand an seinem Übergewicht, dort nahm man es vielleicht sogar als Zeichen dafür, dass er ein ganzer Kerl geworden war. Endlich.
Er schlüpfte in einen Bademantel, verließ den Ankleideraum und tänzelte die Travertintreppe hinunter zum Schwimmbad, er schaltete die Unterwasserbeleuchtung ein, der Raum war angenehm temperiert, es roch nach Holz und Kräutern vom letzten Saunagang. Dann warf er seinen Bademantel über die Tischtennisplatte und stieg über eine Aluminiumleiter an der Stirnseite des Pools ins zweiundzwanzig Grad warme Wasser. Immerhin, zehn Meter lang war das Becken, er nahm sich zwanzig Bahnen vor, gemächlich, Brust – das war mehr als nichts.
Es war ein wundervoller Morgen. Obwohl es schon acht war, hatte er Zeit, denn er musste erst um zehn Uhr in der Staatskanzlei sein, zur Vorbereitung der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten am Mittag. Außerdem war er erfüllt von dem Triumph, den er am Vorabend errungen hatte. Ein erfreulicher, in dieser Eindeutigkeit sogar für ihn selbst unvorhergesehener Triumph. Er war, zum ersten Mal in seiner Karriere, Gast bei jener politischen Fernseh-Talkshow am Sonntagabend gewesen, die, nach Einschätzung einiger Leitartikler, an Bedeutung und Einfluss sogar den Bundestag übertraf. Landespolitiker aus der zweiten Reihe, wie er, durften normalerweise nur davon träumen, dorthin eingeladen zu werden, und auch ihn hatte dieses Glück nur ereilt, weil sein Ministerpräsident am Sonntagabend zum Abschluss einer »Woche der Partnerschaft« im Kreml empfangen worden war und erst am Montagmorgen zurückkam.
Das Thema der Talkrunde, Elitenförderung, lag dem Ministerpräsidenten sehr am Herzen, deshalb hatte er Schellenbaum gebeten, ihn zu vertreten. Die Fernsehredaktion hatte nichts dagegen gehabt, Schellenbaum war als Scharfmacher bekannt, besaß also einen gewissen Unterhaltungswert, während der Ministerpräsident zu nervösen Ausfallerscheinungen neigte, die ihn geistig hinfälliger erscheinen ließen, als er vielleicht war.
Schellenbaum hatte sich vorbereitet. Im Sinne seines Chefs hatte er, wie er es immer tat, den freien Wettbewerb, die Chance des Tüchtigen, die Verpflichtung zur Leistung und so weiter preisen wollen, doch dann bekam er eine Information … Als er vor laufenden Kameras sagte: »Es gibt in Deutschland ein Unterschichtsproblem«, glaubten viele, das wäre sein Auftakt zum Gewohnten, nach dem er sich, schneidig, wie er es verstand, auf die Faulen stürzen würde, die Arbeitsunwilligen, die es sich auf Kosten der Allgemeinheit bequem machten, und so weiter. Umso größer war die Überraschung, als man ihn sagen hörte: »Wir müssen diese Menschen zurückholen in die Gesellschaft, müssen sie unterstützen und fördern. Die Elitenförderung ist eines unserer vordringlichsten Ziele, aber wir dürfen darüber nicht den Schwächsten das Gefühl geben, für sie sei der Zug abgefahren. Menschen, die den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben, sind für die Gesellschaft verlorenes Kapital. Wir dürfen sie nicht aufgeben, sondern müssen sie ins Boot zurückholen.«
Er pausierte, um sich einen Eindruck von der Wirkung seiner Worte zu verschaffen. Sie war gewaltig. Durch das Studiopublikum ging ein verwundertes, doch zustimmendes Wispern, die Gäste vor der Kamera, Disputanten aus den anderen Parteien, schienen verstört, so auch der Moderator, der ihn skeptisch, fragend, ja sogar etwas vorwurfsvoll ansah, weil er nicht die Position vertrat, deretwegen er eingeladen worden war, sondern offenkundig einfach sagte, was ihm gerade durch den Kopf ging. Hatte er getrunken? Nein. Er legte nach. »Die sozial Minderbemittelten«, sagte er, »also die sozial Schwachen müssen eine faire Chance erhalten. Reintegration ist das Stichwort. Und es ist nicht getan damit, dass man diese Leute mit ein paar hundert Euro pro Monat abspeist, ja sich auf diese Weise buchstäblich von ihnen freikauft. Nein, es sind die Menschen, die nun endlich im Mittelpunkt zu stehen haben, und nicht das Geld.«
Das hatte er sich nicht vorher zurechtgelegt, jedenfalls nicht wortwörtlich, das sagte er wirklich genau so, wie es ihm gerade durch den Kopf ging. Die Menschen und nicht das Geld. Das kam an. Das leuchtete auch dem Studiopublikum sofort ein. Es applaudierte ihm, demselben Schellenbaum, der sonst predigte, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied, jenem Schellenbaum, der Zwangsdienste für Arbeitslose einführen wollte und die elektronische Fußfessel für Arbeitsunwillige, die ihre Meldepflichten versäumten.
War, was er sagte, die neue Linie seines Ministerpräsidenten? Stand es gar in Verbindung mit dessen Reise nach Moskau? Oder waren dies allein seine Ansichten? Handelte es sich um eine öffentliche Kurskorrektur oder um einen geschickten Schachzug? Gleichviel, nach dem Ende der Sendung kam Notger Mittag, Gewerkschaftsurgestein, der ihm gegenübergesessen hatte, mit mürrischem Gesicht auf ihn zu und sagte: »So einfach wirst du uns die Leute nicht wegschnappen. Wenn du dich da mal nicht vergaloppiert hast.«
»Ich bitte Sie, wir kennen uns doch überhaupt nicht«, antwortete Schellenbaum, der sich über das Du empörte. Er wusste, dass sich Gewerkschafter untereinander duzten, auch wenn sie sich nicht kannten, aber war er vielleicht Gewerkschafter? So weit ging die Liebe nicht!
»Ist schon recht«, murmelte Mittag, winkte ab und zog davon.
Auf dem Weg aus dem Studio sprachen ihn viele Leute an, denen sein Auftritt gefallen hatte. Eine hübsche junge Frau, Anfang dreißig vielleicht, die, nach ihrer Art und Kleidung zu schließen, eher nicht seine Partei wählte, rief ihm zu: »Sie sind vielleicht gar kein so schlechter Typ«, und ihr Freund in einem modischen Anzug nickte ihm, ihre Worte bestätigend, zu.
Er hatte schon viel Applaus bekommen in seinem Leben, seinem politischen Leben, um genau zu sein, pflichtgemäßen, schwerfälligen, dumpfen, letztlich gekauften, zu teuer bezahlten Applaus. Aber der Applaus vom Vorabend hatte anders geklungen, freier, spontaner, echter. Das gefiel ihm, und er freute sich auf die Presse, die allerdings erst am Dienstagmorgen darüber berichten würde, da die Sendung am Sonntag erst nach Redaktionsschluss der Zeitungen geendet hatte.
Vorläufig mussten sich seine Kollegen in der Parteizentrale und der Staatskanzlei, die sicher fassungslos vor ihren Fernsehern gesessen hatten, auf ihr eigenes Urteil verlassen, obwohl dies, wie Schellenbaum sehr gut wusste, jedem Politiker wesensfremd war. Auch vor dem Ministerpräsidenten fürchtete er sich nicht, denn er besaß eine Information von der Gegenseite, und selbst wenn sich der Ministerpräsident noch so über den Fernsehauftritt aufregen sollte, was wahrscheinlich war, denn er regte sich über alles auf, würde es diese Information sein, die ihm die Genialität von Schellenbaums Schachzug mit einem Schlag vor Augen führte.
Hochzufrieden mit sich und der Welt, wendete er und nahm Bahn Numero siebzehn in Angriff, als Lea das Schwimmbad betrat, mit einem cremefarbenen Bikini bekleidet und mit jenem Lächeln auf den Lippen, das sie nur aufsetzte, wenn er sich Hoffnungen erotischer Natur machen durfte, und das er schon so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte.
Er lächelte zurück, versuchte, es schüchtern aussehen zu lassen, sie blieb an der Aluminiumleiter stehen, beugte das Knie, wartete, bis er ihre Seite des Beckens erreicht hatte, und sagte, ironisch tadelnd, eine Hand in die Hüfte gestützt:
»Was hast du dir dabei bloß gedacht?«
3. – Ladislav Richter kam …
Ladislav Richter kam auf dem Fußboden seines Ein-Zimmer-Apartments zu sich und wäre gern ein anderer gewesen. Jemand, der sich am Vortag nicht mit seinem alten Freund Mark Gruber die Kante gegeben hatte. Demselben Mark Gruber, der sich, wie es aussah, aus dem Staub gemacht hatte, ohne sich zu verabschieden.
Richter war vollständig bekleidet, in dieser Aufmachung hatte er also übernachtet. Auf dem Teppich. Der Fernseher lief stumm, lachende Gesichter. Er wollte gar nicht hinsehen, fühlte sich, als hätte ihn etwas Großes, Schweres am Kopf getroffen. Vorsichtig betastete er ihn: Er wies keinerlei Verletzungen auf, jedenfalls keine äußeren. Seine Kleidung, beige Baumwollhose und kariertes Flanellhemd, stank nach Rauch, in seinen Schläfen pochte Alkohol.
Die Türglocke läutete. Er glaubte, sich zu erinnern, dass sie vor kurzem schon einmal geläutet hatte und dass er davon aufgewacht war. Vielleicht dachte er das aber auch nur, weil das Läuten so dringlich klang, so energisch.
Jetzt klopfte jemand an der Tür und rief:
»Herr Richter? Sie sind da, das weiß ich. Öffnen Sie bitte die Tür.«
Es war die Stimme eines Mannes, die er nicht erkannte. Er sah auf die Digitaluhr des DVD-Players, es war halb neun Uhr morgens. Wer konnte es also sein, der da hereinwollte? Seit zweieinhalb Monaten zahlte er die Miete nicht, was an seinem Gewissen nagte, obwohl er sich einzureden versuchte, nichts dafürzukönnen, weil es sozusagen höhere Gewalt war, die ihn daran hinderte. Vor ein paar Tagen war ihm deshalb die Wohnung gekündigt worden. Nicht nur die Miete, auch Strom- und Wasserrechnungen standen offen, Beiträge für die Künstlersozialkasse und das Zeitungsabonnement. In den vielen unfreundlich aussehenden Briefen, die er, wann immer sie eintrafen, ungeöffnet in einer Küchenschublade verschwinden ließ, war die Rede von weiteren Ansprüchen gegen ihn. Er hatte die Übersicht verloren. Der Mann mit der energischen Stimme hinter der Tür war ein Abgesandter der Hausverwaltung, ein Gerichtsvollzieher, ein Geldeintreiber einer Inkasso-Firma, ein Polizist.
Richter rappelte sich hoch, schlich so geräuschlos wie möglich zu seinem Schreibtisch, zog eine verknitterte, durchsichtige Plastiktüte, gefüllt mit Gras, aus der Schublade und ging damit zur Balkontür, die er mit einem viel zu lauten Knacken aufzog. Die frische Luft von draußen traf ihn wie eine Faust. Er schwankte, hielt sich am Türrahmen fest. Als ihm besser war, legte er die Tüte auf den Boden und stülpte einen leeren Blumentopf darüber. Außer dem Blumentopf befanden sich zwei Stühle und ein Tischchen aus Aluminium auf dem Balkon. Auf dem Tischchen stand ein mit Kippen und Regenwasser gefüllter Aschenbecher. Es läutete und klopfte wieder, diesmal gleichzeitig.
»Herr Richter!«
Ladislav Richter hatte mit Drogen überhaupt nichts zu tun, normalerweise, und nahm sie nicht einmal gerne, weil sie seinen völlig überstrapazierten Kopf nur noch verrückter machten, als er es ohnehin schon war. Mark Gruber hatte die Tüte mit Gras gestern mitgebracht und sie ihm geschenkt. Er hatte sie nicht gewollt, sondern vorgehabt, sie Gruber heute zurückzugeben, aber der Polizist, der so bescheuert war, diese Geschichte zu glauben, war noch nicht geboren.
Der Mann draußen schlug mit der Faust gegen die Tür.
Richter rang die Hände. Er musste aufmachen und versuchen, einen möglichst unverdächtigen Eindruck zu erwecken, egal, ob es ein Polizist war oder ein Halsabschneider, den einer seiner Gläubiger geschickt hatte. Roch es hier drin eigentlich nach Haschisch? Wahrscheinlich, doch das war jetzt nicht mehr zu ändern. Er ging in den einen Quadratmeter großen Flur und besah sich, bevor er nach der Türklinke griff, im Spiegel. Die Augen blutunterlaufen, gerötet, verschwollen, die Haare zerzaust, der Gesichtsausdruck zerfahren und unsicher. Er sah aus, als wäre er schuld, an was immer man ihm vorwarf.
Er drückte die Klinke nach unten und zog die Tür auf.
»Polizei, guten Morgen, Herr Richter, wir wissen, dass Sie Drogen im Haus haben, ich durchsuche jetzt Ihre Wohnung.«
Es war Gruber, der da vor der Tür stand: blaue Jeans, blaue Jeansjacke, verspiegelte Piloten-Ray-Ban, Koteletten, schüttere blonde Haare. Richter sank in sich zusammen, machte kehrt und ging zurück in die Wohnung. Gruber, vergnügt, dass sein toller Witz so gut funktioniert hatte, folgte ihm. Als er bemerkte, wie elend Richter aussah, versuchte er ihn zu trösten:
»Beruhige dich, ich war Brötchen holen und hatte keinen Schlüssel dabei. Irgendwie musste ich dich ja wach kriegen.«
Gruber war sein ältester Freund, sie kannten sich, seit sie sechzehn waren, und hatten gemeinsam eine erstaunlich lang andauernde Jugend verbracht, und auch heute noch, mit Ende dreißig, trafen sie sich regelmäßig, wenn auch selten, um ihre Jungsabende zu zelebrieren. Für Gruber war das Routine, er lebte noch immer so wie mit Anfang zwanzig von Gelegenheitsjobs und ein bisschen Dealen, verbrachte seine Abende in Bars und Clubs, verliebte sich in Frauen, betrog sie oder wurde von ihnen betrogen, verließ sie oder wurde von ihnen verlassen, lud sich Musik aus dem Internet herunter und brannte sie auf CDs, die er verschenkte, ging ins Kino und auf Konzerte, hatte ein Faible für Buddhismus, praktizierte Yoga, und weil er sich niemals beklagte, hielt Richter ihn für einen starken Menschen, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen war.
Er selbst lebte seit vier Jahren in einer nervenaufreibenden sogenannten Beziehung mit seiner Freundin Kristina. Seit zwei Wochen waren sie, zum x-ten Mal, getrennt, und Kristina hatte ihm verboten, sie anzurufen, weil er ihr in der Zeit davor zu viel Nähe abverlangt hatte und, wie sie sagte, dabei erpresserisch vorgegangen war, denn er hatte sie gefragt, was dagegenspreche, sich zu sehen, wenn man ineinander verliebt sei. »Verliebt? Du und verliebt? Ich und verliebt? Bist du der Meinung, dass unser, wie soll ich es nennen, Verhältnis zueinander mit diesem Adjektiv zutreffend beschrieben ist?«, war ihre Gegenfrage, die sie selbst beantwortete, indem sie ihm die Wohnungstür vor der Nase zuschlug.
Die vergangenen zwei Wochen hatte er allein in seiner Wohnung verbracht und jeden Tag von morgens bis abends an der dritten Fassung eines Drehbuchs geschrieben. Obwohl noch nie eines seiner Bücher verfilmt worden war, hatte er verdient, was er zum Leben brauchte. Fernsehsender und Filmproduzenten entwickelten viele Stoffe, die wenigsten wurden realisiert. Weil er schon lange dabei war, genoss er sogar einen gewissen Ruf als Autor. Gelegentlich wurde er gebeten, Drehbücher anderer Autoren, die nicht weiterkamen, als Skript-Doktor zu überarbeiten, was auch ein bisschen Geld brachte.
Aber seit einigen Monaten konnte er nicht mehr.
Er schob die dritte Fassung, die er schreiben musste, vor sich her und sagte Aufträge zur Überarbeitung anderer Drehbücher mit der Begründung ab, er habe zu viel mit seinem eigenen zu tun. In Wirklichkeit kam er nicht vorwärts. Er stand morgens auf, setzte sich an den Computer, öffnete die Datei seines Drehbuchs, minimierte sie, ging ins Internet und loggte sich in Chatrooms ein, in denen er andere Nutzer, am liebsten solche, die sich als Frauen ausgaben, mit der Beschreibung seiner Schreibblockade zu beeindrucken versuchte. Meist traf er auf jemanden, der es charmant fand, sich eine Weile lang mit ihm den Kopf darüber zu zerbrechen.
Geld von der Produktionsgesellschaft würde er erst wieder nach Abgabe der dritten Fassung bekommen, Geld, das schon jetzt seinen Gläubigern gehörte. Das war ihm bewusst, doch arbeitete er mit aller ihm zur Verfügung stehenden Raffinesse daran, es zu verdrängen.
Ein Treffen mit Gruber bedeutete einen Tag Urlaub von seinem Dilemma. Das war der Grund, warum er sich so vergessen hatte. Am Nachmittag schon hatten sie sich in ihrer alten Stammkneipe, dem »L 17«, eingefunden, und Gruber musste ihn nicht lange überreden, gleich mit Bier anzufangen. Er nahm sich zwar vor, nach dem zweiten aufzuhören, er hatte ja gar nicht das Geld, um mehr zu trinken, aber Gruber, der flüssig war, spendierte ihm ein drittes, und vor dem vierten verwickelten sie Jürgen, den altgedienten Wirt, in ein rührseliges Gespräch, in dem sie Erinnerungen an den Eröffnungsabend des Lokals vor neunzehn Jahren wieder aufwärmten, woraufhin er Richter anschreiben ließ.
Im dichter werdenden Alkoholnebel des frühen Abends malte er, immer unter Hinweis darauf, Gruber nicht etwa »belemmern« zu wollen, in allen Details ein düsteres Bild seiner Schreibkrise, und noch einige Biere später schlug Gruber vor, zum nahe gelegenen Flussufer hinunterzugehen, weil er sich partout einbildete, mit Richter, dem das eigentlich widerstrebte, eigens für diesen Abend mitgebrachtes Haschisch rauchen zu müssen, was er, um ihn zu amüsieren und damit weichzukriegen, »einen fetten Oschi durchziehen« nannte.
»Mensch, komm, Richter, alte Pfeife, lass uns einen fetten Oschi durchziehen. Du wirst sehen, das ist die Inspiration für dich. Danach werden bei dir die Fingerchen über die Tasten hüpfen, dass es nur so eine Freude ist.«
Er wiederholte das ein ums andere Mal, drei deutlich jüngere Typen am Nebentisch wurden darauf aufmerksam und lachten schon darüber, und gerade weil das Gerede so idiotisch war, gab Richter schließlich seinen Widerstand auf, und sie verabschiedeten sich von Jürgen, nickten den drei Jungen zu, die ihnen viel Spaß wünschten, und machten sich auf den Weg zum Flussufer, um, tja, dort einen dicken Oschi durchzuziehen. Am Wasser kauernd, betrachteten sie die Sterne und kicherten unablässig, Richter über die Sterne, Gruber über Richter. Später krabbelten sie die Böschung hoch und machten sich auf den Weg ins Kino, aber es lief überall nur Schrott, also gingen sie zu Richter nach Hause, um sich alte Filme anzusehen.
Auf dem Sofa drehte Gruber eine weitere Hasch-Zigarette und noch eine und freute sich diabolisch, dass Richter nach anfänglichem Zögern zum bedingungslosen Mitraucher geworden war. Der träumte davon, die dritte Fassung seines Drehbuchs könne vielleicht so gut werden wie die der Filme, die sie sahen. Er spürte, dass er die Fähigkeit besaß, die Quelle in sich trug, aber es war ihm bisher nicht gelungen, sie anzuzapfen. Vielleicht hatte Gruber ja recht und das Haschisch half …
Unterdessen wusste er, dass es nicht half, es sei denn, man wollte rasende Kopfschmerzen und das Gefühl, eine zu Asche zerfallene Lunge im Brustkorb zu tragen, als Hilfe bezeichnen. Ihm war beim besten Willen nicht nach Essen zumute. Er ging zum Herd und setzte Wasser auf. Bisher hatte er Gruber nichts von der Kündigung erzählt. Nicht, dass er sich geschämt hätte, nein, er hatte sich lediglich nicht den Abend verderben wollen. Da er diese Sorge nun nicht mehr zu haben brauchte, erzählte er Gruber, der schließlich sein ältester und bester Freund war, von seiner finanziellen Lage.
Der beeilte sich zu erklären, dass er leider selbst völlig abgebrannt sei und deshalb nicht aushelfen könne, war aber bereit, mit ihm zusammen mögliche Lösungen des Problems zu suchen.
»Hast du mit Kristina darüber geredet?«, fragte er.
»Ich habe mit Kristina in den letzten zwei Wochen über gar nichts geredet.«
»Ihr habt euch getrennt?«
»Nicht getrennt, glaube ich. Eher das Übliche.«
»Du wirst sie anpumpen müssen.«
»Ich darf sie zurzeit noch nicht mal anrufen.«
Margarine und Honig waren das einzige Essbare in seinem Kühlschrank, er nahm beides heraus und stellte es auf den Tisch, dann servierte er den Nescafé. Sie aßen schweigend. Richter litt. Grubers Miene wurde zusehends unentspannter.
»Na schön, ich helf dir.«
»Du leihst mir das Geld?«
»Ich sag dir doch, ich hab nicht so viel. Aber ich weiß, wie es gehen könnte. Wir brauchen ein Auto. Kristina?«
Richter zögerte.
»Wozu brauchen wir ein Auto?«
»Wir müssen einen Freund von mir besuchen, der wohnt ein bisschen außerhalb, da kommen wir anders nicht hin.«
»Und was machen wir bei deinem Freund?«
»Das erkläre ich dir auf der Hinfahrt. Ich bin sicher, er kann dir helfen.«
Es passte Richter überhaupt nicht, Kristina um einen Gefallen zu bitten. Aber was blieb ihm anderes übrig?
»Also gut.«
»Gleich nach dem Frühstück rufst du sie an.«
»Und was soll ich ihr sagen?«
»Na, dass wir uns ihr Auto leihen wollen und sie es heute Abend wieder zurückbekommt.«
»Und wenn sie wissen will, wozu?«
»Sagst du, wir wollen einen Ausflug machen.«
4. – »Was haben Sie sich …
»Was haben Sie sich eigentlich gedacht, als Sie die letzten fünfundvierzig Minuten da draußen gesessen sind?«
Sebastian Spring betrachtete Ludwig Heckler voll Bewunderung. Er verwendete viel Sorgfalt auf sein Äußeres, das war das mindeste, was man sagen konnte. Alles passte und saß perfekt, hatte die Farben, die es haben sollte, und war an dem Ort, wo es hingehörte. Er wirkte kompakt, intakt und konnte sich deshalb voll und ganz seiner Aufgabe zuwenden, die in diesem Moment Sebastian Spring hieß. Heckler würde an keinem Ort der Welt fünfundvierzig Minuten warten, schon gar nicht, wenn man ihn dort einbestellt hatte. Spring war klar, dass die Frage nicht nur eine Floskel war, sondern der Beginn des Vorstellungsgesprächs. Sein Instinkt sagte ihm, dass seine einzige Chance darin bestand, in die Offensive zu gehen.
»Darf ich ganz ehrlich sein? Ach, ich bin es einfach. Sehen Sie, in der ersten Viertelstunde habe ich gedacht, Dr. Heckler ist ein vielbeschäftigter Mann. Er wird etwas sehr Dringendes zu erledigen haben, was er der Beschäftigung mit mir vorzuziehen hat. Nach einer halben Stunde dachte ich, Sie wollen mich testen und mein Teil der Aufgabe besteht darin, ruhig zu bleiben und zu warten, bis Sie mich hereinrufen und mir diese Frage stellen.«
»Und was, wenn Ihre Aufgabe darin bestanden hätte, nach zehn Minuten hereinzuplatzen und zu fragen: Verdammt nochmal, was ist mit meinem Vorstellungsgespräch? Wir hatten einen Termin!?«
»Hätte ich niemanden angetroffen.«
»Wie bitte?«
»Nach zehn Minuten, sagen Sie? Ich war um neun hier. Sie sind um Viertel nach neun durch die hintere Tür in Ihr Büro gekommen.«
»So?«
»Ja, ich hörte eine Tür, vermutlich die dahinten, kurz darauf zwängte sich Ihre Sekretärin durch die vordere, ich sah auf die Uhr, es war neun Uhr sechzehn.«
Spring hatte nicht vorgehabt, frech zu sein, es hatte sich so ergeben. Er suchte nach Anzeichen von Verärgerung bei seinem Gegenüber, doch Hecklers strenger Gesichtsausdruck wich einem Lachen, das so abrupt endete, wie es begann.
»Heckler Rechtsanwälte ist eine überdurchschnittliche Kanzlei. Ihre Examensergebnisse und Ihr Lebenslauf sind es nicht. Wie kommt es, dass ich Sie eingeladen habe?«
War es seine Aufgabe, fragte sich Spring, auf die Beziehung zwischen seinem Onkel Werner Kehl und Heckler hinzuweisen? Er wusste nichts darüber. Deshalb entschied er sich anders.
»Noten und Lebensläufe sind nicht alles. Ich werde einen guten Anwalt abgeben.«
»Ihr Onkel glaubt das auch.«
Die Frage, ob er, Heckler, diesen Glauben teilte, ließ er unausgesprochen im Raum stehen und gab dazu seinem Gesicht jenen Ausdruck freundlicher Aufmerksamkeit, die seine Gegner für Kälte hielten.
Spring war beeindruckt. Werner Kehl hatte zu ihm über Heckler gesagt: »Ein sehr guter Anwalt, der sicher etwas für dich tun wird, wenn ich ihn darum bitte.« Genügte das nun, oder genügte das nicht? Er wusste selbst, dass er keine allzu guten Noten hatte, aber er wusste auch, dass ihn ebendeshalb Heckler wohl gar nicht eingeladen hätte, wenn er ihn nicht hätte einstellen wollen.
»Ob ich das glauben soll, weiß ich noch nicht«, fuhr Heckler nach seiner Kunstpause fort. »Was nicht heißen soll, dass ich Ihnen keine Chance geben werde. Jedem in meinem Büro gebe ich eine Chance. Jeden Tag aufs Neue. Bei mir gibt es keine Garantien, auch nicht für Sie, und es gibt nichts umsonst. Aber wer Leistung bringt, wird sich nicht zu beschweren haben.«
Eine Zusage, die sich wie eine Absage anhört, dachte Spring.
»Hat mein Onkel Sie um etwas gebeten?«
»Ihr Onkel, seien Sie beruhigt, hat mich um gar nichts gebeten. Außer, Sie mir anzusehen. Das habe ich getan, und Sie gefallen mir. Warum? Sie sind nicht auf den Mund gefallen. Ich nehme an, Sie interessieren sich für die Arbeit eines Rechtsanwalts. Sobald ich das Gefühl habe, in dieser Annahme fehlzugehen, werden Sie uns wieder verlassen. Wir stehen hier nicht vor dem Traualtar, aber vielleicht ist die Sache einen Versuch wert.«
Deutlicher hätte ihm Heckler nicht sagen können, dass er ihn nur wegen der Intervention seines Onkels einstellte, und vielleicht sogar mit der Absicht, ihn bei der nächsten Gelegenheit zu feuern. Doch er fühlte sich durch Hecklers so offenkundig halbherziges Angebot nicht gedemütigt. In gewisser Weise war es mehr, als er erwartet hatte. Sie hatten noch nicht über Geld gesprochen, aber er durfte annehmen, ein Einstiegsgehalt zu bekommen, wie es in Kanzleien dieser Art üblich war: eine Summe, bei der einem Durchschnittsverdiener der Mund offen stehenblieb, wenn er sie hörte.
Einem Durchschnittsverdiener wie seiner Mutter zum Beispiel, alleinerziehende Musiklehrerin, depressiv und alkoholsüchtig seit dem Tod ihres depressiven und alkoholsüchtigen Mannes vor fünfundzwanzig Jahren, der verzweifelt und hochverschuldet starb, nachdem er als Filmproduzent endgültig gescheitert war. Spring, ihr einziger Sohn, war ihr Hoffnungsträger, ihr Augapfel, ihr Ein und Alles. Leider hatte er von der Mutter nicht die Musikalität, vom Vater nicht die Grandezza geerbt, die dieser zu seinen besseren Zeiten, glaubte man der Mutter, gehabt hatte. Er erledigte die Aufgaben, die an ihn herangetragen wurden, ohne besondere Mühe und ohne besonderen Eifer. Er war ein mittelmäßiger Schüler, musste nie eine Klasse wiederholen, tat sich aber auch in keinem Fach durch besondere Leistungen hervor. Allerdings verfügte er über ein einnehmendes und sympathisches Wesen, das ihn beliebt machte, und eine Gewandtheit in Rede und Umgang, die gefiel. In der Oberstufe wurde er einige Jahre hintereinander zum Schulsprecher gewählt.
Als sein Vater starb und der Familie ein finanzielles Chaos hinterließ, war er zwei Jahre alt. Von Kindheit an erzählte ihm seine Mutter, wie ihr Bruder Werner, damals noch ein junger Jurist am Anfang seiner Beamtenlaufbahn, ihr geholfen hatte, die Dinge in den Griff zu bekommen, Verträge zu kündigen, das wenige zu retten, was zu retten war, um am Ende die Erbschaft, die aus beinahe nichts anderem als Schulden bestand, auszuschlagen. Onkel Werner musste ihr damals als eine Art Weißer Ritter erschienen sein, so sprach sie jedenfalls von ihm. Aus dieser Zeit stammte auch ihre Überzeugung, ihr Sohn sei ebenfalls zum Juristen geboren.
Spring war der Überzeugung, zu überhaupt nichts Bestimmtem geboren zu sein, und setzte deshalb dem mütterlichen Bedürfnis, er möge Jura studieren, nichts entgegen. Er fand, was man ihm an der Universität darüber beibrachte, nicht uninteressant, aber es entfesselte in ihm auch keinen Sturm der Leidenschaft für Gerechtigkeit und Recht. Ein passabler Jura-Abschluss erhöhte die Wahrscheinlichkeit, einen gutbezahlten Job zu bekommen, das war Perspektive genug.
Für den Staatsdienst waren seine Noten nicht ausreichend, sodass er nicht in die Fußstapfen seines Onkels treten konnte, doch für Werner Kehl, der es in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren bis hinauf in einen Direktorensessel der Landesbank geschafft hatte, stellte das Öffnen anderer Türen keine unüberwindliche Schwierigkeit dar. Rechtsanwalt zu werden erschien Spring erstrebenswerter, als sich in einer Bank, einer Versicherung oder in einem anderen Unternehmen anstellen zu lassen. Das ließ er seinen Onkel wissen, und der sagte beiläufig: »Ich rufe bei Ludwig an, der schuldet mir noch einen Gefallen.« Mehr nicht.
Wie es aussah, bestand der Gefallen darin, ihm, Sebastian Spring, eine Stelle als Rechtsanwalt anzubieten. Er musste sie nur annehmen, und fürs Erste wären alle miteinander quitt: er mit seiner Mutter, und Ludwig Heckler mit Werner Kehl.
»Danke«, sagte Spring, »ich bin dabei. Ich meine, ich nehme Ihr Angebot an.«
Er verspürte undeutlich den Wunsch, noch etwas Verbindliches hinzuzusetzen, unterließ es aber. Er wollte nicht überschwänglich erscheinen. Die Männer standen auf und schüttelten sich über den Schreibtisch hinweg die Hände.
»Das freut mich«, sagte Heckler lächelnd, als sei ihm ein feiner Schachzug gelungen, »ich werde Sie jetzt an meine Frau weiterdelegieren, die Sie der Mannschaft vorstellen wird. Sie verstehen, ich muss …«
Er deutete mit einer Kopfbewegung Richtung Schreibtisch, und einen Augenblick später stand Spring wieder allein in dem Vorraum, in dem er eine Dreiviertelstunde lang gewartet hatte. Heckler schloss die Tür hinter ihm. Es war verwirrend, fast so, als wäre er hinauskomplimentiert worden. Da tauchte Frau Koboll aus ihrem Vorzimmer auf und meldete:
»Frau Dr. Heckler erwartet Sie. Ich bringe Sie zu ihr.«
5. – Während Frau Merk, …
Während Frau Merk, die Hausangestellte, das Frühstück auftrug, genoss Schellenbaum das Schweigen der Zeitungen. Nirgends stand sein Name. Was ihm sonst jenen schleichenden, säuerlichen Ärger verursachte, von dem er fürchtete, er könne ihn eines Tages an Magengeschwüren oder sogar etwas Schlimmerem erkranken lassen, erfreute ihn heute, amüsierte ihn geradezu. Kurz nach Redaktionsschluss am Sonntag hatte er für die Schlagzeile vom Dienstag gesorgt: »Generalsekretär Schellenbaum deutet Kurswechsel der Regierung an.« Er war nur der Generalsekretär einer Landespartei, und doch mischte er ganz oben mit. Und warum? Weil er Informationen besaß. Alles, was man tat oder nicht tat, beruhte auf Informationen. Man erhielt sie nur nicht immer zur rechten Zeit. Manchmal, wie er jetzt, hingegen schon. Wenn man geschickt war, und das durfte er in diesem Fall in aller Bescheidenheit von sich behaupten, konnte man aus einer Information einen Erfolg machen. Man musste wissen, wann und wo man sie verwendete, und am besten verwendete man sie, ohne sie dabei preiszugeben, und mit ein bisschen Fortune rückte man urplötzlich in ein sehr günstiges Licht.
»Du hast eine gute Phase, mein Lieber«, ließ ihn Lea wissen, der sein Vergnügen beim Zeitungslesen nicht entging.
Er nahm an, dass sie damit sowohl seine Darbietung im Fernsehen am Vorabend als auch jene von vorhin im Schlafzimmer meinte. Er empfand eine südländisch-lässige Männlichkeit, die niemand in diesem rundlichen, immer etwas glänzenden Körper vermutet hätte. Die vergangenen Wochen waren kein Honiglecken gewesen, weder in der Politik noch in der Liebe.
Der Ministerpräsident hatte sich über seine »Konturlosigkeit« ereifert, die ihm auf Bundesebene nicht behilflich sei. Als er vor vielen Jahren den Posten des Generalsekretärs innegehabt habe, sei seine Stimme in ganz Europa zu hören gewesen. »Guillotine« habe man ihn genannt. »Bei Ihnen, Schellenbaum, scheint allein der Name klingend zu sein«, höhnte er und lachte über seinen Einfall. Witze über seinen Familiennamen war Schellenbaum von Kindheit an gewohnt, ihn kränkte, dass der Ministerpräsident den seinen originell fand.
Lea hatte sich ihm seit Wochen entzogen und verweigert, und bei einem Familienessen im größeren Kreis hatte sein Schwiegervater vor kurzem festgestellt, dass sich »in der Politik offensichtlich ebenso wenig alle Erwartungen erfüllen wie auf anderen Gebieten des Lebens«. Eine Bemerkung, die Schellenbaum Sorgen machen musste, denn die Familie seiner Frau war mächtig. Eduard Klatt, ihr Vater, Kind einer mittellosen Soldatenwitwe, hatte 1956 als Vierzehnjähriger nach dem Abschluss der Hauptschule eine Werkzeugmacherlehre begonnen. Heute war er Mehrheitsgesellschafter und Chairman of the Board des drittgrößten Bohrmaschinenherstellers der Welt mit über zehntausend Mitarbeitern, Inhaber eines Lehrstuhls an der ETH Zürich, Präsident des Interessenverbands der Bauwirtschaft IdB, Duzfreund des Ministerpräsidenten und selbstverständlich Multimillionär. Demgegenüber musste sich alles gering ausnehmen, was andere in die Waagschale zu werfen hatten, selbst wenn es, wie in Schellenbaums Fall, gar nicht so wenig war.
Seine Eltern waren wohlhabende Elektrogroßhändler in einer oberbayerischen Kleinstadt, zu deren Jeunesse dorée er sich einst zählen durfte. Er hatte, mit eher bescheidenem Erfolg, Betriebswirtschaft studiert, parallel dazu aber seine politische Karriere in Partei, Kommune und Landkreis vorangetrieben. Er liebte es, scharf zu polemisieren, war aber nicht immer ausreichend informiert, was ihm bei seinen Gegnern das Etikett »starke Sprüche, schwacher Verstand« eingebracht hatte. In seiner Partei wurde er dennoch geschätzt, wenn er auch in den letzten Jahren, nachdem er zum Generalsekretär berufen worden war, auf der Stelle trat.
Ende der Leseprobe