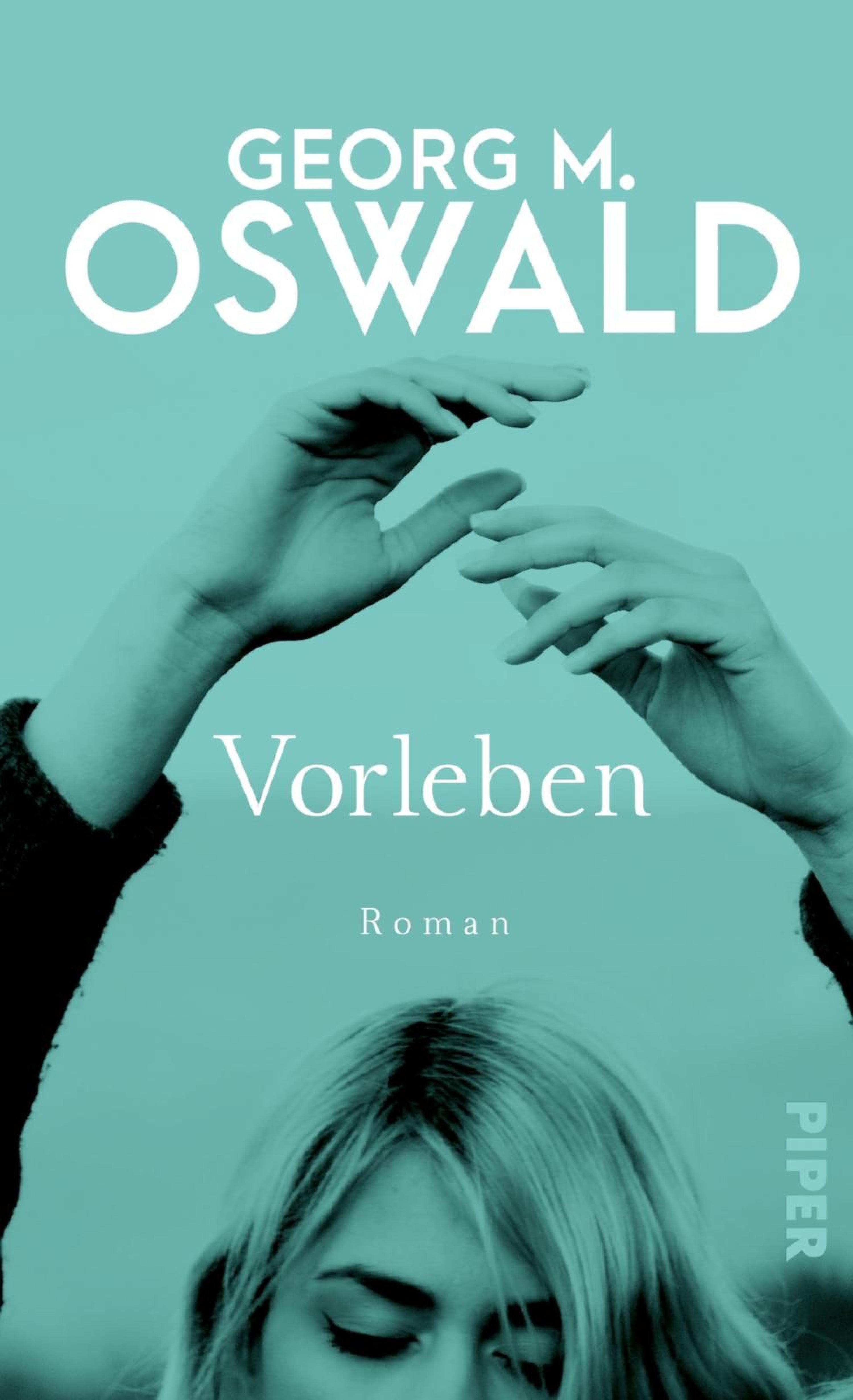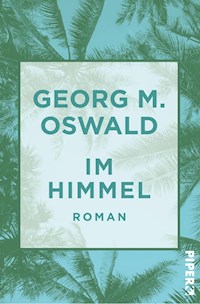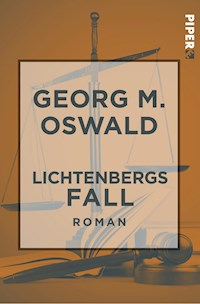18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bringt eine Erbschaft den Sandmanns das Glück? Für Tatjana, Nikolai und ihre zehnjährige Tochter Marie kommt sie fast überraschend: die Erbschaft von Tante Rose, die ihnen ein neues Leben ermöglicht. Aus der liebgewonnenen Altbauwohnung ziehen sie in Tante Roses Villa und in ein Viertel mit vermögenden Nachbarn, die alle Geheimnisse zu haben scheinen. Was zunächst anmutet wie die Erfüllung eines Traums, stellt die Familie bald auf eine schwere Probe. Literarisch raffiniert und mit feinem Gespür für seine Figuren und ihre Lebenswelten erzählt Georg Oswald von schlummernden Sehnsüchten und platzenden Illusionen. Eine Parabel unserer Zeit. »Oswalds Stärke liegt darin, dass er das gesellschaftliche Milieu seiner Figuren sehr gut kennt.« SZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: arcangel/Sybille Sterk
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»In every dream home a heartache …«
Roxy Music
1.
Später behaupteten sie, die Erbschaft sei überraschend gekommen. Das war etwas merkwürdig, denn Tante Rose hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie ihr Haus einmal Tatjana, ihrer einzigen Nichte, hinterlassen würde. Aber gelogen war es auch nicht, denn alles, was diese Erbschaft mit sich brachte, erwies sich für Tatjana, Nikolai und ihre Tochter Marie als so ungeheuerlich, dass ihnen das Wort »überraschend« dafür sogar eher untertrieben erschien.
Tante Rose hatte ihr Leben auf außergewöhnliche Weise gestaltet, und so hielt sie es auch mit dessen Ende.
Ihr Mann Rudolf war schon vor einundzwanzig Jahren gestorben, und sein Tod war plötzlich und unerwartet gekommen. Er hatte in dem ledernen Ohrensessel seines Therapiezimmers gesessen. Das war der größte und prächtigste Raum des Hauses, in dessen Zentrum eine ebenso mächtige wie rätselhafte Gerätschaft stand, mit deren Hilfe er seine Patienten behandelte.
Rudolf las, vermutlich mit Wohlgefallen, und deshalb eigentlich in ausgeglichener Stimmung, in dem von ihm selbst verfassten Buch Die Fortentwicklung des Orgons, und erlitt dabei einen Herzinfarkt, an dem er sofort verstarb. Ein stummer, schneller Tod. Erst abends, als Rose fand, er halte sich ungewöhnlich lange und still in seiner Praxis auf, sah sie nach ihm und fand ihn, das Buch in seinem Schoß liegend, als sei er eingeschlafen, aber sie verstand sofort, dass er tot war.
Sie trauerte sehr um ihn, doch nach düsteren Wochen, in denen sie endgültiger Verzweiflung sehr nahekam, gelang ihr eine Entdeckung, die Rudolf stolz auf sie gemacht hätte. Sie hatte mit der riesigen Apparatur im Therapiezimmer zu tun. Ihr sichtbarer Teil bestand aus einer ziemlich schlicht zusammengezimmerten Kammer aus massivem Holz, deren Innenseiten mit Metallplatten ausgekleidet waren. Ein kleiner Holzschemel stand darin, auf den sich die Patienten setzen mussten, bevor die Kammer geschlossen wurde. Sie befanden sich dann in einem winzigen Raum ohne Licht und mit wenig Luftzufuhr und durften deshalb nur wenige Minuten darin verweilen. Die Tür ließ sich auch von innen öffnen, damit sie die Behandlung abbrechen konnten, wann immer sie wollten.
Um Rudolf auf irgendeine Weise nahe zu sein, verbrachte Rose in den ersten Wochen nach seinem Tod mehr und mehr Zeit in dieser Kammer. Zuerst saß sie einfach nur bei geöffneter Tür darin und dachte an das, was Rudolf ihr über ihre Wirkungsweise erzählt hatte. Wie die metallisch beschichteten Innenwände die Orgonenergie des Körpers reflektierten, wo sie sich dann potenzierten. »Es ist ein absolut rätselhafter und noch kaum erforschter Prozess«, hatte Rudolf zu sagen gepflegt. »Wilhelm Reich hat die Tür nur aufgestoßen. Welch ungeheurer Raum sich dahinter eröffnete, konnte auch er nur erahnen. Ich hatte das Glück, einen ersten Schritt hinein machen zu dürfen. Ich kann sagen, ich bin weiter gekommen, als ich mir je hätte träumen lassen. Und doch ganz sicher nur am Anfang. Es wird an anderen sein, die Suche fortzusetzen. Wir haben die Spur gelegt.«
Immer wenn sie in der Kammer saß, fühlte Rose sich Rudolf besonders nahe. Das war nicht weiter verwunderlich, schließlich war dieses Zimmer der Ort gewesen, wo er die meisten Stunden des Tages verbracht hatte. Wie sollte sie an dieser Stelle nicht ganz besonders intensiv an ihn denken? Zunächst saß sie, wie erwähnt, bei geöffneter Tür auf dem Schemel im Inneren, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, probierte verschiedene Sitzhaltungen, meditierte. Alles, was ihrem Schmerz ein wenig Linderung verschaffte, war ihr willkommen. Irgendwann hatte sie, erst nur ganz vage, den Eindruck, wirklich einer Spur zu folgen. Sie wusste weder, ob dieser Eindruck zutraf, noch, wohin sie führen konnte. Aber hatte Rudolf nicht genau davon gesprochen? Von einer Spur? Eine aufrechte Sitzhaltung mit geschlossenen Augen, Rücken und Kopf gerade, die Hände auf den Knien, erwies sich als besonders ergiebig. Irgendetwas geschah, als sie so saß. Was sie anfangs aus Furcht, sich einzusperren, unterlassen hatte, tat sie jetzt: Sie schloss die Kammer. Zu ihrer Erleichterung war es nicht vollkommen dunkel darin. Die Tür war oben und unten etwas kürzer als der Rahmen; mehr Luft und Licht gelangten ins Innere als sie vermutet hatte.
Zuerst war es vielleicht eher eine Hoffnung als eine Empfindung. Aber schon bald kam es ihr vor, als folge sie einer Art unsichtbarem Wegweiser, einer Energie, die sie leitete. Und dann geschah es: Sie hörte eine Stimme; eine männliche Stimme. Nein, sie erkannte sie nicht sofort als die von Rudolf. Sie hoffte, es könnte seine sein. Rose verstand auch nicht, was die Stimme sagte. Es klang so, als spräche jemand in ein Kissen hinein. Verwaschen, dumpf. Es waren kurze, unaufgeregte Sätze, sie klangen wie beiläufige Bemerkungen, aber leider vollkommen unverständlich.
Rose experimentierte. Sie fixierte mit offenen Augen einen Punkt an der metallischen Innenwand der Kammer, so als wolle sie mit Laserblick ein Loch hineinbrennen. Die Stimme entfernte sich, sprach immer weniger, verschwand schließlich ganz. Rose schloss die Augen, um sich von der Anspannung zu erholen, die Stimme kam wieder, kam näher. Rose versetzte sich in einen tranceartigen Zustand, bewusst und unbewusst zugleich, so als erlebe sie sich selbst beim Träumen. Sie glaubte Rudolfs Stimme zu hören, die ihren Namen sagte.
»Rudolf?«, erwiderte sie zaghaft. Und alles war vorbei.
Viele Male wiederholte sie diesen Vorgang und entwickelte nach und nach eine Technik, sich in der Kammer in diesen Zustand zu versetzen, der es ihr ermöglichte, zugleich vollkommen wach zu sein und doch in einer Sphäre, die ihr ganz neu, ganz unbekannt erschien, wie ein zuvor noch nie betretener Raum. Und dann hörte sie ihn, und verstand, was er sagte:
»Da bist du ja. Gut gemacht. Ich hätte dir nicht sagen können, wie du mich findest. Aber du hast mich gefunden.«
Rose saß in kerzengerader Haltung mit geschlossenen Augen auf dem Schemel in der geschlossenen Kammer, die Hände auf den Knien. Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie sprach nicht wirklich, nicht mit ihren Stimmbändern und ihrem Mund. Sie sprach in diesem neuen Raum, den sie gefunden hatte, und in dem sie nun gemeinsam mit Rudolf war. Sie konnte ihn nicht sehen, nur hören und seine Anwesenheit spüren, auch wenn er nichts sagte.
Er schien sehr schwach zu sein, aber er war da, daran gab es nicht den geringsten Zweifel.
»Wir müssen das üben«, sagte er. Dann war er weg.
Rose stieß die Tür der Kammer auf, stürzte heraus, rang nach Luft, eilte hinaus in den Garten, atmete tief ein und aus, wie sie es beim Yoga gelernt hatte, um sich zu beruhigen. Die Frage, ob sie nun verrückt geworden war, ob die Trauer sie wahnsinnig gemacht hatte, stellte sie sich nicht. Sie kannte den Unterschied zwischen einem realen Erlebnis und einer Wahnvorstellung, und nur, dass man ein völlig unglaubliches Erlebnis hatte, bedeutete nicht, dass es nicht real war. Sie war Rudolf begegnet, sie hatte Kontakt zu ihm, es war ihr möglich, ihn in einem Raum zu treffen, den sie zu betreten gelernt hatte.
Nach diesen Begegnungen war Rose jedes Mal vollkommen erschöpft. Schon nach einem kurzen Aufeinandertreffen mit ihm schlief sie einen Tag und eine Nacht lang, bevor sie sich halbwegs wieder erholt hatte, und nach dem Aufwachen fühlte sie sich elend, so als hätte sie sonst wie über die Stränge geschlagen.
Trotzdem, sobald sie genügend Kräfte gesammelt hatte, ging sie wieder in die Kammer und hoffte, es würde ihr wieder gelingen, Kontakt aufzunehmen. Und es gelang ihr. Nur war Rudolf leider sehr schwach, sehr weit weg.
»Es ist nicht für immer«, hörte Rose ihn sagen. »Aber es wird für lange Zeit sein.«
Es dauerte eine Weile, bis Rose verstand, dass es unverhältnismäßig viel Kraft kostete, zu sprechen. Besser war es, sich auf die gemeinsame Anwesenheit zu konzentrieren, das Dasein des anderen zu spüren, ohne etwas zu sagen. Es gelang ihnen in erstaunlicher Manier, herauszufinden, wie sie sich auf diese Weise vereinigen konnten.
Nur einen einzigen Menschen gab es, dem Rose je davon erzählte, eine Freundin, der sie die Begegnungen mit Rudolf beschrieb »wie den Tanz zweier ineinandergreifender Spiralen«.
Doch Rudolfs Voraussage bewahrheitete sich. Es war nicht für immer. Lange Zeit überwog bei Rose die Euphorie über die ungeheuerliche Entdeckung und überlagerte, was schon von Anfang an zu bemerken gewesen wäre. Auch in diesem fantastischen Raum ihrer Begegnungen waren die Gesetze des Zerfalls nicht außer Kraft gesetzt. Aber sie mochte sie nicht wahrhaben. Was spielte es für eine Rolle, wie lange Rudolf da war, solange er da war? Rose übte sich darin, das Schwächerwerden der Impulse durch das Trainieren ihrer Wahrnehmungsfähigkeiten auszugleichen. Zu Beginn des letzten Jahres aber waren es nur noch undeutliche Signale, die Rose in Sekundenbruchteilen von Rudolf empfing. Schließlich war ein Zustand erreicht, in dem sie, wenn sie ehrlich war, seine Anwesenheit nur noch erahnen konnte. Und irgendwann war auch das vorbei.
Ein ganz besonderer Schmerz lag für Rose darin, dass es ihnen auch diesmal nicht gelungen war, sich voneinander zu verabschieden, und trotzig dachte sie: Warum auch, wenn sie dafür bestimmt waren, zusammen zu sein. Sie war sich sicher, Rudolf war nicht einfach weg; aber er befand sich von jetzt an in einem Seinszustand, der für sie nicht länger erreichbar war.
Da beschloss sie, es sei nun auch für sie Zeit zu gehen.
2.
Sie rief die eine Freundin an, die sie in all dies eingeweiht hatte, eine Rechtsanwältin. Dr. Johanna von Drach war Erbrechtsspezialistin, eine frühere Patientin Rudolfs, später seine Geliebte, und noch später auch eine Geliebte von Rose.
Rudolf und Rose waren zwar verheiratet gewesen, dies jedoch, wie sie stets betonten, allein wegen formaljuristischer Notwendigkeiten, die zu banal waren, um lange davon zu sprechen, also Steuern, Pensionsansprüche und dergleichen. Rose hatte auch Rudolfs Familiennamen angenommen, aber nicht, um sich dem patriarchalischen Prinzip unterzuordnen, sondern weil sie ihren eigenen loshaben wollte.
Den Charakter ihrer Beziehung sollte diese, wie sie dachten, vom Staat aufoktroyierte Zwangsform der Ehe aber nicht bestimmen. Von Beginn an lebten sie in polyamorösen Verhältnissen; offen und frei, aber ohne einander Rechenschaft zu schulden.
Nicht alle Menschen in ihrem Umfeld kamen damit zurecht, sondern fanden es skandalös, beneidenswert, oder beides. Manche aber, wie Dr. Johanna von Drach, verstanden, damit umzugehen, und auch noch lange nach dem Abklingen der erotischen Faszination aneinander blieb unter ihnen dreien eine tiefe Verbundenheit, welche die Jahrzehnte überdauerte. Sie rührte nicht zuletzt daher, dass sie ähnliche Vorstellungen teilten, vom Leben, vom Tod, und den unbenannten Gefilden dazwischen.
Dr. Johanna von Drach lebte in einem ähnlichen Viertel wie Rose. Großzügig bemessene Grundstücke mit stattlichen Einfamilienhäusern darauf, in denen wohlhabende Menschen lebten, die gerne unter sich bleiben wollten.
Das Telefongespräch, das die beiden führten, war kurz:
»Es ist vorbei. Ich erreiche ihn nicht mehr. Fährst du mich?«
»Ja, natürlich. Wie versprochen.«
Gleich nach dem Anruf packte Johanna, führte einige Telefonate und fuhr in ihrem leise summenden Hybrid-SUV direkt zu Rose. In den vergangenen Jahren war ihr Kontakt nicht mehr so regelmäßig gewesen wie früher, aber zur Begrüßung umarmten sie sich innig und lange, denn sie wussten, nun war ihre letzte gemeinsame Zeit gekommen.
Auf der Fahrt nach Zürich sprachen sie kein Wort über das, was dort geschehen sollte. Das hatten sie früher schon getan. Stattdessen redeten sie über die Zeiten, als das Leben noch ihnen gehört hatte; über die Feste, die Musik, das Tanzen, die Experimente, die sie gemacht hatten; vor allem in der Liebe. Sie hatten alles infrage gestellt, alles neu ausprobiert, einander verletzt, verziehen, viel verloren, viel gewonnen.
Sie beide waren übrig geblieben, so hatte es sich nun ergeben. Einmal, als sie schon lange geschwiegen hatten, griff Johanna nach Roses Hand und hielt sie eine ganze Weile. Das fühlte sich schön an, denn sie spürten beide, ihre Entschlossenheit überwog ihre Aufregung.
Sie fanden sich am Stadtrand in einer stattlichen und sehr gepflegten Villa der vorletzten Jahrhundertwende ein, die durch ihre immerwährend erscheinende Bürgerlichkeit Vertrauen weckte. Früher hätten sie sich darüber vielleicht lustig gemacht, jetzt fanden sie es eher tröstlich, vor allem aber nebensächlich.
Nachdem sie die Aufnahmeformalien an der Pforte erledigt hatten, die eigentlich eher einer Hotelrezeption glich, wurden sie von einer Ärztin im weißen Kittel empfangen. Sie war ungefähr sechzig, hatte grau meliertes, fülliges, zu einem Knoten gebundenes Haar und ein Lächeln, das Rose das Zutrauen gab, in den richtigen Händen zu sein. Schwer zu beschreiben, dieses Lächeln. So als gäbe es nichts, was sie nicht schon gesehen hätte.
Rose wunderte sich über sich selbst. Ein Bild, eine Fantasie kam ihr in den Sinn. Sie fühlte sich wie eine Akrobatin, die an einem neuen Zirkus ankommt, wo man die Vorführung eines besonders mutigen Kunststücks von ihr erwartet. Alle wussten, wenn sie es wagte, würde es tödlich enden, und trotzdem geriet ihr Entschluss zu tun, was sie sich vorgenommen hatte, nicht ins Wanken.
Natürlich hatte sie Angst. Aber der Wunsch, dorthin zu gelangen, wo Rudolf jetzt war, war stärker. Das hing übrigens nicht allein mit ihm zusammen, oder mit ihrer Liebe zu ihm. In den Jahren seiner Abwesenheit hatte sie den Eindruck gewonnen, sein Leben nach dem Tod sei vor allem eines gewesen: die Befreiung von den physischen Fesseln seiner Existenz. Er war an einem freieren Ort, nach dem auch sie sich sehnte. Dorthin wollte sie auch.
Die Ärztin zeigte Rose ihr Zimmer. Sie bat Johanna, draußen zu warten, schloss die Tür und führte ein letztes Gespräch mit Rose.
»Überprüfen Sie Ihren Entschluss ohne Furcht, ihn zu ändern«, sagte die Ärztin.
»Ich habe Angst. Aber ich bin mir sicher«, sagte Rose.
»Die Angst ist am Ende bei allen ziemlich gleich. Wir wollen nicht sterben. Selbst wenn wir es wollen.«
Rose nickte. Eine Weile schwiegen die beiden Frauen, bis sie gewiss waren, dass es nichts weiter zu sagen gab.
Roses Zimmer war schlicht, aber geschmackvoll eingerichtet. Johanna hatte genaue Anordnungen erteilt, wie es auszusehen habe. Sie waren gewissenhaft befolgt worden. Vor allem stand dort, wo sie stehen sollte, Rudolfs Therapiecouch, eine sehr bequeme Chaiselongue, die eigens aus seinem Arbeitszimmer hierhergebracht worden war.
»Wenn Sie möchten, machen Sie sich nun fertig, und ich komme, wenn Sie mich rufen«, sagte die Ärztin.
Rose kleidete sich in einen farbenfroh-bunten Kaftan aus Crêpe de Chine, Satin und Twill-Patchwork. Dann bat sie Johanna, hereinzukommen.
»Schön bist du«, sagte Johanna ruhig, beinahe sachlich. »Darf ich?«, fragte sie, und half, nach Roses Einverständnis, mit den Gesten einer Meisterschneiderin, sie für ein letztes Foto zurechtzumachen. Rose saß dafür schon auf der Chaiselongue, noch aufrecht, und Johanna nahm ein Porträt von ihr auf.
Sie betrachteten es gemeinsam und fanden beide, es sei außergewöhnlich gut gelungen.
Rose bat Johanna, die Ärztin zu rufen. Sie kam mit einem gewöhnlichen Glas Wasser, in dem das tödliche Barbiturat aufgelöst war.
Rose nahm das Glas, betrachtete es kurz, führte es ruhig zum Mund und trank es langsam, aber in einem Zug. Dann streckte sie sich auf der Chaiselongue aus und griff nach der Hand Johannas, die sich auf einen Stuhl neben sie gesetzt hatte. Stumm warteten sie, innig verbunden durch ihre Hände, während Rose allmählich in den Schlaf hinüberdämmerte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sich Roses Tod durch vier tiefe, gleichmäßige Atemzüge ankündigte, denen einfach kein weiterer mehr folgte.
Johanna blieb noch eine ganze Weile bei Rose sitzen und betrachtete sie, wobei sie nicht aufhörte, ihre Hand zu halten. Es schien ihr, als wäre Rose nun plötzlich wieder jung, wenn auch auf eine entrückte, unerreichbare Weise. Sie sah friedlich aus, auf wunderbare Art losgelöst von allem. Johanna war sich sicher; wenn es einmal an der Zeit wäre, würde auch sie diesen Weg wählen. Noch allerdings verspürte sie nicht den geringsten Wunsch danach. Rose hatte sie beauftragt, die letzten Dinge für sie zu regeln, und sie hatte vor, nun genau das zu tun.
3.
Tatjana und Nikolai standen in der Küche und bereiteten das Abendessen, Gemüselasagne, und diskutierten dabei mit Marie, die am Küchentisch saß. Sie mühte sich mit einer Hausaufgabe, die sie noch immer nicht zu Ende gebracht hatte. Im Allgemeinen, hieß es, täten sich Mädchen in der Schule leichter als Jungs. Für Marie galt das nicht. Sie langweilte sich oft, und fand selten Vergnügen an den Aufgaben, die Frau Elmer, die Klassenlehrerin, stellte. Obwohl Maries Eltern es nicht so direkt zugeben mochten und es auch Marie gegenüber nicht ausdrücklich sagten, waren sie schon der Meinung, das läge an Frau Elmer. Zumindest lag das Problem in ihrem Verantwortungsbereich, daran gab es ja wohl keinen Zweifel. Tatjana und Nikolai hatten deshalb demnächst einen Sprechstundentermin bei ihr. Mit ihrer Meinung über Frau Elmers pädagogische Fähigkeiten hielten sie sich auch Marie gegenüber nicht zurück, was ihnen zugegebenermaßen nicht ganz richtig vorkam. Aber wenn sie Marie eines sicher nicht beibringen wollten, war es bedingungsloser Gehorsam. Auch eine Viertklässlerin sollte das Recht haben, ihre Lehrerin zu kritisieren. Doch die Hausaufgaben mussten natürlich trotzdem gemacht werden. Tatjanas Telefon lag schon auf dem Tisch bereit für das Spiel, das Marie bis zum Essen darauf spielen durfte, wenn sie endlich fertig wäre. Und plötzlich fing es zu brummen an wie ein großer, auf dem Rücken liegender Käfer, das Display zeigte den Schriftzug »Anonym« an.
Nur bei den Großeltern waren die Telefone manchmal so eingestellt, dass sie die Nummer nicht anzeigten.
Nikolai verdrehte die Augen und fragte, ob Tatjana nicht später drangehen könne, er wolle hier weiterkommen, aber Tatjana meinte, »am Dienstagabend um die Zeit rufen sie sonst nie an«, hielt also einen Notfall nicht für ausgeschlossen und hatte das Telefon schon in der Hand. An ihrem Verhalten wurde Nikolai recht schnell klar, dass zwar nicht die Eltern anriefen, es aber wirklich um etwas Besonderes zu gehen schien. Tatjana legte, ganz aufs Zuhören konzentriert, das Gemüsemesser auf die Anrichte und ging aus der Küche. Nicht aus Sorge, aus purer Neugier, folgte ihr Nikolai ein paar Schritte und versuchte dabei, ihren Blick einzufangen, was ihm auch gelang. Sie nickte ihm auf eine Weise zu, die bedeuten sollte: Ja, passiert ist etwas, aber keine Katastrophe, jedenfalls nicht für sie; sie würde es gleich nach dem Telefonat erzählen.
Er ging, einstweilen zufriedengestellt, zurück in die Küche.
»Wer ist das?«, fragte Marie.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete er.
Nachdem Tatjana das Gespräch beendet hatte, kam sie zurück, sah erst Nikolai, dann Marie an und sagte, als sie sich ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit sicher war:
»Tante Rose ist gestorben.«
»Oh«, antwortete Nikolai, und wäre sofort bereit gewesen zuzugeben, dass dies eine eher unterkomplexe Reaktion war.
Marie aber fragte:
»Wer ist Tante Rose?«
»War«, antwortete Tatjana, »wer war Tante Rose. Das fragst du völlig zu Recht. Du hast sie nie kennengelernt.«
»Warum nicht?«
»Ich weiß es nicht so richtig. Sie wollte nicht, dass wir uns sehen.«
Das war nicht die ganze Wahrheit, wie Maries Eltern sehr wohl wussten.
»War sie sauer auf uns?«
»Nein, gar nicht.«
Marie zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen. Was sollte man dazu sagen?
»Das da eben«, fuhr Tatjana fort, »war eine Anwältin. Eine Freundin von Rose. Sie hat gesagt, ich bin Roses Alleinerbin. Und sie hat über die Beisetzung gesprochen, wenn man das so nennen kann.«
»Kann ich jetzt das Handy haben?«, wollte Marie wissen. Sie spürte, ihre Hausaufgaben schienen plötzlich nicht mehr das Wichtigste zu sein. Und das Gerede über eine Tante, von der sie gar nichts wusste, und die jetzt plötzlich tot war, gefiel ihr überhaupt nicht.