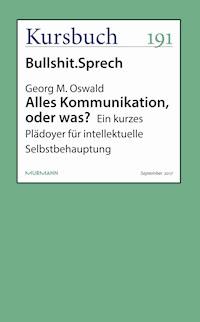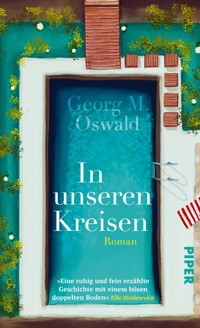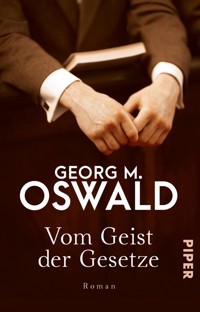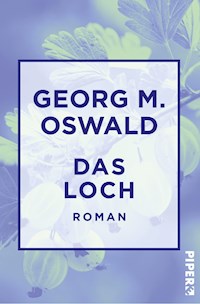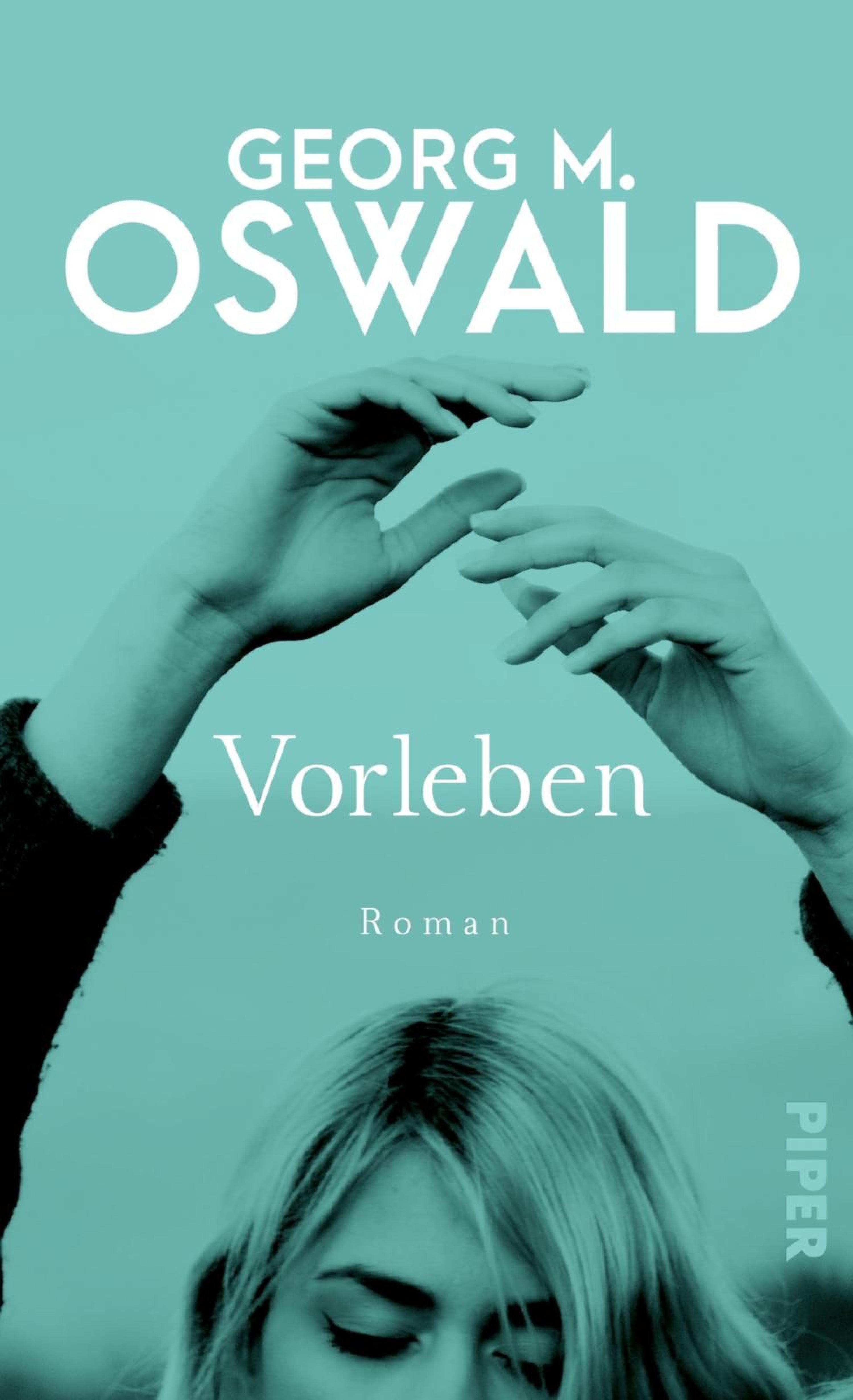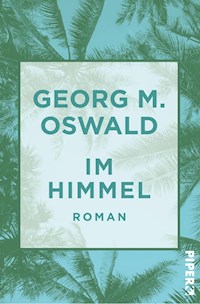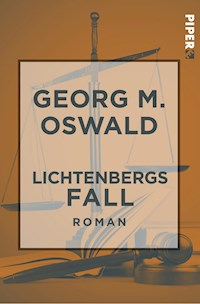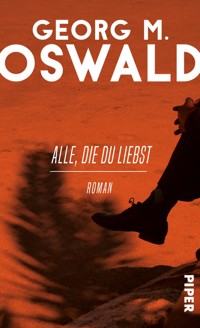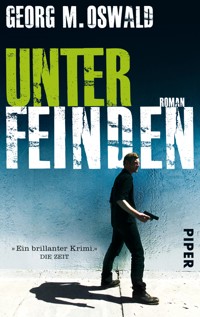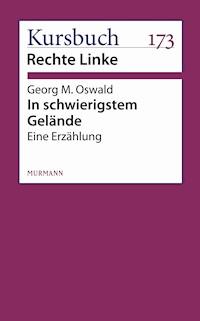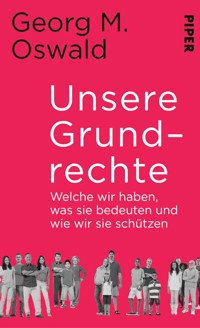
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir halten uns für kritische, aufgeklärte Bürger, die ihre Rechte kennen. Doch wenn wir unsere Grundrechte aufzählen sollen, geraten wir ins Stottern. Das ist fatal. Denn in Zeiten, in denen Rechtspopulismus wieder salonfähig wird und die Demokratie in vielen Staaten wankt, brauchen wir die Grundrechte mehr denn je. Dieses Buch ist kein juristischer Kommentar, keine Staatsbürgerkunde, schon gar keine Sonntagsrede, sondern ein Realitätscheck: Was versprechen die Grundrechte? Und was davon halten sie? Welche Grundrechte haben wir, wozu berechtigen sie und wozu nicht? Georg Oswald zeigt: Unsere Grundrechte sind alles andere als selbstverständlich. Wir müssen sie schützen. Und wir schützen sie am besten, wenn wir sie nicht zu Lippenbekenntnissen verkommen lassen, sondern sie anwenden, jeden Tag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Simon
ISBN 978-3-492-99063-9
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Rawpixel/iStockphoto und skynesher/iStockphoto und LuminaStock/iStockphoto
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Einleitung
»Und das nennt sich Demokratie?« – Verfassungsgrundsätze
»Würde ist die konditionale Form von dem, was einer ist.« – Die Menschenwürde und die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte
»Vielleicht bist du ein Realist, dem Freiheit nicht so wichtig ist.« – Persönliche Freiheitsrechte
»Alle Tiere sind gleich« – Gleichheit vor dem Gesetz
»Der Islam gehört zu Deutschland.« – Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit
»Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!« – Die Freiheit der Meinung, der Kunst und der Wissenschaft
»Die Familie ist die Keimzelle.« – Schutz von Ehe und Familie sowie nicht ehelichen Kindern
»Alle öffentlichen Schulen sind auf die mittelmäßigen Naturen eingerichtet.« – Schulwesen
»Wir sind das Volk!« – Versammlungsfreiheit
»Wenn ihr nur Vereine gründen könnt, dann seid ihr in eurem Element!« – Vereins- und Koalitionsfreiheit
»Versehentlich geöffnet« – Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
»Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein« – Freizügigkeit
»Wenn ich mal groß bin ...« – Berufsfreiheit
»Polizei! Öffnen Sie die Tür!« – Unverletzlichkeit der Wohnung
»Eigentum ist Diebstahl!« – Eigentum, Erbrecht und Enteignung; Sozialisierung
»Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.« – Ausbürgerung, Auslieferung
»Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter.« – Asylrecht
»Einmal alle vier Jahre ein Kreuzchen machen, und das war’s dann!« – Mitwirkungsmöglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie
»Wo bleibt denn da der Rechtsstaat?« – Justizgrundrechte
»Nichts Wahres lässt sich von der Zukunft wissen ...« – Schlussbetrachtung
Die Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland im Wortlaut
Literaturhinweise
Einleitung
Als ich begann, mich mit dem Thema der Grundrechte zu beschäftigen, erwies sich bald schon mein zwanzigjähriger Sohn als wichtiger Gesprächspartner. Das lag aus zwei Gründen nicht unbedingt nahe. Erstens leben wir in unterschiedlichen Städten, zweitens beschäftigt er sich in seinem Studium mit ganz anderen Dingen als den Grundrechten. Sein Interesse an diesem Gegenstand war aber von Anfang an ermutigend groß, sodass ich jede Gelegenheit nützte, mit ihm darüber zu sprechen. So kam ich auf die Idee, ihm die einzelnen Kapitel dieses Buches als Briefe zu schicken. Seine Reaktionen waren wertvolle Hilfestellungen für mich und haben an vielen Stellen ihren Niederschlag gefunden. Jean Paul schrieb: »Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde; Briefe sind nur dünnere Bücher für die Welt.« So ist es auch hier.
Bei anderen Gesprächen, die ich für dieses Buch im Vorfeld geführt habe, ist mir vor allem die Befangenheit aufgefallen, die das Thema bei vielen auslöst – das unangenehme Gefühl, man sollte mehr darüber wissen, als man tatsächlich weiß. Klar, man hatte das ja in der Schule durchgenommen. Aber wie war das noch gleich? Und dann versucht man die Grundrechte aufzuzählen, kommt jedoch nicht sehr weit, was einem peinlich ist, und versucht das Thema zu wechseln.
Der Berufsstand der Juristen nimmt solche Reaktionen eher befriedigt zur Kenntnis. Das Grundgesetz, sagen sie, sei nur vordergründig leicht zu verstehen. Um es wirklich zu begreifen, brauche man sie, die Juristen. Im Detail mag das stimmen, im Großen und Ganzen ist es jedoch grundverkehrt. Wenn jeder von uns einen Juristen neben sich bräuchte, um unsere Verfassung zu verstehen, könnten wir sie getrost vergessen.
Die Grundrechte sind einfach, jeder kennt sie.
Sie heißen, kurz gefasst: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Jeder versteht diese Begriffe, jeder weiß, was sie bedeuten. Das Grundgesetz nimmt direkt auf sie Bezug und formuliert sie aus, und, das ist das Wichtigste, es macht sie zum unmittelbar geltenden Gesetz. Alles Weitere sind Ableitungen und Präzisierungen. Es ist gut, sie zu kennen, aber ihre Kenntnis ist nicht notwendig, um die Grundidee zu verstehen.
Nehmen wir das Grundrecht auf Menschenwürde, so wie es das Grundgesetz formuliert: »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. In den juristischen Kommentaren heißt es, der Begriff der Menschenwürde könne nicht absolut bestimmt werden. Das mag so sein, doch es lässt sich in sehr einfachen Worten sagen, was dieses Grundrecht bedeuten soll: Jeder hat einen Anspruch darauf, anständig behandelt zu werden, vom Staat und von den anderen.
Dieser Anspruch kann niemandem genommen werden. Natürlich schließen sich an diese so schlichten wie grundlegenden Feststellungen viele Fragen an, die am Ende die Fachleute nicht überflüssig machen.
An dieser Stelle ist mir nur wichtig, Folgendes festzuhalten: Wenn wir wollen, dass die Grundrechte in unserem Leben Bedeutung haben, müssen wir sie vom Kopf auf die Füße stellen. Es geht nicht darum, Listen auswendig zu lernen und Rechte aufzuzählen, deren Inhalt uns nicht klar ist. Wir sollten wissen, was unsere Rechte sind. Und, wie gesagt, eigentlich wissen wir das bereits.
Es gibt zahlreiche Abhandlungen über das Grundgesetz und die Grundrechte, vom vieltausendseitigen juristischen Großkommentar bis zum handlichen, allgemein verständlich geschriebenen Kompendium. Es mangelt folglich nicht an Lektüre für Interessierte, mir geht es in diesem Buch jedoch darum, zu zeigen, wie sehr die Grundrechte in unseren aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskursen wirken, wo sie infrage gestellt, eingeschränkt, übergangen werden und wo wir aufgefordert sind, für sie zu kämpfen. Die Grundrechte sind keine Glaubensgebote. Sie sind das Regelwerk für eine andauernde gesamtgesellschaftliche Diskussion. Nur wenn wir diese Diskussion engagiert führen, entfalten sie ihre Wirkung.
Die Grundrechte sind geltendes Recht, aber prägen sie unser Leben so, wie sie es, ihrem Wortlaut nach, beanspruchen? Was sagen uns die Grundrechte in unserer aktuellen historischen und politischen Situation? Wie soll die Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen?
Wenn man beim Schreiben über diese Fragen an einen dreißig Jahre Jüngeren denkt, begreift man, dass dies wirklich offene Fragen sind und keine rhetorischen. Die gute Nachricht ist: Es liegt in unseren Händen, die richtigen Antworten zu finden, denn die Grundrechte gehören uns.
»Und das nennt sich Demokratie?« – Verfassungsgrundsätze
Was aber sind denn nun eigentlich die Grundrechte? Kurz gesagt: Die Grundrechte sind das, was in den ersten neunzehn Artikeln unseres Grundgesetzes steht. Sie umfassen das Recht auf Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Gleichbehandlung und viele andere mehr. Der Rest des Grundgesetzes, die Artikel 20 bis 146, enthalten den Bauplan des Staatsgebäudes und regeln, wie Bund und Länder, Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung, Bundesgesetzgebung, Bundesverwaltung, Rechtsprechung, Finanzwesen und der Verteidigungsfall organisiert sind.
Die Grundrechte sind, um im Bild zu bleiben, die Hausordnung. Diese Bezeichnung wird vielleicht dem hohen Ton, in dem sie verfasst wurden, nicht ganz gerecht, trifft es sonst aber ganz gut.
Das Grundgesetz ist unsere Verfassung. In der Hierarchie der Gesetze ist es das höchste. Alle Gesetze, die in Deutschland erlassen werden, müssen ihm entsprechen. Das Grundgesetz umfasst in der Textausgabe, die jeder Schüler in Deutschland geschenkt bekommt, wenig mehr als hundert locker gesetzte Seiten. Kein allzu langer Text, aber er erschließt sich nicht, indem man ihn von vorn bis hinten durchliest. Nur, wer seinen Aufbau kennt, findet Zugang.
In der Schule wurden uns die Grundrechte vor allem in ihrem historischen Kontext nahegebracht. Sie erschienen uns als hehres Besserungsgelöbnis einer besiegten Nation, die wenige Jahre zuvor noch ihre Bestimmung in Völkermord und Holocaust gesehen hatte. Nun bekannte sie sich – unter der Anleitung der westlichen Siegermächte, allen voran der Vereinigten Staaten von Amerika – zu Freiheit und Würde des Menschen. Das war wohl das Mindeste, was man nach dieser Geschichte verlangen konnte.
Das war vor einem Dreivierteljahrhundert, und spätestens nachdem die Volkskammer der DDR den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland beschlossen hatte, durfte man annehmen, dass das gesamte deutsche Volk das Grundgesetz wirklich als seine Verfassung betrachtete. Aber haben die Grundrechte heute, in einer völlig veränderten Welt, noch eine aktuelle Bedeutung?
Wir leben in einer Zeit großer politischer Umwälzungen, und die Grundrechte könnten unser Kompass sein, der uns die Richtung weist. Er liegt vor uns auf dem Tisch, in bestem Zustand und funktionsfähig. Wir müssen uns »nur« noch dazu entschließen, ihn in Gebrauch zu nehmen.
Vorweg will ich jedoch auf einige Verfassungsgrundsätze eingehen, die unmittelbar nach den Grundrechten in Artikel 20 festgeschrieben wurden. Sie geben den Rahmen vor, in dem sie gelten.
So wie Artikel 1 des Grundgesetzes mit dem Schutz der Menschenwürde das wichtigste und umfassendste Grundrecht formuliert, enthält Artikel 20 die fundamentale Feststellung: »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.«
Die Autoren des Grundgesetzes wollten es so schwer wie möglich machen, diese Grundlagen zu beseitigen oder abzuändern. Zwar gibt es grundsätzlich die Möglichkeit von Verfassungsänderungen. Wenn jeweils zwei Drittel der Bundestags- und der Bundesratsabgeordneten dafürstimmen, kann das Grundgesetz geändert werden. Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes aber bestimmt: »Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.«
Umgangssprachlich wird diese Regelung »Ewigkeitsklausel« oder »Ewigkeitsgarantie« genannt. Die Bezeichnung ist irreführend, denn Artikel 79 Absatz 3 will diese Grundsätze gar nicht für die Ewigkeit festschreiben, sondern nur solange das Grundgesetz gilt. In Artikel 20 steht, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Wenn das stimmt, müsste das Volk doch auch die Möglichkeit haben, dieses Grundgesetz abzuschaffen und sich für eine andere Verfassung zu entscheiden, die ganz andere Grundsätze festlegt.
Und genau so ist es auch. Der letzte Artikel des Grundgesetzes, Artikel 146, formuliert diese Möglichkeit ausdrücklich: »Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.«
Ist es nicht vertrauenerweckend, dass ein Gesetz sogar noch die Voraussetzungen seiner eigenen Abschaffung regelt? Solange das Grundgesetz aber gilt, bleibt es bei den Verfassungsgrundsätzen von Artikel 20. Das bedeutet im Einzelnen: Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, die Staatsgewalt geht, durch Wahlen, vom Volk aus, Deutschland ist ein Bundes-, Sozial- und Rechtsstaat.Das Grundgesetz hat der repräsentativen Demokratie den Vorzug vor anderen demokratischen Organisationsmöglichkeiten gegeben. Lange Zeit war das stärkste Argument dafür ein praktisches: Schon allein aufgrund seiner Größe sei ein Land wie Deutschland gezwungen, demokratische Entscheidungen durch gewählte Vertreter zu treffen. Oder wie sonst wäre der Wille der über sechzig Millionen Wahlberechtigten zu ermitteln?
Je einfacher und schneller aber die modernen Kommunikationsmittel funktionieren, desto weniger verfängt dieses Argument. Technisch wäre es nicht mehr unmöglich, Millionen zur elektronischen Stimmabgabe zu bitten, wann immer es nötig ist.
Doch wäre es wirklich wünschenswert, dass wir abends nach der Arbeit und bevor wir die Kinder ins Bett bringen, tagtäglich über Dutzende Fragen abstimmen müssen, zum Beispiel über einige Detailfragen im Zollgesetz, eine Novelle des Personenstandregistergesetzes, die Haushaltswirkung der Infrastrukturabgabe, die Ergänzung des Grundgesetzartikels 91c, die Einspeisung fossiler Energie, die Regulierung der privaten Wildtierhaltung, die nationale Wirkstoffoffensive oder den Ausbau der taxonomischen Forschung, was immer das ist. Wären wir, zwischen Schwarmintelligenz und Cybermob, wirklich urteilssicher?
Ich will nicht behaupten, dass wir, das Wahlvolk, das nicht sein könnten. Aber wir müssten uns zuvor umfangreich über all diese Themen informieren, wozu wir schlicht nicht die Zeit hätten. Ich will auch nicht behaupten, dass jeder Abgeordnete all die Dinge, über die er abstimmt, bis ins Letzte durchdrungen hat. Allerdings ist die Chance groß, dass er sich damit eingehender beschäftigt hat als jemand, der das nicht hauptberuflich macht.Abstimmungen durch gewählte Abgeordnete machen zudem emotionsgetriebene Augenblicksentscheidungen unwahrscheinlicher, die es bei Direktabstimmungen durchaus geben könnte. Der Versuch der unmittelbaren demagogischen Beeinflussung der Stimmberechtigten ist in einer mittelbaren Demokratie weniger erfolgversprechend als in einer direkten.
Der große Nachteil der repräsentativen Demokratie besteht in der Herausbildung einer »politischen Klasse«. Im schlechtesten Fall ist sie geprägt durch Opportunismus, Fraktionszwang, Karrierismus und Lobbyismus. Deshalb verwenden manche den Begriff »Berufspolitiker« als Schimpfwort. Dahinter steckt die Vorstellung, dass sich echte Hingabe an eine Sache oder Idee mit den Sachzwängen des Broterwerbs kaum vereinbaren lässt. Mit der Realität einer höchst ausdifferenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaft verträgt sich eine derartige Fundamentalkritik allerdings schlecht. Befürworter findet sie dennoch immer wieder.
Die AfD zum Beispiel stellt ihrem Grundsatzprogramm ein Bekenntnis zur Demokratie voran, um dann so fortzufahren: »Wir wollen dem Volk das Recht geben, über vom Parlament beschlossene Gesetze abzustimmen. Dieses Recht würde in kürzester Zeit präventiv mäßigend auf das Parlament wirken und die Flut der oftmals unsinnigen Gesetzesvorlagen nachhaltig eindämmen. Zudem würden die Regelungsinhalte sorgfältiger bedacht, um in Volksabstimmungen bestehen zu können. Auch Beschlüsse des Parlaments in eigener Sache, beispielsweise über Diäten oder andere Mittelzuweisungen, würden wegen der Überprüfungsmöglichkeit der Bürger maßvolle Inhalte haben.«
Eines ist klar: Mit dem Grundgesetz ist das, was hier unter Demokratie verstanden wird, nicht vereinbar. Danach geht die Staatsgewalt zwar vom Volk aus, ausgeübt wird sie aber nicht von ihm. Dafür gibt es die Parlamente. Ihre Entscheidungen wiederum unter den Vorbehalt von Volksentscheiden zu stellen, widerspricht der Idee des Parlamentarismus fundamental. Wer die Dinge so regeln will, muss über die Hälfte der Wahlberechtigten von einer neuen, noch zu entwerfenden Verfassung überzeugen. Kein unmögliches Ziel, aber auch kein sehr realistisches.
Vielleicht lassen sich triftige Argumente gegen den Parlamentarismus ins Feld führen. Aber wäre es, statt ihn anzugreifen, nicht sinnvoller, auch die zahlreichen Mittel und Mitwirkungsmöglichkeiten, die über die Ausübung des Wahlrechts hinausgehen, zur politischen Einflussnahme zu nutzen?
Wir sollten sie als Werkzeuge betrachten. Je besser wir sie beherrschen, desto zufriedener werden wir mit den Ergebnissen sein, die sie hervorbringen.
Die Fundamentalkritik am Parlamentarismus jedenfalls verpufft im Nichts, lange bevor der Versuch realer politischer Einflussnahme überhaupt begonnen hat. Wer in eine Partei eintritt, sich wählen lässt, seinem Abgeordneten schreibt und demonstriert, wird mehr bewirken als jemand, der in Internetforen die Herrschaft der »politischen Klasse« verflucht.
Wo Kritik am Parlamentarismus geübt wird, ist die Klage über den Föderalismus nicht weit. Manchen erscheinen die Landesparlamente und die Vertretung der Länder im Bundesrat als unverhältnismäßiger Aufwand. Deutschland ist ein Bundesstaat, und auch diese Entscheidung des Grundgesetzes wäre nur durch eine neue Verfassung zu ändern. Die Idee dahinter ist, den Bundesländern die Gesetzgebungskompetenz zu überlassen, solange der Bund nicht tätig wird. Dieses Prinzip heißt konkurrierende Gesetzgebung.
Manche Bereiche, solche von nationaler Bedeutung, wie zum Beispiel Geld-, Währungs-, Außen- und Verteidigungspolitik, unterliegen der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes. Doch auch an ihr sind die Länder, über ihre Vertreter im Bundesrat, beteiligt. Die politische Organisation des Staates in dieser Form ist kein Kompromiss oder eine unnötig komplizierte Regelung, sie ist vielmehr der gelungene Versuch, Länder- und Bundesinteressen in ein fein abgewogenes Verhältnis zu bringen.
2005 und 2009 gab es Föderalismusreformen, die vor allem die Anzahl der im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze reduzierten. Die föderale Grundstruktur blieb dabei jedoch unangetastet, denn sie ist im Rahmen des Grundgesetzes unabänderlich festgeschrieben.
Einem weiteren Prinzip unserer Verfassung zufolge ist Deutschland ein Sozialstaat. Für viele ist schon dieses Wort allein eine Provokation, mit der sie sich kaum abfinden können. Manche wollten in ihm zunächst nichts weiter als einen »substanzlosen Blankettbegriff« sehen, doch das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass es sich bei der sogenannten Sozialstaatsklausel um unmittelbar geltendes Recht handelt.
Doch wie weit soll die Verpflichtung des Staates, »sozial« zu sein, gehen? Und was soll das konkret bedeuten? Es lässt sich nicht leugnen, dass der Gesetzgeber an dieser Stelle mehr offen gelassen als geregelt hat. Den Mindestmaßstab hat jedoch das Bundesverfassungsgericht verbindlich vorgegeben: Der Staat muss jedem Menschen, der sich in Deutschland aufhält, ein menschenwürdiges Existenzminimum gewährleisten.
Es gibt nicht wenige Bürger, die diese Selbstverpflichtung als zu weitgehend, ja als empörend betrachten, insbesondere in Verbindung mit dem ebenfalls zu gewährenden Asylrecht. Das Bundesverfassungsgericht folgert sie aus den Menschenrechten, so wie sie von den Vereinten Nationen 1948 in der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« beschlossen wurden.
Das Grundgesetz nimmt in Artikel 1 Absatz 2 ausdrücklich Bezug auf sie. In Gestalt der Grundrechte sind sie in Deutschland unmittelbar geltendes Recht. Wir müssen uns mithin vor Augen führen, dass die Diskussion um die Frage, wie viele Menschen wir in Deutschland aufnehmen und was wir für sie tun können, die Grundlagen unseres Staates betrifft.
Wenn wir hinter die hochgesteckten Anforderungen unserer Verfassung zurückwollten, müssten wir unser bisheriges Verständnis von der Verbindlichkeit der Menschenrechte aufgeben. Ein geschickt gewähltes Dilemma, das uns zwingt, die Kosten des Sozialstaats zu tragen. Und auch an dieser Stelle gilt: Eine ernsthafte Diskussion um die Abschaffung dieses Prinzips könnte nur eine Diskussion über eine neue Verfassung sein, in der formuliert werden müsste, was an seine Stelle treten solle.
Ein weiteres staatliches Organisationsprinzip, das Artikel 20 nennt, ist das Rechtsstaatsprinzip. Auf den ersten Blick scheint es am wenigsten umstritten. Wer würde etwas anderes wollen, als in einem Rechtsstaat zu leben?
Nur, wodurch ist ein Rechtsstaat eigentlich gekennzeichnet? Vor allem anderen durch die Gewaltenteilung. Die gesetzgebende, die ausführende und die rechtsprechende Gewalt sind unabhängig organisiert und kontrollieren einander. Alle drei sind sie dabei den geltenden Gesetzen unterworfen, insbesondere der Bindung an die Grundrechte.Die Justiz ist unabhängig, Richter müssen von niemandem Weisungen entgegennehmen, sie sind allein an Recht und Gesetz gebunden. Die Gerichte gewähren auch Schutz gegen Rechtsverletzungen, die von der öffentlichen Gewalt begangen werden, sei es von Regierungsmitgliedern, Richtern oder Polizisten. Und es gibt eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die darüber wacht, dass die Grundrechte beachtet werden. Sie wären nichts weiter als Feiertagsrhetorik, gäbe es nicht Landesverfassungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht, vor denen, wie das Gesetz sagt, »jedermann« klagen kann.
Die Grundrechte sind Freiheitsrechte, die jedem Einzelnen als Abwehrrechte gegen den Staat zustehen. Das ist ihre Hauptfunktion. Zugleich sieht die Verfassung in ihnen Wertentscheidungen, die deutlich machen, für welche Wertvorstellungen unsere verfassungsmäßige Ordnung steht. Die Verfassungsgerichtsrechtsprechung wirkt dementsprechend immer in zwei Richtungen. Zum einen entscheidet sie über einen konkreten Rechtsstreit, zum anderen haben die Urteile der Verfassungsgerichte aber auch fallübergreifende, generelle Wirkung, durch welche die Wahrung, Auslegung und Fortbildung des Verfassungsrechts gefördert wird. Juristen sprechen hier tatsächlich von einem »Edukationseffekt«, wobei die erzieherische Wirkung darin besteht, dass das Verfassungsrecht und insbesondere die Grundrechte durch ihre Ausdifferenzierung immer besser verstanden werden.
Bei der Prüfung gehen die Verfassungsrichter nach einem Schema vor, das den Aufbau und die Wirkungsweise der Grundrechte verdeutlicht. Nicht alle Grundrechte aller können unbeschränkt und unbegrenzt gelten.
Ein Raucher beruft sich auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, während der Nichtraucher neben ihm sein Recht auf Leben in Gefahr sieht. Beide berufen sich zweifelsfrei auf ihnen zustehende Grundrechte. Beiden schuldet der Staat den Schutz ihrer Rechte. Was bleibt ihm anderes, als abzuwägen. Ein Rauchverbot schränkt die Persönlichkeitsrechte des Rauchers zweifellos ein. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Ist sie verfassungsgemäß? Schränkt sie die Rechte des Rauchers mehr ein als nötig und angemessen?
Mit derartigen Abwägungsfragen muss sich beschäftigen, wer herausfinden will, ob Grundrechte verletzt wurden. Immer geht es dabei um gegeneinanderstehende Interessen und um eine Entscheidung für die einen gegen die anderen – nach Bewertung aller relevanten Umstände.
So muss man die Grundrechte des Grundgesetzes immer mit dem ungeschriebenen Zusatz lesen: »Es sei denn, das Grundrecht eines anderen wiegt schwerer.« Ob dem so ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Artikel 19 Absatz 2 bestimmt aber auch: »In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.«
Man muss zugeben, dass Begriffe wie »Grenzen«, »Schranken« und »Wesensgehalt« wenig eindeutige Anhaltspunkte bieten, aber man kann die Schwierigkeit der Interpretation der Grundrechte auch ins Positive wenden, indem man sie als fortwährende Diskussion begreift. Und, immerhin, es ist eine Diskussion auf sicherem Grund, denn die Verfassungsgrundsätze, insbesondere das Rechtsstaatsprinzip, gewähren ein nachvollziehbares und transparentes Verfahren.
»Würde ist die konditionale Form von dem, was einer ist.« – Die Menschenwürde und die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Der erste Satz des Grundgesetzes ist vermutlich der bekannteste deutsche Gesetzestext. Diese Bekanntheit ist ein wenig trügerisch, denn wenn man den Satz näher betrachtet, stellt man fest, dass er eher Rätsel aufgibt, als etwas zu erklären. Im Vorwort habe ich angedeutet, was er, ins Allgemeinverständliche übersetzt, bedeuten soll: Jeder hat ein Recht darauf, anständig behandelt zu werden. Doch diese »Übersetzung« kann nicht mehr als eine erste Orientierung geben.
In Deutschland gelten etwa zweitausend Bundesgesetze, Abertausende Landesgesetze und Zehntausende von Rechtsverordnungen. Hinzu kommen internationale Gesetze und Verträge, etwa die Rechtsverordnungen der EU oder Handels- und Militärabkommen mit anderen Staaten, und alle diese Regelwerke enthalten Hunderte und Tausende von Vorschriften. Wären sie alle gleichrangig, ergäben sie keine perfekt durchorganisierte Ordnung, sondern ein heilloses Durcheinander.
Da in der Hierarchie der Gesetze das Grundgesetz den höchsten Rang einnimmt und sein erster Artikel die wichtigste Regel formuliert, die unser Recht kennt, müssen sich alle Gesetze, die in Deutschland gelten oder neu geschaffen werden, an diesem ersten Artikel messen lassen.
Doch es ist seltsam: Je öfter man den Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar« liest, desto weniger verständlich erscheint er einem. Was soll er denn eigentlich heißen?
Man kommt ihm nur bei, indem man ihn Wort für Wort betrachtet. Beginnen wir mit den bestimmten Artikeln »die« und »des«. In ihnen steckt schon, dass jeder Mensch Würde hat, und zwar gleich viel, ohne Ansehen der Person, und dass Würde etwas Absolutes ist, das sich nicht relativieren lässt. »Des« Menschen bedeutet: jedes Menschen, ohne Ausnahme. Alles, was uns normalerweise einladend erscheint, um zwischen Menschen zu differenzieren, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Sprache, soll im Hinblick auf ihre Würde also keinen Unterschied machen.
In den ersten sechs Worten des Grundgesetzes ist ein ganzes Menschenbild formuliert. Es ist radikal egalitär.
Wir neigen einerseits dazu, seine Behauptung für eine Selbstverständlichkeit zu halten – natürlich werden alle Menschen gleich an Rechten und Würde geboren –, aber wenn wir uns nur ein wenig Zeit nehmen, unseren Alltag zu betrachten, müssen wir zugeben, dass wir andererseits permanent damit beschäftigt sind, einander zu bewerten. Dies verletzt nicht notwendigerweise die Menschenwürde, doch es zeigt, dass schon diese erste, scheinbar einfache Formulierung des Grundgesetzes einen nicht unwesentlichen utopischen Anteil enthält, einen Anteil, der erst noch verwirklicht werden muss.
Das Substantiv »Mensch« scheint auf den ersten Blick unmissverständlich. Um die Frage, ab wann ein Mensch als Mensch gilt, wird jedoch erbittert gestritten. Genießt schon die befruchtete Eizelle den Schutz der Menschenwürde? Oder erst der geborene Mensch? Oder doch schon der Fötus? Und falls ja, ab wann genau?
Welche Festlegungen einem hier auch immer als zutreffend erscheinen mögen, man wird zugeben müssen, dass sie genauso willkürlich sind, wie sie erscheinen. Wie verhält es sich mit Menschen, die kein Bewusstsein mehr haben? Und was ist mit den Toten? Und ab wann ist jemand tot?
Zu all diesen Fragen gibt es Gerichtsentscheidungen und Lehrmeinungen. Aber wichtiger, als diese Urteile und Ansichten zu kennen (man kann sie zum Beispiel auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts in den dort abrufbaren Entscheidungen nachlesen), ist es, sich bewusst zu machen, dass noch das scheinbar selbstverständlichste aller Wörter der Auslegung und Interpretation bedarf. Diese Arbeit sollten wir, die Bürger, uns selbst machen und sie nicht ausschließlich den Juristen überlassen, denn die Folgen treffen uns unmittelbar.
Das gilt erst recht für Begriffe, die im Alltag weniger gebräuchlich sind, wie zum Beispiel »Würde«. Ein Wort, das wenig konkret klingt, altertümelnd, vielleicht sogar ein wenig pompös. Genau darüber machte sich derjenige lustig, von dem das Zitat in der Überschrift zu diesem Kapitel stammt, der Wiener Satiriker Karl Kraus.
Sein Bonmot legt nahe, dass es mit der Würde des Menschen nicht so weit her ist, wie dieser gern von sich selbst annimmt. Den Gegenbeweis wird man wohl kaum führen können. Es ist aber dennoch möglich, den Begriff der Würde aus der Sphäre des Unverbindlich-Festlichen zu befreien und ihn mit einer nachprüfbaren Bedeutung zu versehen.
Nahe liegt es, zu sagen: Würde ist das, was den Menschen zum Menschen macht: die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Vernunft, sein freier Wille, seine Freiheit, Entscheidungen zu treffen und seine Identität zu bestimmen.
Ende der Leseprobe