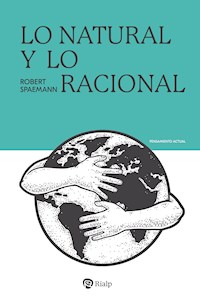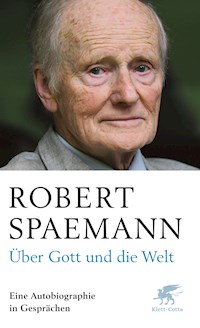Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Den Zeitpunkt und die Art des eigenen Todes selbst bestimmen und bis zuletzt die Kontrolle über das eigene Leben und über das eigene Sterben bewahren – das wünschen sich viele, vor allem schwerkranke Menschen. Das Buch führt die Antworten der Palliativmedizin, der Psychiatrie, der medizinischen Ethik und der Philosophie im Umgang mit Todeswünschen zusammen und begründet, warum es keine gesellschaftlich akzeptierte und propagierte Form der Suizidbeihilfe geben darf. Es zeigt Perspektiven auf, wie ein guter Umgang mit Todeswünschen aussehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Spaemann | Gerrit Hohendorf | Fuat S. Oduncu
Vom guten Sterben
Warum es keinen assistierten Tod geben darf
Mit einem Vorwort von Manfred Lütz
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand
Umschlagmotiv: © Panka Chirer-Geyer, Geheimnis Heimat I (2009)
Foto: Stefan Weigand
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-80727-5
ISBN (Buch) 978-3-451-34824-2
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Der Wunsch zu sterben: Ängste, Hoffnungen und Wünsche betroffener Menschen – Drei Fallgeschichten
2. Worum geht es in der Debatte um die Sterbehilfe?
3. Freiheit zum Tode oder Unfreiheit zum Leben? – Sterbehilfe und Sterbehilfeorganisationen in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, den USA und Deutschland
4. Die Perspektive der Palliativmedizin
5. Zum richtigen Umgang mit Todeswünschen: Solidarität mit den Leidenden statt Suizidbeihilfe
6. Wer entscheidet letztlich über den Tod? Selbstbestimmung, das Tötungsverbot und die Heiligkeit des menschlichen Lebens
1. Das moralische Paradox einer Legitimation der Suizidbeihilfe durch Selbstbestimmung
2. Das Argument von der »Heiligkeit des Lebens«
3. Die Angst vor Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit als Grundlage für Todeswünsche
7. Fazit: Warum es keinen assistierten Tod geben darf: Gutes Sterben als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Fünf Thesen
8. Es gibt kein gutes Töten
Dank
Anmerkungen
Bibliografie
Vorwort
Der Tod geht alle an. Jeder Mensch stirbt. Und viele Menschen fürchten, dass sie ausgerechnet im Sterben hilflos der Macht der Ärzte, des Staates, der Kirche ausgesetzt sind. Das Sterben ist etwas derart Intimes, Persönliches, Verletzliches, dass es für viele eine Horrorvorstellung ist, dann nicht mehr selbst bestimmen zu können, was man mit sich geschehen lassen will und was nicht. Deswegen kann man sehr gut verstehen, dass sehr viele Menschen auf die unvorbereitete Frage, ob sie das Recht und die Möglichkeit haben wollen, notfalls die Notbremse zu ziehen und aktiv aus dem Leben zu scheiden, die unvorbereitete spontane Antwort geben: Ja, selbstverständlich! Selbstbestimmung heißt das Stichwort. Und Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht.
In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg hat diese Lage dazu geführt, dass »Tötung auf Verlangen« inzwischen eine normale gesellschaftliche Dienstleistung ist. In der Schweiz wird der assistierte Suizid von agilen Vereinigungen lautstark propagiert und von der Rechtsordnung toleriert. Im US-Bundesstaat Oregon ist der ärztlich assistierte Suizid gesetzlich ausdrücklich erlaubt. Man nennt solche Regelungen »liberal« oder »fortschrittlich«. Diesen Begriffen wohnt eine Dynamik inne, die davon ausgeht, dass nach und nach auch andere Länder solche Regelungen übernehmen werden wie alles »gute« Neue durch beharrliche Überwindung »schlechten« alten Denkens.
Ich war Zeuge, als ein Arzt, der sich selbst aktiv für ärztlich assistierten Suizid einsetzt, mit brillanter Rhetorik eine Gruppe führender deutscher Psychiater fast in Trance redete. Es ginge natürlich nur um »Grenzfälle«, er »ringe« immer mit sich. Wie ein Mantra wurde immer wieder der Begriff »Selbstbestimmung« eingestreut. Und natürlich ging es immer um Würde: »würdevolles Sterben«.
Für mich war dieser Vortrag ein Weckruf. Ich kannte den Film »Ich klage an«, mit dem die Nazis die Euthanasieaktion propagandistisch begleitet hatten. Es ist ein teuflisch-brillant gemachter Film mit ausgezeichneten Schauspielern. Professor Spaemann nimmt in seinem Text darauf Bezug. Der Film ist überhaupt nicht grausam, sondern sentimental und er arbeitet mit der gleichen Rhetorik, die man derzeit – natürlich unbeabsichtigt – bei Befürwortern des ärztlich assistierten Suizids erleben kann. Auch in diesem Film »ringt« ein Arzt um die Frage, ob er seiner Frau einen »würdevollen Tod« ermöglichen soll. Er handelt allein aus Liebe und fordert von der Rechtsordnung, sich dem Fortschritt nicht in den Weg zu stellen und Menschen nicht mehr qualvoll leiden zu lassen.
Bekanntlich haben nicht die Nazis die Euthanasie »erfunden«, sondern es waren zu Beginn der 1920er-Jahre Psychiater und Juristen, die sich Gedanken über die »Volksgesundheit« machten und empfahlen, Behinderten und anderen leidenden Menschen einen »guten Tod« zu ermöglichen. Euthanasie lag im Trend. Die Nazis haben diese Gedanken mit grausamer Konsequenz dann umgesetzt. Nicht selten werfen niederländische Ärzte uns deutschen Psychiatern heute eine unangemessene Befangenheit vor, wenn wir uns strikt gegen ärztlich assistierten Suizid aussprechen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wir deutschen Psychiater wissen um die manipulative Wucht von Worten. Damals ging es um »Volksgesundheit«, zweifellos ein positiver Begriff, und heute spricht man von Hilfe, »Sterbehilfe«, wenn es in Wahrheit um die Tötung eines Menschen geht. 70 Prozent der Deutschen sind angeblich für »aktive Sterbehilfe«. Wären auch 70 Prozent der Deutschen für das »Töten« von Menschen? Die wirkliche Frage ist also: Töten oder sterben lassen. Wer gegen Tötung ist, ist freilich nicht für Lebensverlängerung um jeden Preis. Denn es wäre genauso manipulativ, das Sterben mit allen Mitteln zu verlängern, so wie es manipulativ ist, das Sterben durch Gift zu verkürzen. Man soll Menschen sterben lassen, wie sie das selber wollen. Genau das geschieht im Hospiz. Selbstbestimmtes Sterben findet also in Wahrheit vor allem im Hospiz oder unter ambulanter palliativer Betreuung statt, denn wie kann man eigentlich sich selbst bestimmen, wenn man das Selbst, das da bestimmt, vernichtet? Wir deutschen Psychiater wissen auch, wenn wir uns der Last unserer Tradition bewusst sind, dass eine gesetzliche Freigabe des ärztlich assistierten Suizids Druck auf alte, chronisch kranke, behinderte und andere Menschen in Not aufbauen würde, ihren Angehörigen und der Gesellschaft nicht mehr zur Last zu fallen und einen Weg zu wählen, der ja dann eine reguläre Option wäre. Wir wissen, dass die ausdrückliche Erlaubnis des ärztlich assistierten Suizids ein vernichtender Anschlag auf die Selbstbestimmung der Schwächsten in unserer Gesellschaft wäre. Und wie eine Gesellschaft mit ihren Schwächsten umgeht, das entscheidet über die Humanität einer Gesellschaft.
Kein Wunder also, dass die Debatte hoch emotionalisiert verläuft. Kein Wunder, dass viele Diskussionsteilnehmer von höchst persönlichen Erfahrungen geprägt sind. Kein Wunder auch, dass Gerüchte Hochkonjunktur haben und wichtige sachliche Informationen fehlen. Deswegen ist dieses Buch das richtige Buch zur richtigen Zeit. Wie ist die Lage in den Niederlanden, Belgien, Oregon und der Schweiz wirklich? Darüber informiert gründlich und kompetent der Medizinethiker und Psychiater Gerrit Hohendorf. Was kann die Palliativmedizin heute leisten? Darüber schreibt der Onkologe, Palliativmediziner und Medizinethiker Fuat Oduncu, der über langjährige Erfahrung in der Betreuung von schwerkranken und sterbenden Patienten verfügt. Und schließlich analysiert der Philosoph Robert Spaemann messerscharf, welche Argumente tragen und welche nicht.
Dieses Buch ist notwendig und dringend. Es liefert allgemeinverständlich und wissenschaftlich seriös die unverzichtbaren präzisen Informationen für eine angemessene respektvolle Diskussion dieses aufwühlenden Themas. Zugleich enthält es überzeugende Argumente, die jeder kennen muss. Denn die Frage nach dem ärztlich assistierten Suizid ist keine Fachfrage für Fachleute. Sie ist für jeden von uns eine Frage von Leben und Tod.
Manfred Lütz
Einleitung
Viele Menschen wünschen sich ein gutes und leichtes Sterben. Manche verstehen darunter einen Tod, der sie im Schlaf ereilt, ohne eine lange Zeit des Leidens oder der bewussten Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des eigenen Lebens. Manche wünschen sich ein bewusstes Abschiednehmen im Kreis von Angehörigen und Freunden in ihrer gewohnten Umgebung. Und manche möchten bis zuletzt die Kontrolle bewahren nicht nur über das eigene Leben, sondern auch über das eigene Sterben. Sie möchten Zeitpunkt und Art des eigenen Todes selbst bestimmen. »Selbstbestimmt sterben« ist zu einem Schlagwort geworden, das in den Jahren 2014 und 2015 auch den Deutschen Bundestag beschäftigt. Aber können wir das wirklich: selbstbestimmt sterben? Soll der von Ärzten, selbsternannten Sterbehelfern und Sterbehilfevereinen angebotene begleitete Suizid Bestandteil unserer Sterbekultur werden?
Viele Menschen haben Angst, einer Medizin ausgeliefert zu sein, die sich an der technischen Machbarkeit der Lebensverlängerung orientiert, anstatt zu lernen, Menschen sterben zu lassen. »Der medizinische Kampf gegen den Tod ›bis zum letzten Atemzug‹ erscheint jetzt seinerseits als tödliche Bedrohung, der Tod selbst hingegen avanciert zum Retter aus den Griffen einer als fatal empfundenen, unbarmherzigen Maschinerie, die den Sterbenden ›seinen‹ Tod nicht sterben lässt.«1
Die moderne Medizin hat lange Zeit die Illusion befördert, sie könne das Leben gleichsam ins Unendliche verlängern und müsse das Sterben eines Menschen verhindern, wo es nur geht. So geriet aus dem Blick, dass der Tod ebenso wie die Geburt zum Leben dazugehört und dass die Sorge um ein gutes Sterben eine ganz wesentliche Aufgabe der Medizin, aber auch der Gesellschaft ist. Zur Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit schrieb der Philosoph Wilhelm Kamlah 1979: »Das Aufbegehren gegen Verfall und Tod ist normal und natürlich und führt doch zur Verzweiflung. Die Hinnahme hingegen kann schwer zu erringen, im Gelingen aber befreiend sein. Und die ars vitae, die mit philosophischer Besinnung gelingende Kunst zu leben, besteht zu allererst nicht im Handeln-Können, sondern im Loslassen-Können. Die Einübung in die Hinnahme unabänderlicher Verluste durchzieht dann wiederum unser ganzes Leben und findet in der einwilligenden Hinnahme des eigenen Todes nur ihre Vollendung.«2
Gleichwohl gibt es Menschen, die das eigene Sterben – im Sinne eines Geschehenlassens – nicht hinnehmen können oder wollen. Sie wollen ihrem Leben selbst und »selbstbestimmt« ein Ende setzen, weil sie Angst vor dem Leiden an einer unheilbaren Erkrankung haben, weil sie nicht pflegebedürftig oder von anderen abhängig werden wollen, weil sie das »Dahinsiechen« im Alter als unwürdig empfinden oder weil sie in seelischer Not keine Perspektive für ein gelungenes Leben mehr sehen. Todeswünsche gehören zu der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und Sterben, sie sind für sich genommen nichts Krankhaftes oder Unmoralisches. In diesem Buch geht es weniger um die Frage nach der moralischen Bewertung des Suizids, sondern vielmehr darum, wie Medizin und Gesellschaft, Angehörige und Freunde mit Todeswünschen umgehen sollen. Die aktuelle Debatte um Sterbehilfe und Suizidbeihilfe macht deutlich, dass es dabei nicht nur um sterbende Menschen im engeren Sinne geht, sondern auch um Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, ohne dass der Tod konkret absehbar ist, die den Tod als eine Erlösung von körperlichem oder seelischem Leiden verstehen.
Wir möchten in diesem Debattenbeitrag die Perspektiven der Palliativmedizin, der Psychiatrie, der medizinischen Ethik und der Philosophie zusammenführen und gemeinsam begründen, warum es keine gesellschaftlich akzeptierte und propagierte Form der Suizidbeihilfe geben darf und wie ein guter Umgang mit Todeswünschen aussehen kann. Unser Buch heißt »Vom guten Sterben« – nicht, weil wir denken, dass wir ein Patentrezept für ein gutes Sterben präsentieren können, sondern weil wir denken, dass der Umgang einer Gesellschaft mit Tod, Sterben und Suizidbeihilfe etwas darüber aussagt, wie sie sich zu schwerer Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Einsamkeit im Alter verhält.
Die Debatte um die Sterbehilfe steht in Deutschland im Schatten der Geschichte und der historischen Verantwortung für die »Euthanasie«-Verbrechen im Nationalsozialismus. Daher rührt – und das ist gut so – die besondere Sensibilität, mit der das Thema in Deutschland behandelt wird. Damit hat sich Gerrit Hohendorf in dem Buch »Der Tod als Erlösung vom Leiden« (Göttingen 2013) ausführlich auseinandergesetzt. In diesem Buch wollen wir die gegenwärtigen menschlichen und ethischen Fragen eines guten Sterbens in den Vordergrund rücken.
Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung der aktuellen Debatte über die Sterbehilfe bis zur Vorstellung der vier Gesetzentwürfe im Deutschen Bundestag im Sommer 2015 und klärt die dabei verwendeten Begriffe. Kapitel 3 untersucht kritisch die Erfahrungen mit aktiver Sterbehilfe, Suizidbeihilfe und Sterbehilfeorganisationen in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, den USA und Deutschland. Aus der Perspektive der Palliativmedizin (Kapitel 4), einer am einzelnen Menschen orientierten Psychiatrie (Kapitel 5) und der medizinischen Ethik (Kapitel 6) wird dann eine Antwort auf die Frage gegeben, wie wir als Ärzte3[1] und Pflegende, als Angehörige und als Gesellschaft mit Todeswünschen gut und richtig umgehen können, ohne den vorschnellen Tod im Angebot zu haben. Fünf Thesen (Kapitel 7) und die klare Argumentation von Robert Spaemann gegen die Suizidassistenz (Kapitel 8) runden das Buch ab. Doch zunächst soll die Perspektive der betroffenen Menschen in drei Fallgeschichten (Kapitel 1) zur Sprache kommen.
München im Juli 2015
Gerrit Hohendorf und Fuat S. Oduncu
1. Der Wunsch zu sterben: Ängste, Hoffnungen und Wünsche betroffener Menschen – Drei Fallgeschichten
Eine Fallgeschichte aus der Onkologie
Frau M. ist 84 Jahre alt, als sie eines Tages vom Notarzt in die Klinik eingeliefert wird. Sie schnappt sichtlich angestrengt nach Luft und hat hohes Fieber. In der Klinik wird zügig eine Lungenentzündung festgestellt und sofort mit einer Antibiotikatherapie begonnen. Die behandelnden Ärzte erkennen aber gleich, dass nicht die Lungenentzündung das eigentliche Problem von Frau M. ist, sondern eine unheilbare Leukämie.
»Ich habe keine guten Nachrichten«, will der verantwortliche Krebsarzt das Gespräch einleiten.
»Ich habe den Krieg erlebt und meinen todkranken Mann bis zum Ende gepflegt. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann gehe ich eben«, bremst Frau M. den Onkologen aus.
»Ich weiß nicht, ob Ihre Zeit schon gekommen ist. Aber die Untersuchungen haben ergeben, dass Sie Leukämie haben und Ihre Lungenentzündung nur eine Folge der Erkrankung ist«, antwortet der Arzt mit ruhiger Stimme und wartet etwas ab.
»Also Krebs! Muss ich jetzt sterben? Ich bin seit Wochen schlapp, kraftlos und lustlos, jede noch so kleine Anstrengung treibt mich in die Erschöpfung«, erklärt Frau M. etwas resignierend.
Der Arzt nickt und sagt: »Auch die Müdigkeit kommt von der Leukämie, die eine ausgeprägte Blutarmut verursacht hat, unter der Sie jetzt leiden.«
»Ich habe das alles bereits mit meinem Mann erlebt. Er ist vor 35 Jahren von mir gegangen – Lungenkrebs. Er hat sehr gelitten, und mit der Chemo wurde alles noch viel schlimmer. Ich sage Ihnen gleich, ich will keine Chemo! Können Sie mir nicht etwas geben, damit ich ruhig einschlafe? Ich habe keine Lebenskraft und keine Lebensfreude mehr. Ich möchte nicht wie mein Mann leiden.«
Der Arzt schweigt eine Zeit lang, um dann neu anzusetzen: »Es ist kein Wunder, dass Sie keine Kraft und keine Lust zum Leben haben. So macht das Leben keine Freude. Aber warum sagen Sie, Sie wollen keine Chemo?«
Frau M.: »Ich habe Angst, dass die Chemo mich noch mehr schwächt. Aber vor allem will ich nicht meine Haare verlieren. Lieber sterbe ich vorher. Und wenn es sein muss, fahre ich dafür in die Schweiz.«
Der Arzt lässt die Patientin aussprechen, schweigt wieder für eine kurze Zeit und setzt dann erneut an: »Erzählen Sie mir ein wenig von sich. Wie sah Ihr Leben aus, bevor Sie krank geworden sind?«
Frau M.: »Nach dem Tod meines Mannes habe ich seine Stiftung weitergeführt. Wir haben keine Kinder bekommen und die Stiftung ist unsere große Familie. Ich bin viel unterwegs in ganz Deutschland und die Menschen brauchen mich. Aber in den letzten Wochen war ich sehr schwach auf den Beinen und konnte nicht mehr zu den Veranstaltungen gehen.«
Dann unterbricht sie kurz das Gespräch, fängt an, in ihrer Handtasche zu wühlen, und zieht ein Foto heraus, das sie stolz dem Arzt zeigt: »Das war im vergangenen Jahr, als Frau Merkel mir zu unserer Stiftung gratulierte.« Endlich ein Lächeln in ihrem Gesicht. Der Arzt ist sichtlich beeindruckt; er hat das nicht erwartet, als er sie nach ihrem Leben fragte.
Plötzlich fragt Frau M.: »Können Sie mir nicht etwas geben, damit ich wieder auf die Beine komme? Ich muss noch so viel für die Stiftung machen und ich habe schon so viele Termine absagen müssen.«
Der Arzt muss sich zunächst etwas sammeln. »Ich finde es toll, dass Sie trotz Ihres respektablen Alters mit so viel Hingabe Ihre Stiftung leiten und Ihnen eine derart besondere Ehre zuteil geworden ist.« Er hält etwas inne und fährt schließlich fort: »Hm, dann schauen wir, dass wir zügig Ihre Lungenentzündung und Ihre Blutarmut behandeln. Wenn die Antibiotika gut wirken und die Blutarmut sich mit Bluttransfusionen beheben lässt, können wir Sie vielleicht nach zehn Tagen wieder entlassen.«
Frau M.s Lächeln strahlt jetzt über ihr ganzes Gesicht. Der Arzt: »Wir werden keine Chemotherapie machen. Ihre Leukämieform spricht nicht gut auf gängige Therapien an und würde eine sehr starke Chemotherapie erforderlich machen, die aber für Sie zu gefährlich wäre. Aber wir können Ihre Symptome und Beschwerden, die die Leukämie verursacht, gut behandeln. Unser Ziel ist es, dadurch Ihre Lebensqualität und Ihre sozialen Aktivitäten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Sie brauchen keine Angst haben, wir werden Ihre Beschwerden in den Griff bekommen, sodass Sie nicht leiden müssen. Es wäre doch zu schade um Sie, wenn Sie sich frühzeitig vom Leben und Ihrer Stiftung verabschieden würden. So wie Sie über Ihr gemeinsames Lebenswerk sprechen, kann ich mir gut vorstellen, dass jeder Tag mehr Leben auch mehr Erfüllung und Zufriedenheit für Sie bedeutet.«
Frau M. zeigt sich mit den Vorschlägen des Arztes sehr einverstanden.
Der Arzt: »Haben Sie sich schon einmal Gedanken über eine mögliche Nachfolge für Sie in Ihrer Stiftung gemacht?«
Frau M. versteht sofort. »Sie haben Recht. Es wird höchste Zeit, meine Nachfolge zu regeln. Ich wollte ja schon seit Langem zurücktreten. Aber meine Mitarbeiter haben mich immer wieder ermutigt, weiterzumachen.«
Der Arzt: »Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen.«
In den Folgetagen erhält Frau M. die erforderlichen Therapiemaßnahmen. Die Therapie verläuft gut und Frau M. kann in gebessertem Zustand nach Hause entlassen werden. Ab sofort stellt sie sich einmal pro Woche in der onkologischen Ambulanz der Klinik zu Blutbildkontrollen vor. Hin und wieder erhält Frau M. dort Blutkonserven. Danach ist sie wieder fit und kann an den Wochenenden zu den Sitzungen und Veranstaltungen ihrer Stiftung reisen. Immer wenn sie ein besonders wichtiges Treffen hat, lässt sie sich einen Tag vorher zwei Blutkonserven in der Ambulanz anhängen, um sich, wie sie selbst immer sagt, für die bevorstehenden Treffen zu »dopen«. Frau M. findet zwar eine Nachfolgerin für ihre Stiftung, nimmt aber weiterhin an den Treffen teil, wann immer es ihr möglich ist.
So vergehen die nächsten Monate. Frau M. fühlt sich wohl und ist weiterhin sozial engagiert. Sie bringt regelmäßig Fotos von den Veranstaltungen mit, um sie freudestrahlend ihrem Arzt zu zeigen. Doch nach zehn Monaten verschlechtert sich ihr Zustand rapide, ihre Leukämie ist sehr aktiv. Frau M. muss schließlich stationär aufgenommen und behandelt werden. Ihr Arzt kommt regelmäßig an ihr Krankenbett – so auch an ihrem letzten Tag. Beide haben über die Zeit hinweg eine stabile und vertrauensvolle Arzt-Patientin-Beziehung aufgebaut; sie verstehen sich gut, manchmal auch ohne dabei viel zu sprechen.
Als ob Frau M. es ahnt, dass ihre Zeit gekommen ist, bittet sie um ein Gespräch mit ihrem Arzt. Ihre Stimme ist schon ganz schwach. »Ich danke Ihnen, dass ich Ihnen immer sagen konnte, was mich gerade bedrückte. Sie haben mich zu nichts gezwungen. Sie haben immer gewusst, was für mich das Richtige war. Sie haben mir meine Angst genommen. Mit Ihrer Hilfe habe ich noch viele schöne Begegnungen erleben dürfen. Danke für jeden einzelnen Tag und für jede Stunde, die Sie mir geschenkt haben. Für meine Stiftung ist alles geregelt und sie braucht mich nicht mehr. Jetzt kann ich beruhigt gehen.«
Ihr Arzt spürt, dass es das letzte Gespräch sein wird. Er bleibt bei ihr, setzt sich an ihre Bettkante und hält ihre Hand, bis sie ihm alles gesagt hat, was sie ihm noch sagen wollte. Die gegenseitige Wertschätzung und ehrliche Kommunikation zwischen den beiden war ihnen von Anfang an sehr wichtig. Umso bedeutsamer war es, dass Frau M. mit Hilfe symptomkontrollierender und symptomlindernder palliativmedizinischer Maßnahmen die Kommunikation bis zum Schluss ermöglicht wurde. Schließlich stellt Frau M. friedlich, mit einem zufriedenen und lebenserfüllten Gesichtsausdruck ihre Atmung ein, mit ihrer Hand in der Hand ihres Arztes.
Todeswünsche am Ende des Lebens
Die Untersuchung von Todeswünschen schwer kranker und sterbender Patienten ist Gegenstand aktueller Forschung der Medizin am Lebensende. Aufgrund körperlicher und psychischer Einschränkungen bei schwerer Krankheit am Lebensende ist für die Patienten die Teilnahme an solchen Untersuchungen und daher deren Durchführung nur bedingt möglich.4 Insgesamt aber empfinden die Teilnehmer die Befragung nach ihren persönlichen Todeswünschen eher als befreiend und wohltuend denn als störend oder belastend. Todeswünsche kommen in der Endphase bei 9–20 % der Betroffenen vor.5
Im Laufe einer schweren Krankheit oder in qualvollen Lebenssituationen können Todeswünsche auf unterschiedliche Art und Weise auftreten und geäußert werden.6 Bei manchen Menschen drückt sich der Todeswunsch in der Hoffnung aus, die unheilbare Krankheit möge schnell zum Tod führen. Diesem Ziel liegt das Motiv zugrunde, dass ein schneller Tod eine lange Sterbe- bzw. Leidensphase verhindern oder abkürzen soll. Bei anderen wiederum äußert sich der Todeswunsch dadurch, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie sie sich selbst das Leben nehmen können, und vielleicht andere dazu um Hilfe bitten. Dabei kann die Hilfe zum Sterben auf zweierlei Art erfolgen: durch Beihilfe zur Selbsttötung oder durch aktive Tötung auf Verlangen.
Es ist ganz wichtig, die von Betroffenen geäußerten Sterbe- bzw. Todeswünsche ernst zu nehmen und dabei auf die oft verzweifelten Menschen verständnisvoll, empathisch und mit wertschätzender Neutralität einzugehen. Allerdings sollte man sich zunächst zurückhaltend äußern und darauf achten, dem Betroffenen einen geschützten Raum zu bieten, in dem ein vertrauensvolles Gespräch in guter Atmosphäre zustande kommen kann. Es ist wichtig, dass der Betroffene sich frei äußern, sich zu seinen Todeswünschen und Todesplänen frei bekennen kann und darf. Auf diese Weise wird es ihm ermöglicht, dass er ganz aus sich herauskommt und die eigentlichen Gründe und Motive seiner Todeswünsche aussprechen kann. Dann wird sofort klar:
»Schwer kranke Menschen, die den Wunsch zu sterben äußern, wünschen nicht zwingend den sofortigen eigenen Tod, sondern oftmals das Ende einer unerträglichen Situation. Häufig ist es die Angst, Schmerzen, Luftnot oder anderen schweren Symptomen hilflos ausgeliefert zu sein, Angst vor dem Verlust körperlicher Funktionen und Fähigkeiten, die Angst, beim Sterben alleingelassen zu werden, Angst vor Vereinsamung und Verlust der Würde, Angst vor medizinischer Überversorgung oder Angst, dauerhaft der Medizintechnik (zum Beispiel durch künstliche Beatmung) ausgeliefert zu sein. Manch einer sorgt sich, anderen zur Last zu fallen.«7
Deshalb sollten der Arzt, die Pflegekraft oder andere Personen aus dem Behandlungsteam, denen derartige Todeswünsche vorgetragen werden, diese nicht einfach ignorieren. Todeswünsche, wenn sie vorhanden sind und geäußert werden, sind für die Betroffenen extrem wichtig. Deshalb sollte sich das Behandlungsteam ihnen offen stellen. Wenn ein Patient seine Todeswünsche artikuliert, sollte das als Hinweis auf eine vertrauensvolle Beziehung zu seinem Arzt verstanden werden. Der Arzt sollte dieses Zeichen des Vertrauens behutsam annehmen sowie mit Wertschätzung und Respekt vertiefen. »Das Gespräch kann eine große Entlastung (›denken dürfen‹) für die Betroffenen und eine Bereicherung der Team-Patienten-Beziehung bedeuten.«8
Eine gelingende Kommunikation bildet die erste erfolgreiche Säule der Behandlung einer Krankheit des Patienten. Für den Erfolg der Behandlung ist es von großer Bedeutung, dass es zwischen dem Patienten und seinem Arzt »passt«.
Aus der klinischen Erfahrung und den Ergebnissen zahlreicher Studien ist bekannt, dass Todeswünsche nicht starr und eindimensional sind oder in eine Einbahnstraße führen. Im Gegenteil, Todeswünsche entwickeln sich sehr dynamisch und weisen zum Teil völlig eine gegensätzliche Zielsetzung auf. Ein und derselbe Patient kann im Laufe seiner Krankheit, ja sogar im Verlauf des gleichen Gespräches, beides äußern: »Ich will leben« und »Ich will sterben« (vgl. Fallgeschichte Frau M.). Der Wunsch nach baldigem Sterben und der Wunsch nach noch mehr Leben stehen gleichwertig nebeneinander.9 Todeswünsche können im weiteren Verlauf der Erkrankung und Behandlung zunehmen und wieder abnehmen, sich verstärken und schwächer werden oder einfach auf gleichem Niveau bleiben (vgl. Abbildung 1).10
Abbildung 1: Dynamik von Todeswünschen über die Zeit hinweg (hier zwei bis vier Wochen) bei Patienten mit terminaler Krebserkrankung, aus: Rosenfeld, Barry/Pessin Hayley/Marziliano Allison et al. (2014): Does desire for hastened death change in terminally ill cancer patients?, Social Science and Medicine 111, S. 35–40.
In einer Untersuchung zur Häufigkeit von Todeswünschen bei Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose, einer Erkrankung der Nervenbahnen, die mit einer zunehmenden Lähmung der Skelettmuskultur einhergeht, konnte gezeigt werden, dass der Wunsch, das eigene Sterben zu beschleunigen, insgesamt selten vorkommt, nicht sehr ausgeprägt ist und im Verlauf der Erkrankung abnimmt. Dabei sind die Todeswünsche, wenn sie auftreten, häufig verbunden mit dem Gefühl, anderen zur Last zu fallen. Diese Ergebnisse aus Deutschland, wo der ärztlich assistierte Suizid nicht etabliert ist, widersprechen den Untersuchungen aus den Niederlanden oder Oregon, wo 5–20% der ALS-Patienten nach Euthanasie oder ärztlich assistiertem Suizid verlangen.11
Eine Fallgeschichte von der Vergiftungsstation12
Frau S. ist fast 83 Jahre alt, sie hat vier Geschwister, zu denen jedoch kein Kontakt mehr besteht. Sie hat ein bewegtes Leben geführt, war mit einem US-amerikanischen Soldaten verheiratet und hat ihre drei Söhne in den USA geboren. Nach der Pensionierung ihres Ehemannes ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland zurückgekehrt. Ihr Mann ist vor längerer Zeit an Krebs verstorben. Seit 40 Jahren leidet Frau S. unter Schmerzen, deren Ursache nie festgestellt werden konnte. Deshalb nimmt sie seit Langem Schmerz- und Beruhigungsmittel ein. Seit 15 Jahren lebt sie in einem Seniorenstift, wo sie anfangs sehr aktiv war, Tanzveranstaltungen organisiert und Musik gemacht hat. Seitdem sie dies nicht mehr kann, hat sie sich zurückgezogen und mit dem Gedanken gespielt, mit dem Sterbehelfer Kusch Kontakt aufzunehmen.
Frau S. verfasst eine Patientenverfügung, in der sie zum Ausdruck bringt, dass bei ihr der natürliche Sterbeprozess akzeptiert werden solle und sie nicht im Krankenhaus, sondern in der Wohnung ihres Sohnes sterben wolle. Wenn sie sich im Sterben befinde und der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten sei, wolle sie keine lebensverlängernden Maßnahmen. Sie bevollmächtigt ihren Sohn, die entsprechenden Entscheidungen für sie zu treffen. In den letzten Wochen wird ihre Stimmung immer schlechter, sie steht kaum noch aus dem Bett auf und unternimmt einen ersten Suizidversuch, der jedoch ohne Konsequenzen bleibt. Dann schreibt sie einen Abschiedsbrief: »Lasst mich bitte in Ruhe sterben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Immer nur Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen … Ich kann so nicht mehr weiterleben.« Frau S. nimmt eine Überdosis Schmerzmittel ein. Sie wird vom Pflegepersonal gefunden und mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort stellt sich die Frage, ob Frau S.s Wunsch zu sterben respektiert werden soll oder ob sie durch intensivmedizinische Maßnahmen, hier eine vorübergehende künstliche Beatmung, gerettet werden soll. Der Sohn möchte, dass der Wille seiner Mutter respektiert wird, die Ärzte wollen sie retten.
Da der Sohn der intensivmedizinischen Behandlung seiner Mutter nicht zustimmt, wird das Betreuungsgericht eingeschaltet, was die Patientin belastet hat. Die Richterin entscheidet, dass die Behandlung fortgeführt werden soll.
Nachdem Frau S. den Suizidversuch ohne Komplikationen überstanden hat, ist sie froh, überlebt zu haben. Ihre Schmerzen sind verschwunden und sie sagt, dass sie eine solche Dummheit nicht wieder machen würde. Sie wird antidepressiv behandelt, braucht keine Schmerz- und Beruhigungsmittel mehr. Nach einer Rehabilitationsbehandlung entscheidet sie sich, zu ihrem Sohn zu ziehen.
Frau S.s Geschichte ist eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass Menschen nach einem Suizidversuch ihre Lebenssituation ganz anders bewerten können als zuvor. Vielleicht hätten Sterbehelfer oder Sterbehilfeorganisationen gemeint, dass Frau S. ihr Leben gelebt hat, dass sie sich bei klarem Verstand und unter chronischen, scheinbar nicht behandelbaren Schmerzen für ihren Tod entschieden hat. Doch auch Menschen, die wirklich entschlossen sind, ihrem Leben ein Ende zu setzen, sind oft erleichtert, wenn sie den Suizidversuch überleben und mit entsprechender psychosozialer Unterstützung neuen Lebensmut schöpfen können. Wichtig ist, dass sie mit ihren Ängsten, Sorgen und Nöten nicht alleine gelassen werden. So ergab beispielsweise eine Studie der Münchener Psychiatrischen Universitätsklinik, die an überlebenden Suizidenten durgeführt wurde, dass 81% der Geretteten »froh über ihre Rettung« waren.13 Auch wenn Menschen sich nach einem misslungenen Suizidversuch weiterhin den Tod wünschen, kann eine geduldige und lebensbejahende psychiatrische Behandlung sie in ihrer seelischen Not erreichen. Psychotherapeutische und medikamentöse Unterstützung können helfen, eine scheinbar aussichtslose Situation zu verändern. Dies zeigt die folgende Fallgeschichte.
Eine Fallgeschichte aus der Psychiatrie14
Frau P., eine etwa vierzigjährige Angestellte, leidet aus ihrer Sicht seit zwanzig Jahren an einer schweren Depression. Nach vier Klinikaufenthalten hat sie die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas ändert. Sie denkt, dass sie schon als Kind depressiv war, keine Gefühle und Wünsche entwickeln konnte und der ganze Zustand ihre Schuld sei. Frau P. unternimmt einen schweren Suizidversuch, einsam in einem Hotelzimmer, und wird durch einen Zufall gerettet. Frau P. ist verärgert, dass man sie gerettet hat. Sie bedauert, überlebt zu haben. In ihrem Abschiedsbrief hatte sie darum gebeten, dass keine lebensverlängernden Maßnahmen durchgeführt werden. Sie fühle sich durch den Aufenthalt auf der geschlossenen Station bei fortbestehender Suizidalität in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt, ja, ihre Selbstbestimmung sei sogar »ausgelöscht« worden. Allein in dem Entschluss zum Suizid, nach langem Hin-und-her-Überlegen, habe sie sich frei gefühlt. Sie leide an absoluter Verzweiflung, dem Gefühl der Ausweglosigkeit, sie spüre eine Bezugslosigkeit zu sich selbst und zur Welt. Eigentlich sei es ihr nie gut gegangen, sie könne keine Freude an der Welt empfinden und habe keine Hoffnung auf Besserung; nun fühle sie sich total erschöpft. Entschlossen plädiert sie dafür, dass ein Arzt den Suizid assistieren können soll.
Das Leiden dieser Patientin ist überaus schwer. Ihre Argumentation für ihre Freiheit zum Suizid wirkt auf den ersten Blick rational, ist jedoch geprägt durch eine tiefgreifende Verzweiflung, ein ausschließlich negatives Selbstbild und ein Gefühl der Ausweglosigkeit ohne Hoffnung.
Frau P. kann schließlich eine Spur von Hoffnung in der Person des sie behandelnden Psychiaters erkennen. Sie fühlt sich auf einer ganz persönlichen Ebene angenommen und seine therapeutische Überzeugung, dass es ihr wieder besser gehen wird, macht der Patientin den quälenden Zustand, in dem sie sich befindet, etwas erträglicher. Nach fünf Monaten stationärer psychotherapeutischer und medikamentöser Behandlung kann sie in deutlich gebesserter Stimmung in die ambulante Behandlung entlassen werden. Sie möchte sich ehrenamtlicher Tätigkeit zuwenden.
Ist der Suizid hier ein Zeichen von Freiheit gegenüber einer aus der Sicht der Patientin ausweglosen Erkrankung? Sollten Ärzte und Psychiater den Todeswunsch der Patientin akzeptieren oder sogar unterstützen? Oder ist Suizidalität hier ein Krankheitssymptom, in diesem Falle das einer schweren Depression, welches dazu verpflichtet, die Patientin auch gegen ihren ausdrücklichen Willen zu retten und zu behandeln?
Sicher gibt es nicht für alle Nöte, Ängste und Probleme, die Menschen dazu bringen, ihr Leben beenden zu wollen, eine Lösung oder eine Antwort. Auch die Anstrengungen der Suizidprävention werden nicht in allen Fällen Erfolg haben. Der von selbst ernannten Sterbehelfern und Sterbehilfeorganisationen oft vorschnell gewährte assistierte Tod kann jedoch weder für Menschen mit schweren körperlichen noch mit seelischen Erkrankungen eine Lösung sein. Sie brauchen menschliche Zuwendung, Solidarität und das Gefühl der Wertschätzung ihrer Person.
2. Worum geht es in der Debatte um die Sterbehilfe?
Was bedeutet Sterbehilfe? Der Begriff ist vieldeutig und führt in der gegenwärtigen Debatte häufig zu Missverständnissen. Man spricht von aktiver und passiver, von direkter und indirekter, von freiwilliger und nicht freiwilliger Sterbehilfe, und auch dann ist nicht immer klar, was genau gemeint ist. Nur ein Beispiel für die Sprachverwirrung in der aktuellen Debatte sei hier genannt: In der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« wurde im April 2015 eine Stellungnahme von deutschen Strafrechtsprofessoren zitiert, in der es heißt, dass in Hospizen und Palliativstationen »tagtäglich organisiert Sterbehilfe geleistet werde« und es dabei oft zu einer Verkürzung der Lebenszeit komme. Diese Tätigkeit dürfe nicht mit Strafbarkeitsrisiken gehemmt werden.15 Es entsteht so der Eindruck, dass ein Verbot organisierter Suizidbeihilfe, wie es zurzeit im Deutschen Bundestag diskutiert wird, die wichtige Arbeit in Hospizen und Palliativstationen in die Nähe von Straftaten stellen würde. Dabei hat das eine mit dem anderen nichts zu tun: Beihilfe zur Selbsttötung ist etwas ganz anderes, als Menschen am Lebensende mit starken Schmerzen und anderen quälenden Symptomen nach den Regeln der ärztlichen Kunst so zu behandeln, dass ihre Leiden weitestgehend gelindert werden.16
Von daher ist eine Klärung der Begriffe, die in der aktuellen Debatte verwendet werden, dringend notwendig. Es geht nämlich einerseits um den Umgang mit sterbenden Menschen, um die Fürsorge, Behandlung und Zuwendung, die sie brauchen, und andererseits um Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Tod wünschen – nicht nur, weil sie todkrank sind. Das eine ist Hilfe, Unterstützung und Fürsorge beim Sterben, und das andere ist Hilfe zum Sterben, die Herbeiführung des Todes auf Wunsch des Patienten. Wenn wir von Sterbehilfe sprechen, kann das eine oder das andere gemeint sein.
International ist der Begriff der Euthanasie gebräuchlich; er kommt aus dem Griechischen und bedeutet – wörtlich übersetzt – »guter Tod«. In der Antike war damit ein leichter, ein angenehmer, aber auch ein würdevoller Tod gemeint. Der englische Staatsmann und Philosoph Francis Bacon verband bereits 1623 mit dem Begriff der Euthanasie die Pflicht der Ärzte, den Sterbenden zu helfen, leichter und sanfter aus dem Leben zu gehen.17 Doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff der Euthanasie mit aktiver Lebensverkürzung verbunden. Ärzte sollten unheilbar kranke Menschen auf ihr Verlangen hin töten dürfen. In der Zeit des Nationalsozialismus sind unter dem Deckmantel des »Gnadentodes« oder der »Euthanasie« etwa 300000 Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen als so genanntes »lebensunwertes Leben« gegen ihren Willen ermordet worden. Bedingt durch diesen Missbrauch des Euthanasie-Gedankens wird der Begriff in der Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland praktisch kaum verwendet.18