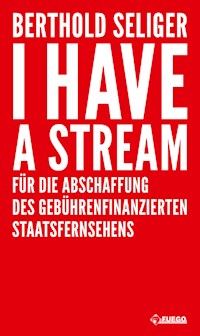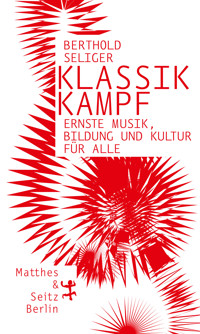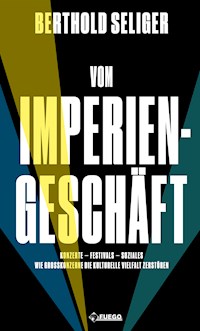
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Berthold Seliger, Publizist und seit über dreißig Jahren Konzertagent und Tourneeveranstalter, berichtet über die Neustrukturierung der Märkte in der Musikindustrie. Er nimmt die aktuellen Entwicklungen bei den Konzentrationsprozessen in der deutschen und internationalen Konzertbranche und die dubiosen Tricks im Ticketing zum Anlaß für konkrete Vorschläge, wie man mit konsequenter Gesetzgebung die Machenschaften der Konzerne eindämmen könnte, die die kulturelle Vielfalt gefährden. Seliger erklärt, wie unabhängige Musikclubs, soziokulturelle Zentren und Künstler-orientierte Festivals Möglichkeitsräume werden, in denen eine Kultur jenseits der Konzerne stattfinden kann, und wie das Musikstreaming funktioniert. Er beschreibt die soziale Situation von Musikern und Kulturarbeitern und schlägt Lösungen wie Mindestgagen vor. Der Grundgedanke seiner Überlegungen sind immer die Interessen der Musiker und der Konzertbesucher. Nur wenn sich diese gegen die Imperiengeschäfte der Kulturindustrie wehren, wird die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft erhalten bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Berthold Seliger
Vom Imperiengeschäft
Konzerne – Festivals – Soziales
Wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören
FUEGO
- Über dieses Buch -
Berthold Seliger, Publizist und seit über dreißig Jahren Konzertagent und Tourneeveranstalter, berichtet über die Neustrukturierung der Märkte in der Musikindustrie. Er nimmt die aktuellen Entwicklungen bei den Konzentrationsprozessen in der deutschen und internationalen Konzertbranche und die dubiosen Tricks im Ticketing zum Anlaß für konkrete Vorschläge, wie man mit konsequenter Gesetzgebung die Machenschaften der Konzerne eindämmen könnte, die die kulturelle Vielfalt gefährden. Seliger erklärt, wie unabhängige Musikclubs, soziokulturelle Zentren und Künstler-orientierte Festivals Möglichkeitsräume werden, in denen eine Kultur jenseits der Konzerne stattfinden kann, und wie das Musikstreaming funktioniert. Er beschreibt die soziale Situation von Musikern und Kulturarbeitern und schlägt Lösungen wie Mindestgagen vor. Der Grundgedanke seiner Überlegungen sind immer die Interessen der Musiker und der Konzertbesucher. Nur wenn sich diese gegen die Imperiengeschäfte der Kulturindustrie wehren, wird die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft erhalten bleiben.
»Seliger spricht Klartext, sein profundes Wissen über das Musikbusiness stammt aus erster Hand ...« [Der Standard]
»Seliger ist ein Überzeugungstäter. Er liebt Musik, das merkt man seinen Texten an. Deswegen plädiert er heftig und oftmals hoch unterhaltsam dafür, dem regierenden neokapitalistischen Markt nicht kampflos das Feld zu überlassen.« [Rocks]
INHALT
Kapitel 1
Imperiengeschäfte
Kapitel 2
Hippies, kalifornische Ideologie und das Silicon Valley
Festivals von Monterey Pop bis Burning Man
Kapitel 3
Immobilienverwertung, Kulturorte und der öffentliche Raum
Clubs, soziokulturelle Zentren, Unterhaltungsviertel
Kapitel 4
Kulturelles Prekariat und konzeptive Ideologen
Zur sozialen Situation von Musiker*innen und Kulturarbeiter*innen
Epilog
Literaturverzeichnis
»Ich will nicht wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Ich will wissen, wie sie abläuft.« Heiner Müller
Kapitel 1
Imperiengeschäfte
Endlose Wüste in New Mexico. Blauer Himmel, am Horizont Berge. Karger, steiniger Boden, vertrocknende Grasbüschel, die im Wind wehen. Wir sehen einen vielleicht vierzehnjährigen Jungen auf seinem Geländemotorrad durch die kleinen Hügel der Wüste rasen. Mal fährt er sandige Wege entlang, mal quer durchs Geröll, schließlich verlangsamt er seine Enduro und bleibt stehen. Er nimmt bei laufendem Motor seinen Helm ab, geht ein paar Schritte vom Motorrad weg und begibt sich in die Hocke. Schließlich sehen wir den Grund: Eine Aphonopelma chalcodes, eine etwa zehn Zentimeter große hellbraune Vogelspinne, englisch »Arizona blond tarantula«, kriecht durch den Sand. Der Junge hält seine Hand in ihren Weg und läßt sie hinaufklettern, bietet ihr abwechselnd beide Hände zum Weiterlaufen an, ehe er vorsichtig ein kleines Glasgefäß aus der Innentasche seiner Jeansjacke holt und die Vogelspinne hineingleiten läßt. Er dreht einen Deckel darauf und hält das Glas mit der Vogelspinne hoch. Wir sehen ihn und die Vogelspinne jetzt vor dem hellblauen Himmel, und ein leichtes Lächeln spielt um seinen Mund.
Der Junge geht zu seinem Geländemotorrad zurück, steckt das Glas mit der Spinne in die Innentasche seiner Jacke, steigt auf die Maschine und setzt seinen Helm auf. Sorgfältig schließt er den Riemen des Helms. In diesem Moment hören wir das Signalhorn eines nahenden Güterzugs der Union Pacific. Der Junge düst los, dem Zug entgegen.
Er wird den Tag nicht überleben. Drogenhändler, denen er zufällig bei einem Überfall auf den Güterzug in die Quere kommt, werden ihn erschießen ...
Walter »Walt« White, der Held der US-amerikanischen Fernsehserie Breaking Bad, sitzt tief in der Tinte. Daß sein Schwager ihn verdächtigt, der gefürchtete »Heisenberg« zu sein, also der Kopf einer mafiösen Drogenbande, ist noch sein kleinstes Problem. Seine Frau Skyler hat sich von ihm abgewandt, und aus Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder hat sie diese bei ihrer Schwester untergebracht. Walt darf seine Kinder nicht sehen. Skyler betrachtet sich als Walts Geisel, wäscht resigniert weiter sein Drogengeld und wartet darauf, daß Walts Krebserkrankung zurückkehrt und er endlich stirbt.
Walts Partner im Drogengeschäft, Jesse Pinkman und Mike Ehrmantraut, wollen aussteigen – Mike, weil er von der Drogenpolizei überwacht wird, Jesse, weil er, sowieso schon länger hadernd, nach der Ermordung des Jungen »das nicht mehr machen kann« und sich »zur Ruhe setzen« will. Jesse und Mike planen, ihren Teil des geraubten Methylamin für jeweils fünf Millionen Dollar an den Drogenboss Declan zu verkaufen. Der jedoch verlangt das gesamte Methylamin im Wert von 300 Millionen Dollar, denn er möchte seinen Marktanteil vergrößern und ein Monopol errichten, indem er das konkurrierende Blue Meth vom Markt nimmt. Walt verweigert den Verkauf seines Anteils und durchkreuzt so den Verkaufsplan von Jesse und Mike.
In dieser Situation kommt Jesse in Walts Haus, um mit ihm den Declan-Deal zu besprechen, um Walt zu überreden, dem Deal zuzustimmen. Er versucht, ihm den Verkauf schmackhaft zu machen: »Als du mit dieser Sache angefangen hast, hast du da auch nur davon geträumt, fünf Millionen Dollar zu haben?« Jesse verweist darauf, daß der Verkauf zur Folge habe, daß niemand mehr getötet werde. »Du hättest Zeit für deine Familie, müßtest dir keine Sorgen machen, daß jemandem was zustößt oder daß jemand was darüber rausfindet.«
Doch Walt bleibt stur: »Ich habe nicht so hart dafür gearbeitet, um das alles zu verschleudern. Wir haben gelitten und geblutet, buchstäblich, für dieses Geschäft.«
Jesse fragt Walt: »Wenn es hart auf hart kommt, sind wir dann lieber im Meth-Geschäft oder lieber im Geld-Geschäft?« Wollen wir lieber mafiöse Drogenhändler oder lieber korrupte und dubiose Bänker sein?
Und dann bleibt diese Folge von Breaking Bad förmlich stehen, der Stillstand währt nur wenige Sekunden und doch eine Ewigkeit, bevor wir von Walt, dem gefürchteten und bewunderten »Heisenberg«, erfahren, worum sich alles, wirklich alles dreht. Wir hören die Gralserzählung des 21. Jahrhunderts:
»Hast du schon einmal von einer Firma namens Gray Matter Technologies gehört? Ich habe diese Firma noch als Student zusammen mit Freunden gegründet, von mir stammt sogar der Name der Firma. Damals war es zunächst ein Kleinstunternehmen, wir hatten ein paar Patente angemeldet, aber nichts Weltbewegendes. Natürlich wußten wir alle um das Potential der Firma. Ja, wir wollten die Welt im Sturm erobern ... Und dann hat ... also ... irgendwas ist zwischen uns dreien passiert. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber aus persönlichen Gründen entschloß ich mich, die Firma zu verlassen, und verkaufte meinen Anteil an meine beiden Partner. Ich wählte einen Buyout. Für 5000 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt war das ein Haufen Geld für mich. Jetzt rate mal, was dieses Unternehmen heute wert ist.«
Jesse: »Millionen?«
Walt: »Milliarden! Und es wächst weiter: 2,6 Milliarden, Stand vom letzten Freitag, ich sehe jede Woche nach. Und ich habe meinen Anteil verkauft, mein Potential, für 5000 Dollar. Ich habe das Geburtsrecht meiner Kinder für ein paar Monatsmieten verkauft.«
Jesse: »Aber das ist doch überhaupt nicht das gleiche.«
Walt: »Jesse, du hast mich gefragt, ob ich im Meth-Geschäft oder im Geld-Geschäft wäre. Weder noch. Ich bin im Imperiengeschäft!« Und Walt führt bedeutungsvoll das Whiskyglas zum Mund.1
Die Fernsehserie Breaking Bad von Vince Gilligan kann man als Beschreibung der dunklen Seite des Kapitalismus verstehen, eines neoliberalen Kapitalismus in einer aus den Fugen geratenen Welt. Der kapitalistische Realismus zeigt sich auf mehreren Ebenen: Der Chemielehrer Walter White ist schon von Haus aus nicht in der Lage, mit seinem Lehrergehalt seiner Familie das Leben zu bieten, das ihm als biederer amerikanischer Bürger vorschwebt, zumal sein Sohn an Cerebralparese leidet und die Therapie hohe Kosten verursacht. So ist er gezwungen, einem Zweitjob in einer Autowaschanlage nachzugehen.
Auch hierzulande besteht eine ständig wachsende Gruppe des »Prekariats« aus arbeitenden Vätern, die zwischen 25 und 54 Jahre alt sind und denen es auch bei regelmäßiger Erwerbsarbeit nicht gelingt, »gemeinsam mit der Partnerin die Familie sicher zu versorgen«, wie es in einer aktuellen Studie heißt.2
Walter White kollabiert kurz nach seinem 50. Geburtstag bei der Arbeit in ebendieser Autowaschanlage, und im Krankenhaus erhält er die Diagnose: Lungenkrebs, sehr geringe Heilungschancen. Neben der existentiellen Bedrohung durch diese Krankheit an sich verschärft die neue Lebenssituation noch einmal die soziale Problematik seines Daseins: In den USA existiert bekanntlich nur eine marginale Krankenversicherung, und White kann die immensen, privat aufzubringenden Kosten der Chemotherapie von über 90 000 Dollar nicht aufbringen. Gleichzeitig will er seine Familie finanziell absichern, falls er bald sterben wird. Er berechnet die dafür benötigte Summe mit 737 000 Dollar. Geld, das er mit der Herstellung von Drogen, von besonders reinem und deshalb begehrtem Methamphetamin zu verdienen beabsichtigt.
Bereits die Grundkonstellation der prekären Existenz von in seriösen Jobs arbeitenden Menschen beleuchtet die Lebensbedingungen im kapitalistischen Realismus. Gleichzeitig zeigt uns Breaking Bad beispielhaft verschiedene Stadien und Formen dieses Wirtschaftssystems: Die Ideologie der Start-Ups etwa, der »ausgelagerten Testbienchen« (Dietmar Dath), also kleiner Firmen mit Ideen und Patenten, von denen einige aus unterschiedlichsten Gründen groß werden und ihre Gründer, so sie denn nicht vorher die Segel gestrichen haben, reich machen. Microsoft wurde bekanntlich 1975 von Bill Gates, Paul Allen und Monte Davidoff gegründet. Die drei Microsoft-Gründer hatten die Programmiersprache Altair BASIC 2.0 für den Computer Altair 8800 des Unternehmens MITS (Micro Instrumentation Telemetry Systems) entwickelt, mit dem sie einen Distributionsvertrag abschlossen, der ihnen neben einer Einmalzahlung von 3000 Dollar auch unterschiedlich hohe Umsatzbeteiligungen garantierte, wenn die Computerkäufer die von Microsoft entwickelte Software mit- oder nachbestellten. Der Firmensitz von Microsoft wie auch von MITS war ursprünglich Albuquerque, also just die Stadt, in der auch Breaking Bad spielt. Gates und Allen schlossen untereinander einen Vertrag, der die Aufgabenverteilung und die Gewinnausschüttungen innerhalb ihres jungen Unternehmens regelte. Der dritte Partner, Monte Davidoff, wurde mit einmalig 2400 Dollar ausbezahlt. Walt White in Breaking Bad erhält nach seinem Burnout etwas mehr – 5.000 Dollar –, was damals »ein Haufen Geld« für ihn war. Mittlerweile allerdings ist die Firma, die White mit gegründet hat, mehr als 2,6 Milliarden Dollar wert (und Microsofts Marktwert beträgt im Mai 2018 750,6 Milliarden Dollar).3 Oder denken wir an Apple, den heute mit 926,9 Milliarden Dollar nach Marktwert größten Weltkonzern, der 1976, also ein Jahr nach Microsoft, von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne mit einem Startkapital von 1300 Dollar gegründet wurde. Mitgründer Wayne, der sich um die juristischen Formalitäten der Firmengründung gekümmert und das erste Logo der neuen Firma gezeichnet hatte (Isaac Newton unter einem Apfelbaum, an dem ein einzelner Apfel hängt), verließ Apple nach kurzer Zeit. Er verkaufte seine Firmenanteile für insgesamt 2300 Dollar. Es handelt sich hier offensichtlich um eine der substantiellen Narrationen von Firmengründungen im digitalen Zeitalter.
Vor allem aber diskutiert Breaking Bad eine Existenzform des modernen Kapitalismus, die durch den gnadenlosen Neoliberalismus, wie wir ihn seit den siebziger Jahren erleben müssen, und die Digitalisierung erst ermöglicht wurde: das Imperiengeschäft. Man macht einen Laden nicht mehr auf, um einen Laden zu besitzen und ihn erfolgreich zu führen. Man gründet keine Firma mehr, um ein Produkt zu entwickeln und erfolgreich zu verkaufen. Nein, man macht heutzutage einen Laden auf, um einen zweiten aufzumachen, einen dritten, solange, bis man den örtlichen und den regionalen Markt beherrscht, dann den nationalen und schließlich den Weltmarkt. Es geht darum, ein Imperium zu errichten, ganz egal mit welchem Produkt (und es muß nicht einmal ein Produkt sein, im digitalen Kapitalismus betreiben die erfolgreichsten Unternehmen ja häufig nur Plattformen), und ganz egal in welchem Sektor. Die Frage, die Jesse stellt: »Sind wir lieber im Drogen- oder im Geldgeschäft?«, ist die falsche Frage, denn darauf kommt es nicht an. »I’m in the empire business!«, macht Walter White klar. Es kommt auf Größe, auf Markt- und letztlich auf Weltbeherrschung, auf Dominanz und auf Profit an, egal, ob man dies mit Drogen oder mit Bankgeschäften erreicht.
Oder mit Konzerten. Der Rapper Gucci Mane, der »Trap-Gott«, der die Karrieren von Weltstars wie Travis Scott, Young Thug und Migos befördert hat, erklärt in seiner Autobiographie,4 daß das Geschäft mit Musik letztlich so läuft wie das Geschäft mit Drogen – und mit beidem hat Gucci Mane seine einschlägigen Erfahrungen, als Drogenhändler, der im Knast saß, ebenso wie als erfolgreicher Musiker, der zum Millionär wurde. In beiden Fällen »streckte« er sein Produkt – als Musiker, indem er jeden Monat ein Mixtape veröffentlicht und alte Hits neu aufkocht, mit neuen Musikern, anderen Rappern. Und sowohl als Drogenhändler wie auch als Musiker weiß Gucci Mane, worauf es ankommt: auf die Vertriebswege. Wer über die Distributionskanäle verfügt, der hat die Macht. Der kann den Markt mit seinen Produkten fluten.5
* Beispielsweise hat Microsoft 1991 laut einem US-Kartellverfahren eine Version von Windows 3.1 auf den Markt gebracht, die eine vorgetäuschte Fehlermeldung anzeigte, wenn Windows 3.1 auf einem Betriebssystem des Konkurrenten Digital Research installiert wurde. Microsoft verglich sich gegen eine Abfindung von mehr als 200 Millionen Dollar – vermutlich ein eher kleines Schmerzensgeld, wenn man den realen Schaden für den Konkurrenten betrachtet, der bald danach vom Markt verschwand.
Wer ein Imperium errichten will, dem sind alle Mittel recht, legale wie illegale. Ob Walt White in Albuquerque Crystal Meth herstellt, dann die Vertriebswege seiner Drogen kontrolliert und schließlich als »Heisenberg« zum Herrscher eines Imperiums wird, oder ob Microsoft in eben diesem Albuquerque eine Software schreibt, später ein Betriebssystem und eine grafische Benutzeroberfläche entwickelt (oder von Apple klaut, ganz wie man will),6 seine Verdrängungspolitik gegenüber der Konkurrenz mit nicht immer legalen Mitteln vorantreibt,* öfter mit Ermittlungen des Kartellamts zu tun hat und am Ende als Monopolist und als »wertvollstes« Unternehmen der Welt dasteht – der Weg und das Ergebnis sind ähnlich: Man hat ein Imperium errichtet, das den Markt beziehungsweise die Welt dominiert – koste es, was es wolle.
Einen ähnlichen Weg sind die drei weltbeherrschenden Giganten des Konzertgeschäfts gegangen: die AEG, CTS Eventim und Live Nation.
Mit AEG ist nicht etwa die altehrwürdige, 1883 in Berlin gegründete »Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft« gemeint, die einmal einer der weltweit größten Elektrokonzerne (und vor und während des Ersten Weltkriegs nach Krupp zweitgrößter deutscher Rüstungsproduzent) war, die 1982 Insolvenz anmelden mußte, 1985 von der Daimler-Benz AG übernommen und 1996 endgültig aufgelöst wurde – sondern die »Anschutz Entertainment Group«, als Tochtergesellschaft der »Anschutz Corporation« eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Unterhaltungsindustrie und des Sports. Die AEG besitzt und betreibt einige der wichtigsten und größten Arenen und Theater wie das Staples Center in Los Angeles, »The O2«* in London (ein Entertainment-Komplex mit dem größten Kuppelbau der Welt), die Cadillac Arena7 in Beijing oder hierzulande die Mercedes-Benz (ehemals O2) Arena in Berlin und die Hamburger Barclaycard Arena.
* Es ist schlechter Brauch, daß derartige Arenen heutzutage ähnlich wie Stadien nach demjenigen benannt werden, der dafür am meisten Geld bietet: Die Namensrechte für diesen Entertainment-Komplex in Greenwich (London) wurden 2007 durch das Mobilfunkunternehmen O2 erworben und 2017 für umgerechnet etwa 148 Millionen Euro bis in das Jahr 2027 verlängert.
Jüngst hat die AEG ihre Tournee-Sparte »AEG Live« in eine globale Tourneeagentur umgewandelt: die »AEG Presents Global Touring and Talent«. Von der Zentralisierung der Tourneegeschäfte erhofft man sich, die AEG noch mehr als »leader in global touring«, als einen der Weltmarktführer im Tourneegeschäft, zu etablieren. Zusätzlich verbleiben die weiteren Konzertveranstalter und Agenturen, die AEG besitzt, unter dem Dach von »AEG Presents«. Dazu gehören die Firmen Goldenvoice (ein kalifornischer Großveranstalter von Konzerten und Festivals, unter anderem des Coachella und des Stagecoach Country Music Festivals), Concerts West (einer der größten Konzertveranstalter, zu dessen Klienten Céline Dion, The Rolling Stones, Katy Perry, Roger Waters und Justin Bieber gehören), die im Bereich der Country-Musik tätige Messina Touring Group (u. a. Taylor Swift, Ed Sheeran), The Bowery Presents (einer der führenden Veranstalter und Betreiber von Konzerthallen in New York, Boston, Philadelphia, Atlanta und Maine) und die legendäre europäische Agentur Marshall Arts, die unter anderem Paul McCartney, Elton John, Herbie Hancock, José Carreras, Cher, Pink und Tina Turner vertritt und die Tourneen von Joe Cocker veranstaltet hat. Am Rande sei erwähnt, daß die Anschutz Entertainment Group mit AEG Sports auch eine Sportdivision unterhält. Der AEG gehören weltweit eine Vielzahl von Sportmannschaften, unter anderem die Eishockeyteams Los Angeles Kings und Eisbären Berlin (beide Teams können ihre Spiele praktischerweise in den AEG-eigenen Mehrzweckhallen austragen), das Fußballteam Los Angeles Galaxy (das 2006 mit der Verpflichtung von David Beckham für Aufsehen sorgte) oder die Los Angeles Lakers (an dem Basketballteam hält AEG eine 50-Prozent-Beteiligung). Unternehmenschef Philip Anschutz unterstützt übrigens politische Gruppierungen aus dem evangelikal-konservativen Milieu, die unter anderem Homosexuelle diskriminieren,8 was durchaus eine pikante Note hat: Mit dem Geld, das mit dem bekennenden Homosexuellen Elton John verdient wird, finanziert Anschutz Propaganda, die sich gegen Homosexuelle richtet.
In meinem Buch Das Geschäft mit der Musik habe ich beschrieben, wie der 1996 verabschiedete US-amerikanische »Telecommunications Act« Wettbewerbsbeschränkungen aufhob mit dem vorgeblichen Ziel, die Angebotsvielfalt zu steigern, und genau den gegenteiligen und letztlich erwünschten Effekt erzielte, denn es kam zu massiven Konzentrationsprozessen. Zu den Unternehmen, die von diesem Gesetz profitiert haben, gehört die regionale texanische Radiostation Clear Channel aus San Antonio. Nach 1996 investierte Clear Channel mehr als 30 Milliarden Dollar und kaufte mehr als 1200 Radiostationen in den USA – aber auch führende Konzertagenturen, Veranstalter und Konzerthallen. Im Jahr 2005 mußte Clear Channel aus Wettbewerbsgründen die Konzertsparte aus dem Unternehmen herauslösen, die seitdem als »Live Nation« fungiert und heute der weltgrößte Konzertveranstalter ist.
Live Nation hat 2017 etwa 30 000 Konzerte in 40 Ländern veranstaltet und dabei 500 Millionen Tickets verkauft. Live Nation besitzt oder betreibt weltweit 222 Veranstaltungsorte und besitzt oder kontrolliert über Mehrheitsbeteiligungen etliche der wichtigsten Tourneeveranstalter und Festivals unter anderem in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Skandinavien, Italien, Spanien und neuerdings auch in Deutschland. Live Nation managt weltweit mehr als 500 Künstler und Bands, darunter U2 und Madonna. Der weltweite Expansionskurs, das Imperiengeschäft, wurde mit gigantischen Verlusten finanziert: Zwischen 2005 und 2012 schrieb Live Nation Verluste in Höhe von 951 Millionen Dollar (allein im Jahr 2008 waren es 239 Mio.).
Seit dem Erscheinen von Das Geschäft mit der Musik im Jahr 2013 hat Live Nation unter anderem die folgenden Firmen gekauft oder gegründet beziehungsweise Beteiligungen an ihnen erworben: Insomniac Events (ein auf »Electric Dance Music«, EDM, spezialisierter US-Veranstalter, der zum Beispiel das Electric Daisy Carnival-Festival betreibt), C3 Presents aus Austin, Texas (die unter anderem das legendäre Austin City Limits Music Festival und das Lollapalooza Festival, das seit einigen Jahren auch in Berlin stattfindet, aber auch eine Managementfirma betreiben, zu deren Klienten The Strokes, Phoenix, My Bloody Valentine oder Justice gehören; zum Zeitpunkt der Übernahme durch Live Nation galt C3 Presents als der größte unabhängige Konzertveranstalter der Welt), marktdominierende Tourneeveranstalter in Südafrika und Israel sowie weitere Groß-Festivals, von New Orleans über das finnische Hip-Hop-Festival »Blockfest« bis zum brasilianischen »Rock in Rio«.
Last but not least wagte Live Nation im Sommer 2015 auch den Markteintritt nach Deutschland, den größten europäischen Musikmarkt. Hier gewann man den größten deutschen Konzertveranstalter der letzten Jahrzehnte, Marek Lieberberg (an dessen Marek Lieberberg Konzertagentur, MLK, die CTS Eventim AG seit dem Sommer 2000 eine Mehrheitsbeteiligung hält) als »Chief Executive Officer« von Live Nation Concerts Germany; Lieberberg brachte auch sein Führungsteam mit zu Live Nation. Marek Lieberberg war zum Zeitpunkt seines Eintritts in den Live Nation-Konzern laut eigenen Angaben der weltweit fünftgrößte Konzertveranstalter. Live Nation-Chef Michael Rapino kommentierte den deutschen Markteintritt seines Unternehmens und die Zusammenarbeit mit Marek Lieberberg wie folgt: »Dieser Schritt bildet die Fortsetzung der globalen Expansion unseres Unternehmens und bietet unseren Sponsoren Zugang zu den Fans in einem wichtigen europäischen Markt, während gleichzeitig das Inventar von Ticketmaster um mehrere Millionen Tickets wächst.«
Die »Fortsetzung der globalen Expansion unseres Unternehmens« – so nennt Rapino das Imperiengeschäft, dem er nachgeht. Und Marek Lieberberg stieß ins gleiche Horn: »Ein Teil von Live Nation zu werden, ist der Traum eines jeden Veranstalters. Der Zugang zur Plattform von Live Nation und dem Sponsorship-Team wird unser Business auf die nächste Ebene heben.«9 Einigermaßen lustig ist es, daß nun die Firma, die Lieberbergs Namen trägt, nämlich die Marek Lieberberg Konzertagentur Holding GmbH, zu 100 Prozent der CTS Eventim AG gehört, während er, Lieberberg selbst, für Live Nation arbeitet. Besonders aufschlußreich an Rapinos und Lieberbergs Stellungnahmen zur Gründung von Live Nation Concerts Germany ist allerdings der doppelte Hinweis auf Sponsoren, denen man »den Zugang zu den Fans in einem wichtigen Markt« ermöglichen möchte, und auf das Ticketing. Auch wenn Rapino hier flunkert, denn Lieberbergs Konzertagentur war zuvor nicht für »mehrere Millionen« Tickets verantwortlich, sondern für zwei Millionen, und die gehen jetzt nicht automatisch an die Live Nation-Firma Ticketmaster, sondern zu einem guten Teil nach wie vor an die führende deutsche Ticketing-Plattform, nämlich an CTS Eventim, an der selbst der Weltmarktführer Ticketmaster offensichtlich nicht so einfach vorbeikommt. Jedoch kann man an diesen Statements ablesen, worauf es im globalen Konzert-Imperiengeschäft zuvörderst ankommt: Auf Sponsoring und Ticketing!
Betrachten wir etwa die Geschäftszahlen von Live Nation aus dem Jahr 2017:
● Der Konzertbereich hat 93,59 Millionen US-$ Verlust gemacht.
● Der Bereich »Sponsoring & Advertising« sorgte dagegen für Gewinne in Höhe von 251,49 Millionen US-Dollar (bei nur 445,15 Mio. Dollar Umsatz!).
● Im Bereich Ticketing wurden 90,9 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht (wobei man faktisch die 110 Mio. Dollar hinzuzählen muß, die für einen Rechtsstreit zurückgelegt wurden).
Die Zahlen lassen interessante Rückschlüsse zu: Das eigentliche Konzertgeschäft von Live Nation ist hochdefizitär, was nicht zuletzt an den überhöhten Gagen liegen dürfte, die der Konzern an Künstler zahlt, um diese für Live Nation zu gewinnen. Nicht selten werden mehr als 100 Prozent der Einnahmen aus dem Ticketverkauf als Künstlergage bezahlt, was absurd klingt, sich aber »rechnet«, wenn man bedenkt, daß die eigentlichen Gewinne im Konzertgeschäft längst durch Ticketing und Sponsoring gemacht werden. Live Nation ist der Weltmarktführer nicht nur im Konzertgeschäft, sondern auch beim Verkauf von Eintrittskarten.
Noch höhere Gewinne als beim Ticketing werden im Bereich »Sponsoring & Advertising« gemacht, insbesondere, wenn man die Erlöse ins Verhältnis zum Umsatz in dieser Unternehmenssparte setzt: Eine Bruttogewinn-Marge von 56,50 Prozent ist einigermaßen sensationell. Was aber bedeutet »Sponsoring & Advertising«? Da geht es längst nicht mehr um das gute alte Tour-Sponsoring. Nein, hier ist eine ganze Abteilung von Marketingprofis damit beschäftigt, exklusive Vorverkaufsrechte an andere Konzerne zu verkaufen. Es geht um die »Exclusive Presales«, eine Art von Vor-Vorverkauf: Ein Konzern wie die Deutsche Telekom AG erhält das Recht, bereits vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden vor Beginn des eigentlichen Vorverkaufs einen exklusiven Vor-Vorverkauf einzurichten. In der Regel verkauft der Konzern, der sich den Vor-Vorverkauf für hohe Beträge gesichert hat, die exklusiven Presales-Tickets ausschließlich an seine eigenen Kunden oder zumindest an Kunden, die sich auf der konzerneigenen Plattform registriert haben, über deren Daten der Konzern also verfügt. Telekom-Kund*innen konnten sich so zum Beispiel achtundvierzig Stunden vor Beginn des »offiziellen« Vorverkaufs für das Deutschland-exklusive Konzert des US-Rapstars Eminem 2018 ihre Eintrittskarten sichern. Laut Aussage des Veranstalters, Live Nation-Deutschland-Chef Marek Lieberberg, durfte die Telekom »bis zu 50 Prozent der Tickets verkaufen«, während »mindestens 50 Prozent in den offiziellen Vorverkauf zu den Anbietern Eventim und Ticketmaster« gingen.10 Ein Telekom-Sprecher erklärte das Modell des exklusiven Vor-Vorverkaufs so: »Wir haben eine strategische Partnerschaft mit dem Veranstalter Live Nation. Dadurch können wir Prio-Tickets für unsere Kunden anbieten.«11 Im Fall des Eminem-Konzerts in Hannover im Sommer 2018 bedeutete dies, daß die Telekom-Kund*innen über die Telekom-App »Megadeal« bis zu vier Tickets erwerben konnten. Der Preis: zwischen 93,90 und 122,65 Euro pro Karte. Der »Rohpreis« der Karten betrug in drei Kategorien 75,90 beziehungsweise 100 Euro, die Telekom schlägt also die üblichen Vorverkaufs- und Zusatzgebühren drauf oder, was wahrscheinlicher ist, übernimmt die Preise der Ticketingkonzerne, denn diese wickeln auch den kompletten Vorverkauf für die Telekom ab. Wofür die Telekom mit ihren »Magenta Music Prio Tickets« bezahlt, ist lediglich das exklusive Vor-Vorverkaufsrecht. Live Nation verkauft also für Millionen Euros »Zeitfenster« von vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden an »Branding-Partner« (und dieses Geld bezahlen letztlich die Kund*innen dieser Branding-Firmen). Der Konzertveranstalter gibt sozusagen die Attraktivität der Tickets von Stars wie Eminem & Co. an die Branding-Partner ab. Diese Firmen wiederum, die sich die exklusiven Presale-Rechte gesichert haben, versprechen sich davon einen Imagetransfer der coolen Superstars auf ihre Produkte und nutzen das Presale-Tool natürlich für die Neukundengewinnung. Und die Firmen freuen sich über die frei Haus gelieferten Nutzerdaten.
Was ein Konzern wie die Deutsche Telekom AG mit den Nutzerdaten anstellt, zeigte eine Recherche des Spiegel Anfang 2019.12 Es kam heraus, daß »die Telekom Mobilfunkdaten auswertet, um Bewegungsprofile zu erstellen«. Motionlogic heißt die Telekom-Tochter, die mit riesigen Datenmengen hantiert und »mit ihren Erkenntnissen die Werbebranche, Verkehrsbetriebe, Planer und Händler beliefert«. Ein Marketingmanager bei T-Systems wird mit den Worten zitiert, daß man »in Stadtzentren bis auf eine Fläche von 250 mal 250 Metern genau messen kann, wo Menschen sich aufhalten«. Und entsprechend wirbt Motionlogic damit, »daß sich sogar Erfolge einzelner Plakatkampagnen erfassen« lassen, weil man »durch Passantenanalysen genau feststellen kann, wie lange Menschen in der Nähe eines Plakats stehen geblieben seien – und welcher Gruppe diese Menschen angehörten«. Dies wird natürlich erst deswegen möglich, weil »die Telekom zudem auf Daten aus den Verträgen ihrer Kunden zurückgreift« wie das (gerundete) Alter, das Geschlecht und die ersten vier Stellen der Postleitzahl ihres Wohnsitzes. Und: Nach derzeit bestehendem Gesetz und den Telekom-Nutzungsbedingungen müssen die 40 Millionen Telekom-Kunden der Datennutzung (ich würde sagen: dem Datenmißbrauch und dem Verstoß gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung) nicht einmal zustimmen. Die Kunden wissen sowieso nichts davon, wie die Telekom mit ihren Nutzerdaten dealt. Es handelt sich um ein weltweit explodierendes Geschäft mit extrem hohen Profitraten, weswegen man auf den Anzeigen des deutschen Live Nation-Konzerns mittlerweile ständig die Angabe von »Magenta Musik Prio Tickets« und deren Website findet, ob für die einschlägigen Tourneen oder sogar für die Großfestivals »Wireless Germany«, »Rock am Ring« und »Rock am Park«.
Natürlich hat CTS Eventim unlängst nachgezogen und eine eigene Abteilung namens »Eventim Brand Connect« ins Leben gerufen, die sich um Unternehmenskunden kümmert, die sich für Marketing- und Sponsoring-Maßnahmen im Livebereich interessieren. Mit der neuen Geschäftseinheit bietet CTS Eventim »Kampagnenmöglichkeiten entlang der gesamten Fan Connection«.13 Denn »Marketingpartnerschaften« sind für CTS Eventim »ein strategisches Wachstumsfeld«, wie Frithjof Pils, der Geschäftsführer der neuen Abteilung und auch Geschäftsführer der Medusa Music Group, erklärte: »Wir verfügen über wesentliche Assets und Kompetenzen, um Werbepartnern einen erheblichen Mehrwert für ihre Kampagnen zu bieten.« Eventim Brand Connect biete dazu »eine in Europa einzigartige Reichweite und Internationalität« mit Zugang zu rund 3000 Veranstaltungen von mehr als 20 Promotern in zehn Ländern mit Besucherzahlen von mehr als zehn Millionen Menschen pro Jahr.14 Und Pils verweist auf einen anderen Vorteil eines Konzert- und Ticketkonzerns: »Bei uns kauft der Kunde in der Regel 150 Tage vorher. Wir können ihn also ein halbes Jahr lang begleiten«. Heißt: mit Werbung eindecken und seine Daten absaugen.15 Und für den Aufbau des neuen Unternehmensbereichs Marketing, Partnerships und Sponsorship hat CTS Eventim Anfang 2017 einen ausgewiesenen Experten an Land gezogen: Simon Lewis. Er war zuvor Präsident von ...? Genau: Live Nation Europe.
Grundsätzlich sieht es bei der CTS Eventim AG nicht anders als bei Live Nation aus. Man operiert nur auf etwas niedrigerem Level. Der drittgrößte Konzertveranstalter und zweitgrößte Tickethändler der Welt verzeichnete 2017 erstmals in der Firmengeschichte Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro und konnte den Umsatz im Jahr 2018 nochmals um mehr als 20 Prozent auf 1,242 Milliarden Euro16 steigern. Das Betriebsergebnis (das normalisierte EBITDA)17 lag 2017 bei 204,7 und 2018 bei 231,1 Millionen Euro (eine Steigerung von 12,9 Prozent). CTS Eventim ist in gewisser Weise und rein wirtschaftlich gesehen ein sehr deutsches Gegenmodell zu Live Nation: Man schreibt bevorzugt schwarze Zahlen; die Zukäufe werden nicht durch gigantische Verluste finanziert wie bei Live Nation, sondern eher seriös; und das Wachstum des Konzerns schreitet deswegen langsamer voran. Doch im übrigen ist das Prinzip ähnlich: Man setzt auf das Betreiben von Konzertarenen (die Lanxess Arena in Köln, die Berliner Waldbühne und die Arena Berlin, Eventim Apollo in London, K. B. Hallen in Kopenhagen) und den Zukauf von nationalen Tourneeveranstaltern in ganz Europa sowie auf Festivals.
In Großbritannien wurde heftig kritisiert, daß Live Nation mehr als 25 Prozent aller dortigen Festivals mit mehr als 5000 Zuschauern dominiert. Darüber kann die deutsche Konzertbranche nur müde lächeln: In Deutschland kontrollieren CTS Eventim-Firmen heute gut zwei Drittel der großen Rock- und Pop-Festivals. Und vor allem verdient CTS Eventim am Ticketing: Während der Konzertbereich des Konzerns 2017 bei einem Umsatz von 626,7 Millionen Euro nur 25,5 Millionen Euro Gewinn (normalisiertes EBITDA) machte (und 2018 bei einem Umsatz von 812,5 Mio. Euro nur 35,3 Mio. Gewinn), lag der Erlös im Ticketing-Bereich 2017 bei einem Umsatz von 418,4 Millionen Euro bei 178,6 Millionen und 2018 bei einem Umsatz von 447,1 Millionen Euro bei 195,8 Millionen (jeweils EBITDA).
Die EBITDA-Marge des CTS-Konzertgeschäfts liegt derzeit bei etwas über 4 Prozent (mit dem tiefsten Wert seit 2005, nämlich 4,2 Prozent, in 2017 und dem zweittiefsten Wert in 2018: 4,4 Prozent; 2010 lag der Wert noch bei 8,0 Prozent, 2012 bei 9,3 Prozent, 2013 bei 8,7 Prozent), während die EBITDA-Marge im Ticketing bei CTS seit fünf Jahren bei über 40 Prozent liegt, mit kontinuierlich steigender Tendenz (mit dem höchsten Wert im Jahr 2018: 43,8 Prozent).
Das bedeutet im Klartext: Die extrem hohen Gewinne aus dem Unternehmensbereich Ticketing verschaffen CTS Eventim die Möglichkeit, zu expandieren und weitere Konzertfirmen zu kaufen, die wiederum dafür sorgen, daß die Ticketeinnahmen von CTS Eventim weiter steigen, was CTS Eventim wiederum die Möglichkeit verschafft, zu expandieren und weitere Konzertfirmen zu kaufen und so weiter und so fort. Die Erfindung des Perpetuum mobile – im Konzertbusiness ist sie gelungen, als sowohl vertikales wie horizontales Imperiengeschäft.
Das war übrigens von Anfang an das Erfolgsmodell von CTS Eventim: Im Jahr 1996 hatte Klaus-Peter Schulenberg den seinerzeit hochdefizitären Kartenvermarkter »Computer Ticket Service«, CTS, einen Dienstleister für Vorverkaufsstellen, von den damaligen Granden der deutschen Konzertveranstalter-Szene gekauft, von Marek Lieberberg, Matthias Hoffmann und Marcel Avram. CTS soll damals mit 10 Millionen D-Mark verschuldet gewesen sein.18 Schulenberg sanierte den Laden und brachte ihn im Jahr 2000 unter dem Namen »CTS Eventim« an die Börse. Mit dem Cashflow aus dem Börsengang stand Schulenberg und seiner jungen Aktiengesellschaft neues Kapital zur Verfügung, das investiert werden konnte. Zunächst plante Schulenberg, 12 Millionen D-Mark in eine umfassende Werbekampagne für seine Kartenfirma zu stecken, um Kunden auf die Websites des Unternehmens zu locken. Doch das Konzept ging nicht auf. »Wir hatten 2 Millionen DM ausgegeben und keinen Mehrumsatz gemacht«, wird Schulenberg zitiert.19 Schulenberg stellte die teure Werbekampagne ein. Stattdessen investierte er den zweistelligen Millionenbetrag, der übriggeblieben war, in Konzert- und Ticketfirmen – Wachstum durch Übernahmen. Schulenberg kaufte Kartenportale, vor allem aber Konzertveranstalter, und zwar die größten und renommiertesten. Unter anderem den Marktführer, die Marek Lieberberg Konzertagentur, sowie Semmel Concerts (der Tourneeveranstalter von Helene Fischer war im Jahr 2018 laut Pollstar der vierterfolgreichste Konzertveranstalter der Welt mit über 4,47 Millionen verkaufter Tickets),20 außerdem Peter Rieger, Dirk Becker oder später FKP Scorpio. Diese Zukäufe waren für Schulenberg, der über seine »KPS Stiftung« 43,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an CTS Eventim hält,21 der »einfachste Weg, die Marke CTS Eventim an die Künstler zu bringen«.22 Mit mehr als dreißig Firmenübernahmen hat Schulenberg aus einer Firma mit einst 6,5 Millionen D-Mark Umsatz ein Milliardenimperium aufgebaut, das den Ticketmarkt für Konzerte und Sportveranstaltungen in Deutschland dominiert und auch in ganz Europa mal mehr, mal etwas weniger mitbeherrscht und gleichzeitig im europäischen Konzertgeschäft mit Live Nation ein Duopol bildet. Und last but not least ist Schulenberg mit seinen Geschäften binnen nur siebzehn Jahren selbst zum Milliardär geworden.
Faktisch haben die Ticketingkonzerne (oder präziser: die Ticketingabteilungen der Live Entertainment-Konzerne) die Macht im Konzertgeschäft übernommen. Diese Macht hängt mit mehreren Faktoren zusammen: Bekanntlich tragen die Ticketanbieter im Gegensatz zu den Konzertveranstaltern keinerlei unternehmerisches Risiko, sie betreiben ein reines Provisionsgeschäft. Werden für ein Konzert wenig Tickets verkauft, verdient der Tickethändler eben ein bißchen weniger, während der Konzertveranstalter in die Bredouille gerät und Verlust macht. Der stärkste Grund für die Gewinne im Ticketing aber lautet: das Internet! Die Menge der von CTS Eventim im Internet verkauften Tickets steigt in Riesenschritten: 2005 waren es noch 3,5 Millionen Tickets, 2010 bereits 17,1 Millionen, 2017 hat CTS Eventim 48,9 Millionen und 2018 erstmals über 50 Millionen Tickets im Internet verkauft, nämlich 54,3 Millionen Online-Tickets. Dabei kommen den Ticketingfirmen vor allem ihre geringen Kosten zugute. Während im alten Modell die Kartenverkaufsstellen ganz konkret eine Bude auf dem Markt hatten (mit Kosten für Miete, Ausstattung, Computer und Personal), die sie von ihren 10 Prozent Vorverkaufsgebühren finanzierten, fallen die meisten dieser Kosten im Internet weg. Die Ticketingkonzerne können neben ihrer weiterhin erhobenen »System«- beziehungsweise »Buchungsgebühr« (zwischen 1 und 2 Euro) nun den größten Teil der Vorverkaufsgebühren selbst als Gewinn verbuchen. Und außerdem verlangen die Großkonzerne im Ticketgeschäft bekanntlich noch absurde Zusatzgebühren wie zum Beispiel die »Print at Home«-Gebühr für Kund*innen, die sich ihre Tickets selbst am Drucker ausdrucken. Dafür, daß sie selbst die Arbeit machen, das Equipment zur Verfügung stellen und den Toner selbst bezahlt haben, wurden die Kunden von CTS Eventim nochmal mit einer »Servicegebühr« von 2,50 Euro zur Kasse gebeten. Auch »Reservix« und die mit ihr verbundene »AD Ticket«, Nummer drei im deutschen Ticketinggeschäft, verlangen immer noch (allerdings geringere) »Print at Home«-Gebühren, während Ticketmaster diese Zusatzgebühren für den deutschen Markt mittlerweile aus freien Stücken abgeschafft hat. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die »Print at Home«-Gebühren der CTS Eventim AG im August 2018 höchstrichterlich gekippt – jedenfalls wenn diese Gebühr 2,50 Euro beträgt. Denn der BGH-Entscheid gilt nicht grundsätzlich für derartige Gebühren, sondern lediglich für ihre Höhe. Und so hat ein CTS-Eventim-Sprecher auch unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid frech angekündigt, daß man zwar »vorerst« auf diese Gebühr verzichten, aber »wenn nötig Anpassungen vornehmen« werde. Möglicherweise könne die Gebühr »auch in verringerter Höhe beibehalten werden«.23
Der Kunde ist ganz offensichtlich der Feind. In kaum einer anderen Branche werden die Kund*innen derart arrogant und schlecht behandelt wie im Konzertgeschäft beim Kartenkauf.
Dies kann man auch bei den Versandkosten feststellen. Ohne daß irgendwelche besonderen Serviceleistungen wie zum Beispiel der Versand per Einschreiben angeboten würde, verlangen die beiden größten Ticketingkonzerne absurd hohe Gebühren beim Ticketversand: 4,90 Euro sind es beim deutschen Marktführer CTS Eventim, neuerdings sogar 5,90 Euro bei der deutschen Dependance des Weltmarktführers Ticketmaster. Zur Erinnerung: Das Porto für einen Standardbrief, mit dem die Tickets versandt werden, beträgt hierzulande (Stand Frühjahr 2019) 70 Cent. Ein Briefumschlag ist für weniger als 2 Cent zu haben, und selbst wenn man die Kosten für Versandstraßen und Personal einkalkuliert, dürften die Gewinne bei den Versandgebühren bei deutlich über 3 Euro pro Sendung liegen. Laut Angaben eines CTS Eventim-Sprechers werden »weniger als zehn Prozent« (Handelsblatt) beziehungsweise »etwa fünf Prozent« (Spiegel Online) der in Deutschland über die Verkaufsplattform Eventim.de verarbeiteten Kundenaufträge mittels »Print at Home« verarbeitet – was im Klartext bedeutet, daß der weitaus größte Teil der hierzulande von den Ticketingkonzernen verkauften Eintrittskarten weiterhin per Post mit noch höheren Versandgebühren und entsprechend noch höheren Gewinnen verschickt wird. Und warum machen CTS Eventim und Ticketmaster das? Ganz einfach: weil sie’s können. Weil niemand diesem modernen Raubrittertum zu Lasten der zig Millionen Konzertfans Einhalt gebietet.
Wie dreist diese Konzerne mittlerweile vorgehen, zeigte sich Ende 2014, als die Karten für die Tournee von AC/DC exklusiv über CTS Eventim in den Vorverkauf gelangten. Diese Tournee wurde nicht von einer der Firmen der CTS Eventim AG, sondern von United Promoters veranstaltet. Die Marktmacht des Quasi-Monopolisten im Ticketbereich zeigt sich daran, daß selbst bei einer derartigen Mainstream-Tournee offensichtlich kein Weg an CTS Eventim vorbeiführt. Die AC/DC-Karten wurden vom Konzertveranstalter zum Fixpreis von 80 Euro auf den Markt gebracht – »zuzüglich Gebühren«. Und bei diesen Gebühren langten die Raubritter von CTS Eventim gewaltig zu:
AC/DC Tournee 2015
Ticket-Fixpreis
80 Euro
Vorverkaufsgebühr
21,55 Euro (üblich: 10 Prozent, hier: mehr als 25 Prozent)
Premiumversand
24
19,90 Euro (Versand erfolgte mit Standardporto 0,60 €)
Zahlungsgebühr
8,72 Euro (für Bezahlung per Kreditkarte oder Lastschrift)
Gesamtpreis pro Ticket
25
130,17 Euro (bei einem Fixpreis von 80 Euro), entspricht einem Aufschlag von 62,71 Prozent
Schon in den ersten 63 Minuten des Vorverkaufs griffen 325 000 Fans zu und kauften Tickets für die AC/DC-Konzerte. Der Konzertveranstalter, noch mehr aber die Ticketbosse von CTS Eventim durften sich die Hände reiben.
Immerhin, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat CTS Eventim wegen der »Abzock-Entgelte« bei den Bezahlgebühren abgemahnt, weil CTS nur gebührenpflichtige Zahlmethoden angeboten hatte, was unzulässig ist, es muß immer auch eine kostenneutrale Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Die überhöhte Vorverkaufsgebühr von knapp 27 Prozent und der sogenannte Premiumversand allerdings bleiben zulässig, jedenfalls juristisch, wenn auch ganz sicher nicht moralisch. Aber um Moral oder nur Legitimität kümmert sich CTS Eventim naturgemäß nicht, wenn es um die Profitmaximierung geht: »Wir bedauern die Vorwürfe der Verbraucherzentrale, da die Gebühren aus unserer Sicht im Rahmen des öffentlichen Vorverkaufs marktüblich und rechtskonform sind.«26
Diese Abzockerei ist nicht nur ärgerlich, sondern sie trägt auch zu einem schlechten Image der Konzertbranche in der Öffentlichkeit bei und richtet zudem einen nicht zu unterschätzenden kulturellen Schaden an. Den Fans wurden in den genannten Fällen zwischen 21 und mehr als 40 Euro zu viel abgeknöpft. Das entspricht einem oder zwei Tickets für ein gutes Club-Konzert, für das die Fans dann kein Geld mehr übrig haben. CTS Eventim schadet hier also auch den kleineren Bands und den vielen engagierten Clubs, die auf den Besuch von Fans dringend angewiesen sind.
Die Praxis der überhöhten Zusatzgebühren läßt sich nicht nur bei Rockkonzerten beobachten. Am 11. Mai 2019 gastierte Igor Levit, einer der angesagtesten und interessantesten Pianisten unserer Tage, im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Das Konzert wurde von einem freien Veranstalter, First Classics, organisiert. Auf der Webseite des Konzertveranstalters wurden Eintrittskarten in fünf Kategorien angeboten, von 35 Euro bis 55 Euro. Dazu erhebt der Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro. Bei CTS Eventim kosteten die Tickets der besten Kategorie statt 55 Euro jedoch 64,95 Euro, bei Ticketmaster immerhin noch 62,95 Euro. Für die günstigsten Tickets von 35 Euro zahlte man bei CTS 42,55 Euro und bei Ticketmaster 40,55 Euro, alles zuzüglich der überhöhten Versandgebühren von 4,90 Euro (CTS) beziehungsweise 5,90 Euro (TM). Für »Ticketdirect«, das CTS-eigene »Print at Home«-Angebot, verlangt der Monopolist derzeit keine Zusatzgebühr, wohl aber für das »Mobile Ticket« – 2,50 Euro. Man denkt sich eben immer neue Wege aus, um an das Geld der Kunden zu kommen. Der Kauf von zwei Eintrittskarten der besten Kategorie kostete beim Konzertveranstalter 115 Euro, bei CTS Eventim 134,80 Euro (17,22 Prozent mehr) und bei Ticketmaster 131,80 Euro (jeweils inklusive aller Gebühren). Natürlich stellt sich die Frage, warum die Leute ihre Konzertkarten nicht direkt bei den Konzertveranstaltern, sondern bei den Ticket-Gangstern kaufen? Die Antwort ist einfach. Wer im Frühjahr 2019 bei Google »Igor Levit Berlin« eingab, erhielt als Top-Suchergebnis eine bezahlte Anzeige von eventim.de. Mit den relativ geringen Kosten einer bezahlten Anzeige auf Google wurde potenziellen Kund*innen die Ticketing-Plattform des deutschen Monopolisten für den Kartenkauf angeboten, um den Eindruck zu erwecken, dies sei die einzige Möglichkeit, an die Karten zu kommen. Auf der ersten Seite der Google-Suche fand sich keine andere Kaufmöglichkeit für die Tickets. Weiter unten erschien dann übrigens nochmal der Verweis auf eventim.de, diesmal mit dem schönen Zusatz: »Igor Levit Tickets – Karten jetzt zu Top-Preisen bestellen«. »Top-Preis« offensichtlich im Sinne von »Höchstpreis«.
Aber man glaube nicht, daß es nur die Ticketgiganten sind, die abzocken. Auch unabhängige Vorverkaufsstellen langen gerne mal zu. Bei Tickets für die Bands A Perfect Circle und Chain & The Gang wurden 2018 in Berlin in vier verschiedenen Vorverkaufsstellen Zusatzgebühren von 1 Euro bis 4,40 Euro erhoben. Wohlgemerkt zusätzlich zu den zehn Prozent des Ticketpreises, den die Vorverkaufsstellen bereits als Vorverkaufsgebühr erhielten!
Ein weiteres Geschäftsfeld stellt der sogenannte »Zweitmarkt« dar. Gemeint ist der mittlerweile größtenteils kommerzielle Weiterverkauf von Konzertkarten zu teilweise drastisch erhöhten Preisen. Früher nannte man das einfach »Schwarzmarkt«, wenn fragwürdige Gestalten vor den Konzertsälen oder Stadien Karten für ausverkaufte Veranstaltungen anboten und mit der Differenz zum aufgedruckten Eintrittspreis ihr mehr oder minder kleines Geschäft machten. Aber der eigentliche Schwarzmarkt findet heute im Internet statt. Er ist dort geradezu explodiert und wird von großen Firmen dominiert, die sich auf den Weiterverkauf von Tickets mit einer nennenswerten Gewinnmarge spezialisiert haben. Diese Zweitmarkthändler kaufen beträchtliche Kartenkontingente für Konzerte, Fußballspiele und andere Events auf und bieten sie im großen Stil auf eBay oder einschlägigen Zweitmarktplattformen wie Stubhub, Ticketbande oder Viagogo an. Preisaufschläge von 250 Prozent und mehr sind dabei keine Ausnahme. Je attraktiver das Angebot, desto höher der Aufschlag. Es ist Kapitalismus pur. Nicht der Künstler legt den Wert seiner geistigen, schöpferischen Arbeit fest, sondern eine Plattform, auf der Kunst als handelbare Ware feilgeboten und mit ihr Mehrwert (Profit) gemacht wird. Menschen, die der Ideologie vom sogenannten freien Markt und einer nachfrageorientierten Wirtschaft nachhängen, dürften am Ticketing-Zweitmarkt ihre helle Freude haben.
Nun haben Musiker und Konzertveranstalter das alte Marxsche Gebrauchswert-Modell teilweise überwunden, indem die Musiker über die reine Bezahlung ihrer »Dienstleistung« hinaus auch an den Gewinnen einer Konzertveranstaltung beteiligt werden. In Club-Konzerten ist eine Gewinnbeteiligung von 70 Prozent nach Break Even, also zuzüglich zur etwaigen Festgage, gang und gäbe, bei Hallenkonzerten sind 80 bis 85 Prozent mittlerweile Standard, bei Stadionkonzerten geht sie bis zu 100 Prozent, und wie oben bereits ausgeführt wurde, bietet Live Nation den Musikern teilweise sogar mehr als 100 Prozent der Einnahmen, um die Musiker zur Zusammenarbeit mit dem Konzern zu gewinnen (um dann mit den Ticketing- und Sponsoring-Einnahmen Profit zu machen).
Der Eintrittskarten-Zweitmarkt allerdings torpediert die Möglichkeiten der Musiker*innen, tatsächlich mit ihrer Arbeit oder mit ihrer »Dienstleistung« (wie Marx sagen würde) an den Gewinnen an ihrer Darbietung beteiligt zu werden, denn die gesamten Gewinne aus dem über den ursprünglichen Eintrittspreis hinausgehenden Verkaufspreis eines Zweitmarkt-Tickets streichen ja die Wiederverkäufer sowie die Plattformen ein. Weder die Künstler noch die Veranstalter, also diejenigen, die die Konzert-Arbeit leisten und die gewissermaßen die gemeinsamen »Unternehmer« sind, erhalten einen Anteil an diesem zusätzlichen Gewinn. Vielmehr werden sie um diesen Teil möglicher Einnahmen betrogen.
Natürlich ist der Ticket-Zweitmarkt unfair gegenüber den Konzertbesucher*innen, auch wenn die Fans dort natürlich »freiwillig« die überhöhten Preise für die Eintrittskarten bezahlen. Sie wollen eben unbedingt an dem Event teilnehmen, koste es, was es wolle. Das Hauptmotiv der Ticketkonzerne, sich dem Kampf gegen den Ticket-Zweitmarkt zu verschreiben, dürfte letztlich darin begründet sein, daß derartige Plattformen den Ticket-Großkonzernen massive Probleme bereiten. Die Trennung von Primary und Secondary Ticketing ist ja lediglich eine interne Sicht der Konzertindustrie. Die Fans machen diesen Unterschied nicht, sie kaufen die überteuerten Tickets, wenn sie unbedingt auf ein bestimmtes Konzert gehen wollen, bei Viagogo oder bei Stubhub, und so wurde Stubhub zu einem der größten Tickethändler in den USA, der dem dortigen Marktführer Ticketmaster bedrohlich nahegekommen ist. Dies dürfte der Grund sein, warum die größten Tickethändler Ticketmaster und CTS Eventim eigene Zweitmarkt-Plattformen auf den Markt gebracht haben.
Großveranstalter (auch solche, die zu Konzernen wie CTS Eventim gehören) haben sich mittlerweile zu einer Initiative namens »Face-Value Alliance for Ticketing« (FEAT), also einer »Allianz für den Nennwert beim Ticketing«, zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Lobbyarbeit für gesetzgeberische Initiativen, um Fans und Künstler vor Ticketspekulanten und -betrügern zu schützen. In Großbritannien gibt es eine entsprechende Initiative namens »FanFair Alliance«, und in Frankreich, das in dieser Hinsicht führend in Europa ist, gibt es sogar ein Gesetz gegen Zweitmarkt-Plattformen wie Viagogo. Entsprechende Gesetze auf europäischer Ebene wären wünschenswert, wenn sie sich aber lediglich auf den Zweitmarkt beschränken, statt auch die von den Großkonzernen wie CTS Eventim und Ticketmaster eingeführten, Fan-feindlichen Zusatzgebühren zu berücksichtigen, greift diese Initiative zu kurz. Sie beschränkt sich auf eine oberflächlichen Anbiederung an Fans und Künstler, während die Ticketkonzerne weiter ihr legales Unwesen treiben.
Zu den Maßnahmen der Ticketingkonzerne gegen die Konkurrenten vom Zweitmarkt gehören auch die »Verified Fan«-Vorverkäufe oder die sogenannten »Platin-Tickets«, mit denen ein begrenztes Kontingent von Karten zu nachfrageorientierten Preisen erst dann angeboten wird, wenn die Konzerte »ausverkauft« sind. Das Ziel ist, die letzte Eintrittskarte möglichst erst am Konzerttag zu verkaufen, um den gewerblichen Weiterkauf von Tickets mit drastischen Aufschlägen einzudämmen und, natürlich, den gesamten Erlös bei den Künstler*innen und ihren Partnern, den Konzernen, zu belassen. Derartige Platin-Tickets sind keineswegs VIP-Tickets, auch wenn die Fans das oft annehmen. Es handelt sich lediglich um die angeblich besten Plätze zum Zeitpunkt des Kartenkaufs.
Die einfachste und vernünftigste Art und Weise, dem Ticket-Zweitmarkt den Hahn zuzudrehen, wäre ein Modell, das längst zur Verfügung steht, aber hierzulande viel zu selten genutzt wird: das papierlose Ticket. Dieses befindet sich auf dem Smartphone und wird beim Einlaß zum Konzert gescannt, wie wir es zum Beispiel bei Flügen kennen. Die ID des Käufers kann durch anonymisierte Tokens festgestellt werden, wie sie beispielsweise Apple Pay verwendet. Vorteil: Diese digitale Einlaßberechtigung (und nichts anderes ist ja ein Ticket) kann nicht zu überhöhten Preisen weiterverkauft werden, denn sie kann gar nicht weiterverkauft werden, sie ist ja an die ID der Nutzer*innen gekoppelt. Und wenn Käufer*innen aus irgendwelchen Gründen ihre Einlaßberechtigung (ihr papierloses Ticket) nicht nutzen können, weil sie zum Beispiel verhindert sind, müssen die Ticketinganbieter gegen eine geringe Gebühr eine Plattform anbieten, auf denen das papierlose Ticket an Interessent*innen zumOriginalpreis weiterverkauft werden kann – die ebenfalls mit einer Käufer*innen-ID belegen, daß sie keine kommerziellen Weiterverkäufer*innen sind.
Go paperless, und ihr seid das lästige Secondary-Ticketing-Problem los!
Der amerikanische Philosoph Michael Sandel hat in seinem Buch »Was man für Geld nicht kaufen kann« von einer »Ethik des Schlangestehens« gesprochen: Wer als erster kommt, wird als erster bedient. Wer später kommt, muß sich anstellen und kommt später dran. Es geht, wie man so sagt, »immer der Reihe nach«, und es gehört sich nicht, sich vorzudrängeln. Man könnte sagen, die Schlange macht uns gleich. Oder sie erinnert uns daran, daß wir in einer Demokratie zumindest theoretisch alle gleich sind, daß zu den Idealen der Aufklärung neben »Freiheit« und »Brüderlichkeit« eben auch die »Gleichheit« zählt. Wenn nun aber jemand, der Karten für ein ausverkauftes Konzert erwerben möchte und bereit ist, nicht den ursprünglichen, von Künstlern und Veranstaltern festgelegten, sondern einen beträchtlich überhöhten Eintrittspreis zu zahlen, dann wird die Gleichheit außer Kraft gesetzt. Diejenigen, die sich mit ihrem Geld das Privileg erkaufen wollen und können, die Schlange zu ignorieren und statt derjenigen, die den normalen Eintrittspreis bezahlen, in die Veranstaltung gelangen, sind im Grunde Egoisten, die ihre Ellbogen ausfahren und die sich rücksichtslos und zum Nachteil der anderen vordrängeln. Wollen wir wirklich in einer Welt der Vordrängler leben? In einer Welt, in der sich die mit dem meisten Geld durchsetzen? In der die Gleichheit aller Menschen nur auf dem Papier existiert?
Es gibt ja immer noch Musiker*innen wie auch Veranstalter*innen, denen es nicht egal ist, wie hoch die Eintrittspreise sind. Das Recht auf Preisgestaltung und letztlich auf Gleichbehandlung der Konzertbesucher*innen wird jedoch durch neue Ticketing-Modelle aufgeweicht, die der neoliberalen Wirtschaftsweise und den Möglichkeiten der Digitalisierung abgeschaut worden sind. Zu diesen Modellen gehört das »Dynamic Pricing«, wie wir es zum Beispiel von Fluglinien oder aus der Hotellerie kennen. In der Konzertbranche bedeutet Dynamic Pricing vor allem: Je höher die Nachfrage nach Tickets, desto teurer werden sie. Und je größer die Nachfrage nach einem bestimmten Ticket (z. B. dem vermeintlichen »Best Seat«), desto teurer wird dieser beste Platz. Umgekehrt gilt: Wenn für ein Konzert im Vorverkauf nur wenige Karten abgesetzt werden, könnten die Eintrittspreise billiger werden, um den Verkauf anzukurbeln. Ticketverkauf zu wechselnden Preisen je nach Nachfrage.
Live Nation / Ticketmaster haben allein durch die Praxis des Dynamic Pricing für das Geschäftsjahr 2018 Zuwächse in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erwartet. Mit Dynamic Pricing kann man also noch mehr Profit aus den Konzerten herausholen. Dynamic Pricing nutzt dabei die Datensammelwut sowohl der Handelsriesen als auch der Internetplattformen. Letzteren ist zum Beispiel bekannt, mit welcher Hardware ihre Kunden die Seiten ansteuern. Nach einer Recherche des SWR-Magazins Marktcheck bezahlen Apple-Nutzer teilweise höhere Preise für einzelne Produkte, weil sie von den Konzernen als zahlungsstärker eingestuft werden. Auch Amazon hat eingestanden, daß Kunden für Amazon-Produkte zum Teil unterschiedliche Preise zahlen.*
* »Wenn wir das Gefühl haben, es entwickelt sich für den Kunden ein neuer Marktpreis, und das kann bei manchen Produkten mehrmals am Tag sein, reagieren wir darauf.« Ralf Kleber, Deutschland-Chef von Amazon, in: »Amazon-Chef: Wir passen den Preis den Kunden an«, Süddeutsche Zeitung, 1. 11. 2015.
Und die Informatikerin Constanze Kurz hat beschrieben, wie sogenannte »Tracker«, die in Apps auf dem verbreiteten Android-Betriebssystem enthalten sind, ohne daß die Nutzer*innen davon Kenntnis haben, pausenlos »Daten aus den Mobiltelefonen an Unternehmen senden, die Nutzerprofile anlegen und sie meistens Werbekunden anbieten«. Laut einer Studie von Forschern der Universität Oxford haben 90 Prozent aller Apps, die im »Google Play Store« angeboten werden, Tracker eingebaut, und fast alle gehören US-amerikanischen Unternehmen, die diese Nutzerdaten erhalten. Etwa zehn Prozent der Apps senden ihre Trackerdaten nicht nur an US-Firmen, sondern »zusätzlich in andere Länder, in denen Profilfirmen sitzen«. Im Klartext bedeutet das: »Fremde Dritte sitzen massenhaft und unbemerkt in unseren Mobiltelefonen und vermerken unser Verhalten oder unsere politische Gesinnung, um uns später maßgeschneiderte Werbung schicken zu können.«27
Es wäre technisch für CTS Eventim oder Ticketmaster, die über Kundendaten im gigantischen Ausmaß verfügen, ein leichtes, Kunden, die sich über ein Apple-Notebook, ein iPhone oder ein iPad auf ihren Websites einloggen, höhere Ticketpreise abzuverlangen als jenen, die mit einem Aldi-Laptop ihr Portal besuchen. Und man darf getrost davon ausgehen, daß zu den »fremden Dritten«, die in unseren sogenannten Smartphones sitzen, längst auch die Ticketing-Konzerne gehören. Der zusätzliche Vorteil für die Ticketing-Konzerne bei Dynamic-Pricing-Modellen: Die Musiker bekommen von den erhöhten Eintrittspreisen in der Regel nichts mit, die Konzerne müssen diese Zusatzprofite also nicht mit den Musiker*innen teilen (es sei denn, die haben smarte, mit allen Wassern der Digitalwirtschaft gewaschene Manager*innen). Kein Wunder, daß Michael Rapino, CEO von Live Nation, also Chef des weltgrößten Konzertveranstalters und des weltgrößten Ticketinghändlers, ausgesprochener Freund von »Best Sale«-Modellen und ganz allgemein von höheren Eintrittspreisen ist. Rapino tritt dafür ein, Künstler davon zu überzeugen, »bei der Preisgestaltung mehr zu wagen«. Ohnehin seien »Ticketpreise im Durchschnitt noch zu niedrig«. Man müsse lediglich »den Umsatz im eigenen Haus behalten, indem man den Kuchen in viele unterschiedlich große Stücke« schneide. »Besseres, offensiveres Pricing« sei zwar ein kontroverses Thema, doch die Konzertindustrie müsse »Feuer mit Feuer bekämpfen«.28
Hier zeigt sich der Paradigmenwechsel im Konzertgeschäft: Früher war ein Veranstalter glücklich und zufrieden, wenn er eine Halle oder gar ein Stadion zügig ausverkauft hatte, und für die Promoter der alten Schule dürfte das auch heute noch gelten: Man hat ein großes Publikum für die Musiker*innen und Bands gefunden, die man veranstaltet – was will man mehr? Aber die neuen Herren der internationalen Konzertimperien sehen das anders, sie sind bei einem rasch ausverkauften Konzert der Ansicht, daß der Ticketpreis offensichtlich zu günstig war. Sie ziehen den – rein wirtschaftlich gesehen logischen – Schluß, daß man höhere Ticketpreise hätte verlangen und den Profit noch hätte weiter steigern können. Man muß Michael Rapino geradezu dankbar sein für die Offenheit, mit der er sein Geschäftsmodell vertritt.
Klaus-Peter Schulenberg von CTS Eventim dürfte vieles ähnlich sehen und praktizieren, würde sich aber niemals öffentlich so äußern, wie es der Texaner Michael Rapino mit seiner selbstbewußten Cowboy-Attitüde immer wieder tut. Sowohl Ticketmaster als auch CTS Eventim haben mit Seatwave, Get Me In und fanSALE eigene Zweitmarkt-Plattformen für Eintrittskarten an den Start gebracht. »Wenn ein Besucher bereit ist, für ein Ticket 4000 Dollar zu zahlen, dann ist er nicht der Böse, sondern ein engagierter Fan«, ließ Rapino auf der ILMC verlauten. Es komme eben lediglich darauf an, daß man »den Umsatz im eigenen Haus behält«. Klar: Wenn die Tickets auf der konzerneigenen Zweitmarkt-Plattform ein zweites Mal verkauft werden, streichen die Ticketing-Konzerne ein zweites Mal ihre Prozente ein, laut Brancheninsidern im Falle des Zweitverkaufs nochmal 15 bis 20 Prozent. Sie machen doppelten Profit. Sie perfektionieren ihr Imperiengeschäft.
Und zusätzlich können die Ticketanbieter theoretisch selbst Tickets von ihrer Erstverkaufs- in die eigene Zweitmarkts-Plattform verschieben, ohne daß es irgendjemand merkt. Ob sie es wirklich tun, wie immer wieder behauptet wird, läßt sich nicht beweisen, die Tickethändler sind den Konzertveranstaltern ja nur über die auf ihrer ursprünglichen Plattform verkauften Tickets Rechenschaft schuldig. Aber der Toronto Star veröffentlichte im Herbst 2018 ein Video-Interview, indem ein Verantwortlicher bei Ticketmaster zugab, daß seine Firma eine Software namens »TradeDesk« anbietet, die Wiederverkäufern das schnelle Up- und Downloaden von Tickets auf und von Ticketmasters eigener Wiederverkaufsplattform erlaubt, ohne daß Ticketmaster einen besonderen Einblick in diese Aktionen habe oder sie kontrollieren würde. Demzufolge unternahm Ticketmaster nichts dagegen, daß praktisch alle Tickethändler mehr als 200 Ticketmaster-Konten führten und diese täglich synchronisierten. »Ich kenne keinen einzigen meiner Klienten, der keine Multiples verwendet«, läßt sich der Ticketmaster-Mitarbeiter vernehmen. »Klar, man muß das so machen, wenn der Kauf von Tickets auf sechs oder acht begrenzt ist – vom Weiterverkauf von acht Tickets kann man schließlich nicht leben.«29
Natürlich haben die Ticketingkonzerne kein Interesse daran, daß Fans auf der Ursprungsplattform feststellen, daß es für ein Konzert keine Tickets mehr gibt, woraufhin sie dann direkt zu unkontrollierten Zweitmarkts-Anbietern wie Viagogo oder Stubhub wechseln. Ein Interesse haben sie vielmehr an der direkten Verschränkung ihrer eigenen Primary und Secondary Platformen. Offizielle Statements der Ticketkonzerne, daß sie den Zweitmarkt bekämpfen würden, dürfen also getrost als Lippenbekenntnisse gewertet werden.