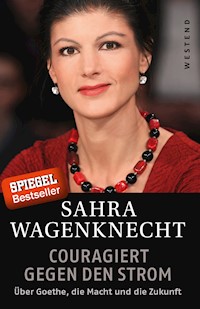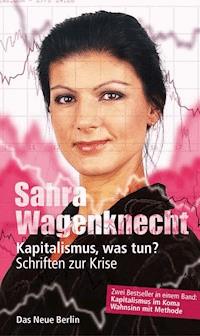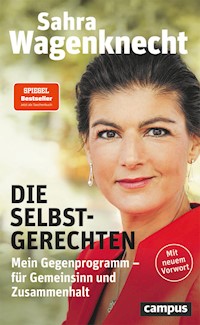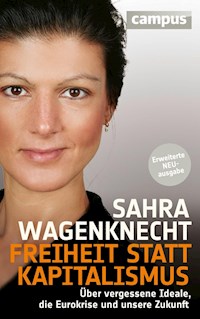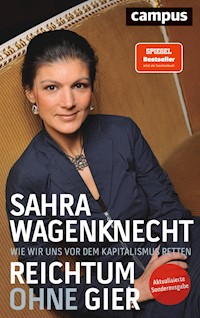Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aurora Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedrich Engels hat, um den revolutionär neuen Theorieansatz von Marx zu charakterisieren, 1888 das halbwahre Wort geprägt, dieser habe "Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt". Fast möchte man meinen, diese Behauptung sei philosophisch nie ernsthaft befragt worden. Sahra Wagenknecht hat sich in einer grundlegenden Studie zur Hegelrezeption beim jungen Marx nun damit auseinandergesetzt und kommt zu ebenso überraschenden wie weitreichenden Ergebnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-359-51000-0
ISBN Print 978-3-359-02532-0
Erstausgabe 1997, Pahl Rugenstein
1. Auflage dieser Ausgabe
© 2013 Aurora Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: toepferschumann.de
Eulenspiegel · Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Aurora Verlags erscheinen
in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.aurora-verlag-berlin.de
Sahra Wagenknecht
Vom Kopf auf die Füße?
Zur Hegelkritik des jungen Marx
oder
Das Problem einer dialektisch-materialistischen Wissenschaftsmethode
Aurora Verlag
Inhalt
I. Vorwort
II. Die Rezeption des Hegelschen Dialektik- und Spekulations-Konzepts in den »Ökonomisch-philosophischen Manuskripten« Die Hegel-Rezeption in den »Ök.-phil. Manuskripten«
Die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der Hegelschen Dialektik
Die Figur der Negation der Negation als abstrakt-logischer Ausdruck realgeschichtlicher Prozesse
Die Reduktion des menschlichen Wesen auf abstraktes Selbstbewusstsein
Die Reduktion der gegenständlichen Realitäten auf logische Kategorien
Geschichte als Denkprozess – Verkehrung von Subjekt und Objekt
Der unkritische Positivismus der Enfremdungskonzeption der »Phänomenologie«
Der unkritische Positivismus der spekulativen Methode im Allgemeinen
Der Marxsche Gegenentwurf
III. Die Grundkategorien der Hegelschen Philosophie – Eine Analyse ihrer originären Bestimmung
1. Die Spezifik der »Phänomenologie des Geistes«
2. Die Kategorie des »Selbstbewusstseins« im Hegelschen System
3. Das »Geheimnis« der spekulativen Methode
Die Dialektik von Bewusstsein und Gegenstand und die Begründung der spekulativen Methode in der »Phänomenologie des Geistes«
Die Dialektik von setzender, äußerlicher und bestimmender Reflexion und der Rückgang in den Grund
Der Begriff als »gegenständliches Wesen« – Hegels Ontologie als Grundlage seines Methodenkonzepts
Negation und Negation der Negation – Die absolute Methode
Widersprüche in Hegels Methodenkonzept
IV. Die »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« als Werk des Übergangs Die »Ök.-phil. Manuskripte« als Werk des Übergangs
1. Die theoretischen Positionen des jungen Marx
2. Exkurs über Feuerbach
3. Marx’ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophievon 1843
4. Der Standpunkt der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte«: Die »Entfremdungs«-Theorie als universalhistorische Konstruktion
Studien im Vorfeld der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte«
Die ökonomische Entfremdung als Kern aller gesellschaftlichen Entfremdungsverhältnisse
Arbeitsbegriff und Methode der klassischen Nationalökonomie
Marx’ Einbau des nationalökonomischen Arbeitsbegriffs in die anthropologische Konzeption
Die Position als Negation der Negation – Rückgriff auf Hegel
Marx’ Konzept der »entfremdeten Arbeit«
Die »entfremdete Arbeit« als Grundlage der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise
Der Grundfehler des Entfremdungskonzepts: Die Reduktion gesellschaftlicher Verhältnisse auf intersubjektive Beziehungen anstelle ihrer Bestimmung als objektiv-gegenständlicher Vermittlungsprozesse
Der Versuch einer rein logischen Deduktion realgeschichtlicher Prozesse – der methodische Rückfall der »Manuskripte« hinter das Hegelsche Spekulationskonzept
V. Die Rezeption des Hegelschen Dialektik- und Spekulations-Konzepts in den »Ökonomisch-philosophischen Manuskripten« – Analyse und Wertung Die Hegel-Rezeption des jungen Marx – Analyse und Wertung
VI. Nachbemerkung. Methodologische Reflexionen des reifen Marx
I.Vorwort
Explizite Äußerungen zu philosophischen Problemen sind rar in Marxens Spätwerk. Wohl dieser Umstand hat dazu geführt, dass die dialektisch-materialistische Philosophie, sofern sie ihre Positionen durch Marx-Zitate zu untersetzen oder zu illustrieren suchte, diese zumeist den Schriften des jüngeren Marx entnommen hat. Im besonderen war diese Orientierung an den Marxschen Jugendschriften prägend für die Haltung des Marxismus zu seinem großen Vorläufer, der Hegelschen Philosophie.
Nun finden wir eine ausdrückliche und eingehende Auseinandersetzung Marx’ mit den Hegelschen Vorgaben, speziell mit dem Hegelschen Dialektik- und Spekulationskonzept, tatsächlich nur in zwei früh entstandenen Arbeiten: in der »Kritik des Hegelschen Staatsrechts« von 1843 und in den »Ökonomisch-philosophischen Manuskripten« von 1844. Aber auch der Mangel späterer Bezüge darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Schriften selbstverständlich nicht die Marxsche Position zur Hegelschen Philosophie, sondern lediglich die Position des jungen Marx, konkret des Marx der Jahre 1843 und 1844, dokumentieren. Und obgleich zumindest der östliche Marxismus stets davon ausging, dass die Marxsche Theorie in jenen Jahren noch keineswegs auf eigenen Füßen stand, man sich daher zu hüten hat, das Marxsche Spätwerk aus der Perspektive dieser Frühschriften zu interpretieren, galt die in ihnen formulierte Kritik der Hegelschen Dialektik und Spekulation doch unangefochten als Musterbeispiel marxistischer Hegelrezeption und wurde in diesem Sinne immer wieder herbeizitiert. Diese Unangefochtenheit in Frage zu stellen ist ein wesentliches Anliegen dieser Arbeit. Eine genauere Analyse wird zeigen, dass die in den genannten Werken formulierte Hegelkritik erstens gar nicht so materialistisch ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint, und dass es sich zweitens bei ihr um ein ebenso vorübergehendes Stadium der Marxschen Hegelrezeption handelt, wie bei der ursprünglich weitgehenden Identifizierung mit der Hegelschen Begrifflichkeit, die etwa die Marxsche Dissertationsschrift prägt.
Für diese Annahme spricht schon, dass beide Arbeiten – die »Kritik des Hegelschen Staatsrechts« und die »Manuskripte« – Fragment geblieben sind und von Marx nie veröffentlicht wurden. Er empfand die in ihnen entwickelten Positionen offenbar selbst als unbefriedigend. Ohnehin finden wir in beiden Schriften weit weniger eine abgeschlossene Haltung zur Hegelschen Philosophie, als vielmehr ein Ringen mit Hegels Dialektik- und Spekulations-Konzept, eine Auseinandersetzung, die sich noch ganz im Prozess befindet und deren Resultate wesentlich erst erarbeitet werden sollen. Zweitens muss bei einer Analyse dieser Schriften beachtet werden, dass Marx der Hegelschen Philosophie natürlich nicht unvermittelt gegenübertrat. Er rezipiert sie zwar durchaus eigenständig, aber doch nie losgelöst vom Kontext ihrer junghegelianischen Interpretation: zunächst in Anlehnung an diese, dann in ausdrücklicher Abgrenzung von ihr. Es wird sich zeigen, dass manche Marxsche Polemik, als deren unmittelbarer Adressat zunächst Hegel erscheint, genau besehen überhaupt nicht diesen, sondern ausschließlich seine junghegelianischen Schüler trifft. In der marxistischen Rezeptionsgeschichte nun wurden aus diesen im Fluss befindlichen Gedanken und zeitbedingten Polemiken feste und endgültige Stellungnahmen. So entstand ein Bild der Marxschen Hegelrezeption, das weder Marx noch Hegel gerecht wurde und vor allem dem Nachdenken über materialistische Dialektik und dialektische Wissenschaftsmethode äußerst abträglich war.
Wir leugnen nicht, dass gerade letzteres unser eigentliches Anliegen ist. »Die Herausarbeitung der Methode, die Marx’ Kritik der politischen Ökonomie zugrunde liegt« – schrieb Engels seinerzeit –, »halten wir für ein Resultat, das an Bedeutung kaum der materialistischen Grundanschauung nachsteht.«1 Entscheidend ist, dass beide Seiten überhaupt nicht getrennt werden können. Mit der dialektisch-materialistischen Methode steht und fällt die dialektisch-materialistische Philosophie. Und was für die Philosophie im besonderen gilt, gilt für die Wissenschaft im allgemeinen. Sollen im wissenschaftlichen Denken wirkliche Zusammenhänge und Beziehungen reproduziert werden, müssen die wissenschaftsimmanenten Regeln und logischen Strukturen den zu erfassenden ontischen Strukturen in irgendeiner – möglicherweise stark abstrahierenden – Weise angemessen sein. So gibt es beispielsweise in der Realität keine mathematischen Strukturen als solche. Jede quantitative Bestimmung ist in ihrer Existenz an konkrete Qualitäten gebunden; das rein quantitative Eins bzw. die reine Raumgröße sind daher unter allen Umständen eine Abstraktion. Aber sie sind insofern vernünftige Abstraktionen, als die Realität ja tatsächlich dieses quantitative Moment – wenn auch nie isoliert für sich – aufweist. Die Isolierung dieses Moments im Denken schafft ein homogenes Medium, in dem so dann auf Grundlage immanenter Regeln mit strenger Notwendigkeit operiert und abgeleitet werden kann. Der Abstraktionsschritt, der der Konstituierung dieses Mediums zugrunde liegt, impliziert also ebenso den Realgehalt der innerhalb dieses Mediums darstellbaren und erschließbaren Beziehungen wie dessen Grenzen. Eine von den qualitativen Bestimmungen des Seins ab-strahierende Analyse vermag ganz sicher reale – eben quantitative – Zusammenhänge zu reproduzieren, wohl kaum jedoch wesentliche Zusammenhänge, denn letztere sind in allen Seinsbereichen an konkrete Qualitäten gebunden. (Wobei die Relevanz der rein quantitativen Beziehungen in den verschiedenen Seinsbereichen unterschiedlich ist; die Strukturen im anorganischen Sein sind offenbar in erheblich höherem Grade quantifizierbar, und die vermittels mathematischer Methoden gewonnenen Ergebnisse sagen daher Wesentlicheres über den jeweils untersuchten Gegenstand aus, als dies etwa im organischen oder gar gesellschaftlichen Sein der Fall ist.)
Marxistische Analyse indessen erhebt den Anspruch, wesentliche Realzusammenhänge aufzudecken, und zwar im besonderen wesentliche gesellschaftliche Zusammenhänge. Hinsichtlich der begrifflichen Erfassung grundlegender Strukturen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses hat zumindest Marx diesen Anspruch erfüllt. Es gibt kein Werk der bürgerlichen Ökonomie, das neben dem »Kapital« bestehen könnte; ohne Marxsche Kategorien bleibt der kapitalistische Funktionsmechanismus auch heute unverständlich und unverstehbar; (was nicht heißen soll, dass die Funktionsweise des heutigen Kapitalismus allein mit den im »Kapital« entwickelten Kategorien verstanden werden kann; das ist aber eine andere Frage, die uns hier nichts angeht). Vergleicht man nun die Marxsche Darstellung mit der der klassischen Natio-nalökonomen, die ja zum Teil bereits die gleichen Kategorien benutzten, wird deutlich, dass Marxens Leistung mit Marxens Methode in allerengstem Zusammenhang steht.
Marxistische Theorie ist insofern – recht verstanden – nicht ein Aggregat von Begriffen, unter die die Phänomene der Realität zu subsumieren wären. Sie ist vor allem eine spezifische Methode der Entwicklung von und des Umgangs mit Begriffen, durch die diese Begriffe die Fähigkeit erhalten, reale Zusammenhänge tiefer und ganzheitlicher zu erfassen, als die auf formaler Logik begründeten wissenschaftlichen Methoden es je vermögen. Insoweit sind marxistische Theorie und dialektische Methode untrennbar. Die Methode wird nicht im Umgang mit den marxistischen Kategorien angewandt; sie konstituiert sie.
Ein das Verständnis dieser spezifischen Methode enorm erschwerender Umstand liegt nun darin, dass Marx sie zwar im »Kapital« exzellent praktiziert, sich jedoch – von verstreuten Bemerkungen abgesehen – jeder ausdrücklichen theoretischen Reflexion über ihr Wesen und ihre konkrete Struktur enthalten hat. Unstrittig dürfte indessen sein, dass die Marxsche Methode ihren Ursprung einer – kritischen – Rezeption der Hegelschen Dialektik verdankt und in letzterer ihren unmittelbaren Vorläufer besitzt. Im Unterschied zu Marx enthält nun aber die Hegelsche Philosopie nicht nur die Praxis, sondern auch eine explizite Theorie der »absoluten Methode«. Ohne eine genaue Analyse der Hegelschen Bestimmungen muss daher auch die Marxsche Methode unverständlich bleiben. Lenin hatte also ganz recht, als er feststellte: »Man kann das ›Kapital‹ von Marx und besonders das I. Kapitel nicht vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von Hegel durchstudiert und begriffen zu haben. Folglich hat nach einem halben Jahrhundert nicht ein Marxist Marx begriffen.«2
Bedenklich ist allerdings, dass sich daran auch in den seither vergangenen knapp 80 Jahren (wenn wir von Lenins eigener Hegel-Rezeption absehen) nur sehr wenig geändert hat. Zwar wurde im offiziellen nachleninschen Marxismus ununterbrochen über Dialektik und dialektische Methode gesprochen und geschrieben. Aber die Charakterisierung der letzteren ging im allgemeinen kaum über die Bestimmung hinaus, »… die Dinge und Erscheinungen der materiellen Welt, aber auch die Begriffe als Abbilder der wirklichen Dinge, in ihrer Bewegung und Veränderung zu betrachten, die allseitige Analyse der Erscheinungen, die ihre mannigfaltigen gegenseitigen Zusammenhänge beachtet, die Erkenntnis des Einheitlichen in seinen gegensätzlichen Bestandteilen usw.«3 All das ist natürlich richtig, nur reicht es bei weitem nicht aus. Gerade die eigentlich interessanten und entscheidenden Fragen bleiben unbeantwortet: Welcher Rationalitätsform, welcher logischen Strukturen bedarf es denn, um die Realität in ihrer Bewegtheit und Entwicklung, in der je relativen Ganzheitlichkeit ihrer Teilbereiche, in ihren Widersprüchen und Gegensätzen gedanklich zu reproduzieren und ihre wesentlichen Zusammenhänge begrifflich zu erfassen? Wodurch unterscheidet sich diese Rationalitätsform von den auf formaler Logik beruhenden Methoden? Wie entstehen die geforderten Übergänge der Begriffe? Wie verhalten sich Apriorisches und Aposteriorisches, Analyse und Synthese im Rahmen dieser Methode? Inwieweit variieren die spezifischen Formen dieser Methode je nach dem analysierten Seinsbereich? Usw. usf. All diese Fragen sind grundlegend für ein adäquates Verständnis der marxistischen Theorie. Und sie sind viel zu wichtig, als dass man sich weiterhin mit oberflächlichen Bestimmungen begnügen könnte.
Denn letztlich geht es um weit mehr als darum, Marx zu verstehen. Es geht darum, zum Verständnis einer Methode durchzudringen, die erwiesenermaßen die Realität – und insbesondere die gesellschaftliche Realität – in ihrer Bewegung und Entwicklung besser und adäquater zu erfassen vermag als jede bisher entwickelte andere. Soll die marxistische Theorie je wieder wirkliche und breite Überzeugungskraft gewinnen, steht sie in der Pflicht, das, was sich seit Lenins Tod auf diesem Planeten zugetragen hat, wissenschaftlich zu analysieren und begrifflich zu fassen. Das betrifft sowohl die Gesamtgeschichte des ersten sozialistischen Weltsystems – seinen Aufstieg, Niedergang und letztlichen Zusammenbruch – als auch die Entwicklungen, Veränderungen und Anpassungen im Kapitalismus der zweiten Jahrhunderhälfte. Erst auf dieser Grundlage wird die gegenwärtige Situation in ihrer Spezifik begreifbar und können die notwendigen, dem Hier und Heute angemessenen Strategien entwickelt werden.
Diese immense Aufgabe lässt sich aber nur mit einer wissenschaftlichen Methode lösen, die ihrem Gegenstand gewachsen ist, keinesfalls mit methodischen Ansätzen, die hinter dem bereits erreichten Niveau der Wissenschaftsmethodologie (das durch Hegel und Marx bestimmt wird) zurückbleiben. In diesem Kontext erweisen sich eine materialistische Hegelinterpretation und ein materialistisch-dialektisches Methodenkonzept als zwei Seiten einer Medaille. Gerade deshalb ist ein richtiges Verständnis der Marxschen Haltung zur Hegelschen Philosophie kein bloß wissenschaftshistorisch interessantes Problem, sondern eines von unmittelbar aktueller und grundlegender Wichtigkeit. Zur Aufhellung dieser Problematik einen Beitrag zu leisten, ist der Zweck und das Ziel dieser Arbeit.
In dem uns gesetzten Rahmen kann es natürlich nicht darum gehen, die Hegelbezüge und methodischen Anknüpfungspunkte im Marxschen Gesamtwerk zu analysieren, um daraus ein adäquates Bild seiner Stellung zur Hegelschen Dialektik zu entwickeln. Selbst die Untersuchung der Veränderungen im Hegelverständnis der frühen Werke – von der »Dissertation« über die »Kritik des Hegelschen Staatsrechts« bis zu den »Manuskripten« – wird nur im kursorischen Überblick möglich sein. Wir beschränken uns im wesentlichen auf eine Analyse und Kritik der Hegelrezeption in den »Ökonomisch-philosophischen Manuskripten«. Dabei werden wir andere Marxsche Äußerungen und Stellungnahmen insoweit einbeziehen, als sie zum Verständnis des theoretischen Standpunkts der »Manuskripte« und ihrer Hegel-Interpretation wesentlich sind.
Es sei auch betont, dass der Gegenstand dieser Arbeit keineswegs die »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« in ihrer Gesamtheit sind. Auf die anderen Abschnitte dieses Werks, die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Nationalökonomie und die in diesem Kontext von Marx entwickelte Geschichtsphilosophie – die Entfremdungskonzeption – werden wir allerdings insoweit Bezug nehmen, als diese Marxschen Positionen die Grundlage seiner Spekulations- und Methodenkritik bilden, diese in Absehung von jenen also unverständlich bleibt. Eigentlicher Gegenstand unserer Analyse ist jedoch das in den Marx-Engels-Werken ca. 20 Seiten füllende, am Schluss der »Ökonomisch-philosophisehen Manuskripte« angeordnete Kapitel »Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt«.
Um die Hegel-Rezeption der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« überhaupt bewerten zu können, ist es zudem unerlässlich, die spekulative Konzeption in ihrer originären Hegelschen Gestalt anhand ausgewählter Kategorien zu untersuchen. Schließlich wird in einem gesonderten Kapitel auf Feuerbach Bezug genommen, unter dessen Einfluss – speziell unter dem Einfluss seiner Hegel-Kritik – Marx in der Entstehungsperiode der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« stand.
1 Marx / Engels Werke in 42 Bänden, Dietz-Verlag Berlin, Bd. 13, S. 474
2 Lenin Werke in 40 Bänden, Dietz-Verlag Berlin, Bd. 38, S. 170
3 Philosophisches Wörterbuch, VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Bd. I, S. 245
III.Die Grundkategorien der Hegelschen Philosophie – Eine Analyse ihrer originären Bestimmung
Um die im vorangegangenen Kapitel referierte Kritik der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« an der Hegelschen Dialektik und Spekulation bewerten zu können, ist eine Analyse der originären Hegelschen Bestimmung zumindest jener Kategorien, die im Zentrum dieser Kritik stehen, unerlässlich.
Das beginnt mit der Kategorie des Selbstbewusstseins. Wir haben gesehen, dass für Marx die Reduktion des Menschen auf abstraktes Selbstbewusstsein Ausgangspunkt und Grundlage der Abstraktion der spekulativen Methode im allgemeinen ist, damit zugleich Ausgangspunkt und Grundlage des impliziten Positivismus der Hegelschen Form der Dialektik überhaupt. Es ist also die Stellung der Kategorie des Selbstbewusstseins im Hegelschen System zu untersuchen und zu überprüfen, ob und in welchen Zusammenhängen Hegel das menschliche Wesen als abstraktes Selbstbewusstsein bestimmt. Zugleich ist in diesem Kontext der Frage nachzugehen, inwiefern im Hegelschen System realgeschichtliche Entwicklung tatsächlich auf die reine Bewegung von Gedanken reduziert wird. Damit ist die Frage nach dem Charakter der spekulativen Methode selbst aufgeworfen. Es wird demnach notwendig sein, ihre Spezifik sowie den ihr zugrunde liegenden und sie konstituierenden Abstraktionsschritt anhand der Hegelschen Bestimmungen nachzuvollziehen.
Bei all diesen Fragen wird es sich als wesentlich erweisen, die Stellung der Kategorien innerhalb der Hegelschen »Phänomenologie« von derjenigen, die sie im System selbst einnehmen, zu unterscheiden. Marx interpretiert – und in diesem Punkt verbleibt er, ungeachtet aller Kritik, im Rahmen der junghegelianischen Rezeptionsvorgaben – die Hegelsche Philosophie im wesentlichen aus der Perspektive der »Phänomenologie« und ihrer Kategorien. Aber die »Phänomenologie« ist nicht schlechthin ein Teil des Hegelschen Systems, wie etwa die »Logik« oder die »Rechtsphilosophie«. Sie hat eine spezifische Stellung zum System und aus dieser folgt die Spezifik ihrer Kategorien.