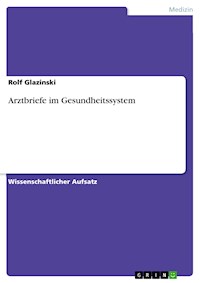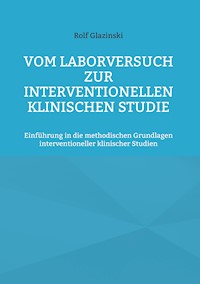
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Um die zum Verständnis interventioneller klinischer Studien notwendigen methodischen Grundkenntnisse zu erlangen, benötigen Sie keinen Abschluss in Statistik oder Mathematik. In der vorliegenden kompakten Abhandlung werden sie unter Verzicht auf Formeln in die Lage versetzt, den experimentellen Ansatz einer interventionellen klinischen Studie nachzuvollziehen. Sie lernen, zwischen Deduktions- und Induktionsschluss zu unterscheiden und machen sich mit den wichtigsten Validitätskriterien interventioneller klinischer Studien vertraut. Darüber hinaus verstehen Sie, was mit Nullhypothese und Alternativhypothese, Fehler erster und zweiter Art sowie Signifikanzniveau und statistischer Trennschärfe gemeint ist. Die Abhandlung richtet sich an Mediziner, Psychologen sowie Gesundheits- und Naturwissenschaftler, die ein grundlegendes Verständnis der Methodik klinischer Studien erlangen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 31
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vom Laborversuch zur interventionellen klinischen Studie
Lernziele
Inhaltliche Einführung
Methodische Vorüberlegungen
1.1 Mathematik, Naturwissenschaften und interventionelle klinische Studien
1.1.1 Unabhängige und abhängige Variablen
1.1.2 Induktionsschluss und Deduktionsschluss
1.1.3 Beweise in Mathematik und Naturwissenschaften
1.2 Interventionelle klinische Studien
1.2.1 Induktionsschluss in interventionellen klinischen Studien
1.2.2 Gültigkeitskriterien klinischer Studien oder der Nachweis von
„Kausalität“
1.2.3 Repräsentativität der untersuchten Stichprobe, „Randomisierung“ und „Stratifizierung“
1.2.4 Vergleich von Verum- und Kontrollgruppe
1.2.5 Unzulänglichkeiten interventioneller klinischer Studien oder
„erlaubte Irrtümer“
Fragestellung, besonderer methodischer Ansatz und Irrtumsarten in interventionellen klinischen Studien
2.1 Fragestellung
2.1.1 Hypothesenformulierung
2.1.2 Formulierung der Nullhypothese
2.1.3 Formulierung der Alternativhypothese
2.2 Besonderer methodischer Ansatz interventioneller klinischer Studien
2.2.1 Verwerfen der Nullhypothese
2.2.2 „Akzeptieren“ der Alternativhypothese
2.2.3 Indirekte Bestätigung der Alternativhypothese durch Verwerfen der Nullhypothese
2.3 Irrtumsarten
2.3.1 Fehler erster Art (α-Fehler), Signifikanzniveau und p-Wert
2.3.2 Fehler zweiter Art (β-Fehler) und Power
2.3.3 Korrektheit und Akzeptanz der Nullhypothese
Interne und externe Validität
3.1 Interne Validität
3.2 Externe Validität
Lessons Learned
Vorwort
Die vorliegende kompakte Abhandlung soll Sie mit der allen interventionellen klinischen Studien zu Grunde liegenden Methodik vertraut machen. Vertiefte Kenntnisse der Mathematik oder Statistik sind nicht erforderlich. Sie benötigen lediglich die Grundrechenarten sowie Ihren klinisch und logisch urteilenden Verstand.
Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Sie zwischen interventionellen und nicht-interventionellen Studien strikt unterscheiden müssen. Bei den sogenannten therapeutischen Studien handelt es sich um interventionelle Studien, weil in ihnen eine bestimmte Maßnahme(Operation, medikamentöse Therapie, Rehabilitationsbehandlung, etc.) im Hinblick auf ihre Wirkung(Ergebnis der Intervention) untersucht wird. Nur mit den interventionellen klinischen Studien werden wir uns im Folgenden beschäftigen.
Die Auseinandersetzung mit den methodischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen interventioneller klinischer Studien mag Ihnen zunächst etwas mühsam erscheinen, Sie werden dafür aber mit einem vertieften Verständnis der „Forschungsmechanik“ belohnt, die Ihnen unabhängig von Ihrem Fachgebiet das Verständnis und die kritische Überprüfung („critical appraisal“) interventioneller klinischer Studien deutlich erleichtern wird.
So werden Sie verstehen, wie es gelingt, unter Einhaltung von Gültigkeits- bzw. Validitätskriterien die Sicherheit der in Laborversuchen erlangten Erkenntnisse mit Hilfe von Untersuchungen an vorab definierten Patientenkollektiven im Rahmen interventioneller klinischer Studien auch auf klinische Sachverhalte zu übertragen. Der Unterschied zwischen Deduktions- und Induktionsschluss wird Ihnen verständlich werden. Sie werden nachvollziehen können, weshalb eine Stichprobe repräsentativ für die Grundgesamtheit sein muss und wie durch Randomisierung und Stratifizierung (Schichtung) sowohl für die Grundgesamtheit repräsentative als auch untereinander vergleichbare Stichproben erzeugt werden können. Ihnen wird einsichtig werden, dass Sie nicht nur eine Interventionsgruppe, in der eine bestimmte Maßnahme (Intervention) durchgeführt wird, sondern auch eine Kontrollgruppeohne Intervention benötigen, um zwischen Intervention und Wirkung einer (neuen) Therapie einen kausalen Zusammenhang nachweisen zu können. Darüber hinaus wird Ihnen geläufig werden, wie sich komplexe klinische Fragestellungen durch Formulierung einer so genannten Nullhypothese und einer Alternativhypothese auf Fragen zurückführen lassen, die sich im Rahmen interventioneller klinischer Studien mit „ja“ oder „nein“ beantworten lassen. Sie werden verstehen, dass man sich auf zweierlei Art irren kann, und werden den Fehler erster Art vom Fehler zweiter Art unterscheiden können. Abschließend werden Sie lernen, zwischen interner und externer Validität einer interventionellen klinischen Studie zu differenzieren.
Der Abhandlung sind die zugehörigen Lernziele und eine kurze inhaltliche Einführung vorangestellt. Am Ende des Textes finden Sie unter der Überschrift Lessons Learned eine schlagwortartige Zusammenfassung des behandelten Stoffs.
Auf wörtliche Zitate und Quellenangaben, wie sie in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, Dissertationen und