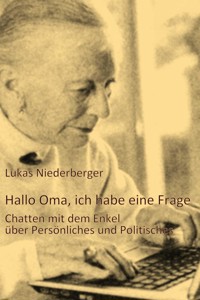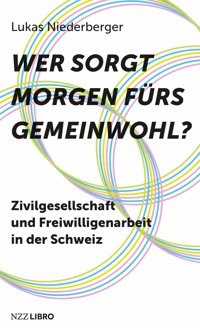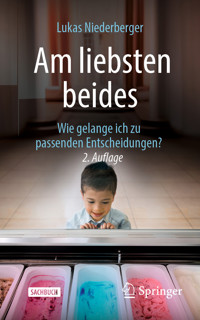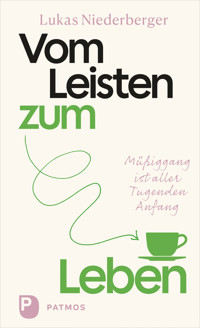
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Von nichts kommt nichts.« »Ohne Fleiß kein Preis.« »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.« »Müßiggang ist aller Laster Anfang.« Redensarten wie diese zeugen von der tief verankerten Arbeitsmoral, die unser Denken und Handeln auf der individuellen und kollektiven Ebene prägt. Für Arbeit und Tempo, Leistung und Fleiß gibt es Lob und Belohnung, Anerkennung und Liebe. Fürs vermeintliche Trödeln und Faulenzen werden wir schief angeschaut oder getadelt. Aber der Wert des Lebens lässt sich nicht an der Produktivität bemessen. Dieses Buch sensibilisiert dafür, wie uns Leistungsdenken unter Druck setzt. Es stellt vermeintliche Laster wie Lust und Genuss, Langsamkeit und Langeweile, Muße und Müßiggang sowie Faulheit und Nichttun in ein neues Licht. Und es ermutigt zu einem selbstbestimmten und kreativen Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lukas Niederberger
Vom Leisten zum Leben
Müßiggang ist aller Tugenden Anfang
Patmos Verlag
Inhalt
Einführung
1 Arbeiten ist mehr als Leisten
2 Genießen ist mehr als Konsumieren
3 Entschleunigen ist mehr als Pausieren
4 Langeweile ist mehr als Interesselosigkeit
5 Faulheit ist mehr als Nachlässigkeit
6 Aufschieben ist mehr als Trödeln
7 Muße ist mehr als Träumen in der Freizeit
8 Müßiggang ist mehr als Zeitvertreib
9 Nichttun ist mehr als nichts tun
10 Altsein ist mehr als nachberuflich sein
Fazit und Ausblick, Dank und Rückblick
Quellenhinweise
Literaturempfehlungen
ÜBER DEN AUTOR
ÜBER DAS BUCH
IMPRESSUM
HINWEISE DES VERLAGS
Einführung
In den folgenden zehn Kapiteln geht es um unser oftmals unbewusstes Leistungsdenken. Und gleichzeitig nehmen wir scheinbare Laster wie Faulheit und Genuss, Langsamkeit und Langeweile, Muße und Müßiggang als Werte und Tugenden genauer unter die Lupe. Jedoch will ich in diesem Buch nicht nur meine persönlichen Erfahrungen und Meinungen wiedergeben. Deshalb kommen rund 50 Personen im Alter von 25 bis 85 Jahren aus meinem Bekanntenkreis zu Wort und berichten über ihre Einstellungen zu Arbeit und Leistung, Muße und Nicht(s)tun.
Dass ich dieses Buch kurz nach meinem 60. Geburtstag schreibe, hängt damit zusammen, dass ich selbst im Übergang vom Paradigma des Leistens in eine Haltung des Daseins stecke. Wenn mich früher jemand einen Workaholic nannte, erwiderte ich kopfschüttelnd, dass mein Beruf einer Berufung entspreche und darum eins sei mit Freizeit und Privatleben. Wenn ich heute selbstkritisch zurückblicke, habe ich zwar meistens aus innerem Feuer heraus gearbeitet. Gleichzeitig habe ich mich aber stark über die Arbeit und über berufliche Rollen definiert und durch Leistung Anerkennung erwartet. Durch das fast pausenlose Arbeiten habe ich nicht nur meinen Energiehaushalt und meine Partnerschaft herausgefordert, sondern mich vermutlich auch gegen Langeweile und Leere geschützt. Als ich meinen 60. Geburtstag feierte, spürte ich, dass ich mich nicht mehr länger über Beruf, Rollen, Funktionen und Titel definieren will.
Im Rückblick auf mein Leben erkenne ich mindestens zehn Erlebnisse, die mir die Fragwürdigkeit meines geistigen Korsetts und die Notwendigkeit einer Neuorientierung vor Augen führten. Meistens habe ich die seelischen Signale erst dann wahr- und ernst genommen, als mein Körper zu reagieren begann.
Erstens wurde ich bereits mit sieben Jahren bei den Pfadfindern auf den Namen Gispel getauft. In der Schweiz ist damit ein Zappelphilipp gemeint. Heute würde man mir wohl die Diagnose ADHS verpassen. Seit meiner Kindheit generieren mein Hirn und Herz am laufenden Meter neue Ideen. Zum Arbeiten musste mich nie jemand antreiben. In den letzten 30 Jahren war ich stets zu 100 Prozent erwerbstätig und leitete abends und an Wochenenden zusätzlich Kurse, verfasste Bücher und gestaltete Rituale. Auch im Urlaub war ich für meine Arbeitgeber stets erreichbar.
Zweitens brach ich mir mit 41 Jahren auf einer Skitour das Bein. Der Unfall sollte mich etwas ruhiger treten lassen. Aber ich arbeitete bereits im Krankenhausbett ganztags am Laptop. Später ließ ich ein Bett in mein Büro stellen, damit ich uneingeschränkt arbeiten konnte.
Drittens lebte ich ein Jahr danach, als mein Leitungskollege im Ausland weilte, in einem Haushalt mit sieben Männern, die älter als 70 waren. Meine damaligen Ordensbrüder mussten weder einkaufen noch kochen, waschen oder putzen. Und ohne ihre bisherige berufliche Funktion und Anerkennung waren sie frustriert und jammerten von früh bis spät über Belanglosigkeiten. Eines Tages fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Wer zölibatär lebt, definiert sich noch stärker über Arbeit und Leistung und fällt im Alter ohne die beruflichen Rollen vermutlich tiefer als Menschen, die in einer Partnerschaft leben. Das Schicksal dieser älteren Mitbrüder wollte ich dereinst nicht teilen und ich verließ nach 22 Jahren den Jesuitenorden.
Viertens wurde mir im Sommer 2022 nach fast zehn Jahren Leitungstätigkeit meine Arbeitsstelle als Geschäftsleiter einer gemeinnützigen Organisation gekündigt, da ich dem Vorstand im Weg stand. Zum ersten Mal im Leben hatte ich das Gefühl, dass sich mein starkes Engagement nicht gelohnt hatte, und ich bereute, dass ich nicht schon ein bis zwei Jahre früher von mir aus gekündigt hatte.
Fünftens erschütterte es mich in den letzten Jahren wiederholt, wenn Freunde mehrere Monate in Burnout-Kliniken verbringen mussten. In meinem nahen Umfeld kenne ich auch aktuell mehrere Personen, die Gefahr laufen, demnächst in einen solchen Erschöpfungszustand zu fallen. Die Gründe dafür sind zahlreich: vom eigenen Perfektionismus über private Herausforderungen bis zu Mobbing und mangelnder Wertschätzung am Arbeitsplatz.
Sechstens beobachte ich, dass immer mehr Menschen nicht nur im Zug und im Bus permanent an ihrem Smartphone hängen, sondern auch wenn sie auf der Rolltreppe stehen, auf dem Bahnsteig gehen, den Kinderwagen schieben, mit Freunden am Tisch sitzen, den Hund Gassi führen oder wenn im Konzertsaal eine Mini-Pause zwischen zwei Werken oder Sätzen entsteht. Manche Apps sind so gestaltet, dass die Nutzer:innen ständig mit ihnen interagieren müssen. Dadurch wird nicht nur unsere innere Festplatte dauernd überreizt und unsere Aufmerksamkeit reduziert, sondern auch die FOMO (fear of missing out) gefördert: die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.
Siebtens stieß ich vor einem Jahr bei der Recherche für ein Buch mehrmals auf den Begriff Muße. Dieses Wort war mir zwar bekannt, aber ich erfuhr erst bei der vertieften Lektüre, dass Muße in der Antike als eine wichtige Tugend galt und erst im Mittelalter von Mönchen und später von Reformatoren als Quelle aller Laster geschmäht wurde. Dass sich die Geister an der Muße und am Müßiggang so stark scheiden, weckte meine Lust, mich mit diesem Zustand tiefer zu beschäftigen.
Achtens gebe ich seit zehn Jahren Kurse zur ganzheitlichen Standortbestimmung. Die ursprüngliche Idee war, dass Personen zwischen 25 und 40 Jahren teilnehmen würden, die sich für eine bestimmte Lebensform oder Arbeitsstelle zu entscheiden haben. Doch die meisten Teilnehmenden sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Bei diesen Kursen wird mir immer stärker bewusst, wie lange und intensiv wir uns auf die zweite Lebensphase der Arbeitswelt und Erwerbstätigkeit vorbereiten. Aber in die dritte und vorletzte Lebensphase (zwischen 60 und 80 Jahren) gelangen wir in der Regel ohne große Vorbereitung. Dieses Buch soll ein bescheidener Beitrag dazu sein.
Neuntens starben in den letzten Jahren mehrere meiner Freunde kurz vor oder nach der Pensionierung an Herzversagen oder Krebs. Das wünsche ich niemanden – auch mir selbst nicht. Ich muss nicht hochbetagt werden, aber die Jahre zwischen 60 und 75 möchte ich gern mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung erleben und genießen.
Und zehntens habe ich letzthin zum dritten Mal Viktor E. Frankls erschütternden Bericht …trotzdem Ja zum Leben sagen gelesen. In den Konzentrationslagern wurde alles unproduktive Leben wörtlich für lebensunwert gehalten und mit industrieller Effizienz zerstört. Diese Pervertierung des Effizienz- und Leistungsdenkens stellt fundamentale Fragen an die zugrundeliegende Geisteshaltung von Arbeit und Leistung, Effizienz und Tüchtigkeit.
Je öfter ich in den letzten Jahren mit anderen Menschen über unsere Leistungsgesellschaft und das persönliche Leistungsdenken sprach, desto stärker wurde mein Wunsch, mich mit unserem Verhältnis zum Tun und Nichttun zu befassen. Die Themen dieses Buches bewegen sich zwischen den beiden Polen Leistungsideal und Müßiggang. Jean de La Fontaine wies 1668 in seiner berühmten Fabel diese beiden Pole zwei Tieren zu: der Ameise und der Grille. Die Ameise sammelte im Hochsommer emsig Futter für den Winter, während die Grille den lieben langen Tag Lieder sang und die Wanderer erfreute. Die Grille riet der Ameise, sich nicht so abzumühen und den Sommer etwas zu genießen. Die Ameise ließ sich aber nicht beirren. Als der Winter einbrach und die Grille ohne Obdach und Nahrung die Ameise um ein wenig Futter bat, wies die Ameise sie eiskalt ab und riet ihr, mit Tanzen und Singen gegen die Kälte des Winters anzukämpfen. Am Ende des Buches werde ich auf diese Fabel zurückkommen.
Das Schreiben eines Buches über Muße und Nichttun ist genau betrachtet ein Widerspruch in sich, zumal Thomas Edison behauptete, Kreativität bestehe aus einem Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration. Erfreulicherweise besteht der Tag eines Autors aber nicht ausschließlich aus Schreiben, sondern verlangt viele schöpferische Pausen. Dass wir mehr Muße pflegen sollten, formulierte Friedrich Nietzsche in Diefröhliche Wissenschaft vor über 150 Jahren in deutlichen Worten:
»Man schämt sich jetzt schon der Ruhe; das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand. Lieber irgendetwas tun als nichts. Man hat keine Zeit und keine Kraft mehr für die Zeremonien, für die Verbindlichkeit mit Umwegen, für allen Esprit der Unterhaltung und überhaupt für alles Otium [Muße]. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen Sich-Verstellen oder Überlisten oder Zuvorkommen: die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer (…) Es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur vita contemplativa (das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. – Nun! Ehedem war es umgekehrt: die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich. Ein Mensch von guter Abkunft verbarg seine Arbeit, wenn die Not ihn zum Arbeiten zwang.«
Und der Wiener Kabarettist Georg Kreisler drückte die Einladung zur Muße im Jahr 1974 im Lied Wenn alle das täten treffend aus:
»Bleib’n Sie doch mal Ihrer Arbeit fern,
geh’n Sie stattdessen spazieren (…)
Alles wird weitergeh’n ohne Sie,
Sie würden gar nichts riskieren (…)
Deswegen geht die Welt doch nicht unter –
sie geht eher unter, wenn’s so bleibt wie jetzt!«
1 Arbeiten ist mehr als Leisten
Um vom Leisten zum Leben zu gelangen, besteht der erste Schritt darin, das menschliche Tätigsein möglichst umfassend zu betrachten.
In der Volksschule erlebte ich in den 70er-Jahren noch in jedem Schulfach eine Note für die Leistung und eine separate Note für den Fleiß. Wenn wir das Jahreszeugnis unserer Oma zeigten, erhielten wir eine Belohnung von fünf Franken. Ich glaube, dass Oma das Zeugnis gar nicht anschaute. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass sie uns jemals kritisierte, wenn irgendwo keine Bestnote stand. Ich hatte in der Volksschule in den meisten Fächern gute Leistungsnoten. Beim Fleiß gaben mir die Lehrerinnen jedoch selten die Maximalnote, weil ich die Schule recht locker nahm. Damals fand ich die unterschiedliche Bewertung von Bemühung und Leistung wenig sinnvoll. Heute erkenne ich den pädagogischen Wert. Und dass Lehrpersonen heute an vielen Volksschulen bzw. Grundschulen überhaupt keine Noten mehr vergeben, sondern die Kinder nach ihren Kompetenzen und Potenzialen in einem Prosatext oder einem Entwicklungsgespräch beurteilen, ist noch sinnvoller.
Unser ökonomisch dominiertes Denken und Handeln ist durch und durch vom protestantischenArbeits- und Leistungs-Ethos geprägt. Wirtschaftsunternehmen versuchen die Arbeitsleistung ihres Personals mit zahlreichen Maßnahmen zu optimieren und dadurch dieGewinnezu maximieren:
Vor 40 Jahren begannen Fast-Food-Ketten, für ihre Mitarbeitenden großzügige Familien-Events zu organisieren, um die Identifikation mit dem Unternehmen zu steigern. Letztlich ging es aber darum, das familiäre Umfeld günstig zu stimmen für Abend- und Wochenend-Einsätze der Mitarbeitenden.Vor 20 Jahren richteten Google und andere IT-Giganten ihre Arbeitsplätze wie Freizeitparks ein und boten ihren Angestellten rund um die Uhr kostenloses Essen an. Wenn man aber mit Mitarbeitenden ins Gespräch kam, wurde schnell klar, dass sie abends nur selten vor 22 Uhr die Firma verließen und praktisch kein Sozialleben hatten.Manche Firmen schulen ihre Personalabteilungen darin, Arbeitskolleg:innen in psychischen Krisen zu begleiten. Eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zeigte auf, dass dieses Vorgehen einen positiven Return on Investment aufweise. Viele Firmen versuchen mit internen Gesundheitsprogrammen, Yoga- oder Meditationskursen, die Abwesenheitszeiten der Mitarbeitenden zu reduzieren und deren Leistung zu steigern. ZudemsorgenPersonal Trainer sowie Atem-, Schlaf-, Ernährungs-, Beziehungs-, Mental-, Gesundheits-, Team-, Motivations-, Executive- und Erfolgs-Coaches dafür, dass sich Mitarbeitende laufend optimieren.Das Leistungsdenken sitzt so tief in unseren Knochen, Hirnzellen und Genen, dass wir dieses persönliche und gesellschaftliche Grundmuster selten bis nie in Frage stellen. Der Homo sapiens ist längst zur humanen Ameise geworden und blickt despektierlich auf die menschliche Grille herab. Redensarten wie »erst die Arbeit, dann das Vergnügen«, »von nichts kommt nichts« oder »ohne Fleiß kein Preis« gelten in einer von ökonomischem Denken dominierten Gesellschaft als Selbstverständlichkeiten. Von meinen befragten Freund:innen erhielt ich ganz unterschiedliche Reaktionen auf diese Redensarten:
»In meiner Kindheit und Jugend in einem Handwerkergeschäft und mit einer Bauerntochter als Mutter hatten diese Redensarten einen hohen Stellenwert. Später wurde diese Leistungsmoral meiner Eltern durch Reisen und Arbeitseinsätze im Ausland sowie durch Adoptivkinder aus Afrikaallerdingsstark relativiert.« (, 61 J.)»Diese Redenarten drücken reine Logik aus.« (, 84 J.)»Diese Redensarten stecken seit Kindertagen als Erziehungsleitsätze tief in mir und treiben mich zum Leisten an. Ich frage mich aber immer öfter, ob man sich alles verdienen kann und muss.« (, 60 J.)»Diese Sprüche enthalten ein Körnchen Wahrheit. Ich musste mich zumindest ziemlich anstrengen, um das zu erreichen, was ich mir in der Ausbildung erhofft hatte.« (, 64 J.)»Als Jugendlicher dachte ich: So ein Blödsinn! Als ich meine berufliche Bestimmung fand, dachte ich: Stimmt schon – und geht ja wie von selbst! AlsElternteildenke ich heute: Wie soll es anders funktionieren?« (, 55 J.)»Diese Redensarten erinnern mich stark an die preußische Erziehungsweise meiner Mutter. Davon habe ich mich distanziert und fühle mich heute deutlich wohler und freier.« (, 56 J.)»Dass man nichts verdient, ohne zuvor eine Leistung zu bringen, ist ein gefährliches Credo, das einen Menschen vor sich hertreiben kann und ihm suggeriert, nur etwas wert oder glücksberechtigt zu sein, wenn eine Leistung erbracht wird.« (, 62 J.)»Das Lieblingssprichwort meiner im Alter von53 Jahrenverstorbenen Mutter war ›Müßiggang ist aller Laster Anfang.‹ Aus ihrer Sicht hatte sie recht, weil der Müßiggang für meinen Vater meistens im Wirtshaus endete. Wir hatten kein Geld, und mein Kapital war das fleißige Lernen.« (, 78 J.)»Das Tröstliche dieser Redensarten besteht darin, dass man mit Fleiß trotz fehlendem Talent reüssieren kann.« (, 71 J.)»Mein Vater stimmt diesen Sprüchen noch heute zu. Ich mochte sie nie. Allerdings verwende ich manchmal meiner Tochter gegenüber Floskeln, die in dieselbe Richtung gehen.« (, 39 J.)»Wenn wir erkennen würden, wie wundervoll und wertvoll wir sind, ohne etwas zu leisten, würde viel Frieden in unsere Seelen kehren. Wir sind nicht erst, wenn wir etwas tun, sondern allein schon durch unser Dasein. Um etwas Sinnvolles und Neues zu schaffen, braucht es meistens einen hohen Einsatz. Solangedieserselbstbestimmt ist, finde ich nichts Negatives dabei.« (, 47 J.)»Mit diesen Glaubenssätzen bin ich aufgewachsen und habe dadurch vieles durchgestanden. Retrospektiv betrachte ich diese Haltung aber als nicht so gesund.« (, 50 J.)»Ich finde, dass der Mensch sein Glück unabhängig von Leistung und Erfolg finden kann und soll.« (, 26 J.)»Solche Redensarten sind oft die Grundlage, Menschen zu verurteilen, die vermeintlich keinen Fleiß zeigen.« (, 59 J.)»Diese Redensarten fördern nicht nur unser Leistungsdenken, sondern auch die sogenannte Meritokratie: die Überzeugung, dass Erfolg allein auf Leistung beruht und dass Menschen aufgrund individueller Verdienste und Leistung ausgewählt werden, um führende Positionen zu besetzen. Untersucht man die Gründe für Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft etwas genauer, so sind es oftmals gerade nicht persönliche Verdienste, sondern soziale Beziehungen und Herkunft, die bestimmte Menschen an Gymnasien, Hochschulen und in höhere beruflichePositionenhieven. Besonders die Genderforschung hat aufgezeigt, dass es nicht zwingend die Leistungsbewertung ist, die in allen gesellschaftlichen Bereichen dazu führt, dass Frauen Männern gegenüber benachteiligt werden. Ganz abgesehen davon bestehen die Aufgaben der modernen Arbeitswelt aus zahllosen Mini- undMikro-Prozessen, an denen ganze Teams beteiligt sind. Darum lassen sich Leistung und Erfolg immer weniger einzelnen Personen zuordnen.« (, 55 J.)»Erfolge werden in unserer Leistungsgesellschaft als Produkt von persönlichem Einsatz, Opferbereitschaft, Durchhaltewillen, harter Arbeit, Anstrengungen und Leid betrachtet. Ich glaube, dass Erfolg weitgehend vom Glück abhängt. Jedenfalls finde ich den Umkehrschluss problematisch: dass Misserfolg das Resultat von mangelndem Fleiß sei.« (, 35 J.)»Als Jugendliche und als junge Frau war ich sehrfleißig. Heute bereue ich, dass ich nicht mehr Mußegelebthabe. Wenn ich mich recht erinnere, so behaupten manche Reformierte, dass sie aufgrundihresFleißes mehr erreichen würden als die faulen Katholiken in Südeuropa.« (, 59 J.)»Bei mir entsteht gerade im Nichtstun viel Kreatives. Im bewussten Zurücklehnen schöpfe ich Kraft, um zu mir zu kommen.« (, 78 J.)»Sehr vieles im Leben erreichte ich nicht durch Leistung, sondern es wurde mir geschenkt, in die Wiege gelegt.« (, 53 J.)»Um in Beziehungen, bei Projekten oder anderenVorhabenerfolgreich zu sein, ist es meiner Erfahrung nach unerlässlich, Zeit, Ideen, Kreativität und Engagement zu investieren. Ohne dieses Engagement bleibt alles beim Alten; es findet keine Bewegung und keine Veränderung statt.« (, 32 J.)»Von meinem noch im 19.Jahrhundert geborenen Vater bin ich ganz im Geiste dieser Redensarten erzogen worden. Erst an meinen längst erwachsenen Kindern habe ich gemerkt, dass eine andere Lebensgestaltung akzeptabel ist. Dieser Lernprozess war ein langer Weg.« (, 77 J.)»Ich glaube, dass Erfolg mit Anstrengungen verbunden ist. Gleichzeitig wissen wir vom Spitzensport, dass Ruhephasen wichtig sind für Höchstleistungen und darum einen festen Teil des Trainingsprogramms bilden.« (, 46 J.)»Fleiß halte ich für einen wichtigen Faktor, wenn man erfolgreich sein will. Kürzlich habe ich den Spruch gelesen: ›Qualität kommt von Qual.‹ Auch diesen Satz würde ich unterschreiben, wenn es um hervorragende Leistungen geht. Sportler:innen, Musiker:innen und andere Personen, die Spitzenleistungen bringen wollen, müssen fleißig trainieren.« (, 44 J.)Diese persönlichen Zeugnisse zeigen drei zentrale Aspekte unseres Leistungsdenkens auf:
Das Leben ist ein Geschenk. Wesentliche Dinge im Leben müssen wir uns nicht durch harte Arbeit und Leistung verdienen. Gleichzeitig können wir uns im Leben nicht immer in vorbereitete Nester setzen. Vieles müssen wir mühevoll selbst erarbeiten und bezahlen dafür manchmal einen hohen Preis.Wer nicht von Erfolg gekrönt ist, ist nicht automatisch faul. Erfolg hängt nicht nur von der persönlichen Leistung ab. Zufall, Glück, Talent, familiäres Umfeld und soziale Beziehungen bilden mindestens so wichtige Erfolgsfaktoren wie die eigene Leistung.Die Bedeutung und die Weitergabe des Leistungsdenkens sind je nach Kultur und Religion, Generation und Familie unterschiedlich stark ausgeprägt.Pädagog:innen und Psycholog:innen betonen zunehmend, dass Personen unter 40 Jahren wenig Kritik ertragen, weil sie von ihren Eltern im Kindesalter permanent gelobt und vor Wettbewerb und Niederlagen geschützt wurden. Darum empfehlen sie, Angestellte und Kinder für ihre Leistungen nicht allzu sehr zu loben und zu belohnen. Und wenn man Lob ausspreche, so solle sich dieses auf Bemühungen und den Fleiß, nicht aber auf Leistungen beziehen. Meine befragten Bekannten beurteilten das Loben von Fleiß und Anstrengungen wiederum unterschiedlich:
»Fleiß belohnt sich selbst. Loben ist darum unnötig.« (, 84 J.)»Ich lobe und belohne lieber Werte wie Empathie und Leidenschaft.« (, 63 J.)»Eine Person zu ehren, die viel Gutes für die Welt tut, finde ich angebracht. Aber während Jahrzehnten fleißig Geld anzuhäufen, ohne das Wohl der Mitmenschen im Auge zu haben, verdient kein zusätzliches Lob.« (, 26 J.)»Loben und Belohnen können die intrinsische Motivation verdrängen. Fleiß sollte nicht nur dann erfolgen, wenn man am Schluss belohnt wird.« (, 64 J.)»Lob für Fleiß fördert nicht nur die Produktivität, sondern auch das Selbstwertgefühl, die Zufriedenheit und die Motivation.« (, 63 J.)»Lob macht glücklich, Belohnung abhängig.«(, 55 J.)»Bei Kindern ist Lob für Fleiß in der Erziehung gut.« (, 68 J.)»Die Motivation zum Leisten und Arbeiten sollte von innen kommen. Man sollte sich nicht vom Lob anderer abhängig machen.« (, 20 J.)»Gerade, wenn das Ergebnis nicht optimal ist, sollten der Fleiß und die Anstrengung gelobt und beachtet werden.« (, 60 J.)»›Er gibt sich Mühe und hat Mühe‹ wurde mir früher ins Schulzeugnis geschrieben. Mit einer schlechten Fleißnote doch ein gutes Ergebnis zu erbringen, war meine Ambition.« (, 74 J.)»Wenn Fleiß für die Fähigkeit steht, auf dem anspruchsvollen Weg zum Ziel dranzubleiben und durchzuhalten, dann würde ich Fleiß als Bestätigung für eine Selbstwirksamkeit und als Motivationsspritze verstehen. Wichtig ist allerdings, dass die Fleißbelohnung nicht zur Sucht wird und uns blind machtgegenüberunseren eigenen Bedürfnissen.« (, 62 J.)»Da ich Fleiß nicht für eine schlechte Charaktereigenschaft halte, darf er genau wie andere positive Eigenschaften – wie z.B. Empathie – gelobt und belohnt werden.« (, 73 J.)»