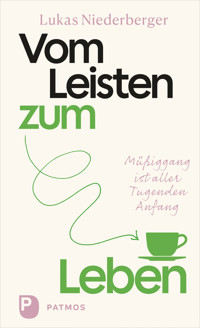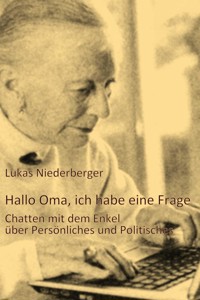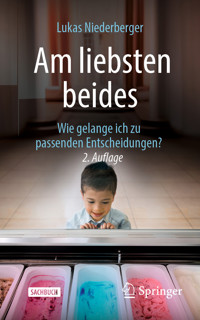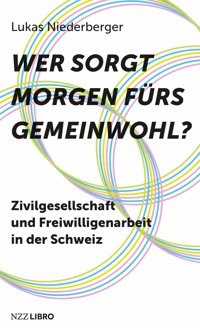
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Bereitschaft zu unbezahltem Engagement sinkt. Wer betreut in Zukunft alte Menschen, wenn diese keine Kinder haben oder weit von ihnen entfernt leben? Wer wird in Zukunft das Handball-Training für Jugendliche leiten? Freiwillige übernehmen viele gesellschaftlich notwendige Dienste, bei denen das private Umfeld und das staatliche Sozialwesen zunehmend an Grenzen stossen. Damit freiwilliges Engagement, das über lange Zeit selbstverständlich erschien, auch in Zukunft stattfindet, braucht es eine Förderung durch Vereine und Stiftungen, Staat und Wirtschaft. Der 25. Geburtstag des UNO-Jahres für Freiwilligenarbeit im Jahr 2026 bietet eine ideale Gelegenheit, um den Blick zurück zu werfen – und nach vorn. Dieses Buch bietet Anstösse zum Reflektieren, Debattieren und Politisieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NZZ LIBRO
Lukas Niederberger
Wer sorgt morgen fürs Gemeinwohl?
Zivilgesellschaft und Freiwilligenarbeit in der Schweiz
NZZ Libro
Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Umschlaggestaltung: Martin Zech Design, Bremen
Korrektorat: Anja Borkam, Langenhagen
Satz: Daniela Weiland, textformart, Göttingen
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
Herstellerinformation: Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro,
Grellingerstrasse 21, CH-4052 Basel, [email protected]
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH,
Marienstraße 28, D-10117 Berlin, [email protected]
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-03980-023-0
ISBN E-Book 978-3-03980-024-7
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Homo faber: Der tätige Mensch
2. Aspekte von Freiwilligenarbeit
2.1 Definition von Freiwilligenarbeit
2.2 Freiwilligenarbeit in Zahlen
2.3 Motivation von Freiwilligenarbeit
2.4 Angehörigenbetreuung
2.5 Nachbarschaftshilfe
2.6 Freiwilligenmanagement
2.7 Wertschätzung und Vergütungen
2.8 Freiwilligenarbeit lernen
2.9 Neue Freiwillige gewinnen
2.10 Freiwilligenarbeit und Diversität
3. Freiwilligenarbeit gemeinsam fördern
3.1 Staat und Freiwilligenarbeit
3.1.1 Staatliche Engagementstrategien
3.1.2 Brauchen wir einen Service Citoyen?
3.2 Wirtschaft und Freiwilligenarbeit
3.3 Zivilgesellschaft und Freiwilligenarbeit
3.3.1 Professionalisierung der Freiwilligenarbeit
3.3.2 Engagement ist ein Recht
3.4 Weitere Akteure und die Freiwilligenarbeit
3.5 Trisektorale Förderung der Freiwilligenarbeit
3.6 Neuer Gesellschaftsvertrag
Eine Reise nach Utopia
Dank
Literaturhinweise
Vorwort
Für viele Europäer:innen gilt die Schweiz als das Land des Bürgersinns schlechthin. Der Gründungsmythos der Schweizer Selbstbestimmung beruht auf dem freiwillig gefassten Vorsatz, ein «einig Volk von Brüdern» zu sein. In der Schweiz haben Parlamente ein eingeschränkteres Mandat als in fast allen anderen Demokratien. Das Volk behält sich vor, über viele Angelegenheiten selbst und direkt zu entscheiden. Dies geht einher mit einer hohen Dichte an freiwilligen Gemeinschaften, in denen sich Bürger:innen engagieren, solidarisieren, einander helfen und gemeinsame Interessen und Geselligkeit pflegen. Wozu also, so könnte man fragen, bedarf es eines so eindringlichen Plädoyers für freiwilliges Engagement in der Gemeinschaft, wie es Lukas Niederberger in dem hier vorgelegten Band präsentiert?
Der Autor verdeutlicht: Auch in der Schweiz erscheint der moderne Staat nicht selten als übergriffig, wie am Beispiel der COVID-19-Pandemie aufgezeigt wird. Auch in der Schweiz droht der Gemeinsinn im Wohlfahrtsstaat, im Kapitalismus neoliberaler Prägung, in der Suche nach einer Work-Life-Balance und anderen modernen Trends im 21. Jahrhundert zu verkümmern. Denn eines ist gewiss: Es nützt wenig, die Schuld für alles einem anonymisierten Staat oder einer anonymisierten Wirtschaft zuzuschreiben. Es kommt auf jede und jeden von uns an, uns dafür ins Zeug zu legen, um die grosse Krise unserer Gesellschaft zu überwinden. Wir brauchen mehr citoyens und citoyennes. Das heisst: Manches, so auch das freiwillige Engagement, das über lange Zeit selbstverständlich erschien und keiner besonderen Reflexion oder Darlegung bedurfte, verlangt heute neue Begründungen, Einordnungen, Klarstellungen und Ermutigungen. Diese liefert Lukas Niederberger in systematischer und aufschlussreicher Weise. Mit langjähriger Praxiserfahrung in der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und dem notwendigen wissenschaftlichen Rüstzeug ausgestattet, präsentiert er empirische Forschungsergebnisse – nicht nur aus der Schweiz – sowie theoretische Erkenntnisse und praxisorientierte Handlungsanleitungen. Für Leser:innen ausserhalb der Schweiz bietet er zudem einen Spiegel, in dem sie sowohl Zusammenhänge als auch Missstände im eigenen Land erkennen können. Der Abgleich zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, den der Autor vornimmt und in dem er auf Unwuchten stösst, ist eben nicht nur ein Schweizer Thema, sondern zumindest ein europäisches, mit erstaunlichen, keineswegs nur positiven Gemeinsamkeiten.
Ein Beispiel, das Lukas Niederberger ausführlich behandelt, ist der meist wenig partnerschaftliche Umgang von Politik und Verwaltung sowie von Unternehmen und Medien mit den Zivilgesellschaftlichen Organisationen, in denen sich die Freiwilligenarbeit vor allem konkretisiert. Bezugnehmend auf bedeutende Denker wie Alexis de Tocqueville, Ernst-Wolfgang Böckenförde und Robert Putnam arbeitet er heraus, wie unerlässlich Freiwilligenarbeit für eine offene Gesellschaft ist – und wie dieses Engagement zugleich nicht erkannt, verdrängt und geringgeschätzt wird. Als deutscher Leser, der zu wissen glaubt, wie viel mehr Respekt die Bürger:innen der Schweiz von ihren Behörden und Unternehmen einfordern und auch erhalten als etwa die deutschen, muss mich dies erstaunen. Umso mehr stimme ich dem Verfasser in der Prognose zu, die bereits im Titel zum Ausdruck kommt: Die Zukunft ist freiwillig. Wenn es nicht gelingt, dieses Prinzip in den Überzeugungen und in der täglichen Praxis von Entscheidungsträger:innen und Multiplikator:innen ebenso wie in der breiten Bevölkerung zu verankern, hat eine offene Gesellschaft, die auf Freiheit, der Herrschaft des Rechts und der Volkssouveränität gründet, keine Überlebenschance.
In der Kirche war früher oft von Reue und Umkehr die Rede. Diese Botschaft ruft Lukas Niederberger nun in der Gesellschaft in Erinnerung. Es ist zu wünschen, dass viele Leser:innen – besonders Verantwortliche und Multiplikator:innen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft – sich mit ihr auseinandersetzen und sie in ihr Handeln integrieren.
Rupert Graf Strachwitz
Berlin, im Januar 2025
Einleitung
Die Begriffe Gemeinsinn, Gemeinwohl und Gemeinnutzen wirken leicht verstaubt. Inhaltlich ist ihr Gegenstand jedoch topaktuell. Der Begriff Gemeinwohl (von griechisch koiné symphéron, lateinisch bonum commune, englisch common good) bezeichnet den kollektiven Nutzen und das kollektive Interesse für eine Gesellschaft. Gesellschaft kann Familie, Verein, Region, Land, Menschheit oder Gemeinschaft aller Lebewesen bedeuten. Gemeinwohl entsteht dadurch, dass Individuen, Vereine, Firmen und Gemeinden, Verbände und Kantone nicht nur ihre Partikularinteressen verfolgen, sondern das Wohl aller im Blick behalten. Gleichzeitig ist das Gemeinwohl auch der Nutzen, den Einzelne für ihr Leben aus den Erfahrungen mit der Gesellschaft ziehen. Das Gemeinwohl bildet auch die Voraussetzung, dass sich Menschen und Organisationen in einer Gesellschaft frei einbringen können und wollen. Der Moralphilosoph und Begründer der Nationalökonomie Adam Smith (1723–1790) war überzeugt, dass Gemeinwohl dadurch entstehe, dass es den Einzelnen wohlergehe.
Rein monetär betrachtet wird das Gemeinwohl am effektivsten durch Steuern gefördert. Gesellschaftlich betrachtet tragen die private und die bezahlte Care-Arbeit entscheidend zum Gemeinwohl bei. Weil Individuen und Familien sowie das staatliche Sozial- und Gesundheitswesen mit ihren gemeinnützigen Diensten zunehmend an Grenzen stossen und zahlreiche von der Wirtschaft angebotene Dienste kaum bezahlbar sind, wird das freiwillige Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls immer wichtiger. Vereine, Kirchen, gemeinnützige Institutionen und politische Gemeinden würden ohne Freiwillige nicht funktionieren. Damit gesellschaftlich notwendige Dienste auch in Zukunft garantiert und finanziert werden können, wird die Gesellschaft noch stärker auf freiwilliges Engagement angewiesen sein und dieses entsprechend stärker fördern müssen.
Dieses Buch erscheint ein Vierteljahrhundert nach dem UNO-Jahr der Freiwilligenarbeit. Seit 1985 wird jedes Jahr weltweit am 5. Dezember die Freiwilligenarbeit gewürdigt. In der Universal Declaration on Volunteering heisst es:
«An der Schwelle eines neuen Jahrtausends ist die Freiwilligenarbeit ein wesentliches Element aller Gesellschaften. Freiwilliges Engagement ist ein Baustein der Zivilgesellschaft. Diese Erklärung unterstützt das Recht aller, sich frei zu versammeln und freiwillig zu engagieren, unabhängig vom kulturellen und ethnischen Ursprung, von Religion, Alter, Geschlecht sowie physischen, sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnissen. Alle Menschen sollen das Recht haben, ihre Zeit, ihr Talent und ihre Energie anderen im Rahmen von Einzel- oder Kollektivmaßnahmen frei anzubieten, ohne eine finanzielle Entschädigung dafür zu erwarten.»
Die Erforschung und die Förderung von Freiwilligenarbeit wurden in der Schweiz im Jahr 2001 durch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) angestossen. In regelmässigen Abständen von drei bis fünf Jahren hat sie seitdem fünf Freiwilligen-Monitore mit landesweiten Befragungen durchgeführt, die – ähnlich dem deutschen Freiwilligensurvey – differenzierte Einblicke in das unbezahlte Engagement für das Gemeinwohl bieten. Von 2013 bis 2022 war ich als Geschäftsleiter der SGG verantwortlich für drei Freiwilligen-Monitore und leitete zudem zahlreiche Fachtagungen zu den Themen Freiwilligenarbeit, Gemeinwohl und gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Wie hat sich Freiwilligenarbeit in den letzten 25 Jahren entwickelt? Und für welche Herausforderungen muss die Gesellschaft in den kommenden 25 Jahren Lösungen finden? Dieses Buch bietet Anstösse zum Reflektieren und für die politische Debatte.
Im ersten Kapitel werden die unterschiedlichen Formen des tätigen Menschen thematisiert – von der Hausarbeit über Angehörigenbetreuung bis zur Freiwilligenarbeit und der Erwerbsarbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet Aspekte der Freiwilligenarbeit sowie deren historische Entwicklung und künftige Perspektiven. Im dritten Kapitel wird untersucht, wie Staat, Wirtschaft, Vereine, Kirchen, Medien, Schulen und Stiftungen die Freiwilligenarbeit fördern können und wie sektorübergreifende Kooperationen dieses Engagement noch effektiver unterstützen könnten. Schliesslich widmet sich das vierte Kapitel den zukünftigen Herausforderungen und den Möglichkeiten zur gezielten Förderung der Freiwilligenarbeit.
Dieses Buch will zur Stärkung von Freiwilligenarbeit beitragen. Darüber hinaus will es in der Schweiz das Bewusstsein für den Dritten Sektor – die Zivilgesellschaft – wecken: für den Raum kollektiven Handelns zwischen und jenseits von Staat, Wirtschaft und Privatbereich. Zwar sind drei von vier Erwachsenen Mitglied in mindestens einem der rund 100’000 Schweizer Vereinen. Fast jede zehnte Person bekleidet ein Ehrenamt in einem Verein, für das sie für eine bestimmte Zeit gewählt wird. Und es gibt 13’000 gemeinnützige Stiftungen. Gleichzeitig wirken mehrere tausend berufstätige Bürger:innen in den lokalen und regionalen Parlamenten und Regierungen des politischen Milizsystems. Staat und Zivilgesellschaft sind eng miteinander verzahnt. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb wird in der Schweiz die Bedeutung der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements selten thematisiert. 25 Jahre nach dem UNO-Freiwilligenjahr soll aufgezeigt werden, dass und wie zivilgesellschaftliches Engagement stärker gefördert werden kann und muss.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Lukas Niederberger Rigi Klösterli, im Januar 2025
1. Homo faber: Der tätige Mensch
Wenn kleine Kinder am Seeufer spielen, bewundern sie nicht die schöne Landschaft, sondern bauen Bäche und Burgen. Auch der erwachsene Mensch ist, sofern er nicht schläft, ist ein Tätiger, ein Homo faber. Ob am Arbeitsplatz, im Fussballclub, beim Sprachenlernen oder gar beim Zähneputzen, stets ist er aktiv. In ihrem Buch Vom tätigen Leben (1958) differenzierte Hannah Arendt das Tätigsein – die vita activa – in körperliche Arbeit, ökonomisches Herstellen und selbstbestimmtes Handeln. Dem gegenüber stünden kreatives Wirken und Muße – die vita contemplativa.
Das Bundesamt für Statistik untersucht alle drei bis vier Jahre mittels der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) die Tätigkeiten, die wir als Erwerbsarbeit gegen Bezahlung, als Freiwilligenarbeit für das Gemeinwohl oder im Rahmen von Familie und Haushalt verrichten. Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung des zeitlichen Investments pro Person im Alter von 16–70 Jahren zwischen 1997 und 2020 in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen auf.
Im Jahr 1997 zählte die Schweiz bei einer Gesamtbevölkerung von 7.1 Mio. rund 5 Mio. Personen im Alter von 16–70 Jahren. Im Jahr 2020 waren auf 8.67 Mio. Bewohner:innen rund 6.2 Mio. Personen im gleichen Alter. Die verwendete Zeit für Haus- und Familienarbeit sank bei den Frauen zwischen 1997 und 2020, während sie bei den Männern stieg – allerdings noch nicht auf das Niveau der Frauen. Unbezahlte private Care-Arbeit, das heisst die Betreuung von Angehörigen, nahm bei Frauen und
Tabelle1: Die Entwicklung unserer Tätigkeiten (1997–2020)
Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Statistik: SAKE-Befragungen 1997/2020. Lesebeispiel: Im Jahr 1997 leisteten Frauen im Alter von 16–70 Jahren in der Schweiz im Durchschnitt 861 Stunden unbezahlte Arbeit. Im Jahr 2020 waren es 738 Stunden.
Männern zu, was stark mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Auch in diesem Bereich leisten Frauen noch immer deutlich mehr als Männer. Die formelle Freiwilligenarbeit in Zivilgesellschaftlichen Organisationen sank bei beiden Geschlechtern. Männer leisten in diesem Bereich mehr als Frauen, weil fast die Hälfte der Freiwilligenarbeit in Sportvereinen stattfindet. In der informellen Freiwilligenarbeit, das heisst bei Tätigkeiten ausserhalb von Organisationen, insbesondere Care-Arbeit in der Nachbarschaft, sind Männer heute fast doppelt so viel tätig wie vor 30 Jahren. Aber auch in diesem Bereich leisten sie noch immer weniger als Frauen. Dass Männer in der Care-Arbeit weniger engagiert sind als Frauen, hängt mit der traditionellen Sozialisation zusammen. Insgesamt leisteten Männer im Jahr 2020 etwa 25 % mehr unbezahlte Arbeit als im Jahr 1997, während sie bei den Frauen leicht abnahm. Im gleichen Zeitraum nahm bei den Männern die Erwerbsarbeitszeit leicht ab, während sie bei den Frauen zunahm. Zählt man die formelle Freiwilligenarbeit und die informelle Freiwilligenarbeit von Frauen und Männern zusammen, kommt man im Jahr 2020 auf rund 620 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit in der Schweiz. Diese Zahl wird im weiteren Verlauf wiederholt Erwähnung finden. In der Sozialforschung unterscheidet man fünf Kategorien von Tätigkeiten: die vier unbezahlten Bereiche Haushaltsproduktion, private Care-Arbeit, die informelle und die formelle Freiwilligenarbeit sowie den bezahlten Bereich der Erwerbsarbeit. Weil diese fünf Kategorien, ihre Abgrenzungen und ihre Finanzierung in Zukunft vermehrt Anlass zu politischen Debatten geben werden, seien sie an dieser Stelle kurz erläutert.
Haushaltsproduktion und private Care-Arbeit umfassen Hausarbeit, Familienarbeit sowie die Betreuung Angehöriger. Diese Tätigkeiten kommen unserem privaten Umfeld zugute und erfolgen in der Regel in unseren eigenen vier Wänden. Zur Haushaltsproduktion zählt auch die persönliche Investition, die unsere Bildung, geistige und kulturelle Betätigung, Hobbys und Erholung beinhaltet.
Formelle Freiwilligenarbeit findet in Zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) statt. Bei den freiwilligen Feuerwehren handelt es sich allerdings um staatliche Organisationen, und Betagtenzentren sind immer öfters als Aktiengesellschaften organisiert. Eine spezielle Form der formellen Freiwilligenarbeit bildet das Ehrenamt: Eine Person wird in einem Verein, in einem Verband, in einer Stiftung oder in einer Genossenschaft für eine bestimmte Zeit gewählt, um eine bestimmte Funktion wahrzunehmen. In Deutschland wird der Begriff Ehrenamt jedoch oft als Synonym von Freiwilligenarbeit verwendet. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden in sozialen Institutionen, Hilfswerken, Vereinen und Unternehmen Debatten stattfinden bezüglich der Vergütung von formeller Freiwilligenarbeit. Der Ruf nach monetärer Vergütung wird immer lauter, vor allem in Vereinsvorständen und Stiftungsräten. In der Sozialforschung wird von formeller Freiwilligenarbeit im engen Sinne gesprochen, wenn die Einsätze unbezahlt erfolgen. Formelle Freiwilligenarbeit im weiten Sinne bezeichnet Einsätze, die monetär vergütet werden, auch wenn die Vergütungen bescheiden sind und nicht Löhnen auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Die Vergütung von Freiwilligeneinsätzen betrifft auch das sogenannte Corporate Volunteering, bei dem Arbeitnehmer:innen während ihrer bezahlten Arbeitszeit für eine gemeinnützige Organisation wirken. Weil diese Tätigkeiten bezahlt werden, werden sie in der Sozialforschung nicht als Freiwilligenarbeit im engen Sinne betrachtet. Die Einsätze im Rahmen von Corporate Volunteering sind entweder niederschwellig, wenn Teams von Banken Bäche und Wälder reinigen oder Personen mit einem Handicap zu kulturellen Veranstaltungen begleiten. Manche Mitarbeitende leisten auch skills-based volunteering, indem sie ihre fachlichen Kompetenzen für ZGO zur Verfügung stellen, indem sie z. B. Organisations- und Marketingkonzepte erarbeiten.
Informelle Freiwilligenarbeit