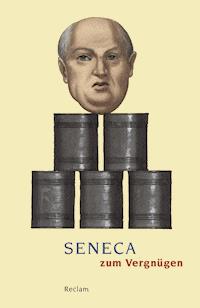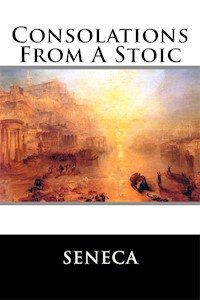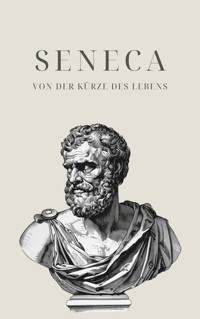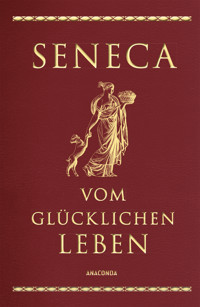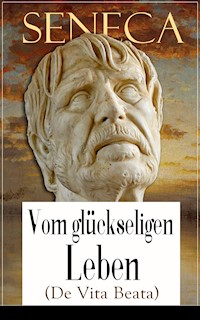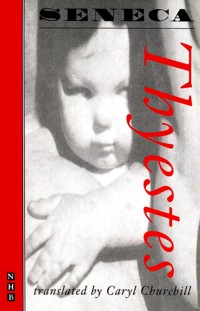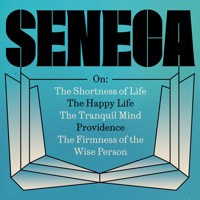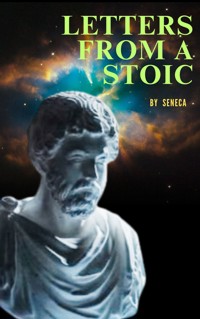4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Weisheit der Welt
- Sprache: Deutsch
Der Schlüssel zum Glück liegt für Seneca im Streben nach Seelenruhe, die sich der Einzelne durch ein tugendhaftes, naturgemäßes Leben, durch Bescheidenheit, Freundschaft und den Dienst an der Allgemeinheit erwerben muss. In »Vom Seelenfrieden« legt der große Stoiker Seneca die zentrale Botschaft seiner Lehre anschaulich in Briefform dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Seneca
Vom Seelenfrieden
Aus dem Lateinischenvon Otto Apelt
Anaconda
Der Text folgt der Ausgabe Lucius Annaeus Seneca:
Philosophische Schriften. Zweites Bändchen. Der Dialoge zweiter Teil.
Buch VII–XII. Übersetzt, mit Einleitungen und Anmerkungen
versehen von Otto Apelt. Der philosophischen Bibliothek Band 74.
Leipzig: Verlag von Felix Meiner 1923. Der Dialog »Vom Seelen-
frieden« (De tranquilitate animi) heißt dort »Von der Gemütsruhe«.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so
übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns
diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand
zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017, 2021 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Alphonse Osbert (1857–1939), »An Evening
in Ancient Times« (1908), Musée de la Ville de Paris,
Musée du Petit-Palais, Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-28384-1V001
www.anacondaverlag.de
An Serenus
[Brief des Serenus an Seneca]
1. [Serenus]: Bei innerer Selbstschau, mein Seneca, machten sich mir gewisse Gebrechen bemerkbar, teils sichtlich und offen daliegend, wie mit Händen zu greifen, teils verborgener und versteckter Art, und noch andere, nicht anhaltender Art, sondern stoßweise wiederkehrend, und diese, darf ich sagen, sind die allerlästigsten, gleich streifenden Feinden, die nur die Gunst des Augenblicks zu einem Anfall benutzen, sodass man weder gerüstet sein kann wie im Kriege, noch sorglos wie im Frieden. Und gerade dies ist der Zustand, auf dem ich mich überwiegend ertappe – denn warum sollte ich dir nicht als meinem Arzt die Wahrheit gestehen? – Weder unbedingt frei fühle ich mich von den Fehlern, die ich fürchtete und hasste, noch auch anderseits völlig in ihrer Gewalt. Ich befinde mich also, wenn auch nicht gerade in der schlimmsten, so doch in einer höchst kläglichen und verdrießlichen Lage: Ich bin weder krank noch gesund. Und komme mir nicht mit dem Einwand, zu jeder Vortrefflichkeit bilde ein schwacher Ansatz den Anfang, erst die Zeit bringe dauernden und festen Halt. Ich verkenne nicht, dass auch, was auf die äußere Herrlichkeit hinarbeitet, wie z. B. auf Ehrenämter, auf den Ruhm der Beredsamkeit, sowie auf alles, was von der Zustimmung anderer abhängt, nur durch geduldiges Ausharren sich durchsetzt – nicht nur, was uns wahre Kraft schafft, sondern auch jene Künste, die, um Gefallen zu erwecken, einer gewissen Schminke bedürfen, erfordern manches Jahr, bis die Länge der Zeit der Farbe allmählich Festigkeit und Dauer verleiht –, allein ich fürchte, dass die Gewohnheit, diese Begründerin einer gewissen Beständigkeit im Verlauf der Dinge, diesen Fehler sich bei mir noch tiefer einwurzeln lässt: Langer Umgang macht uns dem Bösen wie dem Guten befreundet. Das eigentliche Wesen dieser zwiespältigen, weder entschieden zum Rechten noch zum Verkehrten sich neigenden Gemütsschwäche kann ich dir nicht mit einem Schlagwort klarmachen, sondern nur durch eine Reihe von Einzelheiten; ich will dir meine Zustände schildern; du magst den Namen für die Krankheit finden.
Ich bin großer Freund der Sparsamkeit, ich gesteh’ es. Mein Lager soll nicht durch prunkhafte Ausstattung Neid erregen, ich mag nichts wissen von einem Gewand, das man aus einem schmucken Kasten hervorholt und dem man durch aufgelegte Gewichte und tausenderlei Druckmittel einen erzwungenen Glanz gegeben hat; nein ich lobe mir ein einfaches Hauskleid, das weder zum Aufbewahren noch zum Anlegen besondere Sorge erfordert. Meine Mahlzeit soll keiner Dienerschaft bedürfen, weder zur Zubereitung noch zum Aufwarten und Zuschauen; sie soll nicht schon viele Tage vorher bestellt und vieler geschäftiger Hände Werk sein, sondern wohlfeil und leicht beschaffbar, nicht ans fernen Bezugsquellen mit vielen Kosten bereitet, sondern überall erhältlich, weder dem Vermögen noch dem Körper schädlich, nicht von der Art, dass sie den Eingangsweg auch zum Ausgangsweg hat.
Zum Diener wünsche ich mir einen schlichten Naturburschen, zudem wuchtiges Silbergeschirr, wie es mein das Landleben liebender Vater hatte, ohne aufgeprägten Künstlernamen, einen Tisch, der nicht durch reiche Maserung die Augen auf sich zieht und durch häufigen Besitzwechsel unter Prachtliebhabern stadtbekannt ist, sondern dem schlichten Gebrauche dienend, ohne eines Gastes besonderes Wohlgefallen zu erwecken oder seinen Neid zu erregen.
Doch so sehr ich mich dadurch befriedigt fühle, so werde ich doch an mir selbst wieder irre, wenn ich den Blick werfe auf die stattlichen Einrichtungen mancher großen Herren zur Ausbildung von Sklavenknaben, auf die tadellose Kleidung der Dienerschaft mit den Goldstickereien, prächtiger als bei Prozessionen, und auf die Schar strahlender Sklaven, ferner auf ein Haus, dessen Fußboden schon eine Kostbarkeit ist, das in allen Winkeln von Reichtum strotzt, ja dessen Dach sogar durch seinen Glanz die Blicke auf sich lenkt; dazu der Volkshaufe, der das durch die verschwenderische Pracht dem Ruin geweihte Erbgut umlagert und sich zur Begleitung aufdrängt. Dazu die Bewässerungsanlagen, die mit ihrem spiegelklaren Wasser den Speisesaal umrahmen! Was bedarf es weiterer Worte darüber sowie über die Mahlzeiten selbst, die dem Glanz dieser Aufmachungen entsprechen? Wenn ich so aus einer vermoderten Häuslichkeit komme, dann hat der Glanz dieser Prachtentfaltung etwas Verführerisches für mich und umgaukelt mich von allen Seiten, dann flimmert’s mir vor den Augen, und eher noch kann ich mich innerlich fassen als den Blick erheben. So trete ich also den Rückzug an, nicht schlechter geworden, wohl aber betrübter, und bewege mich inmitten meiner armseligen Umgebung nicht mehr so selbstbewusst; ich fühle leise Gewissensbisse, und es beschleicht mich der Zweifel, ob jenes nicht vorzuziehen sei; nichts davon macht mich zu einem anderen Menschen, aber alles dies rüttelt doch an mir.
Ich entschließe mich, den Anweisungen meiner Lehrer zu folgen und mich mitten in den Strudel der Staatsgeschäfte zu stürzen. Dazu verleitet mich nicht etwa das Verlangen nach Ehrenstellen, nach dem Konsulat, nach Purpur oder Rutenbündeln, sondern der Wunsch, meinen Freunden, meinen Verwandten und allen meinen Mitbürgern, ja der ganzen Menschheit mich dienlicher und nützlicher zu machen. Festen Entschlusses und besonnen folge ich dem Zeno, dem Kleanthes, dem Chrysippus, von denen indes doch keiner selbst sich auf Staatsgeschäfte einließ, obschon jeder von ihnen dazu mahnte. Hat irgendetwas mein Gemüt, das keine starken Stöße verträgt, erschüttert, begegnet mir, wie das im Leben so häufig der Fall ist, irgendetwas, was mir wider den Mann geht, oder will eine Sache nicht recht von der Stelle rücken, oder fordern irgendwelche Lappalien einen unverhältnismäßigen Zeitaufwand, dann wende ich mich der Muße zu, und dabei geht es mir wie den Tieren, selbst wenn sie ermüdet sind: Der Schritt nach der Heimstätte ist schneller; ich schließe mich behaglich in meine vier Wände ein: »Niemand soll mir fortab einen Tag rauben, denn er kann mir nichts geben, was an Wert dem entspräche: Der Geist vertiefe sich ganz in sich selbst, widme sich ganz dem eigenen Dienste, treibe nichts, was sich nicht auf ihn bezieht, nichts, was vor den Richter gehört; alles Verlangen sei nur auf die Ruhe gerichtet, die von Sorgen für Staat oder einzelne Bürger nichts weiß.«
Aber wenn dann wieder eine kräftigere Lektüre den Mut aufgerichtet und leuchtende Beispiele anstachelnd gewirkt haben, dann regt sich wieder der Trieb nach dem Forum: Dem einen möchte ich meine Stimme leihen, dem anderen meine Dienste, um, wenn es auch nichts nützt, doch wenigstens den Versuch zu machen, ihm zu nützen; auch den Übermut mancher im Glück sich Überhebenden möchte ich dort vor aller Öffentlichkeit demütigen.
Was die Studien anlangt, so meine ich, es sei wahrlich besser, die Dinge selbst scharf ins Auge zu fassen und um ihrer willen zu reden, die Worte aber aus der Sache hervorwachsen zu lassen, dergestalt, dass der frei gestaltete Vortrag den Anforderungen der Sache folgt. »Wozu bedarf es denn schriftlich ausgearbeiteter Reden? Was hat es denn auf sich mit deinem Streben, die Nachwelt nicht über dich schweigen zu lassen! Zum Sterben bist du geboren, ein stilles Leichenbegängnis erfordert weniger Umständlichkeiten. Daher bringe, um Zeit zu gewinnen, zum eigenen Nutzen, nicht zum tönenden Nachruhm, in einfacher Schreibart etwas zu Papier; wer für das Erfordernis des Tages schreibt, der erspart sich unnötige Mühe.«