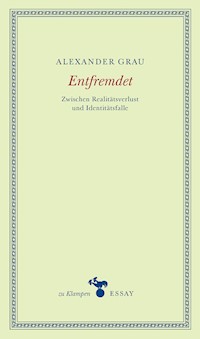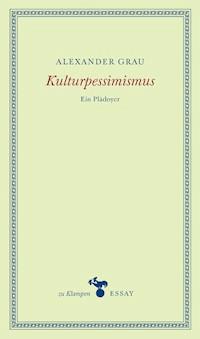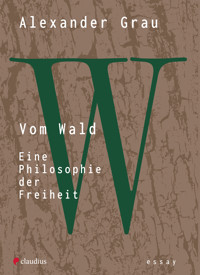
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wald ist Freiheit. Denn der Wald schafft Distanz. Er schirmt ab und lenkt den Blick auf unser Menschsein. Er ist der Ort, an dem man sich lösen kann von den Manipulationen und Einflüsterungen des Zeitgeistes. Und er konfrontiert uns mit dem Ursprung menschlicher Existenz. In seinem eindringlichen Essay entwirft Alexander Grau eine zeitgemäße Philosophie des Waldes jenseits von Naturkitsch und Esoterik. Dabei führt er den Leser durch die Kultur- und Ökologiegeschichte des Waldes ebenso wie durch die literarischen und philosophischen Projektionen, die unser Bild vom Wald in der Moderne geprägt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Grau
Vom Wald
Eine Philosophie der Freiheit
Für Julius
INHALT
Einleitung
Kapitel 1
Wald und Zeit
Kapitel 2
Der Wald und das Nichts
Kapitel 3
Die Wege der Freiheit
Kapitel 4
Die stille Rebellion
Kapitel 5
Wald und Revolte
Kapitel 6
Wald, Kontingenz, Freiheit
Literatur
Anmerkungen
Einleitung
Wald ist Freiheit. Wald schafft Distanz zum Alltag. Er schirmt ab und lenkt den Blick auf unser Menschsein. Er ist der Ort, an dem man sich von den Manipulationen und Einflüsterungen des Zeitgeistes lösen kann. Er gibt uns Raum für unser Bewusstsein und konfrontiert uns mit dem Ursprung menschlicher Existenz.
Das kann man zunächst ganz wörtlich verstehen. In diesem Sinne ist der Wald Erholungsgebiet, ein Ort zum Spazierengehen und Wandern, wo der räumlich und zeitlich eingepferchte Großstädter die Zwänge des Alltags hinter sich lassen kann. Hier ist Wald Freiheit in einem ganz konkreten Sinn. Raum der freien Zeit und der selbst gewählten Pfade für all jene, die ansonsten in enge Neubauwohnungen und starre Routinen eingepfercht sind.
Ohne jede Frage sind diese erlebten Freiheitsmomente wertvoll. Und es ist kein Zufall, dass sich mit der beginnenden Moderne die ersten Wanderbewegungen formieren, zunächst bei Studenten, romantischen Literaten und Künstlern, sehr bald aber auch als Massenphänomen der urbanen Mittelschicht. Der Wald mutierte zum Freizeitgebiet, in dem man für ein paar Stunden wandernd die frische Luft und die Stille genießt, bevor man sich wieder den alltäglichen Verpflichtungen widmen muss.
Angesichts unserer verwalteten und durchtechnisierten Welt ist es kein Wunder, dass Wandern, Wälder und Bäume eine so hohe Anziehungskraft auf den Menschen ausüben. Dauernde Erreichbarkeit, Reizüberflutung und ein beruflich wie privat überplanter Alltag innerhalb einer zunehmend sterilen Lebenswelt lassen instinktiv die Sehnsucht nach einem Raum jenseits technischer Verfügbarkeit, von Terminen und Verabredungen entstehen. Der Wald wird dem latent überforderten und von seinen anthropologischen Bedürfnissen abgeschnittenen Menschen der durchdigitalisierten Moderne zu einem Zufluchtsort, wo er Natürlichkeit, Authentizität und Gesundheit zu finden hofft.
In diesem Sinne vermittelt der Wald ein ganz praktisches und erlebbares Gefühl von Freiheit. Doch das vorliegende Buch versteht sich als philosophischer Essay. Dabei geht es weniger um Fragen der Freizeitgestaltung und deren Erholungswert. Vielmehr geht es um die Bedeutung des Waldes für unsere menschliche Existenz.
Denn der Wald ist zunächst ein Erfahrungsraum, den der Mensch sich in seiner Entwicklungsgeschichte nach und nach erschlossen hat und dessen Eigenarten ihn und sein Denken geprägt haben. Ohne den Lebensraum Wald wären wir andere Wesen. Wir würden uns anders bewegen, anders fühlen und uns anders verhalten. Und auch unser Selbstverständnis als Menschen ist entscheidend vom Wald und seiner spezifischen Form der Vegetation geprägt. Der Wald war nicht nur Ressource für Bau- und Brennmaterial, sondern auch ein Ort der Bewährung, der Bedrohung und der existenziellen Erfahrung. Eine entsprechende Bedeutung nimmt er etwa in Religionen ein, als Ort von Heiligtümern oder Wohnsitz von Göttern und Geistern.
Diese Eroberung des Lebensraumes Wald war nur möglich, weil sich im Laufe der Altsteinzeit eine Revolution ungeahnten Ausmaßes ereignete: Homo sapiens erfand die Kultur. Das koppelte den Menschen ab von der biologischen Evolution – mit dramatischen Folgen. Kulturtechniken wie die Herstellung von Kleidung, Waffen und Handwerkszeug ermöglichte es Homo sapiens, unwirtliche Regionen und Lebensräume für sich zu erschließen. Auch den Wald hätte der Mensch niemals ohne diese Fähigkeit zur kulturellen Anpassung erschließen können. Erst entsprechende Handwerkstechniken und Werkzeuge machten die dauerhafte Besiedlung großer waldreicher Gebiete überhaupt erst möglich und formten damit zugleich den Weltzugang der dadurch betroffenen Menschen.
Doch genau jener Kultur, die den Menschen befähigte, ausgedehnte Wälder dauerhaft zu bewohnen, stellte sich der Wald entgegen. Denn Kultur bedeutet Ordnung. Dementsprechend meinte cultura zunächst das gerodete Ackerland, das dem undurchdringlichen und unübersichtlichen Wald abgerungen wurde. Wälder aber sind nicht ordentlich. Sie widersetzen sich dem planenden Eingriff des Menschen. Wald ist daher nicht nur Lebensraum und Rohstofflieferant, er ist auch immer Antagonist der Zivilisation, da einmal gewonnene Kulturlandschaft immer wieder zu verwildern und zu verwalden droht. Wald ist Antikultur, die dort beginnt, wo die vom Menschen geschaffene landschaftliche und soziale Ordnung aufhört.
Deshalb war der Wald zugleich immer schon attraktiv für jene, die vor der Zivilisation fliehen wollten oder mussten. Das waren Kriminelle ebenso wie Ausgestoßene, Eigenbrötler, Einsiedler oder Sinnsucher aller Art. Der Wald war auch stets ein Ort der Anarchie.
Die Grenze zum Wald, auch wenn sie in früheren Jahrhunderten selten so eindeutig war wie in der modernen Raumbewirtschaftung, markierte für Jahrtausende zugleich die Grenze der menschlichen Kultur als Ordnungsprinzip und Garant von Berechenbarkeit und Sicherheit. Denn der Wald ist nicht nur unübersichtlich und undurchdringlich. Wald bedeutet auch permanenter Wandel und Vergänglichkeit. Im Wald wird sich der Mensch am eindringlichsten des unablässigen Umbaus, der andauernden Veränderungen der Welt bewusst. Nichts ist hier von Dauer, nichts hat Bestand. Ackerflächen, die vor zwei Jahren angelegt wurden, sind heute schon zugewachsen. Pfade, die noch vor Kurzem passierbar waren, sind heute kaum zu erkennen. Mehr als jeder andere Landschaftstyp ist der Wald ein Ort der Unsicherheit und des Unberechenbaren – der permanenten Kontingenzerfahrung.
Diese Kontingenzerfahrung erlebt der Mensch als zutiefst zwiespältig. Einerseits ist der Wald dunkel, unübersichtlich, bedrohlich und unheimlich. Zahlreiche Mythen und Märchen ranken sich daher um diesen düsteren Aspekt des Waldes, seine Gefährlichkeit. Aufgrund seiner Unüberschaubarkeit und Diffusität war der Wald zugleich aber auch immer ein Ort der Verzauberung, des Unwirklichen, der Erlösung. Er war Sehnsuchtsort, Ort der Besinnung und Selbstfindung, Hort nicht nur von bösen Geistern, sondern auch von guten Göttern, freundlichen Kobolden und Feen. Auch davon handeln viele Sagen und Erzählungen.
Der Wald ist somit nicht nur Ort eindringlicher Kontingenzerfahrung, sondern auch eines fundamentalen Ambivalenzerlebens – unheimlicher Ort der Bedrohung und zugleich verklärter Ort innerer oder äußerer Erlösung. Beides, Kontingenz und Ambivalenz, hängen unmittelbar zusammen. Im Wald erfährt der Mensch die Möglichkeit, dass jeder Augenblick, jede Situation auch anders sein könnte. Dieses Zerbrechen der Ordnung ist einerseits zutiefst beunruhigend und verunsichernd. Andererseits wohnt dieser Unberechenbarkeit aber auch etwas Magisches und Befreiendes inne.
Natürlich kann man auch auf dem Meer oder im Gebirge böse Überraschungen erleben. Ein Wetterwechsel, ein Steinschlag, ein plötzlich aufziehender Sturm kann zur unvorhergesehenen Gefahr werden. Doch es ist kein Zufall, dass diese Landschaften geradezu symbolhaft für das Ewige und Unverrückbare stehen. Nicht zuletzt in der Philosophiegeschichte versinnbildlichen Gebirge und Meer Übersichtlichkeit, Klarheit und Zeitlosigkeit: Versunken in tiefschürfende Gedanken und auf der Suche nach ewigen Wahrheiten richtet der Denker versonnen seinen Blick auf den Meereshorizont oder die Erhabenheit der Berge. Entsprechend sahen Philosophen aller Zeiten in der Weite der Ozeane und der Majestät der Gebirge geradezu Allegorien des Denkens, die das Philosophieren zudem ästhetisch aufwerteten und ihm Pathos und Majestät verliehen.
Damit verbunden war der Anspruch der Philosophie, Wahrheiten und Einsichten zu verkünden, die genauso ewig, unverrückbar und grenzenlos sind wie Meere oder Gebirge. Der so erhobene Absolutheitsanspruch hat allerdings unverkennbar totalitäre Züge. Denn wo ewige Wahrheiten gelten, ist kein Platz für Individualität, Nonkonformismus oder Relativität. Die Erhabenheit der Gebirge und die ewige Weite des Meeres stehen für die Idee einer universalen und dauerhaften Wahrheit, die alle Kulturen, Traditionen und Individuen in das harte Korsett objektiver Erkenntnis schnürt. Sie werden zu Symbolen des umfassenden Geltungsanspruchs einer angeblich überzeitlichen Vernunft.
Anders der Wald. Hier ist nichts ewig. Hier ist nichts zeitlos. Und statisch ist hier schon einmal gar nichts. Wald bedeutet Veränderung, Zeitlichkeit und Relativität. Diese Erfahrung von Kontingenz und Ambivalenz ist bedrohlich. Die Welt zeigt sich als unberechenbar und willkürlich. Sicherheit und Planbarkeit entlarven sich als Selbsttäuschung. Der Mensch erlebt im Wald einen permanenten Kontrollverlust und ein tief greifendes Ausgeliefertsein. Hier wird er zurückgeworfen auf die Wirklichkeit seiner Existenz. Das Planbare, der versichernde Blick in die weite Ferne erweist sich als Illusion. Der Eindruck des erhabenen Überblicks zeigt sich als naive Selbsttäuschung.
Die Schaffung von cultura durch Rodung ist jedoch nicht nur der Versuch der Kontingenzbewältigung mittels der Axt, sondern zugleich eine Revolte gegen die Vergänglichkeit. Erst mit bestelltem Land, mit kulturell erschlossenem Raum schafft sich der Mensch einen Ort zumindest symbolischer Überzeitlichkeit. Die Äcker und Weiden, die Siedlungen und Wege sind nicht nur praktische Lebensbedingungen, sondern zugleich Ausdruck des existenziellen Bedürfnisses, die Endlichkeit zu überwinden und der Vergänglichkeit die Idee des Ewigen entgegenzusetzen. Indem der Mensch Räume der Ordnung schafft, überwindet er zumindest temporär die eigene Todesfurcht und schafft Orte der Kontinuität und Berechenbarkeit in einer Welt andauernder Veränderung.
Doch nichts ist ewig. Am allerwenigsten cultura. Permanent versucht der Wald sich zurückzuholen, was ihm zuvor mühsam abgerungen wurde. Zivilisation erweist sich als temporär. Nicht nur Äcker und Weiden zeigen sich als fragile Schöpfungen. Jedes Haus, jedes Dorf, jedes Heiligtum ist dem Verfall anheimgegeben und wird früher oder später wieder überwuchert. Caspar David Friedrich hat diese Szenen des Zerfalls und das Übergreifen des Waldes auf die Ewigkeitsansprüche des Menschen in seiner „Klosterruine Eldena“ symbolisch dargestellt.
Durch den Wald wird der Mensch mehr als in jeder anderen Landschaft mit seiner Ohnmacht konfrontiert, mit der Vergeblichkeit seines Bemühens, Ewiges zu schaffen. Das endliche Wesen Mensch wird auf die Endlichkeit selbst zurückgeworfen. Der Wald kuriert von dem Größenwahn, die eigene Existenz, das eigene Schaffen, die eigenen Vorstellungen ins Unendliche erheben zu wollen.
Im Wald erlebt der Mensch somit das Scheitern seiner naiven Selbsterhöhungsträume. Der Wald stutzt zurecht. Nicht nur kollektive Ewigkeitsfantasien und Absolutheitsansprüche erweisen sich als naive Fantasie. Auch die individuelle Selbstermächtigung über das eigene begrenzte Leben entlarvt sich als narzisstisches Märchen. Jeder Mensch, jede Biografie ist das Produkt einer Reihe von Zufällen und eben nicht von individueller Planung oder persönlicher Wahl. Im Idealfall wird der Mensch bescheiden und begreift sich als Sisyphos, der fortwährend versucht, der Welt Stabilität, Ordnung und Sinn abzuringen, ohne Chance, dass dies dauerhaft gelingt.
Doch die Unberechenbarkeit und Absurdität der Welt ist nicht nur eine Last, sie ist zugleich die Bedingung für die Freiheit des Menschen. Gäbe es einen übergeordneten Plan, ein höheres Gesetz, eine Vorherbestimmung oder ein Ziel der Geschichte, das individuelle Leben wäre eingekerkert in einen Masterplan. Freiheit wäre dann nichts anderes als die sinnlose Revolte gegen eine übermächtige Ordnung oder einen unentrinnbaren Weltmechanismus. Erst der Zufall und die Beliebigkeit der Welt eröffnen dem Menschen jenen Spielraum, den er für die Entfaltung seiner Freiheit benötigt. Mehr noch: Eben, weil die Welt kontingent ist und keinen höheren Sinngesetzen folgt, ist der Mensch zur Freiheit verurteilt. Zugleich aber verhindert der Zufall in Gestalt des Schicksals die Verabsolutierung menschlicher Freiheit. Denn die Unberechenbarkeit der Welt macht den Menschen nicht nur frei, sie limitiert zugleich seine Freiheit, da jeden Moment Unvorhergesehenes eintreten könnte, die seine Pläne, Hoffnung und Projekte umgehend Makulatur werden lassen.
Der Wald lehrt, dass nichts absolut ist. Weder die Freiheit des Menschen noch seine Unfreiheit. Und auch selbst der Zufall ist relativ. Denn das Zufällige, das jeden Menschen ereilen kann, ist nicht Ausdruck des einen Zufalls, sondern eben eine Aneinanderreihung kontingenter Zufälle. Und weil das so ist, bewahrt die Zufälligkeit der Zufälle den Menschen vor einem Gefangensein in einem determinierenden Chaos. So erwächst aus der Erfahrung mit dem Wald nicht nur das Bewusstsein für Endlichkeit und Kontingenz, sondern auch für Relativität, die aus seiner Unberechenbarkeit und seiner permanenten Veränderung erwächst. Der Wald ist Landschaft gewordener „Abschied vom Prinzipiellen“1.
In diesem Sinne erzieht die Erfahrung im und mit dem Wald zugleich zur Skepsis. Denn Skepsis bedeutet, dem Absolutheitswahn der auf Ewigkeit, Objektivität und Unendlichkeit fokussierten Philosophien und Ideologien zu entsagen. Erst die Skepsis, die aus der Kontingenzerfahrung und dem Ambivalenzerleben erwächst, macht auch geistig frei. Das gilt zumindest dann, wenn die Skepsis nicht ihrerseits zur Dogmatik wird, sondern Ausdruck der Limitiertheit eines endlichen Wesens in einer kontingenten und endlichen Umwelt.
Freiheit gibt es nur im Plural. Wer von der einen Freiheit redet, meint nicht Freiheit, sondern eine intellektuelle Konstruktion, die unfrei macht. Frei ist der Mensch nur, wo es Freiheit en gibt. Nur Ideologen sprechen von der Freiheit und meinen damit zumeist das, was sie unter Freiheit verstehen. Zugleich ist Freiheit niemals absolut. Denn auch absolute Freiheit macht unfrei. Zumindest in einer Welt, die unberechenbar ist und endlich.
Das Befreiende der Freiheiten liegt in dem Pluralismus, der aus der faktischen Begrenztheit und der Kontingenz der Welt folgt. Er bewahrt das Individuum davor, die eigene praktische Freiheit zugunsten einer Freiheitsdogmatik aufzugeben. Wer sich zwanghaft von allem befreien möchte, auch von den Zufällen und Unberechenbarkeiten der Welt, baut sich ein Gefängnis aus einer in letzter Konsequenz totalitären Freiheitsideologie. Auch der ideologische Zwang zur Freiheit kann in Unfreiheit münden.
Der Wald ist das Symbol und der Erfahrungsraum für alles Relative, Begrenzte und Endliche, für Werden und Vergehen, mithin für alles Nicht-Absolute. Im Wald erlebt der Mensch seine Beschränktheit ebenso wie die Autonomie, die aus der Kontingenz einer endlichen Welt erwächst. Diese Facetten der Freiheit sind in zahlreichen Märchen, Gedichten, Erzählungen, Romanen und Essays wieder und wieder behandelt worden. Leitmotiv ist dabei immer die Ambivalenz des Waldes als Ort des Unheimlichen und Bedrohlichen einerseits sowie der Entrückung, Verzauberung und Freiheit andererseits. Entsprechend steht diese Janusköpfigkeit des Waldes am Beginn der neuzeitlichen Dichtung. „Als unseres Lebens Mitte ich erklommen, befand ich mich in einem dunklen Wald, da ich vom rechten Wege abgekommen“2, lauten die berühmten ersten Zeilen von Dantes Göttlicher Komödie.
Der Wald, in den sich Dante hier versetzt sieht, ist erkennbar die eigene Sündhaftigkeit. In der Mitte des Lebens hat Dante so viel Fehler, Irrtümer und Verfehlungen begangen, dass er sich wie in einem dunklen Wald befindet, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt und – so darf man wohl die Dunkelheit des Waldes interpretieren – das Licht Gottes nicht mehr scheint. Vom rechten Weg abgekommen, beginnt Dante sich zu fürchten: „Wie schwer ist’s, zu beschreiben die Gestalt der dichten, wilden, dornigen Waldeshallen, die, denk ich dran, erneun der Furcht Gewalt!“3 Der Held fürchtet sich vor dem Wald selbst. Nicht vor wilden Tieren oder irgendwelchen Räubern. Der Wald an sich ist das Ängstigende und Unheimliche. Wie genau Dante aus dem Wald herausfindet, erklärt er nicht. Plötzlich aber steht er am Fuß eines Hügels. Als er emporschaut, sieht er „des Berges Grat bereits im Strahlenkleide, der recht uns führt auf einem jeden Pfad“4. Doch so einfach ist das Entkommen aus dem Wald nicht. Dante treten zunächst drei Raubtiere entgegen: erst ein Leopard, dann ein Löwe und schließlich eine Wölfin. Diese Allegorien auf Wollust, Hochmut und Habsucht verhindern, dass er dem vor ihm liegenden Pfad folgen kann. Aus der misslichen Situation errettet ihn erst der Dichter Vergil als Repräsentant der menschlichen Vernunft, die allein aus dem dunklen Wald, der selva oscura, und den Versuchungen der Sünde zu führen vermag.
Durch Hölle und über den Läuterungsberg gelangen Vergil und Dante schließlich an eine Feuerwand, die beide durchschreiten. Es wird Nacht. Wieder schläft Dante ein. Diesmal jedoch erwacht er nicht in der selva oscura, sondern findet sich am Aufstieg zum irdischen Paradies, wo ihn Vergil verlässt. Dante ist nun befreit. Die Läuterung hat ihn „frei, recht und heil“5 gemacht. Zunächst durchstreift er den Wald des irdischen Paradieses. Der stellt sich ihm ganz anders dar als der dunkle Wald seiner Sünden: „Zu streifen lüstern schon im Gotteshag und seiner dichten, immergrünen Zelle, durch die gedämpft nur drang der neue Tag, verließ ich ohne Aufenthalt die Schwelle und zog gemächlich durch die ebnen Gründe, darin es duftete an jeder Stelle.“6
Der Wald des irdischen Paradieses ist nicht selbst geläutert, Dante ist es. Als er tiefer in diesen alten Wald (selva antica) eindringt, kommt er an einen Bach, der heller und klarer ist als alle Wasser, die er bis dahin gesehen hat, „mag auch sein Lauf hier noch so dunkel sein“7. Die durch seine Läuterung erlangte Freiheit ermöglicht es Dante, die Pfade des Waldes, in denen er sich am Anfang seiner Wanderschaft noch verirrte und die ihm düster und bedrohlich erschienen, sicher zu durchschreiten. Obwohl sie nach wie vor dunkel sind, erscheinen sie nun hell und klar. Erst nachdem Dante sich von seiner Vergangenheit losgelöst hat und somit ein freier Mensch geworden ist, vermag er das Helle im Dunkeln zu erkennen und sieht, dass der Wald lediglich selva antica ist, also kein gefahrvoller, sondern ein alter Wald, licht und sanft, in dem es helle Bäche und Blumenwiesen gibt. Der Wald, am Anfang bedrohlicher Urwald, ist nun für den freien Betrachter parkähnliches Arkadien.
Dante hat mit seinem Bild von der selva oscura und der selva antica die Ambivalenz des Waldes, die die europäische Kunst bis in unsere Gegenwart beschäftigt, erstmals deutlich beschrieben, wenngleich in der Bildsprache seiner spätmittelalterlichen Welt. Der Wald verliert für den freien und autonomen Menschen jede Bedrohlichkeit und wird zu einem Ort des Findens und Selbstfindens. Der Wald ist nicht länger Symbol für Angst und Verfehlung, sondern für deren Überwindung.
Dieses Spannungsfeld zwischen Bedrohung und Erlösung durchzieht die gesamte Deutungsgeschichte des Waldes. Sie ist letztlich der Mehrdeutigkeit des Waldes selbst geschuldet, die es erlaubt, immer wieder neu und immer wieder anders vom Wald als Ort des Geheimnisses und der Befreiung zu erzählen – von den Märchen der Brüder Grimm bis zu David Lynchs legendärer Fernsehserie Twin Peaks.
Genau diese emanzipatorische Seite des Walderlebens und der Walddeutung wurde in der Vergangenheit häufig übersehen. Insbesondere von konservativer Seite galt der Wald eher als Hort nationaler Besinnung und deutscher Eigenart und damit nicht zuletzt als Symbol einer sich gegen westlichen Individualismus und Liberalismus stellenden Kultur. Das hatte umgekehrt zur Folge, dass nicht nur Linke oder Linksliberale den Wald als Topos für autoritätshörige Provinzialität, dumpfen Kollektivismus und einen emanzipationsfeindlichen Antiindividualismus ansahen.8
Der vorliegende Essay will diesen ideologischen Klischees widersprechen. Der Wald ist alles andere als ein Ort eines autoritären und freiheitsfeindlichen Denkens, im Gegenteil. Der Wald ist ein Ort der Freiheit. Und das meint: Er ist ein Raum eines umfassenden Freiheitserlebens, das allerdings unterschiedliche Ursachen haben kann und auf unterschiedlichen Waldwahrnehmungen beruht. Sie reichen von der existenziellen Erschütterung durch den Wald als ängstigenden Raum über seine Rolle als den Blick für die gesellschaftlichen Realitäten schärfende Sphäre der Natürlichkeit bis hin zu seiner Funktion als Fluchtort vor den entfremdenden Verwerfungen der Moderne und letzte Möglichkeit, der Allgegenwart der den Menschen fesselnden Ideologien und Wahnsysteme der Gesellschaft zu entgehen.
Diesen verschiedenen Facetten, durch und mit dem Wald Freiheit zu erleben und zur Freiheit zu gelangen, wird im Folgenden nachgegangen. Ich beschränke mich dafür auf die Literatur der Moderne9, beginnend bei den Brüdern Grimm bis zu Ernst Jünger und Jean-Paul Sartre. Es zeigt sich, dass der Wald nicht nur aufgrund sich ändernder technischer und historischer Bedingungen, sondern auch aufgrund ganz verschiedener Empfindungen befreiend wirkt. Gemeinsam ist allen Freiheitserlebnissen jedoch, dass der Wald Distanz von der gewohnten Gesellschaft und ihren vor allem geistigen Zwängen schafft.
Doch die Weite des Walderlebens gründet wie schon gesagt auch in der Vieldeutigkeit des Waldes selbst. Eben weil die Landschaft Wald ambivalent und fluide ist, eröffnet sie nicht nur das eine Erleben von Kontingenz und Mehrdeutigkeit, sondern einen Pluralismus von Freiheitsbegründungen und Freiheitserfahrungen. Der Pluralismus der Freiheiten wird im Wald erlebbar und ist entsprechend in der Literatur und gedanklichen Verarbeitung von Walderfahrungen präsent. Diese verschiedenen Facetten freiheitlicher Walderfahrung werden in den folgenden Abschnitten genauer betrachtet und zu einer Philosophie der Freiheit zusammengeführt. Grundlage für all das ist jedoch der Erlebnisraum Wald selbst. Mit ihm und seiner Bedeutung für den Menschen, seinen Körper, sein Denken, seine Kultur, hat alles begonnen.
Kapitel 1 Wald und Zeit
Ein schmaler Pfad führt den Hang entlang. Zwischen Bäumen, Baumstümpfen, Felsen und Ästen schlängelt er sich den Berg hinauf. Es ist Spätsommer. Das Grün der Bäume hat schon vor Wochen seine Frische verloren. Doch das Sonnenlicht verfängt sich noch überraschend kraftvoll in der Nachmittagsluft. Der Geruch von feuchtem Holz, altem Laub und Moosen liegt wie eine Decke über dem Waldboden. Massive Wurzeln und bemoostes Gestein machen den Aufstieg mühsam. Vermoderte und entrindete Baumstämme versperren den Weg.
In den Berghang klammern sich Bergahorn, Fichten, Rotbuchen und Weißtannen. Hin und wieder sieht man eine Bergulme. Die Granitblöcke, die wie hingewürfelt zwischen den Bäumen liegen, sind mit Schwefelflechten und Moosen überzogen. Schließlich wird der Boden immer morastiger. Rinnsale bahnen sich ihren Weg ins Tal. Jeder Schritt quetscht Wasser aus dem Boden. Ein Bach gurgelt in Kaskaden in die Tiefe, spült sich über Felsformationen, Äste und Wurzeln. Die Luft ist hier noch feuchter und satter.
Über die Jahrhunderte hat das Wasser sich seinen Weg gebahnt und wurde immer wieder umgelenkt durch herabstürzende Felsen, Bäume, die sich ihm in den Weg stellten, durch Äste und umgestürzte Stämme. Gebirgs-Frauenfarn flankiert den Wasserlauf. Weiter oben, an und jenseits der Abbruchkante, findet sich mitunter Siebenstern oder Sonnentau. Formationen aus Gneis türmen sich hangaufwärts.
Ich bin im Höllbachgspreng, einer felsigen Mulde am östlichen Abhang des Großen Falkenstein im Bayerischen Wald. Ein „Gspreng“ ist ein durch Felsen und Unterholz schwer zugängliches Waldgelände. Der namensgebende Höllbach entspringt etwas oberhalb, an dem Gebirgssattel, der den Falkenstein mit dem Lindberg verbindet und von dort über mehrere Wasserfälle und Rinnsale in einem Triftteich mündet, von dem aus er weiter bergab fließt. Weshalb der Bach Höllbach heißt, ist nicht schwer zu erraten. Die zerklüfteten Felsformationen des Höllbachgspreng, die steilen Granitkaskaden, über die das Wasser in die Tiefe rauscht, die vermoosten Stämme, die wie Mikadohölzer kreuz und quer übereinanderliegen, das alles hat selbst an sonnigen Tagen etwas Düsteres. Es bedarf keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen, dass Menschen in früheren Zeiten hier Unheil ahnten oder gar den Zugang in die Unterwelt.