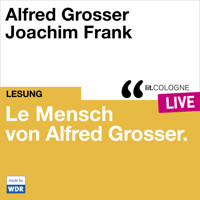9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Shoah prägt bis zum heutigen Tag das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel, zwischen Juden und Nichtjuden. Aber sind wirklich alle politischen und moralischen Folgerungen, die aus ihr gezogen werden, gerechtfertigt? Alfred Grosser wirft einen kritischen Blick darauf, wie nach 1945 mit der mörderischen Vergangenheit umgegangen wurde. Im Land der Täter, aber auch im Land der Opfer – das sich seitdem im Konflikt mit der arabischen Bevölkerung der Region befindet. Grosser ist davon überzeugt: Wer verhindern will, dass ganze Gruppen Opfer von Verbrechen werden, muss die Einhaltung der Menschenrechte immer und überall einfordern. Sie dürfen für Muslime nicht weniger gelten als für Juden – in Palästina, aber auch in Europa selbst. So ist dieses Buch ein sehr persönliches Plädoyer für eine universalistische Ethik, die den Respekt vor dem Leiden des Anderen in den Mittelpunkt stellt. Eine Grundhaltung, die kaum jemand so konsequent vertreten hat wie Grosser seit mehr als fünfzig Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Alfred Grosser
Von Auschwitz nach Jerusalem
Über Deutschland und Israel
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Identitäten, «kollektive» und schöpferische Erinnerung
Die Schuldfrage
Vergleichen
Der vereinfachte Feind: der Islam
Schwieriges Israel
Deutschland, Israel, Juden und Muslime
Ausblick: der Andere
EINLEITUNG
In diesem Buch geht es um ein Thema, bei dem man zunächst klarstellen muss, wer schreibt und warum. Denn gegen Kritik an der Politik des Staates Israel werden immer wieder gravierende Vorwürfe erhoben: Sie bediene antisemitische Klischees oder sei sogar selbst Ausdruck von Antisemitismus. Und sollte der Kritiker, wie in meinem Fall, Jude sein, so muss er sich den berühmten jüdischen Selbsthass unterstellen lassen.
In einer Zuschrift, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht hat, erwiderte ich daraufhin: «Ich habe seit vielen Jahrzehnten das ständige Glück, glücklich zu sein. In der Familie und im vielseitigen Beruf. Aber gerade weil ich fast immer in Glück und Freude gelebt habe, habe ich mir seit jungen Jahren die Pflicht auferlegt, mich so gut es ging um Unglückliche zu kümmern, was nun deren Identität auch sein mochte. Selbsthass? ‹Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst› – oft habe ich den Eindruck, ich liebte mich zu sehr!»
Im Ernst: Wahrscheinlich würde ich anders schreiben, wenn ich wirklich das Schlimmste durchgemacht hätte, die Folter, die Deportation, die KZs. Wahrscheinlich, aber nicht sicher. Es wird noch von Frauen und Männern die Rede sein, denen es auch nach unendlichem Leiden gelang, ein freudiges Leben zu führen, indem sie sich schöpferisch einsetzten.
Als ich 1933 im Alter von acht Jahren mit meiner Familie nach Frankreich emigrierte, hinterließ das bei mir keinen tiefen inneren Riss. Das lag nicht daran, dass ich meine Heimatstadt Frankfurt hätte aus eigenem Antrieb verlassen wollen, nachdem ich als kleines Judenkind von Klassenkameraden auf dem Schulhof verprügelt worden war – dieses Erlebnis hat wirklich keine geistigen Spuren hinterlassen. Der Grund war ganz einfach, dass man als Kind noch keine Wurzeln geschlagen hat, außer in der Familie.
Leider starb mein Vater wenige Wochen nach unserer Ankunft in Saint Germain en Laye bei Paris. Später erhielt meine Mutter von der Bundesrepublik nur eine winzige Rente, weil sie nicht beweisen konnte, dass das Herzversagen des 54-Jährigen etwas mit der Emigration zu tun gehabt hatte.
Aus Frankfurt habe ich ein Buch mitgebracht, das ich noch heute von Zeit zu Zeit lese. Es heißt Der Schädel des Negerhäuptlings Makaua. Kriegsroman für die junge Generation und beruht auf einer wahren Begebenheit. Kaiserliche Truppen hatten dem Anführer eines Kolonialaufstandes den Kopf abgeschlagen und mit nach Deutschland genommen; Artikel 246 des Versailler Vertrages forderte seine Rückgabe. Der Roman spielt im Ersten Weltkrieg und benutzt den Schädel für ein Gleichnis, das alle Motive, deretwegen Menschen in den Krieg ziehen, ad absurdum führt.
Eine Stelle war bei Erscheinen des Werks 1931 weitgehend prophetisch. Der junge polnische Held begleitet einen jüdischen Unteroffizier, im Zivilleben Rechtsanwalt, ins kleine Geschäft eines alten polnischen Juden, wo sie für das Regiment einkaufen wollen. Als der Alte dem Kunden vorwirft, eine Uniform zu tragen, entgegnet dieser: «Ich will nicht, dass man sagt, die Juden seien feig.»
Darauf der Alte: «Ihr Deitschen werden kämpfen und siegen und zum Schluss ihr haben verloren… Was meinste würden dann sagen die Großmächtigen in Deitschland? Sie werden sagen: Jetzt machen wir ä neuer Krieg, ä Krieg der nix kostet und einbringt Geld, jetzt machen wir Krieg gegen die Juden. Gegen die Juden im Land. Und dann werden se Krieg machen gegen dich und all deine Leut und zerstören dein Haus und erschlagen dein Weib. Und das wird sein ihr Dank, dass du hast getragen den blutigen Rock.»
Ich wusste, dass mein Vater vier Jahre lang an der «Westfront» in Frankreich als Stabsarzt eingesetzt gewesen und mit dem Eisernen Kreuz 1.Klasse ausgezeichnet worden war. Dass später Juden massenweise ermordet werden sollten, ahnte ich damals freilich nicht.
Wir integrierten uns rasch in unsere neue Heimat, und schon am 1.Oktober 1937 erhielten meine Mutter und wir zwei Kinder die französische Staatsbürgerschaft. Als die Wehrmacht im Juni 1940 auf Paris zumarschierte, flohen meine drei Jahre ältere Schwester und ich per Fahrrad nach Süden. Meine Mutter blieb bei ihrer achtzigjährigen Mutter, die 1938 aus Frankfurt zu uns gekommen war und im Krankenhaus lag. Dort starb sie Ende Juli, sodass unsere Mutter hinterherkommen konnte und uns in Südfrankreich wiederfand. Meine Schwester hatte sich jedoch durch das Radfahren während ihrer Regel eine Blutvergiftung zugezogen, die ihren Tod im April 1941 verursachte.
In der zunächst unbesetzten, dann von den Italienern eher wohlwollend besetzten Provence ließ es sich einigermaßen normal leben. Im September 1943 verschwanden meine Mutter und ich, bevor die Deutschen eintrafen – sie in ein Kinderheim in Cannes, ich nach Marseille, wo ich mit falschen Papieren an einer katholischen Schule unterrichtete. Ich gestehe, dass ich erst lange Jahre danach erkannt und anerkannt habe, welches enorme Risiko der Direktor auf sich genommen hatte. (Er allein wusste, dass der neunzehnjährige Lehrer Jude war.)
Es war in Marseille, als ich eines Abends im August 1944 durch eine Sendung der BBC erfuhr, dass die älteren Insassen des Lagers Theresienstadt nach Auschwitz abtransportiert worden seien. Darunter waren wahrscheinlich die Schwester meines Vaters und ihr Mann, ein Berliner Arzt, der nicht hatte auswandern wollen. (Viele Jahre später berichtete mir eine Frankfurter Forscherin, dass ihre Namen in der Tat auf der Liste einer der letzten Transporte stehen). Ich hatte als Kind einige Wochen bei Tante Ida und Onkel Kurt verbracht.
Der Schlag war hart. Ich habe in dieser Nacht wenig geschlafen. Am nächsten Morgen war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt, seien die Verbrechen noch so groß und die Verbrecher und ihre Mittäter noch so zahlreich. Warum ich der Versuchung widerstand, «DIE Deutschen» zu denken und zu sagen, möchte ich im folgenden Kapitel erläutern.
Jedenfalls wurde ich bald in meiner Auffassung bestätigt. Nachdem Marseille von amerikanischen Truppen befreit worden war, besuchte ich einen Freund im Krankenhaus, der einen Granatensplitter in der Leber hatte und nach einigen Tagen großen Leidens verschied. Im Nebenbett erholte sich ein achtzehnjähriger deutscher Soldat von einer Verwundung, mit ihm unterhielt ich mich während der langen Besuche öfters. So, wie ich Deutsch sprach, glaubte er zunächst, ich könnte nur ein Deutscher sein. Dann machte ich jedoch Fehler, zum Beispiel, indem ich – wie in England und Frankreich üblich – «Siegfriedlinie» anstatt «Westwall» sagte.
Ich stellte ihm mehr Fragen, als er mir stellte. Es war klar, dass er wenig wusste und ein gläubiger Hitlerjunge gewesen war; als Soldat hatte er darauf vertraut, dass die Wehrmacht den Krieg ritterlich führe. An diesem Krankenbett dürfte ich zu der Überzeugung gelangt sein, dass ich mitverantwortlich sei für seine Zukunft und für die seiner deutschen Altersgenossen.
Wenn ich später den Film Der Untergang vorstellte – für Lehrer, Schüler oder ein allgemeines Publikum–, habe ich jedes Mal auf die sieben oder acht Pimpfe hingewiesen, die kurz vor dem Schluss von Hitler mit dem Eisernen Kreuz behängt wurden, und gesagt: «Diese Jungen dort zur pluralistischen Demokratie zu führen war unsere deutsch-französische Nachkriegsaufgabe, in gemeinsamer Verantwortung.»
Diese Auffassung hatte ich bereits im Oktober 1947 zum Ausdruck gebracht, am Ende einer Artikelreihe über Jugend in Deutschland, die in der Widerstandszeitung Combat erschien. Zuvor war ich als junger agrégé de l’Université (Studienrat) und Journalist zum ersten Mal wieder durch meine alte Heimat gereist und sechs Wochen lang in den drei Westzonen unterwegs gewesen. In Frankfurt hatte mich der Oberbürgermeister freundlich empfangen. Walter Kolb war Insasse des KZ Buchenwald gewesen. Wie recht hatte ich doch, die Kollektivschuld abzulehnen!
Im folgenden Jahr verbrachte ich einen Tag auf dem Höllhof. So hieß ein Haus im Schwarzwald, in dem ein weitsichtiger französischer Besatzungsbeamter eine Art Ausbildungsstätte für ehemalige HJ-Führer eingerichtet hatte. Drei Wochen lang wurden Dutzende junger Männer, die nicht durch Verbrechen persönlich belastet waren, mit Menschen in Kontakt gebracht, die ihnen früher wohl eher als Feindbilder begegnet waren: Gewerkschafter, Widerstandskämpfer, demokratische Politiker und Ausländer. Diplome gab es am Schluss keine. Der Sinn der Sache war, ihre Ignoranz aufzubrechen, sie dadurch von ihrem alten Nationalismus zu kurieren und vor einem neuem zu bewahren.
Zu Beginn hatte ich ein ungutes Gefühl. Wenn einer von ihnen vor wenigen Jahren den Befehl bekommen hätte, mich in eine Gaskammer zu schieben, so hätte er es getan. Aber in den Diskussionen zeigten die jungen Männer Wissbegierde und die Bereitschaft, über ihre Wertvorstellungen nachzudenken. Ein halbes Jahrhundert später durfte ich zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten des örtlichen Wahlkreises, Wolfgang Schäuble, die Gründung des Höllhofs mitfeiern. Ich fühlte mich berechtigt, darauf hinzuweisen, dass kaum einer der Kursteilnehmer später den Republikanern oder der NPD beigetreten sei.
Es hatte sich also herausgestellt, dass eine Erziehung zum Fanatismus nicht notwendigerweise einen unüberwindbaren Fanatismus erzeugt. Das zeigt ja auch der Aufstand von 1956 und noch mehr der von 1968.Die jungen Ungarn, die sich damals im Namen der Freiheit erhoben, hatten ein Jahrzehnt Indoktrinierung hinter sich, die jungen Tschechen sogar zwölf Jahre mehr.
Bei den ehemaligen HJ-Führern in Höllhof ging es gleichermaßen um die Vermittlung von Wissen wie um die Herausbildung eines Gewissens. Man könnte auch sagen, sie sollten eine Definition anwenden lernen, die ich gern gebrauche: penser juste, c’est penser avec justesse et avec justice (Richtig denken heißt zugleich mit – logischer – Richtigkeit und mit Gerechtigkeit). Doch was heißt gerecht? Und wie verhält man sich entsprechend? Das ist oft schwer zu bestimmen, aber zwei Wege stehen offen. Den einen hat Bundespräsident Roman Herzog angesprochen, als er bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1995 seine schöne Laudatio auf die Orientalistin Annemarie Schimmel hielt: die «Suche nach einem kulturübergreifenden ethischen Minimum.»
Diese Suche bestimmt weitgehend den Inhalt dieses Buches. Sie sollte in meinen Augen immer verbunden sein mit dem zweiten Weg: Jeder Gruppe Unbequemes zu sagen, damit sie sich auch mit den Augen der Anderen betrachte.
Anfang September 1989 habe ich zwei Reden zum fünfzigsten Jahrestag des Kriegsbeginns gehalten, eine davon in einer Kölner katholischen Kirche. Ich sprach ausführlich über den Verrat, den der Vatikan durch das Konkordat im Juli 1933 an der Zentrumspartei begangen hatte, und überhaupt darüber, wie sich die meisten deutschen Kirchenfürsten den neuen Machthabern unterworfen hatten – und sei es nur, indem sie sofort das Verbot aufhoben, der Nazi-Partei beizutreten.
Am nächsten Tag sprach ich auf einer DGB-Kundgebung in der Dortmunder Westfalenhalle. Dort erklärte ich, wie der Allgemeine Gewerkschaftsbund versucht hatte, sich zu retten, indem er am 1.Mai 1933, nun «Tag der nationalen Arbeit», mitmarschierte, was nicht verhinderte, dass am 2.Mai die Gewerkschaftshäuser geschlossen und Gewerkschaftsführer verhaftet wurden.
Hätte ich für die Katholiken die Gewerkschaften gebrandmarkt und bei den Gewerkschaften die katholische Kirche, so hätte ich als Demagoge gesprochen, nicht als Pädagoge. (Ich scheue nicht davor zurück, mich so zu bezeichnen. Einmal sollte sich bei einem Karl-Jaspers-Kolloquium in Heidelberg jeder Teilnehmer vorstellen – als Philosoph, als Soziologe, als Politologe, als Theologe oder als Historiker. Lächelnd wurde ich gefragt, was ich nun eigentlich sei. Ich antwortete: «Moralpädagoge.»)
In meiner Dankrede für den Friedenspreis 1975 hatte ich hart gegen den «Radikalenerlass» gesprochen. Er wurde vor allem gegen Linke angewandt, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollten. Kurz darauf folgte ich einer Einladung, an einer Kundgebung für einen davon betroffenen Lehrer im Münchener Löwenbräukeller teilzunehmen. Die Kritik der Vorredner, unter ihnen Walter Jens, an der Bundsrepublik war so maßlos, dass aus meinem Beitrag eine Verteidigungsrede der Bonner Demokratie wurde. Ich warf ihr lediglich vor, durch die «Berufsverbote» ihre eigenen Prinzipien zu verletzen und sich geistig der DDR zu nähern.
Am 6.Mai 2008 erhielt ich eine Anfrage aus Frankfurt: Ob ich ein Grußwort schicken könnte für eine Gedenkveranstaltung zur Nakba. So lautet die arabische Bezeichnung für die Vertreibung von Palästinensern bei der Gründung des Staates Israel 1948.Ausrichter waren die Christus-Immanuel-Gemeinde und die Palästinensische Gemeinde Hessen. Im Schreiben wurde beteuert: «Keine Demonstration oder Kundgebung gegen Israel.» Ich schickte einen kurzen Text, in dem ich am Schluss sagte, «Freund Israels zu sein, sollte heißen, die harte Wahrheit zu sagen – so, wie sie auch auf Ihrer Frankfurter Veranstaltung in Erscheinung treten wird».
Da ich aber die palästinensische Forderung nach einem Rückkehrrecht für alle Flüchtlinge ablehnte, so wie ich es für den deutschen Bund der Vertriebenen immer getan hatte, bekam ich die Antwort: «Ihr Grußwort hat uns sehr enttäuscht», ob ich es nicht umgestalten könne. Ich entgegnete: «Ich bin nicht gewohnt, mir meine Einstellungen diktieren zu lassen. Also ohne Grußwort.»
Natürlich kann man eine sachliche, wenn auch warme Aufklärungsarbeit nicht losgelöst vom richtigen Zeitpunkt leisten. In manchen Fällen muss es zunächst Sieger und Besiegte geben. Das Verständnis für die jungen Pimpfe oder HJ-Leute war erst nach dem Sturz des Nationalsozialismus angebracht. Ein anderes Beispiel: In Algier putschten 1961Generäle der französischen Armee gegen Staatspräsident de Gaulle, weil dieser seinen Widerstand gegen die Unabhängigkeit Algeriens aufgegeben hatte. Nach ihrer Niederlage schrieb ich in einer meiner Kolumnen für die katholischen Tageszeitung La Croix, man solle Verständnis für sie zeigen: Immerhin waren sie von ihrem Staatschef belogen worden und nun gezwungen, jene algerischen Moslems, die auf Frankreich gesetzt hatten, den Unabhängigkeitskämpfern auszuliefern – und damit einem furchtbaren Schicksal.
Obwohl der Algerienkrieg (1954–1962) auch von der anderen Seite äußerst brutal geführt wurde, prangerte ich eher die Mängel, die Widersprüche, die Verbrechen der französischen Seite an. Schließlich handelte es sich ja, da ich ein echter Franzose bin, um die Meinen. Sollte man sich nicht verletzt fühlen, wenn die Seinen gegen die Grundwerte handeln, auf die sie sich im Prinzip berufen?
Die Meinen – der Ausdruck ist nur sinnvoll, sofern man einigermaßen geklärt hat, was die eigene Identität ausmacht, wem man sich überhaupt zugehörig fühlt. Die Meinen: Das sind sicherlich Frau, Söhne und Enkelkinder. Auch Frankreich. Das Europa der EU? Gewiss. Inwiefern die jüdische Identität mitspielt, darauf werde ich noch eingehen. Und Deutschland? Seit nun mehr als sechs Jahrzehnten fühle ich mich mitverantwortlich, möchte, darf und kann ich hierzulande mitwirken. Als Begleiter von außen, der innen dabei ist und mit Teilnahme teilnimmt. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. So möchte ich auch dieses Buch verstanden wissen.
Aber weil ich eben Franzose bin und auch in Frankreich ein wenig mitwirken darf, werde ich oft vergleichend schreiben. Was ich in Deutschland sehe, aus Deutschland vernehme – ist das nur deutsch, spezifisch deutsch, oder sind nicht die Ähnlichkeiten mit Frankreich größer als die Unterschiede? Die Antwort wird manchmal in die eine Richtung gehen, manchmal in die andere. Der Vergleich bietet sich unter anderem an beim Umgang mit der Vergangenheit und deren Auswirkungen auf die Gegenwart, beim Verhältnis zum Islam, der Rolle der Kirchen sowie bei der Definition von Antisemitismus, die entweder vernünftig oder polemisch ausfallen kann.
Meinerseits möchte ich auf keinem Gebiet polemisch werden. Der Sinn der Sache ist es, gemeinsam mit dem Leser nachzudenken, zu analysieren, zu urteilen und vor allem aktuelle Kontroversen in eine erweiterte Betrachtung einzubetten.
IDENTITÄTEN, «KOLLEKTIVE» UND SCHÖPFERISCHE ERINNERUNG
Man sollte niemals die sagen. Die Deutschen, die Araber, die Franzosen, die Frauen, die Juden, die Arbeiter, die Berliner, die Christen… Das lässt sich an einem bekannten Paradoxon aus der Antike verdeutlichen: «Epimenides sagt, alle Kreter seien Lügner, aber Epimenides ist Kreter, also lügt er, also sind die Kreter keine Lügner, also sagt er die Wahrheit und alle Kreter sind Lügner, aber er ist Kreter, also lügt er, also sind die Kreter keine Lügner, usw. usw.» Was stimmt da nicht? Nicht alle bedeutet nicht notwendigerweise keiner, sondern kann auch heißen die einen ja, die anderen nein. Ebenso wie die Verneinung von immer nicht nie sein muss, sondern auch manchmal so, manchmal anders sein kann. Wenn man das eingesehen hat, ist man einen großen Schritt weiter – sowohl was das wissenschaftliche Denken betrifft als auch hinsichtlich einer Moral der Toleranz.
Jeder von uns hat eine Vielfalt von Identitäten, eine Menge von Zugehörigkeiten. Ich bin ein Mann und keine Frau. Das verschafft mir sowohl in der deutschen als auch in der französischen Gesellschaft immer noch manche unverdienten Vorteile. Nicht mehr so viele wie vor einigen Jahrzehnten, nicht so viele wie in den islamischen Staaten zwar, doch auch in der katholischen Kirche, in der Synagoge, im Lohn- und Gehaltssystem kann von Gleichberechtigung keine Rede sein. Volle Verwirklichung des Gleichheitsprinzips, wie es das Zweite Vatikanische Konzil in dem schönen Text Gaudium et spes dargestellt hat, hieße, dass eine schwarze Frau Papst werden könnte!
Auch im Umgang mit tragischen Ereignissen wird noch dem Mann der Vorrang gegeben. General Bastian hat vor einigen Jahren seine Lebensgefährtin Petra Kelly getötet, dann sich selbst. Obwohl sie nie die geringste Lust zum Sterben gezeigt hatte, war danach von «doppeltem Selbstmord» die Rede. Wenn sie ihn zuerst getötet hätte, wäre sie als Mörderin betrachtet worden. Generell scheint Sigmund Freuds Erklärung der Geschlechterdifferenzen immer noch weit verbreitet: Die Frau fühle sich unterlegen, weil sie keinen Penis hat. Meinerseits sage ich stets, mein Tatendrang ist vielleicht nur eine unbewusste Umsetzung des Mangels, dass ich kein Kind zur Welt bringen kann.
Ich bin alt und nicht jung. Da meine vier Söhne für mein Ruhestandsgeld arbeiten, habe ich deswegen kein ungutes Gefühl. Meine kinderlosen Kollegen sollten ein solches haben. Ich war als Professor Beamter. Das gibt mir eine andere Identität als die eines Arbeitslosen oder von jemandem, der arbeitslos werden kann. Ich bin Pariser, und das verschafft mir hundertmal mehr Zugänge zu Kulturgütern, als wenn ich in Mittelfrankreich auf dem Dorf leben würde. Ich war Radfahrer und Autofahrer. In der einen Identität verfluchte ich die Autofahrer, in der anderen die Radfahrer: ein typisches Beispiel von Identitätskonflikten!
Ich bin Franzose, was verschiedene Bedeutungen hat. So neige ich in mindestens zwei Hinsichten zur Selbstüberschätzung. Es gibt einen bösen, nicht ungerechtfertigten belgischen Witz, der auf alle dummen französischen blagues belges (Belgierwitze, zu vergleichen mit den deutschen Ostfriesenwitzen) reagiert: «Wie verdient man am leichtesten viel Geld? Indem man Franzosen zu dem Preis kauft, den sie wert sind, und sie dann zu dem Preis verkauft, den sie glauben wert zu sein».
Dieses Gefühl, einer besonders privilegierten Nation anzugehören, ließe sich durch jede Menge Zitate illustrieren. «Unsere Ziele, weil sie französisch sind, liegen im Interesse aller Menschen». (de Gaulle). «Dieser undefinierbare Genius, der Frankreich erlaubt, die tiefen Bedürfnisse des menschlichen Geistes zu konzipieren und auszudrücken.». (François Mitterrand). «Die Biologie des französischen Volkes macht aus ihm eine besondere Gruppe, dazu bestimmt, eine Elite für die Welt zu werden». (Valéry Giscard d’Estaing). «Frankreich muss die Rolle Europas spielen». (nicht: «eine Rolle in Europa»; Georges Pompidou als Premierminister).
Gegen solche Überheblichkeiten kämpfe ich ständig in Wort und Schrift, und sei es nur, um zu zeigen, dass nicht alle Franzosen überheblich sind. Und doch bin ich es in der zweiten Hinsicht: Ich bin ein Kind der Immigration, wie beispielsweise der ehemalige Präsident der Nationalversammlung Raymond Forni, Kind nach Frankreich geflüchteter italienischer Kommunisten, oder wie Nicolas Sarkozy. Dieser sagte vor einigen Jahren in einer Fernsehdiskussion mit Jean-Marie Le Pen: «Wenn es nach Ihnen gehen würde, wäre ich gar kein Franzose». (er wäre Ungar). Kleine Pause. «Welch Verlust wäre das für Frankreich!» Dasselbe sage ich auch von mir seit Jahrzehnten!
In Deutschland denkt man über die Zugehörigkeit zur Nation traditionell anders. In einem Interview mit dem Stern wurde Wolfgang Schäuble gefragt: «Kann ein Türke deutscher Kanzler werden?» Der Minister antwortete: «Sie meinen ein Deutscher mit türkischem Ursprung? Natürlich ja.» Diese Antwort entspricht französischen Normen. In Deutschland ist man ansonsten eher ein Türke mit deutschem Pass. Die Kehrseite der französischen Auffassung wird noch eingehend zu behandeln sein: Eben weil sie Franzosen sind, fühlen sich die jungen Leute nordafrikanischen Ursprungs, die in den Pariser Vorstädten arbeitslos und ohne Perspektive leben müssen, noch mehr diskriminiert, als wenn sie Ausländer wären.
Man kann sich zwischen widersprechenden Identitäten innerlich zerrissen fühlen, wie etwa Albert Camus. In seiner Dankrede zum Literatur-Nobelpreis 1957 betonte er, dass zum ersten Mal ein algerischer Schriftsteller in Stockholm ausgezeichnet würde. Wie viele andere empfand er sich zugleich als Algerier und als Franzose. In den letzten Jahren des Algerienkrieges schwieg er, weil die Gemäßigten beider Lager immer mehr von den Unnachgiebigen zurückgedrängt und oft gnadenlos ermordet wurden. Er selbst hatte versucht, einen aufbauenden Dialog zwischen den Vernünftigen unter Anhängern und Gegnern der Unabhängigkeit herzustellen.
Mein Lieblingsphilosoph ist Emmanuel Levinas, als jüdischer Litauer 1905 in Kaunas geboren, 1923 nach Straßburg ausgewandert, 1995 in Paris verstorben. Mehr als jeder Andere hat er seine Philosophie auf die Anerkennung des Anderen aufgebaut. Er schrieb, jeder solle sich von seinem Inneren aus selber definieren; denn «die Identität eines Individuums besteht nicht darin, sich von außen identifizieren zu lassen durch den Finger, der auf ihn zeigt.»
Das habe ich mir zu eigen gemacht. Mein Vater war ein in Frankfurt heimisch gewordener Berliner, Kinderarzt und Direktor einer Kinderklinik, Außerordentlicher Professor an der Universität, Freimaurer (in der Loge «Zur aufgehenden Morgenröthe», der Ludwig Börne angehört hatte), SPD- und DDP-Wähler, Vater, Gatte, Kriegsteilnehmer als Stabsarzt, im Felde von Anfang bis zum Ende des Weltkriegs, Träger des Eisernen Kreuzes Erster Klasse und «israelitischer Konfession», wie es damals hieß. Zwar war er Mitglied der jüdischen Gemeinde, aber ein wenig praktizierendes; bei uns zu Hause wurde lediglich Hanukka gefeiert. Hitlers Zeigefinger reduzierte alle seine Identitäten, alle seine Zugehörigkeiten auf sein Judentum. Ich habe nie eingesehen, warum sein Sohn sich seine zentrale, seine alles bestimmende Identität von dem Finger Hitlers auferlegen lassen sollte.
Das bedeutet nicht, dass ich den jüdischen Teil meiner Identität verleugnen würde, ich grenze ihn jedoch ein. Auf mein Judentum beziehe mich allerdings, wenn es um die «Schuldfrage» geht. Davon wird noch die Rede sein. Ich sage: «Ich war nicht gegen Hitler. Hitler war gegen mich. Als Jude hatte ich gar keine Wahl. Deswegen bin ich gewiss zornig auf die Verbrecher und auf die wissenden großen Mitläufer, und voller Bewunderung für alle, die in irgendeiner Form widerstanden haben. Ich tendiere aber auch zur Nachsicht gegenüber den Kleinen. Denn ich habe mir ständig die Frage gestellt: Wie mutig wäre ich gewesen, um mich für verfolgte Andere einzusetzen?»
Die vom Finger zugewiesenen Identitäten können langlebig sein, sowohl in der Selbstwahrnehmung wie in der Fremdwahrnehmung. Wenn ich in Baden-Württemberg spreche oder im dem katholischen Bayern eingegliederten Franken, so stelle ich stets die ironische Frage, wieso man sich als Protestant oder als Katholik identifiziert, nur weil vor vier Jahrhunderten ein Fürst seinen Untertanen auferlegt hat, seiner Konfession anzugehören.
Umgekehrt ist in Frankreich ist die Bezeichnung Preuße immer noch negativ belegt. Der «Erbfeind» war eigentlich nicht Deutschland, sondern Preußen. In der ersten großen Anweisung, die die französische Regierung 1945 an die Besatzungsbehörde in Baden-Baden geschickt hat, wird von der Notwendigkeit, den prussianisme auszumerzen, mindestens ebenso eindringlich gesprochen wie vom Nationalsozialismus. Noch 1961 sagte mir General de Gaulle während eines Gesprächs im Élysée-Palast: «Vous et moi, nous savons bien que, de l’autre côté, c’est la Prusse!». (Wir beide wissen doch, dass auf der anderen Seite Preußen liegt!) Dass die bösen Preußen Kommunisten geworden waren, was war natürlicher? Wenn es die guten Bayern oder die guten Rheinländer gewesen wären, so hätte man erstaunt sein dürfen.
Einmal von außen auf eine bestimmte Identität festgelegt, läuft man Gefahr, sich genau so zu benehmen, so zu zeigen, wie es gewissermaßen der herabsetzende Finger behauptet. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Figur des jüdischen Geldverleihers Shylock in Shakespeares «Der Kaufmann von Venedig». Ich hatte Tränen in den Augen, als der große Schauspieler Daniel Sorano den so oft missverstandenen Monolog des Shylock mit warmer Bitterkeit sprach:
»Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir’s euch auch darin gleichtun.»
Seit der Mitte des 20.Jahrhunderts gibt es ein neues Werkzeug der Identitätszuweisung, nämlich die sogenannten demoskopischen Umfragen. Die Fragestellung bestätigt oder schafft Vorurteile, die dann die Antworten bestimmen. Zur Zeit des bundesdeutschen Wahlkampfes 1953 wurde die Frage gestellt: «Darf ein ehemaliger Emigrant Kanzler werden?» Die Antwort fiel leider negativ aus. Bei einer anderen Befragung jedoch keineswegs: «Darf Erich Ollenhauer, ein ehemaliger Emigrant, Kanzler werden?» Adenauers Gegenkandidat wurde hier also vom Finger nur begrenzt stigmatisiert.
Im April 1986 beschlossen die USA, den libyschen Staatschef Gaddafi zu bestrafen. Drei Meinungsforschungsinstitute befragten jeweils einen repräsentativen Ausschnitt der Bevölkerung und bekamen anscheinend ganz unterschiedliche Antworten. Bei näherer Betrachtung sah man jedoch, dass der Finger auf drei verschiedene Identitäten hingewiesen hatte. Das erste Institut hatte gefragt: «Sie wissen, dass die amerikanische Luftwaffe die libyschen Städte Tripolis und Benghasi bombardiert hat. Billigen Sie diese Handlung oder nicht?» 31% der Befragten antworteten mit Ja, 43% mit Nein. Das zweite Institut griff zu einer anderen Formulierung: «Billigen Sie die amerikanische Intervention gegen Gaddafi oder nicht?» Ja: 59%, nein: 35%. Städte wollte man nicht bombardiert sehen, aber eine Strafe für den unbeliebten Diktator wurde begrüßt.
Die Frage des dritten Instituts liegt dazwischen: «Billigen Sie die amerikanische Bombardierung Libyens oder nicht?» Entsprechend fiel die Antwort aus: 39% ja gegenüber 40% nein! Drei verschiedene Identifikationen führten zu drei verschiedenen Antworten. Fazit: Wie vorsichtig sollte man doch mit Umfragen umgehen! Und wie genau sollte man deren Fragen analysieren!
Noch schlimmer ist es, wenn eine Umfrage absichtlich missbraucht wird. Im Jahr 1990 war Le Monde, ohne es klar zu sagen, gegen eine Präsidentschaftskandidatur des ehemaligen sozialistischen Premierministers Laurent Fabius. Dass Fabius Jude ist, war bekannt. Die Zeitung titelte «Laut einer Umfrage: BEINAHE JEDER ZEHNTE FRANZOSE WÄRE GEGEN DIE WAHL EINES JUDEN INS ÉLYSEÉ.» Es hätte doch heißen sollen: «Mehr als 90% der Franzosen haben nichts gegen Juden als Präsidenten»!
Immigranten bekommen besonders häufig eine bestimmte Identität zugewiesen. Dabei werden zwischen einzelnen Gruppen Unterschiede gemacht, die eine positive oder negative Kennzeichnung bewirken. So schrieb General de Gaulle zum Beispiel im Juni 1945 als vorläufiger Staats- und Regierungschef an den Justizminister, er solle Einbürgerungen «nach ethnischen, demographischen, beruflichen und geographischen Kriterien durchführen… Auf der ethnischen Ebene ist es zweckmäßig, den Andrang von jenseits des Mittelmeers und von Menschen aus dem Orient zu begrenzen, die seit einem halben Jahrhundert die Zusammensetzung der französischen Bevölkerung tief verändert haben. Es ist wünschenswert, bevorzugt Menschen aus dem Norden einzubürgern (Belgier, Luxemburger, Schweizer, Holländer, Dänen, Deutsche).» Deutsche – einen Monat nach Kriegsende!
Diese «ethnischen» Gruppen wussten nicht, dass sie als solche betrachtet und vom Finger de Gaulles bezeichnet und gezeichnet wurden. Im Allgemeinen sind sich gesellschaftliche Gruppen jedoch der Diskriminierung bewusst, der sie unterliegen. Dieses Bewusstsein stärkt dann die eine Identität, deretwegen sie diskriminiert werden. Diese empfinden sie nun womöglich als die wesentliche, sogar als die ausschließliche. So ist der polnische Nationalismus von anderer Art als der französische, der britische oder der deutsche. Dem polnischen Volk wurde die Existenzberechtigung abgesprochen, mehrmals besaß es keinen eigenständigen Staat mehr, und immer wieder trachtete man danach, es zumindest kulturell zu vernichten. Das alles stärkte das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit.
Die Proletarier des 19.Jahrhunderts waren als solche zugleich ausgebeutet und verachtet. Die Arbeiter-Internationale konnte sich auf diese gemeinsame Identität britischer, deutscher, französischer Arbeiter berufen, wenn sich auch 1914 zeigen sollte, dass – mit wenigen Ausnahmen – die nationale Identifikation stärker war als die proletarische. Die Frauenbewegungen des 20.Jahrhunderts gründeten auf der Feststellung, dass alle Frauen – der Bourgeoisie wie der Arbeiterklasse – diskriminiert waren und sich also hauptsächlich als Frauen zu identifizieren hatten. Es hätte auch keinen Zionismus gegeben ohne die Überzeugung, dass die Diskriminierung, dass die Bedrohung allen Juden galt, was auch ihre anderen Zugehörigkeiten sein mochten.
Doch inwiefern handelt es sich in solchen Fällen um eine Art kollektive Selbstidentifizierung, inwiefern lediglich um den Anspruch von Interessenvertretern, die gesamte Gruppe in der einen Identität voll zu repräsentieren? In der Türkei brauchten die Kurden keine Vertreter, um sich als Kurden zu identifizieren. Aber eine militante Befreiungsbewegung ruft sie dazu auf, ihre Identität auf die kurdische zu beschränken. Staatlicherseits suggeriert Algerien ebenso wie die Türkei, es gäbe nur ein Staatsvolk, in diesem Falle die Araber; eine Minderheit wie die Berber wird diskriminiert und unterdrückt.
Es sind jedoch nicht die schwachen Organisationen, die identitätserhaltend wirken. In den letzten Wochen der DDR gab es zunächst eine kollektive, nicht auferlegte demokratische Identifizierung: «WIR sind das Volk» war der Ruf der politischen Opposition gegen den Anspruch der SED und der Regierung, das Volk zu vertreten. Die Parole «Wir sind EIN Volk» galt dann der Einheit der Nation – beim Großteil der Bevölkerung trat in diesem Moment die nationale Identität in den Vordergrund, und sie bezog sich nicht auf den taumelnden DDR-Staat, sondern auf Gesamtdeutschland oder die Bundesrepublik.
Regierungen berufen sich gerne auf diese nationale Identität, vor allem in Krisenzeiten. Im Allgemeinen kommt der Anspruch, das ganze Volk als Nation zu vertreten, von der konservativen Seite. Der berühmte Ausspruch «Ich kenne keine Parteien mehr» von Kaiser WilhelmII. bedeutete: «Alle Deutsche haben ausschließlich Deutsche zu sein, was alle Klassenunterschiede auslöschen sollte. Diejenigen, die das nicht einsehen, sind der innere Feind.»
Nicolas Sarkozy spricht in der Wirtschaftskrise davon, dass es nun auf die unité nationale ankomme. Also seid ihr als Franzosen angesichts der Krise alle gleich – ob Bankier oder jüngst entlassener Arbeiter oder Angestellter.
In unseren demokratischen Gesellschaften darf jeder Verband die volle Vertretung seiner Mitglieder reklamieren. Aber auch hier ist dieser Anspruch oftmals vermessen. In Deutschland wie in Frankreich haben die Bauernverbände viel Macht, weil ihnen die Vertretung aller Landwirte zuerkannt wird. In Wirklichkeit sind die Interessen der Großbauern nicht gerade dieselben wie die der ständig in ihrer Existenz bedrohten Kleinbetriebe. Bei dem «Wir Bauern» verstecken sich die Reichen hinter den Armen.
Der Universitätsprofessor hat keine Vorgesetzten, arbeitet, wann er will, darf, außer in Ausnahmezeiten, seine Vorlesungen und Seminare ungestört durchführen. Welcher Unterschied zu einem Lehrer in einer Gesamtschule mit drei Viertel fremdsprachiger Schüler, mit viel Rebellion und sogar körperlicher Bedrohung! Und doch sagen die Fédération de l’Éducation nationale und die GEW Nous les enseignants, «Wir, die Lehrenden», behaupten, im Namen aller Lehrenden zu sprechen.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland wie der CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France – Repräsentativer Rat der jüdischen Institutionen in Frankreich) beanspruchen eine Art Alleinvertretung aller Juden in Deutschland oder in Frankreich, auf andere Vertretungsansprüche reagieren sie zumindest mit Missbehagen.
Häufig verquicken Interessenvertreter die Identität der Gruppe mit einer Erinnerung, mit dem Bezug auf eine kollektive Vergangenheit. Das tun sie insbesondere dann, wenn die vom Finger hervorgehobene Identität ein Stigma bedeutet, was in der Regel eine Verhärtung dieser gemeinsamen Identität nach sich zieht. Es sei denn, der Einzelne erhält die Möglichkeit, sich dem Finger zu entziehen.
Das versuchte in Frankreich 1993 ein Gesetz zu erreichen. Es erlaubt jedem, seinen Namen, seinen Vornamen oder beide zu wechseln, wenn er das Gefühl hat, sie benachteiligten ihn, insbesondere bei der Integration. Bereits im Einwanderungsgesetz vom 2.November 1945 hatte es geheißen, dass jeder Eingebürgerte, dessen Name schwer auszusprechen sei, diesen sous une forme francisée (in franzisierter Form) tragen dürfe. Aber nur wenige Franzosen mit arabischen Namen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sie wollten sich nicht von ihren Wurzeln abschneiden. Sie wollten nicht auf die Erinnerung verzichten.
In Frankreich noch mehr als in Deutschland ist ständig von der mémoire collective, von der kollektiven Erinnerung, die Rede und von dem devoir de mémoire, von der Pflicht des Erinnerns. Beide Ausdrücke sind schlecht gewählt. Denn es gibt keine kollektive Erinnerung, außer bei Menschen, die etwas mit anderen gemeinsam erlebt haben, etwa im Krieg oder im KZ. Aber sogar dann mag die geteilte Erfahrung anders bewertet werden. Als Édouard Daladier 1939Hitler in einer Rundfunkansprache beschwor, als ancien combattant auf einen Krieg zu verzichten, glaubte er, dass jemand, der – wie er selbst – die furchtbare Erfahrung der Schützengräben gemacht hatte, keinen neuen Massenmord anzetteln könne.
Ansonsten ist das Wort Erinnerung in diesem Zusammenhang schlicht falsch. Ich kann mich nicht an Verdun erinnern; ich war noch nicht geboren. Kein Serbe kann sich an eine Schlacht von 1389 erinnern, die den serbischen Besitz des Kosovo rechtfertigen soll. Die Berliner Mauer fiel, als die heute Zwanzigjährigen geboren wurden. Sie können sich doch nicht an den 9.November 1989 erinnern! Die sogenannte kollektive Erinnerung ist etwas Übermitteltes, das man sich aneignet. (Auf Französisch klingt es besser: un transmis qui devient un acquis.) Übermittelt wird sie von der Schule, der Familie, dem weiteren persönlichen Umfeld, den Medien. Und es hängt viel davon ab, welche Inhalte sie vermittelt.