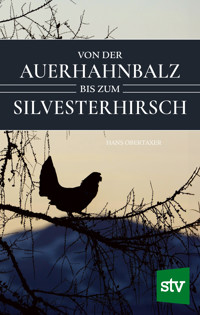
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Jagdgeschichten eines Försters und Jägers mit Herz und Verstand, der Demut vor dem Schöpfer und Ehrfurcht vor der Natur in seinen Geschichten auszudrücken vermag, erzählen von "erlebtem Jägerglück", das keineswegs allein durch Beutemachen entsteht. Neben spannenden Geschichten von Jagderlebnissen im Bergwald, in der Au und in Ungarn beeindrucken vor allem seine Rückblicke in die Vergangenheit, sowie das Erleben der Natur und der idyllisch schönen Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten. Gekonnt fängt der Autor die Stimmungen bei Ansitz und Pirsch ein und zieht so den Leser in seinen Bann – als ob man bei der Auerhahnbalz oder bei der Hirschbrunft mit dabei wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Obertaxer
Von der Auerhahnbalz bis zum Silvesterhirsch
Hans Obertaxer
Von der Auerhahnbalz bis zum Silvesterhirsch
Leopold Stocker Verlag
Graz – Stuttgart
Umschlaggestaltung und Repro: DSR Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl, www.rypka.at
Titelbild: Foto © Christoph Burgstaller
Alle Fotos im Innenteil des Buches sowie auf der Umschlag-Rückseite wurden dem Verlag _ wenn nicht direkt beim Foto anders angegeben _ freundlicherweise vom Autor zur Verfügung gestellt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5
Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2254-9
eISBN 978-3-7020-2318-8
Fragen, Wünsche oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns!
https://www.stocker-verlag.com/von-der-auerhahnbalz-feedback/
Hier finden Sie auch weitere Informationen über unser Programm und können sich für unseren Newsletter anmelden.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2024
Layout: Ecotext-Verlag Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien
Inhalt
Vorwort
Die Schindelhütte
Die alte Lärche
Mein Großvater
Der Auerhahn meines Großvaters
Großvaters einziger Rehbock
Großvaters tragischer Tod
Mein Vater
Der Schwarzlackenhirsch
An einem Sommertag im August
Naturerlebnis Auerhahnbalz
Im Aurevier
Ein Naturjuwel im Wandel der Zeit
Die Au im Frühling
Der abnorme Aubock
Die Au heute
Ein kapitaler Bock aus dem Aurevier
Herbst und Hirschbrunft
Im Zauber des Herbstes
Erlebnisse in Ungarn
Die Zigeunerin
Die Hirschjagd
Der Abschied von Ungarn
Die Gräfin
Auf der Pließalm
Der abnorme Bock vom Schwandwald
Der alte Hirsch vom Brand
Der Gamsbock vom Schwandwald
Ausklang
Erlebnisse mit meinen Hunden
Birko I
Birko II
Birko III
Besinnliche Vorweihnachtspirsch
Der Silvesterhirsch
Hüttengedanken über dies & das
Die Jagd in Gegenwart & Zukunft
Die Jagd im Lauf der Jahreszeiten
Gedanken über die Heimat
Mein Dorf
Abschließende Betrachtungen
Der Autor
Eine Spur oder Fährte des Wildes beginnt nicht dort, wo wir auf sie stoßen und sie endigt nicht unbedingt dort, wo sie aufhört.
So wie die Worte den Abdrücken einer Spur gleichen, so gleichen die Sätze, deren jeweiliger Sinn sich erst am Ende erschließt, den Spuren, immer wieder durch Interpunktionen und andere Zeichen unterbrochen.
Aus dem Buch „Baumgrenze“ von Ingolf Natmessnig.
Besuch vom Auerhahn bei der Hochstadel-Schutzhütte
Frühjahrspirsch mit Birko III
Vorwort
Die Jagd von heute ist vielschichtiger geworden und wird von Menschen aller sozialen Schichten in der Öffentlichkeit repräsentiert. Aus dieser Mischung ergeben sich viele verschiedene Zugänge zur Jagd. Die einen, die ihre jagdlichen Gene schon von Generation zu Generation weitervererbt bekommen haben, wachsen von Kindesbeinen an mit ihr auf. Die anderen steigen ohne familiären Hintergrund im jungen Alter oder auch als Spätberufene ins jagdliche Handwerk ein. Dann gibt es noch die Berufsjäger, deren tiefe Verbindung zur Natur und deren Verständnis für die Jagd im Beruf ihre Erfüllung finden.
Wie viele Jäger, abgesehen von den Berufsjägern, ein echtes Verständnis für die Jagd und die Hingabe zur Natur tatsächlich haben, kann ich nicht beantworten. Ebenfalls sind Jäger, bei denen der elitäre Aspekt im Vordergrund steht, kaum zu erfassen, jedoch dürften diese wohl die Minderheit darstellen.
Ich bin ein einfacher Bauernjäger, der seinen grünen Lodenrock immer mit Stolz und Ehrfurcht vor der Natur und Schöpfung getragen hat und weiterhin tragen wird.
Mein Zugang zur Jagd ist verbunden mit Leidenschaft und Hingabe, bei der es nicht nur um das Töten von Wildtieren geht, sondern auch um ihre Hege sowie um das Bewahren und Pflegen der Natur. Die Entnahme von Wildtieren aus der Natur ist die Ernte des Jägers. Und bevor man erntet, muss man das Wild mit angemessener Hege in seinem Dasein unterstützen, so wie jeder Bauer seine Felder pflegen muss, um ernten zu können.
Die Jagd braucht Visionen, Mut zu notwendiger Veränderung, aber auch ein klares Bekenntnis zu unseren Werten und Traditionen, zu dem also, was wir unsere einzigartige Jagdkultur nennen. Dann wird es die Jagd auch in Zukunft noch geben. Denn die Jagd ist sicher nicht die „Via Regia“ ins Reich der Natur, sie ist bestenfalls eine Brücke, über die man für die kurze Zeitspanne eines Jägerlebens, wenn man will, Einlass in dieses Reich finden kann.
In meinen Erzählungen möchte ich gefühlsbetont und realistisch meinem Respekt vor der Natur Ausdruck geben, ohne dabei das Wissen um das Leid der Menschen von damals zu vergessen. So habe ich Gegenwärtiges und Vergangenes verbunden, meine Erinnerungen führten mich nachfühlend zu meinen Vorfahren, in meine Heimat, mein Dorf. Es kommt mir so vor, als hätten die reichhaltigen Quellen der Jagd und der Natur meine schreibende Seele getränkt. So habe ich versucht, mit behutsamer Hand in die stillen Räume der Natur vorzudringen und aus den fließenden Quellen meines Jägerlebens Erlebtes zu entfesseln und der Tiefe und Weite der Jagd eine Stimme zu geben.
Die Demut vor dem Schöpfer, die Ehrfurcht vor der Natur und vor der Kreatur bei der Jagd, ja selbst das Flüstern und Rieseln einer Quelle und das Rauschen des Windes, all das bewirkt in mir immer schon ein Gefühl der Beglückung. Indem ich mich an dieses Gefühl und meine Jagderlebnisse erinnere, möchte ich Verschollenes wieder hervorholen und niederschreiben.
Es geht im Leben nichts wirklich verloren, was einmal gewesen ist.
Weidmannsheil!
Hans Obertaxer, Faschendorf, im März 2024
Die Schindelhütte
Es gibt Orte, die auf seltsame, nicht ganz erklärbare Weise Kräfte auf Menschen ausüben oder sie anziehen. Nicht jeder Mensch reagiert darauf auf die gleiche Weise, manche bleiben davon unberührt, andere wiederum zeigen eine auffallende Ver-
Die Schindelhütte
änderung in ihrem bisherigen Verhalten, sodass selbst ein oberflächlicher Beobachter diese Veränderung merkt.
Die alte Schindelhütte ist ein solcher Ort, aber es gibt ja keine magischen Orte an sich, so wie es auch keine Orte der Kraft gibt, die a priori wirksam sind. Vielmehr beruht ihre Wirkung auf einer Beziehung zur Natur, zum Wild und zur Jagd, die für viele Außenstehende jedoch nicht ersichtlich ist.
Meine damals 92-jährige Mutter (rechts) und meine Frau Maria vor der Schindelhütte
Die Schindelhütte wurde Anfang der dreißiger Jahre von Jakob Hasslacher, Eigentümer des 84 Hektar großen Schindelwaldes, als Waldarbeiterhütte in einfacher Rundholzbauweise errichtet.
Ich war noch ein junger Jäger, als ich das erste Mal an der Hütte vorbeikam, die damals noch in Abgeschiedenheit inmitten des dunkel beschatteten Schindelwaldes lag. Zu dieser Zeit hausten Holzknechte aus dem ehemaligen Jugoslawien in der Hütte, die allen Unrat einfach rund um die Hütte entsorgten. Ein dichter Brennnesselbewuchs verwies auf die Stellen, wo die Holzknechte offensichtlich ihre Notdurft verrichteten; das war mein erster Eindruck von dieser Waldhütte.
Nach Jahren der Abwesenheit kam ich bei der Hütte wieder einmal vorbei, und ein dichter, verwilderter Strauchbewuchs umgab die Hütte. Die Hüttentür war einen Spaltbreit offen. Drinnen im Hüttenraum lagen Blechdosen verstreut, und der Boden rund um die Herdstelle hatte viele schwarze Brandstellen, alles war in desolatem Zustand.
Vom Besitzer des Schindelwaldes, Herrn Dipl.-Ing. Herbert Kulterer, habe ich das Angebot erhalten, die Hütte zu restaurieren und dafür nutzen zu dürfen, was mich sehr freute. Es wurde mir zugesichert, alle für die Restaurierung notwendigen Materialien würden vom holzindustriellen Betrieb des Besitzers zur Verfügung gestellt werden. Dankend nahm ich dieses großzügige Angebot an. Danken möchte ich an dieser Stelle meinem Kollegen Ing. Sepp Rainer und anderen Helfern, die mich freundschaftlich in meinem Vorhaben unterstützt haben.
Zwei Jahre lang richtete ich also mit helfenden Bekannten die Hütte her. Sie bekam ein neues Schindeldach, einen neuen Kamin, einen neuen Fußboden, und selbst das Fundament wurde fachgerecht saniert. Der Platz vor der Hütte wurde eingeebnet, Wasser zugeleitet, auch eine kleine Holzhütte, ein WC und ein Zaun um die Hütte wurden errichtet.
Heute liebe ich diese Abgeschiedenheit, und nichts kann mich so sehr erden und beruhigen wie die Natur, der Wald und die Hütte. Wenn morgens das Sonnenlicht zwischen den Fichten und Lärchen strahlt und ich weiches Moos unter den Füßen spüre, dann kann ich die Magie des Unberührten noch ein wenig nachempfinden.
Knisterndes Holz im Hüttenherd und das spiegelnde Herdfeuer an den Hüttenwänden, flacher Kerzenschein und der Geruch von Vergangenheit lassen für kurze Zeit die Routine des Alltäglichen vergessen. Ich gehöre zu jenen Menschen, die von Zeit zu Zeit der Häuser und Menschen überdrüssig werden und zu den Bäumen im Wald flüchten und zu der Stille unter dem Sternenhimmel, es ist eine Flucht aus der berauschenden Welt, die in ihrem Reichtum zu zerfallen droht.
Die Zeit fließt dahin und mit ihr auch die Erlebnisse, sie überrollen einen oft, überlagern das gestern Geschehene. Einiges vergisst man, macht wieder neue Erfahrungen, die übermorgen wieder abgelöst werden von einer anderen Sichtmöglichkeit.
Und über all dem vergisst man zu leicht, dass es später geworden ist, die eigene Position oft ins Wanken geraten ist unter der Flut der Ereignisse. Man hat sich, ob man wollte oder nicht, anpassen müssen, und manchmal hat man gar abweichen müssen vom eigenen Standpunkt.
Ich bin vielleicht zu oft leichten Schrittes ins Land hineingezogen, aber auf einmal, da wird es einem dann jäh bewusst, für wenige Minuten, unterm Kronendach alter Bäume oder nachts nach einem Traum, wie alles gewesen ist, und welche Wege man oft hätte nehmen müssen.
Als behutsamer Beobachter möchte ich weiter an den verborgenen und stillen Räumen teilhaben und Gestalten aus Fleisch und Blut versuchen abzubilden, ihnen durch Worte Kraft geben und eine Stiege zum Glück bauen.
Heute frage ich mich, was zwingt mich, dies zu schreiben, vielleicht kommt es vom Zuhören: Das Rieseln einer Quelle oder das Rauschen des Windes flüstern mir zu, meine Geschichten zu Papier zu bringen. Oder es ist meine Heimat, die mich zum Schreiber machte? Für die Schindelhütte habe ich einen Spruch ins Hüttenbuch geschrieben:
Wer das Leben des Waldes kennt,
wer liebet Baum und Strauch,
wer die Natur sein Eigen nennt,
versteht die Sprache auch.
Hier sei Friede dein Begleiter
und Freude dir dein Gast,
bleibe hier und geh nicht weiter,
freu dich, wenn du Ruhe hast.
Hast ein Gläschen du zur Hand,
prost' deinem Partner zu,
denn Herz ist oft mehr als der Verstand,
und denkt oft wie du.
So sei heilig dir die Stätte,
wo dem Göttlichen du nah,
denn nur im Großen liegt die Quelle,
und hier erfährst du auch, wie es geschah.
Die Schindelhütte im Frühwinter
Mein ”Lebensbaum“
Die alte Lärche
Die alte Lärche steht auf der Faschendorfer Alm, einer ehemaligen Niederalm, am „Reitlboden“. Die Alm wurde von den ortsansässigen Bauern bis in die fünfziger Jahre noch bewirtschaftet. Der Name „Reitlboden“ leitet sich von einer damals mit Reitgras bestockten Weidefläche ab, eine nahezu ebene bis leicht kupierte Fläche mit einzelnen Wetterfichten und Lärchenüberhältern bewachsen, von denen eine markante alte Lärche inmitten dieser Lage bis heute erhalten geblieben ist.
Ich entstamme einer Keusche vulgo Binter in Faschendorf, und wir haben bis heute das Weiderecht für zwei Rinder auf dieser Alm. Die Niederalm ist im Laufe der Jahrzehnte zu Wald geworden, die alten Flurbezeichnungen kennt keiner mehr, aber sie bekommen in meiner Geschichte noch einmal Raum, damit sie nicht vergessen werden.
Vor mir steht die über dreihundert Jahre alte knorrige Lärche, dichte Bartflechten hängen an ihren Ästen und eine grobe, tief zerfurchte graue Borke umschließt ihren Lebenskörper schon einige hundert Jahre. Unter ihr sitzend rieche ich den herben Geruch der Vergänglichkeit des späten Herbstes, und das Laub der alten Buchen, die nahe der Lärche stehen, riecht nach Pilzen und Moder.
Oft verweile ich dort unter ihrer Baumkrone, um an Verschollenes zu denken, den Nerv der Natur in ihrer Nähe zu verspüren und dem ewigen Verhältnis der Natur zum Menschen als geheimnisvolle Gewalt zu begegnen.
So ist dieser Baum zu meinem Lebensbaum geworden, er gibt mir die Botschaft des Vertrauens und hilft mir, die Wege zu meinen Zielen offen und ehrlich zu gehen. Jedes Jahr bin ich fasziniert, wenn die Lärche Anfang Mai blüht und die gelben männlichen und dunkelroten weiblichen Blüten zwischen den sprießenden zarten grünen Nadeln hervorleuchten. Genauso beindruckt bin ich, wenn ihre Nadeln die goldige Herbstfärbung haben,und ich lehne mich oft an ihre mächtigen Wurzelanläufe, die eine ungeahnte, nicht erfassbare Kraft des Lebens dieses Baumes erahnen lassen.
Kurze Rast bei der alten Lärche
Zum Niederschreiben von Erlebnissen kann man sich nicht selbst zwingen. Meine Erinnerungen und Gedanken überkommen mich meistens, wenn ich den vertrauten Geräuschen der Natur lausche. Das leise Plätschern eines Bächleins, das sanfte Rauschen des Windes, der durch die Äste streicht: Sie flüstern mir zu, und dann muss ich diese Gedanken nur zu Papierbringen. Mich haben also der Wald, die Natur und die alte Lärche zum einfachen Schreiber gemacht. Aber es ist ein weiter Weg bis dahin. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich ein Behälter von Worten und Gefühlen. Als hätte ich den Atem angehalten, während ich mich in Jugendjahren Träumen hingab, die erst im Laufe der Jahre Gestalt und Form enthüllten und durch Erfahrung Substanz erhielten.
Ich erinnere mich an meinen Vater, an seine Erzählungen von vielen jagdlichen Erlebnissen. Besonders an jene, wo er seinen früh verstorbenen Vater zur Auerhahnjagd und Rehbockjagd begleiten durfte. Schon in diesen Geschichten spielt die alte Lärche eine Rolle. Kein Wunder, dass diese Lärche mir deshalb so vertraut ist und mich längst Geschehenes scheinbar nachempfinden lässt.
Der Motwierbach und der Mühlbach in unmittelbarer Nähe der alten Lärche sind nicht nur die Gewässer meiner Kindheit, sie fließen heute noch durch meine Lebenswelt, von dunklen Wäldern und Schluchten beschattet. Der Mühlbach hat früher die Mühlen der Bauern lebensspendend mit Wasser gespeist, um das notwendige Korn für das tägliche Brot zu mahlen. Es geht eine seltsame Gewalt aus von den Bächen, besonders nach ergiebigem Regen, der die nächtliche Luft zum Brausen bringt, wenn die rauschenden Wasser zu Tale stürzen. Dann wieder kehrt Ruhe in den Gräben ein, und der stille Gesang ihrer Quellen verbindet sich wieder mit dem Geheimnis des Wassers.
Beim Leckgarten, der in unmittelbarer Nähe östlich der Lärche liegt, befinden sich inmitten von Erlen und einzelnen Fichten kleine moorige Flächen, die auch im Winter großteils schneefrei bleiben, weil die darunter liegenden Quellen aus der Tiefe kommen. So manche Waldschnepfe steigt im rötlichen Abendhimmel dort auf, rufend nach einem Partner, aber der noch winterliche Wald hat keine Antwort für sie. Dort gab es auch einen solitär stehenden Vogelbeerbaum. Sein ansehnlicher Stammumfang mit schon leicht borkiger Rinde am Stammfuß und seine weit verzweigte Krone waren im frühen Herbst, wenn die reifen Vogelbeeren weithin rot leuchteten, immer Anziehungspunkt für viele Vögel und Eichhörnchen; auch so mancher Edelmarder lag hier auf der Lauer. Wenn früh Schnee gefallen war, leuchteten seine Beeren weithin, und die abgefallenen Beeren hinterließen im weichen Schnee wässrig-rote Färbungen.
Im beginnenden Frühling herrschen noch die Schatten des Winters rund um die Lärche, und der Nachtfrost härtet den wässrigen Schnee, aber tagsüber sickert Nässe unter der Schneedecke hervor die, von den Höhen kommend, zu kleinen Gerinnen wird. Diese wiederum nähren den sprudelnd talwärts stürzenden Wildbach. Gegen Abend hin steigen bläuliche Nebel aus dem Wald auf, sie füllen die Gräben und Winkel, und es ist bereits der Geruch der Fruchtbarkeit zu riechen. Am frühen Abend werden die ersten Frühlingsstimmen des Bergwaldes wach. Die Ringdrosseln flöten ihre Lieder von den Baumwipfeln der Fichten, die Tannenmeisen fliegen in kleinen Scharen zu den Schlafbäumen.
Und doch birgt die noch herrschende Spätwinterzeit ein Geheimnis in sich, denn in der späten Abendstunde streicht der große schwarze Vogel mit seiner schillernden Brust und den roten Augenbrauen sicher über die Wipfel und durch das Geäst zur Wetterfichte neben der alten Lärche. Es ist sein Schlafbaum, den er zielbewusst ansteuert, und jäh verbirgt ihn das dichte Astwerk, als würde es ihn schlucken.
Und auf einen der tief herabhängenden Äste der alten Lärche hat schon mein Großvater 1930 seinen erlegten Auerhahn aufgehängt.
Mein Großvater
Mein Großvater
Die Geschichte ist unbestechlich. Die Vergangenheit aufzuarbeiten, diese wieder für kurze Momente aus der Erinnerung zu holen, ist oft ein sehr schwieriges Unterfangen. Aus vorhandenen Quellen und Erzählungen meiner Vorfahren werde ich versuchen, in den Flüssen der Ereignisse ein Fenster der Erinnerung zu öffnen und meinen Ahnen noch einmal eine Gestalt zu geben.
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert, am 19. Mai 1900, wurde mein Großvater Johann in einer kleinen Ortschaft im Gailtal geboren und wuchs mit drei Geschwistern in ganz ärmlichen Verhältnissen auf. Das einstöckige Haus, wo er geboren wurde, hatte drei bewohnbare Räume, unten im Parterre war neben der Kuchl eine Stube, in dem die Eltern und der jüngere Bruder schliefen. Oben im ersten Stock war Johann zusammen mit den zwei älteren Schwestern untergebracht. Durch das mit Moos bewachsene alte Bretterdach aus Lärchen sickerte im Frühjahr das schmelzende Schneewasser vom Dach in die oberen Räume, und die Mutter stellte zu dieser Zeit immer kleine Gefäße auf, um das herabtropfende Wasser aufzufangen. Im Winter blies der stürmische Wind oft Schnee durch die Ritzen der Holzbalken auf die groben Tuchent1, welche mit Türkenfedern2 gefüllt waren.
Auf der Hinterseite des Hauses war der Eingang zum Ziegenstall und zum Schweineverschlag. Vom Stall führte eine steile Stiege hinauf in den ersten Stock zum Futterlager der Ziegen.
Vor dem Haus betreute seine Mutter ein kleines Gartl, und dahinter war das kleine, karge und steinige Feld, auf dem das Heu für die Ziegen geerntet wurde. Die Ziegen mussten vom Frühjahr bis in den späten Herbst auf den umliegenden Feldrainen und im Wald von den Kindern gehütet werden, weil ansonsten das Futter nicht ausreichend vorhanden war. Immer wieder wurden Johann und seine Geschwister von Bauern verjagt, wenn die an Stricken angebundenen Ziegen abseits der Wald- und Wegränder auch vom Gras der Wiesen der Bauern gefressen hatten. Besser war die Zeit für das Hüten ab dem Zeitpunkt, von dem an das „Allerheiligenhalten“ gestattet war: Nachdem im Spätherbst das behütete Weiden des Bauernviehs eingestellt wurde, durften sich die Geißen etwas freier auf den Feldern bewegen und auch dort fressen. Bis in den späten Herbst, bis zum ersten Raureif, mussten die Kinder barfuß gehen, denn jeder hatte nur ein Paar meist schon geflickte Schuhe.
An sonnigen Herbsttagen wehte der bläuliche Rauch der Kartoffelfeuer über die Äcker des Talbodens, und Johann und seine Geschwister suchten auf den abgeernteten Kartoffeläckern nach verblieben Kartoffeln, um diese im dürren und in Haufen lagernden Kartoffelkraut zu braten. Von den gebratenen Kartoffeln wurde die verkohlte Schicht abgerieben, bis die vom Feuer gebräunte äußere Schicht der Kartoffel sichtbar wurde, und in dieser eingeschlossen war die wohlschmeckende weiche Frucht; die roten Lippen der Kinder waren von den manchmal verbleibenden Resten der verkohlten Schicht schwarz umrandet, und ihre Augen glänzten in momentaner Zufriedenheit.
Neben den Verpflichtungen hatten Großvater und seine Geschwister auch fröhliche Stunden, in denen sie sich viel im angrenzenden Wald aufhielten. Die Zapfen von Fichten, das waren ihre Rosse, die kleineren Zapfen der Kiefern ihre Kühe, die Eicheln die Schweine. Aus großen Rindenstücken wurde dann ein Hof gebaut, und Rindenstücke waren auch ihre Wagen, an die mit Fäden die Tiere eingespannt wurden. Ihr Getreide war Spitzwegerich, und Buchenblätter waren ihr Geld; auch all die anderen vorhandenen Blumen und Gräser hatten ihre Bedeutung.
In der Kirche von St. Daniel saßen ganz vorne die Bauersleute mit ihren Kindern, ganz hinten die armen Keuschler, Mägde und Knechte. Wenn eines der ärmeren Kinder sich nach weiter vorne in die Kirchenbank setzte, wurde es vom Pfarrer seines Platzes verwiesen, auch als Ministranten wurden nur Kinder von Bauern und aus besser gestellten Familien genommen. Diese Rangordnung hatte auch Bestand im örtlichen Gasthaus. Die Bauern, der Bürgermeister und der Pfarrer saßen nach der Sonntagsmesse in der Gaststube, und die anderen saßen in der Labn3 der Gaststätte.
Als Großvater im Jahr 1909 gerade neun Jahre alt war, fiel außergewöhnlich viel Schnee im Gailtal. Eines Morgens konnten die Bewohner seines Heimatgebietes ein eigenartiges Naturphänomen bestaunen. Der frisch gefallene Schnee war gelbrot gefärbt. Damals hatte der Wind in großer Höhe feinen Wüstensand aus Afrika herübergetragen.
Aus alten Leintüchern nähte die Mutter meines Großvaters Unterwäsche und Hemden, für die Gitschen4 lange Kittel mit breiten Trägern; die vielfach geflickten Hosen der Buben hatten bereits ein annähernd kariertes Muster. Gewand, das noch irgendwie verwendbar war, wurde nie weggeworfen; schon getragene Kleidung wurde an den nächsten weitergegeben oder geändert.
Seine Schwestern, sein Bruder und Johann besuchten die Volksschule. Die zwei Schwestern, welche älter als die Brüder waren, begleiteten die Mutter oft bei ihrer schweren dienenden bäuerlichen Arbeit auf den umliegenden Bauernhöfen und halfen bei leichten Erntearbeiten mit. Der Lohn fürs Arbeiten war die tägliche Verköstigung, und ab und zu konnten sie die Äste von geschlägerten Bäumen für Brennholz und Streu für die Ziegen einsammeln.
Der Vater vom Großvater war Zimmerer, er trank gerne, und so reichte das verdiente Geld nie aus, um die notwendigsten Bedürfnisse der Familie erfüllen zu können. Er behandelte seine Frau und die Kinderschar oft mit groben Worten und Schlägen. Großvater und seine Geschwister konnten zwar die Volksschule besuchen, aber gleich danach wurden sie von ihrem Vater als Dienstboten zu Bauern in der Umgebung, aber auch in weiter entfernte Täler geschickt. Eine Lehre kam selten in Frage, denn damals mussten die Eltern für die Kinder, wenn diese eine Beruf erlernen wollten, dem Meister ein Lehrgeld entrichten, und dieses Geld war meist nicht vorhanden.
Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 1915, Johann war gerade 15 Jahre alt geworden, kam der Vater meines Großvaters von Kötschach mit der Nachricht heim, dass Italien Österreich den Krieg erklärt hatte. Im selben Jahr meldete sich der Vater zu den „Freiwilligen Kärntner Schützen“. In der Militärschießstätte in Laas wurden die Freiwilligen im Schießen ausgebildet. Der Vater meines Großvaters wurde später zur Infanterie und Verteidigung am Isonzo einberufen, wo er bei er dritten Isonzoschlacht im Bereich von Flitsch schwer verwundet wurde und im dortigen Feldlazarett am 2. November 1915 seinen Verletzungen erlag.
Der örtliche Pfarrer überbrachte Johanns Mutter die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes. Die Einsargung und Begräbniskosten wurden vom Militär übernommen. Am Abend kamen Nachbarn an die Bahre zum Rosenkranzbeten und brachten Zucker, Eier und Brot mit. Das war zwei Abende so. Es war ein ärmliches Begräbnis, einige Verwandte, Nachbarn und Bauern fanden sich bei der Keusche ein. Ein Zugsführer der Gebirgsschützen und vier Soldaten trugen den Sarg zu dem von Pferden gezogenen Leiterwagen und begleiteten den kleinen Trauerzug. Zwei Kränze schmückten den an der schattseitigen, kühlen Friedhofsmauer aufragenden Erdhügel, darauf wurde ein einfaches Lärchenkreuz gesetzt, und am Grabe stand trauernd, verzweifelt und weinend die Mutter mit ihren vier Kindern.
Der Vater vom Großvater hatte vor dem Krieg auf verschiedenen Baustellen als Zimmerer im Drautal gearbeitet und kam meistens nur an den Wochenenden nach Hause. In einem Wirtshaus in Lendorf hatte er einem Bauern versprochen, seinen Sohn als Dienstboten zu schicken, wenn dieser 15 Jahre alt wäre.
Der örtliche Pfarrer von St. Daniel erinnerte die Mutter meines Großvaters an das Versprechen ihres Mannes, der ja gerade an der Front war. Der Bauer aus Baldramsdorf hatte sich wohl an die Kirche gewendet, um das versprochene Dienstbotenverhältnis einzufordern. Die Mutter teilte Johann den Handel seines Vaters mit, und Anfang September sollte sein Weg ins Ungewisse beginnen. Die wenigen Habseligkeiten des Buben, ein Paar Socken, ein Hemd, ein Rock und die genagelten Schuhe von seinem Vater wurden in einen Rucksack gepackt, dazu als Wegzehrung Äpfel und Brot sowie 25 Heller Taschengeld.
Es war an einem Freitagmorgen, als Großvater sich auf den Weg machte. Die Mutter und seine Geschwister standen vor der Haustür, alle weinten sie, als Johann sich noch einmal umdrehte und ihnen zuwinkte. Wann würde er seine Familie wiedersehen? Etwas Ungewisses durchströmten seine Gedanken, würde die Mutter zurechtkommen mit der kleinen Wirtschaft, würde auch genug zu essen da sein für seine Geschwister? Er kannte das Gefühl der wärmenden Liebe der Eltern nicht, und doch verspürte er für kurze Momente eine Sehnsucht, zurückzugehen und seine Mutter zu umarmen.
So kam mein Großvater in jungen Jahren als Dienstbote zum vulgo Hanselebauer in Faschendorf. Zuerst musste er dem Stallknecht und dem Rossknecht zudienen, und später wurde er zu Feldarbeiten eingeteilt. Dort lernte er auch meine Großmutter kennen, die als Magd beim Hanselebauer einen zusätzlichen Lohn zur kleinen Landwirtschaft ihrer Eltern (Binterkeusche) verdienen musste. Mit 18 Jahren hat meine Großmutter die Keusche von ihren Eltern überschrieben bekommen, und bald darauf heiratete sie meinen Großvater. Nach der Heirat hat mein Großvater als Holzknecht bei der Firma Jakob Hasslacher in Sachsenburg gearbeitet, und aufgrund seiner fleißigen und geschickten Hände wurde er später von Jakob Hasslacher vulgo Gschmeidler zum Vorarbeiter (Holzmeister) befördert.
Der Auerhahn meines Großvaters
Oft erzählte mir mein Vater von diesem unvergesslichen Erlebnis, waren es doch nur wenige Augenblicke in seinem eigenen erfüllten Jägerleben, die ihm von seinem Vater in Erinnerung geblieben waren. Mein Vater war dabei, als mein Großvater seinen Auerhahn bei der alten Lärche und einen Rehbock im Leckgarten erlegte. Von diesen beiden Begebenheiten möchte ich erzählen.
Mein Vater durfte meinen Großvater 1930 um den Georgitag (27. April) auf die Faschendorfer Alm begleiten. Es war ein Sonntag, im Talboden war kein Schnee mehr, doch strenger Morgenfrost herrschte damals, als sie zeitig in der Früh in Richtung Faschendorfer Alm schritten. Die jagdliche Ausrüstung meines Großvaters bestand aus einer Büchsflinte, Kugel 9x3/72 und 16/65 Schrot mit Kimme und Korn, welche er um 60 Schilling beim damaligen Büchsenmacher Zechner in Spittal gekauft hatte. Das Geld dafür wurde durch den Verkauf von sechs Gänsen meiner Großmutter beschafft.




























