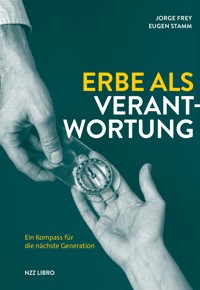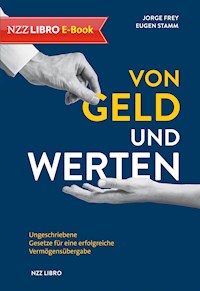
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wer vermögend ist, hat Freiheit. Doch wie nutzt man diese Freiheit sinnvoll und wie bereitet man seine Nachkommen auf die Verantwortung vor, die mit ihr einhergeht? In der Schweiz gehen im Jahr bis 70 Milliarden Franken von einer Generation an die nächste über. Wir wissen viel darüber, wie man ein Vermögen verwaltet, rechtlich strukturiert und mehrt. Wie man dieses aber weitergibt und mit welcher Grundhaltung man es verknüpfen kann, damit es zu einem Geschenk wird und nicht zu einer Last, darüber wird kaum explizit nachgedacht. Jorge Frey und Eugen Stamm haben sich mit 30 Mitgliedern von Unternehmer- und Investorenfamilien aus der ganzen Schweiz über diese Fragen unterhalten. Einige von ihnen sind sehr vermögend, andere gut situiert. Sie sind in verschiedenen Branchen tätig und haben ihr Vermögen selber geschaffen, geerbt oder führen ein von ihren Vorfahren gegründetes Familienunternehmen weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JORGE FREY EUGEN STAMM
VON GELD UND WERTEN
Ungeschriebene Gesetze für eine erfolgreiche Vermögensübergabe
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2019 (ISBN 978-3-03810-403-2)
Lektorat: Marcel Holliger, Zürich
Umschlaggestaltung: icona basel, Basel
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-429-2
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Für meine Eltern, Walter und Verena Frey-Marti, in Dankbarkeit für die Werte, die sie vorgelebt haben und die mich auch heute noch begleiten. Für meine Frau Susanne und meine Kinder Clarissa und Hannah, die möglich machten, was ich mir wünschte.
Inhalt
Diskretion
Vorwort
Einleitung
Der Mann am Neumarkt
1.Wir sind vermögend, was jetzt?
«Dir fällt alles in den Schoss!»
Geld ohne Wurzeln
Die Wahl des Wegs
Der Weg zur Autonomie
Der Familienpfad
Der Weg des Oblomow
2.Nachdenken über Werte
Ein Vermächtnis der anderen Art
Bescheidenheit
Arbeitsethik
Offenheit
Freiheit und Sicherheit
Verantwortung und Integrität
3.Erben als Chance
Über die Freiheit zu vererben
Gleichbehandlung bedeutet Anerkennung
Im Würgegriff der toten Hand
Ein Leben im Wartesaal
Steuern sind nicht das Wichtigste
Transparenz als Herausforderung
4.Ein Sack voll Geld oder eine Windkraftanlage?
Erben einfach gemacht?
Übernehmen, bewirtschaften und weitergeben
Die Wandlung vom Unternehmer zum Investor
Wirklich langfristig denken lernen
Altes Vermögen vs. neues Vermögen
Die Kunst des Loslassens
Vermögensaufbau an der Familie vorbei
5.Von Generation zu Generation
Die Generationen unserer Zeit
Grundsätze der Kommunikation
Die entscheidenden Jahre
Gleiche Eltern – unterschiedliche Kinder
Anerkennung der Eltern
6.Begleitung statt nur Beratung
Ein Ansprechpartner für alle
Reden ist Silber, Zuhören ist Gold
Auswahl des Beraterteams
Das Pflichtenheft der Family-Governance-Berater
Kosten der Family-Governance-Beratung
Next-Gen-Seminare
7.Der Family-Governance-Prozess
Was Family Governance bedeutet
Eckpunkte eines Family-Governance-Prozesses
Ein Beispiel aus der Praxis
Die Familiensitzung
Wo steht Ihre Familie heute?
8.Das Familienleitbild
Das Leitbild als Ausgangspunkt
Ein Beispiel aus der Praxis
Das Leitbild ist wandelbar
Argumente dafür und dagegen
9.Philanthropie
Warum Philanthropie?
Alles zu seiner Zeit
Gemeinnutz statt Eigennutz
Vermögen braucht Identität
Ohne Nachkommen
10.Vermögen als Aufgabe
Vermögen garantiert kein sorgenfreies Leben
Die Freiheit kommt nicht automatisch
Vermögen braucht eine familiäre Gebrauchsanleitung
Vermögen kann einsam machen
Vom Mann am Neumarkt bis zur Philanthropie …
Anhang
Glossar
Interviewpartner
Interview-Fragebogen
Dank
Die Autoren
Anmerkungen
Diskretion
Ein Buch für die Praxis lebt von Beispielen aus der Praxis. Wir legten daher grossen Wert auf Authentizität, aber auch auf Vertraulichkeit. Um diesen beiden Anforderungen gerecht zu werden, haben wir unseren Interviewpartnern Diskretion zugesichert. Es war die Basis für die sehr offen geführten Gespräche. Die mit einem * gekennzeichneten Namen im Text sind Pseudonyme. Bei allen anderen Namen handelt es sich um Personen, die uns autorisiert haben, ihre Identität preiszugeben.
Vorwort
Wer vermögend ist, der hat Freiheit. Wie man sie sinnvoll gebraucht und wie man seine Nachkommen auf die Verantwortung der Freiheit vorbereitet, davon handelt dieses Buch.
Wir, die beiden Verfasser, haben uns im Sommer 2016 zum ersten Mal getroffen. Wir sprachen über die Übertragung von Vermögen von einer Generation auf die nächste – und die Schwierigkeiten, die dabei auftreten. Aus unserer Diskussion entstand ein Artikel mit dem Titel «Emotionen ignoriert man auf eigene Gefahr», der in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist. Später wurde uns klar, dass wir das Gespräch weiterführen und ausweiten wollen; denn wie man mit Vermögen umgeht – ob man es nun selber geschaffen oder geerbt hat – und wie man seine Nachkommen lehrt, vernünftig von der finanziellen Freiheit Gebrauch zu machen, darüber gibt es im deutschsprachigen Raum wenig zu lesen. Diese Lücke ist erstaunlich, umso mehr, als in den USA mit einer gewissen Leichtigkeit über die verschiedenen Facetten des Reichtums diskutiert wird.
Diesem Thema sollte auch in der Schweiz – dem Land, das weltweit als Zentrum der Vermögensverwaltung gilt – mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wie man ein Vermögen verwaltet und rechtlich strukturiert, darüber weiss man in der Schweiz viel. Es zu mehren, fasziniert, aber wie man Reichtum weitergibt, mit welcher Grundhaltung man ihn verknüpft, sodass er zu einem Geschenk wird und nicht zu einer Last, darüber wird, so glauben wir, zu wenig explizit nachgedacht.
Die beiden Büros, in denen wir arbeiten, liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt im Herzen von Zürich, am Sechseläutenplatz. Wir sehen dasselbe, wenn wir aus dem Fenster schauen, nur von verschiedenen Seiten. Das gilt auch für unsere Arbeit. Als Partner eines Family Office und als freier Autor für die NZZ sprechen wir dieselbe Sprache, die auch Unternehmer- und Investorenfamilien sprechen. Ob sie allerdings mit uns über ein so intimes Thema wie Geld in der eigenen Familie sprechen würden? Am Anfang dieses Projekts waren wir uns da gar nicht so sicher. Klar war für uns einzig, dass wir uns nicht aufmachen wollten, um Theorien zu sammeln, sondern Stimmen aus und für die Praxis. Wir wollten genau wissen, wie es um die Sorgen der Vermögenden steht. Darüber, sagten wir uns, wollten wir uns mit ihnen unterhalten.
Wir trafen an vielen Orten, wo wir anklopften, auf offene Ohren. So unterhielten wir uns im Verlauf eines Jahrs mit über 30 Personen aus der ganzen Schweiz, einige von ihnen sehr vermögend, andere vermögend oder gut situiert. Unter den 30 Personen waren auch einige Berater, die die Verhältnisse sehr gut kennen und von ihren Erfahrungen in Bezug auf den Vermögensübergang berichten konnten. Das gesamte Vermögen dieser Familien schätzen wir auf weit über 10 Milliarden Franken. Sie sind in verschiedenen Branchen tätig, einige haben ihr Vermögen selbst geschaffen, andere führen ein von ihren Vorfahren gegründetes Familienunternehmen weiter.
Ihre Offenheit hat uns sehr gefreut und positiv überrascht. Galt früher nicht das ungeschriebene Gesetz, dass man Geld hat, aber nicht darüber redet? Anscheinend ändert sich das; das ist auch unser Ziel. Vielleicht waren wir dank unseres beruflichen Hintergrunds vertrauenswürdig genug als Fragensteller. Vielleicht ist es aber – dieses Gefühl hatten wir nach mehr als einem Gespräch – auch ein Bedürfnis vermögender Personen, ihre Beziehung zu Geld im Gespräch mit einer unabhängigen Person zu klären.
Vielen unseren Gesprächspartnern haben wir Anonymität zugesichert. Verträgt sich das mit der zuvor erwähnten Offenheit? Wir finden das nicht nur deswegen verständlich, weil uns teils sehr schwierige familiäre Ereignisse und Konstellationen offengelegt wurden, sondern noch aus einem anderen Grund: Wir wollten nicht einzelne Familien oder Personen um der Sensation willen porträtieren, sondern Lehren ziehen, die allen dienen.
Wohlstand und Reichtum breiten sich weltweit aus. Wir unterscheiden die Begriffe so: Wer dank seiner Arbeit all seine Bedürfnisse decken kann, angenehm wohnt, medizinisch versorgt ist, am kulturellen Leben teilhat und seine Kinder gut ausbildet, lebt im Wohlstand. Reichtum hingegen bedeutet, solche Kosten durch die Erträge seines Vermögens decken zu können. Ob jemand reich ist, entscheidet sich also auch durch seine Ansprüche, nicht nur durch die Grösse seines Vermögens. Manche sagen, richtig reich sei man erst, wenn man von den Zinsen des Vermögens leben kann oder, anders gesagt, mehr als 100 Millionen Franken besitzt. Andere wiederum fühlen sich reich, wenn sie Dinge besitzen, die man mit Geld nicht kaufen kann.
An dieser Stelle ist eine Erklärung angebracht zum moralischen Kompass, mit dem wir als Verfasser dem Gegenstand unserer Untersuchung begegneten. Wir sind der Meinung, dass Vermögen, mit legalen Mitteln erarbeitet und ordnungsgemäss versteuert, für die nächste Generation ein Segen sein kann und nichts ist, dessen diese sich schämen müsste. «Frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht», so steht es in der Bundesverfassung. Wer sie nur zu seinem eigenen Vorteil nutzt, schadet nicht nur dem Gemeinwohl, sondern auch seiner Familie, das ist unsere Überzeugung. Denn man gibt mehr als nur Vermögen weiter – man vermittelt auch seine Einstellung dazu.
Vermögende werden erst dann zu ehrenwerten Bürgern, wenn sie ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten, sei es durch das Schaffen von Arbeitsplätzen, das Bezahlen von Steuern oder durch philanthropisches Engagement. Wir haben mit solchen Personen gesprochen. Es sind Leute wie sie, denen die Schweiz ihre Stabilität, ihre industrielle Tradition, ihre hervorragende Infrastruktur, zu der auch das Sozial- und Bildungssystem gehört, verdankt. Sie machen das Land zu einem Ort, an dem auch künftig Vermögen geschaffen werden können. Solche Leute sind wichtig, aber sie sind nicht das Mass aller Dinge. Denn wie es ebenfalls in der Bundesverfassung steht, ist es «gewiss, dass die Stärke des Volks sich misst am Wohl der Schwachen».
Die Essenz dessen, was man sich am Ende seines Lebens wünscht, hat eine Mutter einmal in ihrem Testament aufgeschrieben. Als der Notar den Nachkommen das Testament eröffnet, liest er nur drei Wörter vor: «Kinder, vertragt Euch!» Das Vermögen war überschaubar, die Erblasserin traute den Nachkommen zu, mit der neuen Situation umgehen zu können. Die drei Wörter stehen jedoch auch für die Brisanz jeden Vermögensübergangs. Man will Streit vermeiden und hofft, dass die Kinder weitertragen, was die Vorfahren ihnen mitgegeben haben.
Ein Sprichwort sagt, dass Geld den Charakter nicht verändert, sondern ihn sichtbar macht. Umso mehr sollte man versuchen, zeit seines Lebens die familiären Beziehungen so zu gestalten, dass sie auch nach dem eigenen Ableben intakt bleiben. Entscheidend in der Nachlassplanung sind nicht technische Details, sondern weiche Faktoren wie Emotionen und psychologische Sachverhalte. Ziel dieses Buches ist es deshalb, vermögende Familien in diesem Prozess gedanklich zu unterstützen und Wege aufzuzeigen, wie eine erfolgreiche Vermögensübergabe vorbereitet wird.
Wir möchten ausserdem mit diesem Buch einen Stein ins Rollen bringen, nicht nur bei den zahlreichen Familien, für die das Thema relevant ist, sondern auch bei Praktikern, die diese Familien in solchen Fragen beraten: Vermögensverwalter, Private Banker, Anwälte, Treuhänder, Psychologen und andere. Wir sind der Meinung, dass es unter ihnen allen einen Austausch braucht, um das Thema «Family Governance» voranzubringen und auf ein Niveau zu heben, das dem Stellenwert der Schweiz als Vermögensverwaltungsstandort entspricht. Dieses Buch ist ein erster Wurf; viele Fragen werden noch unbeantwortet bleiben, viele Stimmen ungehört. In diesem Sinn haben wir die Informationsplattform www.familygovernance.ch eingerichtet, wo Interessierte weitere Informationen zum Thema finden. Die Verfasser sind für Anregungen und Feedback unter [email protected] und [email protected] erreichbar.
Zürich, im November 2018
Jorge Frey, Eugen Stamm
EINLEITUNG
«Offenbar gibt es ein Gesetz dafür, wann Familien kollabieren: Wenn sie von einer Illusion leben und krampfhaft versuchen, an ihr festzuhalten.»
Paul Gattiker
DER MANN AM NEUMARKT
Ein warmer Frühlingstag im Jahr 2007. Ich, einer der Verfasser, sitze vor einem Restaurant am Neumarkt in Zürich, als sich ungefragt ein älterer Mann an meinen Tisch setzt. Er stellt sich als Kaspar vor, ein Name, der ihm nicht gefalle. In der Schule hätten sie ihn immer «Suppenkasper» gerufen. Kaspar muss offenbar in diesem Stadtteil so etwas wie eine Institution sein. Er wird von zahlreichen Passanten gegrüsst und grüsst zurück. Das hier ist sein Revier. Der Kellner stellt ein gut gefülltes Glas Rotwein vor ihn auf den Tisch, es wird nicht das letzte sein. Kaspar raucht Zigaretten der Marke Parisienne, trägt eine dunkelviolette Hose und einen ausgebleichten Faserpelz-Pullover. Seine Zähne sind gelblich. Am meisten fällt seine Brille auf, die er verkehrt herum auf der Nase trägt.
Ein gut gekleideter Mann will sich mit der Begrüssung «Ich hoffe, ich störe nicht» ebenfalls an den Tisch setzen, worauf Kaspar sagt: «Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn Sie eine Weile hier sind.» Der Mann stutzt, verzieht das Gesicht und geht. «Das war ein Architekt», sagt Kaspar abschätzig. Später werde ich verstehen, warum Kaspar etwas gegen Architekten hat. Er erzählt ein bisschen von sich, etwa, dass er für Zeitungen schreibe und andere, die seine Texte interessant finden. Einmal sei er für eine Arbeit auf der Kanalinsel Jersey gewesen, um über Victor Hugo zu recherchieren. Der Verlag habe alles bezahlt, das Essen sei vorzüglich gewesen. So geht es noch einige Zeit, bis Kasper sich eine neue Zigarette anzündet und beginnt, seine Lebensgeschichte zu erzählen.
Vor 100 Jahren ist Kaspars Grossvater in der Textilindustrie zu Vermögen gekommen. Als er stirbt, hinterlässt er jedem seiner Kinder, darunter Kaspars Vater, Millionen. Einige Nachkommen führen das Geschäft weiter. Kaspars Vater ist Architekt. Er übernimmt Aktien und Vermögen, von deren Erträgen seine Familie gut leben kann. Deswegen arbeitet er nur selten. Kaspar und seine Geschwister wachsen im Verständnis auf, dass Geld wie Wasser aus dem Wasserhahn sprudelt, wann immer man es braucht.
Schon in seiner Jugend verschlechtert sich Kaspars Verhältnis zu seinem Vater. Kaum volljährig, haut er nach Berlin ab, arbeitet am Theater und beim Film. Finanziell kommt er mehr schlecht als recht über die Runden. Schliesslich überwirft er sich vollends mit seinem Vater, der eine andere Gesinnung hat als er, nicht nur politisch. Die Quittung für das Zerwürfnis erhält er, als er von seinem Vater bei einem Erbvorbezug gegenüber seinen Geschwistern schlechter gestellt wird. Also nimmt sich Kaspar einen Anwalt – die Fronten zwischen den beiden verhärten sich weiter. Kaspar bezahlt Anwaltshonorare, geht vor Gericht, bekommt Geld und verbraucht es wieder. Der familiäre Krieg wird unerbittlich ausgefochten, und mithilfe seiner Anwälte schafft er es schliesslich, nicht enterbt zu werden. Kaspar sagt seinem Vater: «Du wirfst mir vor, nichts aus meinem Leben gemacht zu haben? Du hast es ja selbst zu nichts gebracht!» Inzwischen ist das dritte Glas leer und der Aschenbecher voll. Seit Kaspar angefangen hat zu erzählen, wollte niemand mehr an unseren Tisch sitzen.
Später kommt es zum Waffenstillstand zwischen Vater und Sohn, aber vieles ist zerbrochen und lässt sich nicht mehr kitten. Kaspar lebt vom ererbten Vermögen seiner Vorfahren, das ihm nach und nach zufliesst und ihn immer wieder über Wasser hält.
«Wissen Sie, hätte mein Vater arbeiten gelernt und wäre ich in einer normalen Familie aufgewachsen, dann hätte ich es vielleicht auch zu etwas gebracht. An Können hätte es mir nicht gemangelt», sagt er zu mir. Er werde seinen Nachfahren nichts vererben. Vielleicht sei das auch besser so, denn so müssten sie für sich selbst sorgen. Erben sei eigentlich nichts Gutes und sollte besteuert werden, sagt er, ist aber trotzdem froh, dass die Erbschaftssteuer abgeschafft wurde. Sein Leben wolle und könne er jetzt nicht mehr ändern. Plötzlich hat Kaspar genug und bezahlt seine Rechnung. Wir verabschieden uns. Ich sehe ihm nach, wie er durch den Rindermarkt Richtung Niederdorfstrasse geht. Ein paar Monate später ist Kaspar tot. Eine Quartierzeitung berichtet, er sei im September 2007 «fast völlig unbemerkt gestorben».
Zu erben gilt allgemein als glückliche Fügung. Kaspars Geschichte zeigt aber, dass es auch eine Herausforderung ist. Allein in der Schweiz gehen Jahr für Jahr zwischen 60 und 70 Milliarden Franken von einer Generation auf die nächste über, Tendenz steigend.1 Diese Zahl und unsere Erfahrung, dass die Themen Geld und Tod in vielen Familien immer noch Tabus sind, lässt uns vermuten, dass Kaspars Geschichte kein Einzelfall ist. An dieser Stelle werden sich wohl die meisten Leser sagen: «Bei uns in der Familie wird so etwas nie passieren!» Ist das wirklich so?
1WIR SIND VERMÖGEND, WAS JETZT?
«Wenn man nur glücklich sein wollte, wäre das bald geschafft. Aber man will glücklicher sein als die anderen und das ist fast immer schwierig, da wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind.»
Charles-Louis de Montesquieu (1689–
«DIR FÄLLT ALLES IN DEN SCHOSS!»
Die eigene Leistung ist für den Menschen ein grundsätzlicher Bestandteil des Lebensglücks. Geschenkte hundert Franken haben einen anderen Wert als selbst verdiente hundert Franken. Es ist ein entscheidendes Merkmal von Vermögenstransfers innerhalb der Familie, dass die Empfänger Vermögenswerte erhalten, für die sie selbst nichts getan haben.
Das meritokratische Prinzip ist in der Schweiz, so wie in anderen Ländern, nach wie vor stark verbreitet: Leistung legitimiert Einkommen. Jedes Jahr publiziert ein Magazin hierzulande eine Liste der 300 reichsten Schweizer. Während in den USA – von wo diese Idee importiert wurde – die Reichsten bewundert werden, schürt die Publikation in der Schweiz Neid und Missgunst. Sie vermittelt auch ein falsches Bild, wie ein Unternehmer sagt. Ein Grossteil seines Vermögens ist schliesslich in der Familienfirma gebunden, seine flüssigen privaten Mittel sind nur ein Bruchteil der Summe, die in der Liste der Reichsten angegeben wird.
Wer in einer Gesellschaft, die sich über Leistungsfähigkeit und -bereitschaft definiert, nichts anderes vorzuweisen hat, als Erbe zu sein, befindet sich sich selbst und anderen gegenüber im Erklärungsnotstand. Obwohl man viele Freunde haben mag, weiss man nicht, ob die Person oder der Geldbeutel geschätzt wird. Wenn das ererbte Vermögen einen zu starken Einfluss auf Identität und Lebensinhalt hat, besteht die Gefahr, einen wichtigen Teil seines Lebensglücks zu verlieren.
Die Vermögenden, mit denen wir gesprochen haben, sind sich bewusst, dass sie sich in einer privilegierten Situation befinden. Sie führen ein von Geldsorgen unbeschwertes Leben. Dafür sind sie dankbar. Schuldgefühle, weil es ihnen besser geht als fast allen anderen, haben sie nicht. In ihrer Einstellung zum Geld stimmen diese Personen darin überein, dass sie es nicht als etwas Schlechtes ansehen. Die Herausforderung liegt, soweit sind sie sich einig, vielmehr darin, etwas Sinnvolles damit zu tun. Eine Besonderheit der Schweiz ist, dass die Kinder vieler vermögender Familien gleich aufwachsen wie die von Familien mit Durchschnittseinkommen. Sie besuchen die gleichen öffentlichen Schulen und wohnen nicht in abgeschotteten «gated communities», sondern in sozial durchmischten Gemeinden. In den letzten Jahren ist jedoch eine Tendenz hin zur Abschottung bemerkbar, vor allem in den besser situierten und steuergünstigen Gegenden. Wir gehen im Abschnitt «Geld ohne Wurzeln» näher darauf ein.
Sandra Koch[36] ist das jüngste Kind einer Industriellenfamilie. Sie besucht die öffentlichen Schulen, verdient sich ab der sechsten Klasse ihr Taschengeld, indem sie in den Ferien im Familienunternehmen repetitive Arbeiten erledigt. Obwohl daheim viel über die Firma gesprochen wird, wächst sie in normalen, bürgerlichen Verhältnissen auf. Als ihr ein Schulkamerad sagt, dass ihre Familie reich sei, empfindet sie das als Beleidigung. Er habe damit sagen wollen, dass ihr aufgrund ihrer finanziellen Situation alles in den Schoss falle. Es stimmt zwar, dass ihre Eltern ihren Alltag in der Schul- und Ausbildungsphase finanziert haben, was in der Schweiz und auch in anderen Ländern selbstverständlich ist. Aber alles, was das Notwendige übersteigt, musste sie selbst finanzieren. So hat sie früh gelernt, dass man für Geld etwas tun muss, obwohl ihr die Eltern sehr vieles hätten kaufen können.
Peter Weber[61] besitzt ein Familienunternehmen in fünfter Generation. Obwohl seine Kinder nicht verpflichtet sind, ihm im Unternehmen zu folgen, zieht er sie früh in die Verantwortung und legt Wert auf Gleichbehandlung. Nach der obligatorischen Schulzeit sagt er ihnen einen einmaligen Ausbildungsbetrag von 100000 Franken zu, unabhängig davon, welchen Weg sie wählen. Damit müssen sie ihre Lehre oder ihr Studium und die damit verbundenen Lebenshaltungskosten (Studiengebühren, Wohnung, Essen, Freizeit, Ferien usw.) bestreiten.
Was nach verlockend viel aussieht, ist verbunden mit der Auflage, dass sie von nun an finanziell selbst für sich sorgen müssen. Dauert die Ausbildung vier bis fünf Jahre, ist langfristiges Budgetieren gefragt. Weber* sagt, dass seine Kinder so lernen, zu planen und sich zu organisieren. Mit dem Budget gibt er ihnen indirekt auch einen zeitlichen Rahmen vor. Seine Kinder werden nicht ewig Zeit haben, die Ausbildung abzuschliessen. Geld soll mithelfen, zum Ziel zu führen, aber nicht davon abhalten. Bei Erreichen des 20. Lebensjahrs erhalten sie zudem Aktien der Familienfirma, deren jährliche Dividende ausreicht, um über die Runden zu kommen, aber zu mehr nicht. Mit der privilegierten Startposition ins Leben wird jeder Nachkomme anders umgehen. Peter Weber* verknüpft finanziellen Spielraum mit Eigenverantwortung. Daran will er festhalten.
Jamie Johnson ist ein Nachfahre der Unternehmensgründer von Johnson & Johnson, eines der grössten Gesundheitsunternehmen der Welt. Er reflektiert darüber, was es bedeutet, in eine vermögende Familie hineingeboren zu werden. 2003 hat er einen Dokumentarfilm mit dem Titel Born Rich2 gedreht, in dem er Freunde und Bekannte zum Thema interviewt. Erschütternd ist die Aussage von Josiah Hornblower, einem Erben der Vanderbilt-Familie, die im 19. Jahrhundert mit Eisenbahnen ein riesiges Vermögen anhäufte.
An seinem 18. Geburtstag besucht ihn der Vater im Internat. Josiah muss viele Dokumente und sein eigenes Testament unterzeichnen. Er wird über Tatsachen ins Bild gesetzt, an die er nicht im Entferntesten gedacht hat. Dieses Ereignis fällt in eine Zeit, in der er darüber nachdenkt, was aus ihm dereinst werden soll und an welcher Universität er sich einschreiben will. Plötzlich ist er Multimillionär und erhält jedes Jahr aus einem Trust einen hohen sechsstelligen Betrag, während sich seine Freunde mit Sommerjobs über Wasser halten müssen. Die Situation überfordert Josiah, er gerät in eine Identitätskrise und unterbricht die Schule für zwei Jahre. Er sucht einen Job und findet eine Anstellung auf einem Ölfeld in Texas. Die Arbeit ist hart und kräftezehrend. Viele seiner Arbeitskollegen sind Immigranten, die nicht einmal über einen Sekundarschulabschluss verfügen. In der Mittagspause kommen sie ins Gespräch und lernen voneinander. Jeder ist fasziniert vom Leben des anderen. Es entstehen Kameradschaften über soziale Grenzen hinweg. Josiah hat diese Auszeit als die besten Jahre seines Lebens in Erinnerung. Er schliesst später doch noch seine Ausbildung ab und verdient mit seiner ersten Arbeitsstelle 50000 US-Dollar im Jahr. Das Salär seiner geregelten Arbeit steht im starken Kontrast zur Ausschüttung aus dem Familientrust von nahezu einer Million Dollar, für die er nichts zu tun brauchte.
Fünfzehn Jahre nach Erscheinen des Films forscht Business Insider UK nach, was aus den Erben geworden ist. Josiah erwähnt, dass er keine Reue habe, beim Film mitgemacht und sich kritisch geäussert zu haben. Er hat 2007 geheiratet und engagiert sich in zwei Firmen, die er mitgegründet hat.3
GELD OHNE WURZELN
Ein zweites Merkmal von Vermögen ist, dass es zu sozialem Aufstieg und Konsum drängt, aber nicht glücklich macht. Das zeigt das Beispiel von Nick Bauer[1], einem leitenden Angestellten eines Finanzinstituts, der befördert wird. Sein Einkommen steigt stark an, also sucht er nach einem neuen Wohnhaus in einem steuergünstigen Kanton. Noch bevor das Jahr um ist, zieht er mit seiner Frau und seinen zwei schulpflichtigen Kindern aus dem einfachen, aber gemütlichen Häuschen in einer Vorortsgemeinde in ein repräsentatives Domizil an bester Lage. Er hat erreicht, was er immer wollte.