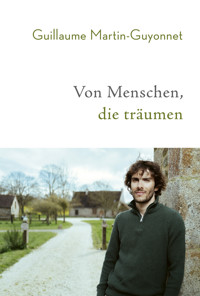
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Covadonga Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein unbekümmerter junger Radfahrer. Ein Kind voller Illusionen. Ein der Welt entrückter Gelehrter. Drei Schicksale. Drei Epochen. Der Geist eines Ortes. Ein junger Radfahrer trainiert auf den schattigen Straßen in der ländlichen Normandie. Der Radsport ist noch nicht sein Beruf, die Tour de France noch eine ferne Welt. Mit fünfzehn genießt er einfach den Augenblick, die Natur und seinen Atem, der sich gerade wieder etwas zu beruhigen beginnt. Fünfzig Jahre zuvor liegt ein Dorfjunge an einem Sommerabend auf einem Feld und betrachtet die Sterne – sein Herz ist voller Träume. Schließlich, im 16. Jahrhundert, beugt sich ein humanistischer Gelehrter vor dem Kamin in seinem Herrenhaus über seinen Schreibtisch, beseelt von der Arbeit an seinen Manuskripten. Drei Menschen. Drei Epochen. Drei Schicksale. Jahrhunderte trennen sie, aber ein Ort führt sie zusammen: das Landgut La Boderie in der Normannischen Schweiz, eine Oase der Ruhe im Grünen. Sie sind arglos und unbekümmert. Sie sind glücklich. Doch die Zeit und die Prüfungen des Lebens werden sie nach und nach von diesem einfachen Paradies entfernen … »Von Menschen, die träumen« ist das bisher persönlichste Buch des erfolgreichen Radprofis, Bestseller-Autors (»Sokrates auf dem Rennrad«) und studierten Philosophen Guillaume Martin-Guyonnet. Ein zauberhaftes Plädoyer, wieder das Träumen zu lernen. Sportler-Memoiren, wie man sie noch nicht gelesen hat: Gekonnt verwebt Guillaume Martin-Guyonnet eigene Erinnerungen als Radrennfahrer mit der Geschichte seiner Familie, seines Zuhauses und dessen berühmtesten historischen Bewohners zu einer anmutigen, mitreißenden Erzählung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Guillaume Martin-Guyonnet
VON MENSCHEN, DIE TRÄUMEN
Guillaume Martin-Guyonnet
Von Menschen, die träumen
Aus dem Französischen von Thaddäus Zobl
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »Les gens qui rêvent« bei Bernard Grasset, Paris.
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2024
Guillaume Martin-Guyonnet:
Von Menschen, die träumen
Aus dem Französischen von Thaddäus Zobl
deutschsprachige Ausgabe: Covadonga Verlag, 2025
Covadonga Verlag, Inh. Rainer Sprehe, Spindelstr. 58, D-33604 Bielefeld, [email protected]
ISBN (Print): 978-3-95726-100-7
ISBN (E-Book): 978-3-95726-101-4
Coverfoto: Louise Quignon
Druck und Bindung: Westermann Druck Zwickau GmbH – 1. Auflage, 2025
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.
Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de
INHALT
ERSTER TEIL
April 2009
April 2022
Juni 1954
August 1567
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Covadonga Verlag
Zuletzt erschienen
ERSTER TEIL
»My whole wretched life swam before my weary eyes, and I realized no matter what you do it's bound to be a waste of time in the end so you might as well go mad.«
JackKerouac,
On The Road (1957)
April 2009
Die Straße zieht vorbei. Nicht gerade die von Kerouac, flach, gerade und verraucht, aber dennoch ein Band, das ich unbekümmert entlangfahre, ohne daran zu denken, wohin es mich führen wird.
Ich bin auf einer kleinen Landstraße in der Normannischen Schweiz unterwegs, einer Gegend, in der die Départements Orne und Calvados zusammenfließen und die all diejenigen Lügen straft, die behaupten, dass die Normandie flach wäre.
Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich bin Jugendfahrer im ersten Jahr. Ich fahre zum Vergnügen Fahrrad, weil ich gerne neue Strecken erkunde, weil ich gerne herausfinde, was sich hinter den Landkarten verbirgt, und auch weil ich mir gerne wehtue: Ich gewöhne mich langsam an dieses Gefühl, in dem Vergnügen und Schmerz sich vermischen, eine Sucht, die ich auch fast fünfzehn Jahre später nicht wirklich abgelegt habe.
Ich rolle zwischen den beiden Dörfern Ménil-Hermei und La Forêt-Auvray dahin, nicht weit von der bekannten geologischen Stätte Roche d’Oëtre entfernt, einem natürlichen Felsaussichtspunkt, von dem aus man einen weiten Blick über den Bocage hat. Die Abfahrt endet. Die kleine Brücke über die Orne markiert den tiefsten Punkt der Senke, ab hier beginnt die Straße, sich wieder aufzubäumen. Der kleine Anstieg ist etwa zwei Kilometer lang, auf bestem Asphalt. Er verläuft gleichmäßig, bei fünf bis sechs Prozent Steigung, und windet sich in hübschen Serpentinen hinauf. Neben der Straße tummeln sich Pferde auf kleinen, sehr grünen Feldern, die mit Holzlatten eingezäunt sind. In der Ferne sieht man einen Tannenwald und den Kirchturm von Ménil-Hermei, wo ich noch vor wenigen Minuten gewesen bin.
Seit dem Beginn meiner Ausfahrt anderthalb Stunden zuvor sind mir vielleicht zehn Autos begegnet. Ich fahre gerne in diese Richtung raus. Ich weiß, dass ich hier meine Ruhe haben werde und mich auf meine Anstrengung konzentrieren kann. Ich fahre den Hügel in einem guten Tempo hinauf, etwa zwanzig Stundenkilometer. Ich bin etwas außer Atem und meine Beine beginnen zu brennen; es ist nicht unangenehm.
In diesem Moment denke ich nicht daran, eines Tages Profi zu werden, nicht an die Ergebnisse, die ich mit diesem Training erreichen werde, nicht an die Karriere, die diese Leistungen mir eröffnen werden, nicht an das Geld und die Anerkennung, die sie mir bescheren werden, nicht an die Bücher, die ich später schreiben werde, um über all das zu berichten. Ich denke nicht viel, ich bin einfach hier, an diesem Ort, im »Hier und Jetzt«, wie man so schön sagt.
Die Zukunft ist leer, unbekannt und daher objektiv beängstigend. Ich weiß nicht, was ich später einmal machen möchte. Meine Ergebnisse als Radsportler sind in Ordnung, aber nichts Außergewöhnliches. In der Schule gehöre ich zu den Besten, aber ich leide darunter, dass ich nicht in der Lage bin, mir eine Richtung zu geben und selbst etwas in die Wege zu leiten. Ich lasse mich treiben und warte darauf, dass andere für mich entscheiden. Ich habe wahrscheinlich ganz gute Karten in der Hand, aber ich bin zu zurückhaltend, um sie auszuspielen. Ich setze nichts in Gang. Wir werden sehen. Wir werden später sehen. Vergessen wir es einfach.
Im Moment, auf meinem Fahrrad, fühle ich mich gut.
April 2022
Ich bin jetzt achtundzwanzig Jahre alt. Ich nutze eines der in dieser Jahreszeit viel zu seltenen Wochenenden, an denen ich frei habe, ohne Rennen, ohne Trainingslager oder andere berufliche Verpflichtungen, um in die Normannische Schweiz zurückzukehren, an einen Ort namens La Boderie, auf das Landgut, auf dem ich aufgewachsen bin.
Dieser Ort ist meine Wiege, ein Ort, der von der Zeit und der Welt abgeschnitten ist. Um dorthin zu gelangen, biegt man drei Kilometer hinter dem letzten Dorf, das man passiert hat, in eine schmale, von Apfelbäumen gesäumte Straße ab, die in einer Sackgasse endet. Dann entdeckt man einen kleinen Weiler, der aus etwa zehn mit Ziegeln gedeckten Gebäuden aus grauem Granit besteht, die jedes für sich genommen bescheiden wirken, aber durch ihre Anordnung, durch die Nähe zueinander, einen Eindruck von Harmonie, ja, sogar von Größe vermitteln. Je mehr Zeit ich in La Boderie verbringe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass sich dort etwas Magisches entwickelt – eine besondere Atmosphäre, ein Zauber. Ich weiß nicht, ob das an dem Ort selbst liegt oder daran, dass er für mich mit dem Stempel der Kindheit versehen ist. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem.
Meine Aufenthalte hier sind nie sehr lang, seit ich Profi geworden bin. Morgen geht es wieder zurück ins Renngeschehen. Nach Hause kommen und gleich wieder aufbrechen. In der Zwischenzeit hat mein Coach mir für heute eine dreistündige Trainingseinheit aufgetragen, in der es um die MAP geht, die maximale aerobe Leistung. Das bedeutet fünf- oder sechsminütige hochintensive Belastungen in Form von Intervallen. Ich verlasse die kleine Straße von La Boderie, wie ich es schon so oft getan habe, und trainiere auf den Wegen meiner Jugendzeit. Ich fahre in Richtung Roche d’Oëtre und dann nach La Forêt-Auvray, wo ich meine erste Intervall-Serie absolvieren möchte. Der kleine Anstieg macht die Dauer der erwarteten Anstrengung greifbarer.
Wie fast bei jeder Trainingsausfahrt habe ich meine kleinen kabellosen Kopfhörer angeschlossen – ich höre nicht zu, aber es ist wie ein Hintergrundgeräusch, das die Langeweile ausfüllt, die aufkommen kann, wenn man jeden Tag mehrere Stunden Rad fahren muss. Es lenkt mich auch von den Schmerzen ab. Die Schmerzen machen sich bemerkbar, sobald ich kurz nach der Brücke über die Orne aus dem Sattel gehe, mich in die Pedale stemme und anfange, mit hoher Belastung zu fahren. Viel schneller könnte ich nicht mehr fahren, aber in Wahrheit tun mir die Beine gar nicht so weh: Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Fast so, als wäre ich darauf dressiert.
Aus den Augenwinkeln behalte ich meinen Radcomputer im Blick, um zu sehen, ob ich mich im Bereich der vorgegebenen Leistung bewege. Das könnte ich auch einfach anhand der empfundenen Anstrengung bestimmen, ich will mich nur selbst beruhigen. Ich habe nicht wirklich Zeit, die Landschaft zu betrachten, weder die schnaubenden Pferde noch den Kirchturm von Ménil-Hermei. Ich fahre mit einer Geschwindigkeit von fast dreißig Stundenkilometern.
Ich bin der Kapitän meines Teams. Ich habe bereits einmal den achten Platz in der Gesamtwertung der Tour de France belegt und schon mehr als zehn Profirennen gewonnen. Ich lebe komfortabel und man kann sagen, dass ich eine gewisse Bekanntheit besitze. Ich schreibe sogar Bücher und werde regelmäßig in Radiosendungen oder auf Fernsehbühnen eingeladen. Kurz gesagt: Ich habe alle Voraussetzungen für ein privilegiertes Leben.
Dennoch fühle ich mich ständig unzufrieden, als hätte ich nicht genug oder zu viel – ich weiß es nicht; ich glaube, ich habe vor allem Angst, von der Position herunterzurutschen, auf die ich mich zufällig hochgearbeitet habe.
Auf dem Fahrrad habe ich jetzt sogar Angst davor zu stürzen, was mir früher nie in den Sinn kam. Ich bin steifer geworden, als mir bewusst wurde, welche Risiken mein Beruf mit sich bringt und was ein schwerer Sturz bedeuten könnte.
Meine Position ist beneidenswert, aber sie ist unsicher. Wenn man alles hat, hat man am meisten zu verlieren.
Ich würde meine Gefühle nicht als »Depression« bezeichnen, aus Respekt vor dem, was eine Depression wirklich ist, und vor den Menschen, die davon betroffen sind, und vor allem, weil ich im Grunde genommen glücklich bin. Ich würde meinen Zustand eher mit dem von dem portugiesischen Schriftsteller Pessoa geprägten Begriff der »Intranquillität« in Verbindung bringen, diese nicht mögliche Ruhe, dieser Mangel, den man nie ausfüllen oder auch nur näher bestimmen kann.
Ich habe Verantwortung. Der Radsport ist für mich zu einem Beruf geworden. Ich entferne mich von La Boderie. Ich versuche, so schnell wie möglich die Kuppe der kleinen Erhebung von La Forêt-Auvray zu erreichen: Vielleicht finde ich dort oben meine verlorene Unschuld wieder.
Juni 1954
Es ist ein Frühsommerabend, siebzig Jahre zuvor, auf den Höhen eines Feldes in der Normandie, in der Gemeinde Ménil-Hubert-sur-Orne, nicht weit von La Forêt Auvray entfernt. Dani, mein Vater, ist sechs Jahre alt. Er ist sehr gut mit »P’tit Constant« befreundet, einem einfachen Mann um die vierzig, vielleicht etwas älter, vielleicht ein paar Jahre jünger, nicht sehr groß gewachsen, eher untersetzt und kräftig, ein »Quadratschädel« mit einem von der frischen Luft gemeißelten Gesicht, zu jeder Tageszeit mit einer Maiszigarette im Mundwinkel, der als Tagelöhner arbeitet. Er hilft auf einem Bauernhof und erhält dafür ein bisschen Kleingeld, Essen und eine Unterkunft, wobei Letztere aus einem Strohbett hinten in einer Scheune besteht.
Den ganzen Tag über wurde unter der drückenden Sonne von Hand, mit der Heugabel, das gemähte Gras auf den kleinen Parzellen gewendet, die so typisch für den Bocage sind, von deren Erhaltung zu dieser Zeit aber noch kein Mensch sprach, weil ihre Existenz so selbstverständlich war.
Vor dem Abendessen gönnen sich Dani und P’tit Constant ein paar Momente der Ruhe und Kontemplation. Sie liegen im gemähten Gras, auf dem abschüssigen Boden, genießen den Duft des Heus, das zu trocknen beginnt, und betrachten die orangen Wolken, die über den Himmel ziehen.
»Siehma’ do«, sagt P’tit Constant mit seinem normannischen Akzent, der unmöglich zu imitieren ist. Er zeigt auf eine der länglichen, sich schnell bewegenden Wolken, die besonders schön ist: »Dos is’ me’ne Mutte’, die vorbe’huscht.«
Dani hört zu, träumt und staunt. Er weiß nicht genau, ob sein Freund es ernst meint oder nicht, ob er verrückt ist oder nur so tut. Natürlich ist er weit davon entfernt, jenes Zitat des japanischen Autors Shûzaku Endô zu kennen, demzufolge »die Weisheit der Bauern in ihrer Fähigkeit liegt, sich zum Narren zu machen«. Er stellt sich diese Fragen nicht: Er genießt den Augenblick.
Allmählich bricht die Nacht herein, und die ersten Sterne kommen zum Vorschein. P’tit Constant zeigt Dani mit seinen schwieligen Händen die Sternbilder. Er kennt ihre Namen nur ungefähr, deshalb erfindet er sie manchmal. Er bemerkt drei Sterne, die ein Dreieck bilden, und nennt sie »das Dreirad«. Er sieht fünf weitere in einer geraden Linie und beschreibt sie als »Straße der Wunder«. Er hat auch Spaß daran, sich Geschichten zu den Sternbildern auszudenken, die er kennt. Er erklärt, dass der Große Bär so genannt wird, weil die Sterne, die man dort beobachten kann, von prächtigen Bären bevölkert werden. Er erzählt, dass Cassiopeia der Name einer riesigen Göttin ist, die über das gleichnamige Sternbild herrscht.
Dani hat seine Augen und Ohren weit geöffnet. Auch wenn er ahnt, dass das, was er hört, nicht immer ganz korrekt ist, lernt er. In der Feldschule lernt er sogar viel besser als in der Dorfschule, wo er seinen Platz ganz hinten im Klassenzimmer hat und im Winter den inoffiziellen Titel »Holzbeauftragter« trägt, was bedeutet, dass er dafür zuständig ist, den Ofen mit Holzscheiten zu füttern. Mit einer gewissen Genugtuung erzählt er P’tit Constant von seiner Aufgabe: Sobald die Flamme kleiner wird, verlässt er mit seinem Weidenkorb in der Hand den Raum, ohne auch nur Madame Botreau, die Lehrerin, um Erlaubnis zu fragen, und macht sich auf den Weg, um vom Schulhof ein paar Holzstücke zu holen, damit er nachlegen kann.
Natürlich, so gibt er verschmitzt zu, nutzt er die Zeit, um ein wenig herumzustreunen und bis ans Ende der Straße durch Ménil-Hubert zu gehen und zu schauen, was dort so los ist. Manchmal ist er fast eine halbe Stunde weg, ohne dass Madame Botreau etwas sagen würde. Das hat zweifellos mit seinen schulischen Defiziten zu tun, aber Dani bringt das nicht in Verbindung. Ihm ist es egal: »Beauftragter« klingt gut. Er hat seiner Mutter davon erzählt. Sie war stolz. Seine Mutter ist immer stolz.
Sie sollten lieber aufbrechen, zu ihr und den anderen, um gemeinsam zu Abend zu essen. Die anderen warten bestimmt schon auf sie. Und gleichzeitig wissen die beiden Freunde, was auf dem Speiseplan steht: »Schon wieder Kalbsgekröse, jeden Tag nur Kalbsgekröse, seit Anbeginn der Woche!« Sie können diese Suppe aus Kutteln, die tagelang in einem großen Topf gekocht und immer wieder aufgewärmt und an der Luft aufbewahrt werden, nicht mehr ertragen. Also haben sie zwar Hunger und wissen, dass es Streit geben wird, aber sie sitzen lieber still da, weit weg von allem, und beobachten den Himmel.
Jeden Abend, nach einem Nachmittag, an dem sie sich um ihren Garten und ihren Hühnerstall gekümmert hatte und manchmal nur mit einem Griebenbrot im Bauch, ging Andrée Martin, die Mutter von Dani, meine Großmutter, drei Kilometer zu Fuß von einem Weiler namens Buisson, der nicht weit von Ménil-Hubert entfernt liegt, über Feldwege zu ihrer Arbeit in einer Textilfabrik im Tal der Orne, das die Verlängerung der Täler des Noireau und der Vère ist. Letzteres sollte später den traurigen Beinamen »Tal des Todes« erhalten, weil dort fast ein Jahrhundert lang ohne jeden Schutz mit Asbest gearbeitet wurde und dabei die unsichtbaren Auslöser schwerer Lungenkrankheiten eingeatmet wurden, die auch heute noch Menschen töten. Angeblich wusste man nicht, dass es gefährlich ist. Um ehrlich zu sein, stellte man solche Fragen auch lieber gar nicht, zumindest nicht, wenn man in den Fabriken angestellt war: Die Normannen sind schweigsam, arbeitswütig und husten still vor sich hin.
Auch Andrée musste bestimmt eine Menge Asbeststaub schlucken, der sich durch den Westwind im ganzen Talkessel verteilte. Aber sie hatte andere Sorgen. Sie musste ihren Sohn allein großziehen, den jüngsten, den sie spät bekommen hatte, den, dem man keinen Vater gegeben hatte. Nicht, dass sie die Jungfrau Maria und Dani das Jesuskind gewesen wäre, natürlich gab es irgendwo einen Erzeuger, aber man wollte ihn nicht kennen, man wollte nicht, dass man ihn kannte, er war keine Person, die es verdient hätte, bekannt zu sein. Er war vergessenswert und man musste ihn vergessen. Wie gesagt: Die Normannen sind schweigsam.
In gewisser Weise zum Glück gab es die Arbeit, die nicht nur die Hände, sondern auch den Geist beschäftigte, und das harte Leben, das einen davor bewahrte, zu viel nachzudenken. Zum Glück gab es auch bald Bernard, der Andrées Lebensgefährte wurde, als Dani fünf Jahre alt war, ein sensibler und kluger, sanftmütiger und lustiger kleiner Mann, der zu allen freundlich war und sich um Andrée und auch um Dani kümmerte, zu dem er bald eine enge Beziehung aufbaute. Aber letztendlich war er nicht der Vater. Außerdem war Bernard oft weg, in Pont-d’Ouilly, in Falaise oder noch weiter weg in der Hauptstadt Paris, um Geschäfte zu machen. Er war Automechaniker und nebenbei auch ein bisschen Schmuggler – hier und da mal eine Fünf-Liter-Flasche Calvados, die in einem Doppelauspuff versteckt war, angeblich sah man nichts als Rauch …
Im Alltag war es Andrée, die sich um den Haushalt und um Dani kümmern musste. Während sie nachts arbeitete und tagsüber schlief, vertraute sie ihn ihrer Nachbarin und Freundin Madame Verrier an, die einen kleinen Bauernhof mit etwa zehn Kühen nur einen Steinwurf von Buisson entfernt bewirtschaftete, auf Land, das sie von einem angesehenen Mann aus Flers gepachtet hatte – gegen eine lächerliche Pacht plus eine Art Steuer auf die produzierten Waren: Butter, Milch, Apfelwein, Calvados .... wie zur Zeit der Gutsherren.
Es war die Zeit nach dem Krieg, also die Zeit vor Europa, vor der »Gemeinsamen Agrarpolitik«, vor der Mechanisierung der Landwirtschaft, auch vor dem Wettlauf um den Ertrag. Frankreich befand sich im Wiederaufbau, die ländlichen Gegenden wurden noch auf fast mittelalterliche Weise verwaltet. So wie Andrée, so wie viele Frauen in dieser Zeit, die ihren Ehemann oder Verlobten im Krieg verloren hatten, musste Madame Verrier nach dem Unfalltod ihres Mannes, der auf dem Hof von einem Karren überfahren worden war, allein für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sie wurde nur von P’tit Constant unterstützt, den sie bezahlte, so gut sie konnte, und je nach Umständen und Notlage von ihren Nachbarn, die sich zu einer informellen Genossenschaft, einer »Trümmer-Gemeinschaft«, zusammengeschlossen hatten. So funktionierte es damals, nur so konnte es funktionieren.
Zu dieser Gemeinschaft gehörte auch Marie Mitaine, eine ältere Frau, die im Talgrund lebte, eine sanfte und fürsorgliche Dame um die fünfzig, die Dani regelmäßig ein Stück Kuchen oder etwas Obst anbot, wenn er zu Fuß von der Schule nach Hause ging, weil sie wusste, unter welchen Bedingungen der Junge lebte, und weil sie etwas weniger arm war als die anderen. »Magst du Kirschen?«, fragte sie ihn zu jeder Jahreszeit und wiederholte die immer gleiche Frage Tag für Tag wie eine rituelle Formel, so als wäre es möglich, dass Dani über Nacht aufgehört hatte, die kleinen säuerlichen Früchte und die Freude an der Unbeschwertheit, die sie versprachen, zu mögen.
Wie fast jeder besaß auch Marie Mitaine ein paar Hektar Land, die sie mit der Unterstützung von Leon dem Belgier bewirtschaftete, einem Bauern, der wiederum von Rapide unterstützt wurde, einem großen, schönen Pferd mit orangem Fell, das Dani durch seine Majestät tief beeindruckte. Der Junge stellte sich das Trio wie Figuren aus einem amerikanischen Western vor, was seine Fantasie umso mehr beflügelte, da Dani noch nie einen Film dieser Art gesehen hatte.
Etwas weiter oben, wenn man über Buisson hinausging, dachte Dani eher an Jean Gabin, wenn er Roger Dujardin sah, einen anderen Bauern, der aussah, als wäre er einem alten Schwarz-Weiß-Film entsprungen. Aber wieder einmal war das Wesen, das ihn am meisten faszinierte, sein Pferd Bijou, eine massive Percheron-Stute, die einen vollbeladenen Karren die steilen Hänge des Ortes hinaufziehen konnte. Der kleine Junge war dem Percheron-Mann zutiefst dankbar für die große Unterstützung, die er seiner zweiten Mutter zukommen ließ. Er bewunderte Bijou sowohl für ihre Tugendhaftigkeit als auch für ihre Robustheit.
Diese Welt, in der sich Menschen und Tiere ohne Unterschied mischten – alle geeint durch eine gemeinsame Sorge –, war es, in der Dani aufwuchs. Inmitten von Figuren mit Namen wie Romanhelden, in einer Welt voller guter und großzügiger Menschen, die sich um starke Frauen gruppierten, die von wenig lebten und durch und durch Feministinnen waren. Der Junge war zwar oft auf sich allein gestellt, und diese frühe Unabhängigkeit belastete ihn manchmal, aber sie bedeutete auch, dass er nach Belieben blaumachen und unbeschwert in den Tag hineinleben konnte, in Gesellschaft von mal diesem und mal jenem, Léon der Belgier, Bijou, Rapide, Madame Verrier … Obschon es doch meist P’tit Constant war, den Dani am liebsten begleitete, wegen der verrückten Geschichten, die er nach Lust und Laune erzählte, während er den Heckenschnitt erledigte oder die Kühe fütterte.
Seine Mutter sah der Junge nur selten, denn wenn Andrée nach getaner Arbeit in der Fabrik frühmorgens nach Hause kam, ging sie direkt ins Bett, völlig übermüdet und »mit den Pfoten im Arsch«, wie sie es nannte. Sie wusste, dass sie in ein paar Stunden wieder von vorne anfangen musste, dass auch die Hausarbeit anstand, dann am Wochenende die Extraaufgaben, die liegengeblieben waren, und so weiter und so fort in einer anstrengenden Routine.
War Andrée glücklich? Man darf nicht unglücklich sein, wenn man reich ist, und man hat keine Zeit dazu, wenn man arm ist.
War Dani glücklich? Wenn er sich diese Frage nicht stellte, war es wahrscheinlich so.
August 1567
Es gibt noch eine weitere Figur in dieser Geschichte, bei der ich in gewissem Sinne sagen kann, dass Daniel und ich mit diesem Mann aufgewachsen sind. Sein Name ist Guy Lefèvre, Guy Lefèvre de la Boderie, benannt nach dem herrschaftlichen Landgut, auf dem er geboren wurde. Es liegt in der heutigen Gemeinde Sainte-Honorinela-Chardonne im Département Orne, nicht weit von den beiden Dörfern Ménil-Hubert und La Forêt-Auvray entfernt.
Guy Lefèvre ist ein Gelehrter aus dem 16. Jahrhundert, ein Homme de lettres, der viel schrieb und viel reiste, in der Epoche der Renaissance, einer Zeit der Erweiterung des Wissens, die aber auch von Kriegen und religiösen Spannungen geprägt war. Wie so viele andere gehört Lefèvre heute zu den Vergessenen der Geschichte, zu denjenigen, deren Werke unbeachtet in den Archiven schlummern und deren Taten keiner Erinnerung mehr angehören. Aus verschiedenen Gründen fühlte ich mich vor einigen Jahren vom Schicksal dieses normannischen Humanisten angezogen, der von den Idealen seiner Zeit geprägt war. Ich stellte Nachforschungen über ihn an, entdeckte die obskuren Texte, die er verfasst hatte, und versuchte, seinen Lebensweg nachzuzeichnen. Dort wo die Zeit Lücken hinterlassen hat, habe ich meiner Fantasie freien Lauf gelassen und mir ausgedacht, wie man sie füllen kann. Auf diese Weise, so glaube ich, erweckt man Vergessenes zum Leben.
Guys Geschichte, die Geschichte, die ich erzählen möchte, beginnt im August 1567, kurz vor Mariä Himmelfahrt, an einem wunderschönen Sommermorgen. Der junge Mann ist sechsundzwanzig Jahre alt und verbringt einen ganz normalen Tag im Herrenhaus von La Boderie. Seit dem frühen Morgen schreibt er an seinem Pult vor dem monumentalen Kamin des Hauses, der mit geheimnisvollen, in den Stein gemeißelten kabbalistischen Zeichen geschmückt ist, und reibt sich dabei mechanisch seinen noch spärlichen und doch bereits leicht ergrauten Bart, der einzige Anflug von Verspieltheit in einer ansonsten äußerst strengen Erscheinung. Die buschigen Augenbrauen, die dunklen Augen, das ausgemergelte Gesicht und die hohe Stirn, die sowohl auf große Intelligenz als auch auf beginnende Kahlheit schließen lässt, verleihen Guy den harten Blick eines Gelehrten, der wenig Wert auf den äußeren Schein legt. Dies zeigt sich auch in seiner Kleidung, einem grauen Wams aus dicker Wolle, der bis zum Kragen zugeknöpft ist und nur dazu dient, ihn vor der Kälte zu schützen.
Draußen ist es zwar warm, aber Guy ist von schwächlicher Konstitution und weiß, dass die dicken Steinmauern des Herrenhauses verhindern, dass sich der Wohnbereich aufheizen kann, und ihn stattdessen auf einer konstanten Temperatur von nur vierzehn oder fünfzehn Grad halten, so als wäre es eine Höhle. Er möchte nicht krank werden, vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, wo große Dinge auf ihn warten und er sich anschickt, Geschichte zu schreiben und der Welt das Geschenk seines Genies zu machen! Er bereitet sich nämlich darauf vor, im Herbst nach Antwerpen zu reisen, um an der Herausgabe der mehrsprachigen Bibel mitzuwirken, der »Biblia polyglotta«, einem monumentalen Unterfangen, einem beispiellosen kollektiven Übersetzungsprojekt, das die Heilige Schrift in fünf verschiedenen Sprachen, vom Griechischen bis zum Syrischen, in einem einzigen Buch präsentieren wird – und zugleich auch ein gewagtes technisches Unterfangen, ja, geradezu eine Revolution in der erst in der Entstehung befindlichen, kaum mehr als ein Jahrhundert alten Buchdruckerkunst, für die der angesehene Druckermeister Christophe Plantin verantwortlich sein wird.
Guy schaut auf die Truhe an seiner Seite, den schönen Eichenholzkoffer, der soeben für ihn angefertigt wurde und bereits mit den wenigen persönlichen Dingen gefüllt ist, die er mitnehmen will. Und allein der bloße Anblick dieses Gegenstands, der eine unvergleichliche intellektuelle Reise verspricht, versetzt ihn in Gefühle, die er sich kaum einzugestehen vermag.
Ich muss an meine Anfangsjahre als Radprofi denken und an die einfache Freude, die ich empfand, als ich meine Ausrüstung für die anstehende Saison erhielt, die gesamte Rennkleidung, sorgfältig verpackt in einem großen, schönen Koffer – etwa fünfzehn Radhosen, ebenso viele Trikots, Armlinge, Beinlinge, Handschuhe und Socken in Hülle und Fülle, dazu Zivilkleidung in den Farben meines Teams, so viele Sachen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie man sie alle in einer Saison verbrauchen konnte. Schließlich war ich zu jener Zeit noch die Do-it-yourself-Mentalität des Amateur-Pelotons gewohnt, wo man seine Klamotten zwischen zwei Etappen selbst von Hand waschen musste und zwei Trikots für ein ganzes Jahr reichen mussten. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt, mächtig stolz und in der großen Welt angekommen.
Guy ist nur wenig älter als ich damals, als er sich anschickt, La Boderie zu verlassen, und ich glaube, er befindet sich ebenfalls in diesem Stadium des naiven Staunens, erfüllt von der Leidenschaft derer, denen die Zukunft offensteht. Er lässt es sich zwar kaum anmerken, aber tief in seinem Inneren könnte er nicht aufgeregter sein, wenn er daran denkt, seinen Teil zu diesem großen Wissensabenteuer beizutragen, das die Antwerpener Bibel sein wird.
Von Zeit zu Zeit legt er kurz die Feder beiseite und verlässt sein Pult, um seine Reisetruhe zu inspizieren, bei deren Anblick er sich weiterhin am Spitzbart krault, als ob er sich mit einem theologischen Problem allerhöchsten Ranges befassen würde. Nach scheinbar reiflicher Überlegung zieht er ein, zwei Kleidungsstücke heraus, fügt ein paar Bücher hinzu, entnimmt ein Ding und legt es dann wieder hinein oder umgekehrt, kurzum, er zögert und richtet letztlich alles wieder so, wie es anfangs war, immer in der Sorge, irgendetwas vergessen zu haben, obwohl die Abreise erst in einigen Wochen geplant ist.
Auch ich habe diesen Stress mit dem Koffer erlebt. Später, also wenn man etwas älter geworden ist und sich an das ständige Herumreisen gewöhnt hat, wenn die Handgriffe fast mechanisch geworden sind und man seine Taschen zwischen zwei Reisen manchmal nicht einmal mehr auspackt, denkt man mit einem zärtlichen Lächeln an die ersten Male des Kofferpackens zurück und an die emotionale Investition, die dieser Moment mit sich brachte. Man lacht milde über sich selbst und trauert der Zeit hinterher, in der man bangen Herzens glaubte, sein Leben stünde auf dem Spiel, wenn man seine Taschen packt.
Doch Guy ist im Moment noch jung, und wenn er besorgt vor seinem Koffer steht und sich wünscht, dass alles perfekt für seine Abreise vorbereitet ist, dann deshalb, weil er bei der ihm zugedachten Aufgabe, eine syrische Version des Neuen Testaments ins Hebräische und Lateinische zu übersetzen, niemanden enttäuschen möchte. Der berühmte normannische Theologe Guillaume Postel hatte den jungen Mann als Schüler unter seine Fittiche genommen und ihm alle Feinheiten des Griechischen, Lateinischen, Hebräischen, Chaldäischen, Aramäischen und Syrischen beigebracht, bevor er ihn Plantin für das Projekt der mehrsprachigen Bibel empfahl und dabei sein Talent als Philologe und auch seinen Arbeitseifer rühmte. Was für ein Geschenk er ihm doch damit gemacht hat! Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Menschen die ihm zugedachte Arbeit als totlangweilig und ermüdend empfinden würden, aber Guy erfüllte sie mit einem tiefen Enthusiasmus und einem ernsten Gefühl der Verantwortung. Aus diesem Grund darf nichts in der Reisetruhe fehlen. Noch bevor er überhaupt in Antwerpen eingetroffen ist, macht sich der junge Mann bereits allein, aber mit großem Eifer daran, den Text zu entschlüsseln.
Im Herrenhaus von La Boderie, vor dem Kamin mit den in den grauen Stein gehauenen Motiven, in dem ein Feuer brennt, dessen Wärme ihn vor körperlichen Gebrechen bewahren soll, und neben dem geliebten Eichenholzkoffer, reibt und krault Guy immer wieder seinen Kinnbart beim Anblick der eleganten und geheimnisvollen Anordnungen des syrischen Alphabets, dieser fast unbekannten Sprache. Nur höchst selten einmal nimmt er sich die Zeit, die Gesellschaft seiner Eltern und Brüder zu genießen, geschweige denn die umliegende Natur, den Garten und den Teich, die an das Herrenhaus angrenzen. Seine Welt ist die der Buchstaben und des Geistes. Was ihn antreibt, sind seine grenzenlose Neugier und sein Wissensdurst. Was ihn entflammt und besessen macht, ist der Gedanke, sich in die Ewigkeit einzuschreiben! Ja, sein Ruhm wird es sein …
Doch ein Geräusch unterbricht Guy inmitten seiner gelehrten Schwärmerei, reißt ihn aus der Welt der faszinierenden orientalischen Schriftzeichen und wirft ihn zurück in seine weltliche Existenz.
»Mein Herr, Ihr Essen ist bereits serviert! Um ehrlich zu sein, fürchte ich, dass die Suppe schon kalt ist …«
Es ist die Stimme von Martin, dem für Guy zuständigen Diener, der von Jacques Lefèvre, dem Gutsherrn von La Boderie, beauftragt wurde, seinen Sohn zum Essen zu rufen, da er es leid war, wie fast jeden Tag auf ihn warten zu müssen.
»O ja, stimmt, das hatte ich vergessen«, antwortet Guy wie beiläufig und erinnert sich daran, dass er Hunger hat. »Sag meinem Vater, dass ich gleich komme.«
Und er fängt wieder an, an seinem Kinnbart herumzufummeln, ohne auch nur einmal von seinem Pult aufgeschaut zu haben.
Lassen sich bereits über Guy Lefèvre nur wenige biografische Daten finden, gibt es über seinen engsten Vertrauten Martin praktisch gar keine Informationen, sodass man sich sogar fragen könnte, ob er wirklich existiert hat. Ich persönlich bin jedoch davon überzeugt, dass er gelebt hat, und habe durch Nachforschungen und Quervergleiche versucht, sein Leben in groben Linien nachzuzeichnen. Ich halte es für normal, dass die einfachen Leute genauso viel zu sagen haben wie ihre berühmteren und höher geborenen Zeitgenossen.
Es war nicht allzu schwer, höher geboren zu werden als Martin, dessen Lebensweg unter einer Brücke im Dorf Pont d'Ouilly am Ufer der Orne begann, wo man ihn fand, als er gerade einmal ein paar Monate alt war. Wahrscheinlich war er einfach dort ausgesetzt worden, es sei denn, seine Eltern waren von der Pest betroffen, die 1544 in der Normandie wütete. Wie auch immer, es scheint, dass das verlorene Kind von Ordensleuten aufgenommen wurde, die den Waisenjungen nach einem Symbol der Nächstenliebe, dem berühmten Sankt Martin, tauften, wie es damals üblich war. Er wuchs in dieser Gemeinschaft im Hôtel-Dieu in Falaise auf, wo er eine rudimentäre Erziehung erhielt. Er lernte weder lesen noch schreiben, sondern nur richtig zu sprechen, sich gut zu benehmen und die Gebote Christi zu respektieren. Nach der Erstkommunion, also im Alter von etwa zwölf Jahren, musste er einen Beruf finden, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, denn sonst wäre er gezwungen gewesen, unter die Brücke zurückzukehren, unter der man ihn gefunden hatte, und sich als Bettler zu verdingen. Glücklicherweise waren Jacques Lefèvre und seine Frau Anne de Montbray, die gute Katholiken waren und wahrscheinlich seinen Fleiß erkannt hatten, bereit, ihn als Diener aufzunehmen, zunächst als Küchenhilfe, bevor sie seine Aufgaben erweiterten und ihm bald die Rolle eines Faktotums in La Boderie anvertrauten, eines wahren Mädchen für alles.
Zuvor von Natur aus eine hagere, traurige Gestalt, gewann Martin nun recht bald die sanfte, milde Ausstrahlung jener Menschen vom Land, die unter allen Umständen glücklich zu sein scheinen. Etwas mollig, aber nicht dick und mit einem schelmischen Blick in den Augen, war er im wahrsten Sinne des Wortes ein »guter Mensch«, jemand, der immer hilfsbereit war, Konflikte verabscheute und Probleme entschärfte, bevor sie überhaupt entstanden. Das bedeutete jedoch nicht, dass er von den Sorgen des Lebens unberührt blieb oder vollkommen glücklich war. Im Gegenteil, er trug seit seiner Kindheit eine innere Zerrissenheit in sich, die er nicht überwinden konnte. Es war nur so, dass er aus instinktivem Anstand darauf bedacht war, es nicht zu zeigen.
Sein Arbeitseifer und seine natürliche Fürsorge machten Martin zu einem der besten Hausangestellten der Familie, ja, sogar zu mehr als nur das: Er wurde zu einem Vertrauten für Guy. Da der Diener nur wenig älter war als sein Herr, waren die beiden Jungen gemeinsam aufgewachsen, in gegenseitigem Respekt, ohne dabei je den Klassenunterschied aufzuheben – Renaissance bedeutete schließlich nicht Revolution. Aber sie hatten stillschweigend ein seltenes Einverständnis gefunden: Guy betrachtete den Mann, der auf all seinen Reisen dabei war, als Gefährten und Freund, ja, fast wie einen älteren Bruder, während Martin, der seinen jungen Herrn aufrichtig bewunderte, darauf achtete, dass es diesem nie an etwas fehlte, vor allem nicht, was materielle Bedürfnisse betraf, die doch allzu oft von denjenigen vernachlässigt werden, die sich von geistigen Werken gefangen nehmen lassen.
Getrieben von dieser Fürsorglichkeit, erscheint Martin an diesem Tag im August 1567, einige Stunden nach dem Mittagessen, im großen Salon des Herrenhauses, um seinem Herrn einen Aufguss aus Thymian, der im Kräutergarten des Anwesens geerntet worden war, und einige Butterkekse zu servieren, die seit jeher die Spezialität der Region sind.
Martins diskrete Anwesenheit wird von dem Literaten zunächst nicht bemerkt, während er vor dem Kamin des Herrenhauses steht und etwas vorträgt, was ein Gedicht zu sein scheint:
»O seliger Ort, dreimal gesegnetes Land
Wo mich erfüllten Genie und Verstand
Am Tag vor Laurentius, als ich geboren
Umrankt von Lorbeer, in der Wiege erkoren!
O glückliche Felder, o wogendes Tal
So mancher Bach, o Wald überall
Du gnädige Flur, wo seit zarter Kindheit an
Süß’ Himmelsluft tief empfinden ich kann […]«
Ich erspare dem Leser die vollständige Version dieses Textes, der in einem elegischen und zugegebenermaßen ziemlich schwülstigen Stil verfasst wurde.
Martin hingegen muss das ganze Gedicht durchstehen. Schlimmer noch: Guy hat den Diener mitten in seiner Rezitation bemerkt und bittet ihn nun um seine Meinung. Das bringt den jungen Mann in große Verlegenheit, denn er versteht nicht viel von Versen (»Ist es das, was man Verse nennt?«), und noch weniger von jenen, die er soeben gehört hat und die in einem beseelten, fast ekstatischen Tonfall vorgetragen wurden.
Aber der Diener hatte sehr wohl verstanden, dass seine Arbeit nicht nur darin bestand, die Sorgen des Alltags zu bewältigen, sondern dass er auch das ständige Bedürfnis seines Herrn nach Bestätigung erfüllen musste, indem er ihm, wann immer es angebracht schien, hinsichtlich seiner Talente schmeichelte – auch wenn es um literarische Themen ging, die ihm völlig fremd waren.
Als Guy ihn also zu dem Gedicht befragt, das er gerade laut vorgetragen hat, improvisiert Martin, nicht ohne zu zögern, eine entsprechende Antwort:
»Ich … also, ich finde das Sonett sehr schön!«
Angesichts Guys zurückhaltendem Blick fühlt sich der Diener verpflichtet, weiter auszuholen:
»Es ist … Es ist fraglos das Werk eines Genies der Worte!«
Dann erinnert er sich an einige berühmte Namen, die Guy ihm gegenüber voll Emphase erwähnt hatte, und fährt mit zunehmender Selbstsicherheit fort:
»Ist es Dante? Oder Homar? Ich für meinen Teil muss jedoch zugeben, dass es mir lieber gewesen wäre, wenn die Referenzen etwas weniger explizit wären.«
»Du hast recht, Martin, du hast wie immer recht«, erwidert Guy, der ein wenig errötet ist und weder den verdrehten Namen noch die Selbstironie in den Worten seines Gefährten bemerkt hat. »Aber deine Worte ehren mich, denn du musst wissen, dass dieses Gedicht nicht von Homer oder Dante stammt, sondern von mir selbst. Es handelt sich um eine sogenannte Elegie, eine Hommage an diesen Ort, an die Domaine de la Boderie, an das Herrenhaus und seine Ländereien.« Und während er wieder eine ernste und seriöse Miene aufsetzt, fügt er noch hinzu: »Natürlich ist diese Komposition für mich nur ein Spaß, wie eine Erholung, um mich kurz von meiner Übersetzungsarbeit abzulenken.«
»Das ist schon eine seltsame Art der Erholung«, denkt Martin. Für ihn, der seine Kindheit abgeschottet und unglücklich hinter den Mauern des Hôtel-Dieu verbracht hatte, ist es unvorstellbar, dass es Spaß machen könnte, den ganzen Tag eingesperrt zu bleiben, nur um nachzudenken und zu schreiben. Ebenso wenig kann er verstehen, wie Guy die Domaine de la Boderie lobpreisen kann, ohne jemals den Hauptraum des Herrenhauses zu verlassen. Man sieht ihn nicht draußen, sein Herr hat die blasse Hautfarbe jener Menschen, die sich nur selten der Sonne aussetzen: Was weiß er schon über »glückliche Felder« und von »Wald überall«? Unter den Bediensteten ist es längst zu einem netten Ritual geworden, sich über den jungen Gelehrten und seine Fantasiewelt, die er sich geschaffen hat, lustig zu machen. »Es wäre besser zu leben«, beteuern sie untereinander, »anstatt den ganzen Tag zu schreiben!«
Obwohl Martin, genau wie die anderen Diener und Mägde, nichts vom Innenleben seines Herrn mitbekommt und sich aus Gründen des Gemeinschaftsgeistes ebenfalls am kollektiven Gelächter beteiligt, ist er tief in seinem Inneren in Wahrheit doch eher verwundert als höhnisch. Er findet es faszinierend, dass die Welt der Fantasie die reale Welt überlagern kann, und schön, dass man die Sanftheit eines Waldes oder den Geruch von Weizen besingen kann, während er selbst in dem Getreide nie etwas anders als ein Nahrungsmittel und in den Ästen eines Baumes nie etwas anderes als eine Ressource zum Heizen gesehen hat. Und schließlich beneidet er den jungen Guy auch um seine unbekümmerte Frische, so glücklich und erfüllt, wie er wirkt, allein vor seinem Pult, gleichgültig gegenüber dem Geschwätz, mitgerissen von der Freude am Schaffen, betäubt von dem Wunsch zu lernen und zu verstehen.
Oder ist es nur so, dass ich beim Schreiben neidisch auf Guy Lefèvre bin, diese mythisch verklärte Figur, die ich rekonstruiere? Wie seltsam es doch ist, sich nach einer Welt zu sehnen, die viereinhalb Jahrhunderte vor einem existiert hat, nach einer Welt, die man erfindet und zugleich wiedergibt.
Glücklicher Idiot: Im Französischen kennt man den Begriff des »imbécile heureuse«, des »glücklichen Idioten«.
1/ Im Allgemeinen wird der Ausdruck mit negativer Konnotation benutzt, um Personen oder Wesen mit schwachem Geist zu bezeichnen, in Abgrenzung zur – vermeintlichen oder tatsächlichen – Intelligenz des Sprechers, der den Begriff verwendet.
Beispiel: »Du Idiot. Du glücklicher Idiot!«
Oder auch: »Diese Katze verbringt den ganzen Tag mit Schlafen, sie ist wahrlich ein glücklicher Idiot.«
2/ Indem man ihn in einem positiven Sinne verwendet, kann der Ausdruck auch dazu dienen, Personen oder Wesen zu bezeichnen, die von ihrer Leidenschaft beseelt sind, voller unschuldiger Begeisterung stecken und so letztlich ein beneidenswertes Dasein führen.
Beispiel: »Don Quichotte ist verrückt, ja, aber seine Hirngespinste tragen ihn. Er besitzt die Gabe des glücklichen Idioten.« (Étude savante sur la vie de l'homme de la Mancha von Jean-Baptiste Botul, erschienen bei POUF, Paris, 1927).
Oder: »Diese Katze verbringt den ganzen Tag mit Schlafen, sie ist wahrlich ein glücklicher Idiot.«
Während Dani im allgemeinen Unterricht eher schlecht ist, weil er nicht gefordert wird, macht er das beim Schreiben von Aufsätzen wieder etwas wett. Das ist jedenfalls das einzige Fach, das ihm Spaß macht. Es ermöglicht ihm, aus den vier Wänden des Klassenzimmers, in denen er sich gefangen fühlt, auszubrechen und Traumwelten zu erkunden. Es bringt ihn der Literatur näher, einer Welt, die so gänzlich anders ist als die seine und ihn deshalb umso mehr fasziniert.
Auf die Frage, welchen Beruf er später einmal ausüben möchte, antwortet Dani selbstbewusst: »Ich werde Bücher machen« – ohne wirklich genau zu wissen, was das bedeuten könnte: sie zu schreiben, sie zu veröffentlichen, sie zu drucken? Sicher ist, dass er sich vom Buch als Objekt angezogen fühlt, vom Papier und seinem Geruch, von den Druckbuchstaben und ihrer fast mystischen Kraft.
Diese besondere Anziehungskraft wird dazu führen, dass er später zwanghaft alle Arten von gedruckten Dokumenten, die er findet, aufbewahrt und sammelt, ohne festen Plan, ohne Grenzen, ohne Ziel: Bücher selbstverständlich, aber auch Briefmarken, Zeitungen, Plakate, Reiseprospekte, Metro-Tickets oder sogar Quittungen, alles, solange es irgendeine Form von Druckwerk ist. So wie viele Menschen, die einmal von sehr wenig leben mussten, kann er sich nicht dazu durchringen, etwas wegzuwerfen. »Man kann ja nie wissen«, sagt er sich.
Obwohl Bücher für ihn viel mehr als nur Texte sind, verachtet er ihren Inhalt keineswegs, und als Erwachsener liest er viel, vor allem Krimis, aber auch anspruchsvollere Autoren. Robert Walser wird einer seiner Lieblingsschriftsteller. Ein Zitat von ihm erregt seine Aufmerksamkeit: »Ich fühle, dass das Leben Wallungen verlangt, nicht Überlegungen.«
Dann sieht er sich selbst als Kind, das es eilig hat, die Schule und ihre Probleme hinter sich zu lassen und zusammen mit seinem vier Jahre älteren Freund Gérard, dem Sohn von Madame Verrier, draußen herumzutoben, einer Naturgewalt mit prallen Muskeln und einem weichen Herzen, die allen Kindern im Dorf imponierte. Das war für Dani sehr praktisch, denn er hatte in ihm seinen Beschützer, seinen »großen Bruder«, gefunden. Sie genossen das Landleben und eine kindliche Unbeschwertheit, die noch nicht von Pflichten und Verantwortungen torpediert wurde.
Er erinnert sich zum Beispiel an ihre Abenteuer mit einer Kameradin namens Rosalie. Ach, Rosalie! Welchen kindischen Freuden die drei doch frönten! Sobald die Schule aus war, eilten Gérard und Dani zu ihr, der treuen Gefährtin Rosalie, um gemeinsam in vollem Tempo vom Rigorée-Hügel die kleine Straße nach Buisson hinunterzusausen.
An dieser Stelle muss gesagt werden, dass Rosalie der Name war, auf den die beiden Jungen ein altes Fahrrad getauft hatten, das sie auf einer Müllhalde in Rouvrou am Fuße des Roche d’Oëtre gefunden hatten. Die beiden hatten den Rahmen mit einer Mixtur aus Rüben und weißem Essig rosa lackiert – nach einem Rezept aus einer alten Ouest France-Ausgabe –, nachdem sie zuvor noch ein paar eilig zusammengesammelte Komponenten drangeschraubt hatten. Trotz ihres geflickschusterten Äußeren, ihres Herzens aus Stahl und der schweren Verantwortung, die auf ihr lastete, war Rosalie eine aufrichtige und engagierte Freundin, die immer bereit war, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Sie hatte keine Bremsen, was sich in den Extremsituationen, in die sie getrieben wurde, als durchaus heikel erweisen konnte.





























