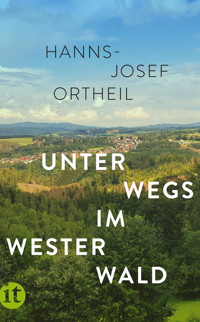11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In kurzen Prosatexten umkreist Hanns-Josef Ortheil das Zeitgeschehen der letzten fünf Jahre. Meist entzündet sich die Erzählung an einer Begebenheit, einer Nachricht, einer Begegnung – und führt ins Autobiografische, Philosophische oder auch Humoristische. Ob er die agile Kontaktfreude von Pinguinen beschreibt oder erklärt, warum sich die Bilder Jan Vermeers so großer Beliebtheit erfreuen – stets münden seine Aperçus in eine Pointe, weiten sich vom Privaten oder auch Zufälligen zum Allgemeinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Wo Hanns-Josef Ortheil ist, herrscht Licht.«
STEFAN KISTER, STUTTGARTER ZEITUNG
In kurzen Prosatexten umkreist Hanns-Josef Ortheil das Zeitgeschehen der letzten fünf Jahre. Meist entzündet sich die Erzählung an einer Begebenheit, einer Nachricht, einer Begegnung – und führt ins Autobiografische, Philosophische oder auch Humoristische. Ob er die agile Kontaktfreude von Pinguinen beschreibt oder erklärt, warum sich die Bilder Jan Vermeers so großer Beliebtheit erfreuen – stets münden seine Aperçus in eine Pointe, weiten sich vom Privaten oder auch Zufälligen zum Allgemeinen.
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sein Gesamtwerk umfasst mehr als siebzig Buchveröffentlichungen. Hanns-Josef Ortheil zählt zu dem meistgelesenen deutschen Schriftstellern der Gegenwart. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Hanns-Josef Ortheil
VON NAHEN DINGEN UND MENSCHEN
Ein Teil der Texte erschien erstmals im »Kölner Stadt-Anzeiger«.
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1014-8
www.dumont-buchverlag.de
VORWORT IM FLUSS DER ZEIT
Die folgenden kurzen Texte sind im Zeitraum von fünf Jahren, von 2018 bis 2023, entstanden. Sie sind ein Part der Aufzeichnungen, die ich meist täglich mache und oft mit anderen Menschen teile.
Das unterscheidet sie von Tagebucheinträgen, die intimer und privater sind und meist nur in Innenwelten kreisen. Die Aufzeichnungen dagegen konzentrieren sich auf ein Tagesereignis, das sich von außen meldet und ins Innere eindringt – eine kleine oder größere Erregung, ein Faszinosum. Ich folge diesem Anstoß eine Weile, versuche, ihn genauer zu erkennen und zu bestimmen. In ihrer Folge ergeben die Erzählsplitter einen Strom, als ließe sich der Fluss der Zeit in einem fortlaufenden, kontinuierlichen Streaming abbilden.
Keine Daten, keine Etappen und erst recht keine Kapitel – das Fließen bringt die Dinge und Menschen für einen Moment ans Licht und lässt sie zurück ins Dunkel treiben. Kleine Daseinsfenster öffnen sich und für einen Moment stehen Freundinnen und Freunde in der Öffnung, schauen hinaus oder blicken fragend. Ihnen gemeinsam ist eine bestimmte Nähe. Kein Abdriften in weit hergeholte Terrains oder gar Theorien, sondern Anschaulichkeit von Umgebungen, die vermessen werden. Sie bleiben durch ein Erzählen erhalten, das ein einziger Sprecher organisiert, sodass man auch von einem Monolog sprechen könnte. Andere wiederum mögen sogar ein Gespräch oder etwas Romanhaftes erkennen.
Wie auch immer – ich danke meinen Nächsten, die mich durch fünf Jahre begleitet, mir viele Anregungen gegeben und mich nicht allein haben schreiben lassen. Das ist nicht nur mein, sondern auch unser Buch, in dem wir jene Dinge und Menschen wiederfinden, die eine Weile zu uns gehörten.
So werdet Ihr vieles entdecken, was uns allen durch den Kopf ging, und aus meinen kurzen Erzählungen könnten Geschichten werden, die Ihr selbst weiterschreibt!
Köln, Wissen an der Sieg,Stuttgart, im Herbst 2023
ZOOBESUCH
Seit vielen Jahren einmal wieder im Zoo. Was für seltsame Begegnungen! Fast alle Tiere nehmen einen in ihren Gehegen nicht wahr, sondern führen ein merkwürdig introvertiertes Dasein.
Der Marabu steht stundenlang wie ein verbitterter Greis im Nichts und bringt es nicht einmal zu einem winzigen Zucken. Die Erdmännchen liegen auf dem Rücken unter hellen Strahlern und tun so, als wären sie im Urlaub am Meer. Das Panzernashorn verlässt seine Tiefbadewanne keinen Moment, sondern suhlt sich schnaubend im Wasser. Nirgendwo eine Reaktion!
Löwen, Tiger und Geparde haben nichts anderes als das mittäglich angebotene Fressen im Sinn und gönnen sich nach dem Verzehr eine unverschämt lange Siesta. Und die königlichen Riesenschlangen bewegen sich den lieben langen Tag gar nicht, sondern verdauen ausschließlich.
Da ist es eine Freude, der hellwachen Ausnahme eines Pinguins zu begegnen! Als ich ihn anschaue, rudert er beflissen heran, stellt die Brillenlinsen scharf, schaut zu mir hoch, meldet die Wassertemperatur, gleitet elegant davon, dreht eine Runde und kommt zurück, um den Blickkontakt zu erneuern. Hingerissen habe ich eine Patenschaft übernommen und versprochen, seinetwegen ab sofort regelmäßig zu kommen.
DINGE DES LEBENS
Vor etwas über dreißig Jahren ist mein Vater gestorben. Seither trage ich die Uhr, die er bei seinem Tod am linken Handgelenk hatte. Ich habe sie ihm mehrere Jahre davor geschenkt und damals daran gedacht, dass ihm etwas Schlichtes, gleichzeitig aber auch Modernes gefallen würde. Die Uhr sollte nicht weiter auffallen, andererseits aber ein zeitgemäßes Signal senden. Keine Nostalgikeruhr, sondern eine, die up to date aussah.
Der Name der Marke (Pulsar) kam dem entgegen, er spielte auf astronomische Vorgänge an, auf einen Neutronenstern und seine Explosion – und damit auf Natur, Weite, das Universum. Als reagierte sein Träger darauf, dass seit einiger Zeit Raketen und Satelliten um die Erde kreisten.
Das Geschenk der kleinen Uhr war auf diese Weise eng mit dem Menschen verbunden, der sie erhielt. Sie traf nicht nur seinen Geschmack, sondern spiegelte sein Wesen: das eines Mannes, der sich nie hervortat und (von Beruf Ingenieur) ebenso naturbesessen wie hingerissen von Forschung war, die auch aufs Weite zielte und den Kosmos mit einbezog. Vom Gärtner, Förster, Geodäten, vom Astronomen und Sterngucker – von all diesen Daseinsformen war mein Vater geprägt. In der Uhr von Pulsar trafen sie zusammen und wurden mit jedem Blick auf den laufenden Zeiger aktualisiert.
Ich besitze viele Dinge des Lebens wie dieses. In ihnen ist die sich verflüchtigende Zeit gespeichert und mit den Emotionen eines Menschenlebens verbunden. Jedes Mal, wenn ich sie sehe oder benutze, bleibt die Zeit einen Moment lang stehen und gelebte Augenblicke oder Stationen melden sich: Wie stolz die Stimme meines Vaters sich anhörte, als er von seiner Quarzuhr sprach! Wie er sie oft (beim Zeichnen) neben sich legte und murmelte: »Jetzt muss sie mal ruhen!« Und wie er, als sie zum ersten Mal stehen blieb, naiv tuend zu ihr sagte: »So einen Stillstand tust du mir jetzt aber nicht laufend an!«
BRÜDERLICHE NÄHE
Meinen alten Freund Peter rufe ich regelmäßig an, meist wenn ich aus dubiosen Gründen etwas durcheinander bin. Er meldet sich immer sofort und sagt: »Na?«, mehr nicht. Ich rede nicht von meiner Unruhe, sondern erzähle ein wenig: dass ich den Herbstwald mit seinen Farben irritierend finde, dass ich momentan häufig Aufnahmen des Pianisten Edwin Fischer mit Bachs Präludien und Fugen[M1] höre und dass eine Leserin in Würzburg vertraulich zu mir gesagt hat, ich solle bald nach Japan reisen, das werde mir guttun.
Peter lauscht meinen Worten und kommentiert sie nicht. Er erzählt auch nicht von sich selbst, sondern wartet, bis ich mit meinen Nachrichten fertig bin. Während ich spreche, werde ich ruhiger. Peter bekommt das durch sein Zuhören hin, gelassen, wie er meist ist. Oft fragt er nach: Wo genau warst du im Herbstwald? Und warum hörst du häufig Edwin Fischer? Und welches Japan meinte die Leserin? Wenn ich auf solche Fragen antworte, gewinne ich Boden unter den Füßen. Der Herbstwald, Edwin Fischer und Japan – sind das nicht bedenkenswerte Themen, aller Vertiefungen wert?
Schließlich steigt Peter auch selbst ein und spricht von der Zukunft: Wollen wir morgen mit dem Rad durch die Gegend fahren? Oder wollen wir schwimmen gehen? Oder wollen wir wieder mal kegeln, in dem alten Keglerheim, in dem sonst niemand mehr kegelt?
Wer ist Peter eigentlich? Manchmal spricht er zu mir wie ein älterer Lehrer, der mich vor Jahrzehnten einmal unterrichtete und seinen Schüler noch weiter durchs Leben begleitet. Andere Male redet er aber so, als wäre er mein Schatten, mein Gegenüber, mein Bruder. Und vielleicht ist er das auch, vielleicht ist er genau das. Seine Präsenz in meinem Dasein erscheint mir oft wie ein Geschenk, über das ich nicht allzu lange nachdenke. Ich sollte mich einfach nur freuen, dass er immer an meiner Seite ist. Heute hat er Geburtstag. Diesmal werde ich ihn anrufen und sagen: »Na?«
GRISSINI
Grissini sind eine typische Erfindung der italienischen Küche. Ihre Herstellung ist nicht aufwendig, und man braucht nicht viele Zutaten: etwas Mehl, Hefe, Wasser, Salz, Olivenöl. Der fertige Teig wird zu schmalen, spitz zulaufenden Stangen gedreht und kommt in den Ofen. Hinterher müssen sie noch durchatmen und austrocknen, dann sind sie länger haltbar. Knusprig sollen sie schließlich sein, und am schönsten sind sie, wenn sie noch Luftlöcher, Blasen und »Knorpel« haben.
Typisch italienisch ist, dass sie auch ästhetische Skulpturen sind, deren Herstellung durch die Handformung noch deutlich erkennbar ist. Sie sind also Kunsthandwerk mit menschlichen Spuren, ähneln andererseits aber auch Gestalten der Natur. So betrachtet erinnern sie an braune Stöcke oder Äste, wie man sie im Herbst auf dem Waldboden findet.
Vor einer Mahlzeit liegen sie in einer Schale oder einem Korb, dicht neben- und aufeinandergestapelt. Man kostet sie als Erstes, sie machen Appetit und verlangen nach einem Schluck (Wasser? Wein? Sekt?). So leiten sie die Mahlzeit ein oder konturieren selbst eine Zwischenmahlzeit. In diesem Fall begleiten sie andere Minima (Pasten, Käse oder Schinken, den man um sie herumwickeln kann).
Dass sie nur in Italien entstehen konnten, macht schließlich ihre eleganteste Funktion deutlich: In den Händen einer sich unterhaltenden Runde von Essern dirigieren sie die Konversation. Man hält sie mit den Fingern, schwingt sie durch die Luft, knabbert an ihnen, lässt sie sich heben und senken. Bissen für Bissen verschwinden sie langsam im Mahlwerk der Worte, als gehörten sie zu Boccaccios Erzählrunden von Frauen und Männern in den luftigen, schönen Gefilden weit draußen, außerhalb der geschäftigen Stadt.
KÖLSCH, ABER RICHTIG
Selten hat das Motto einer Kölner Karnevalssession so viel Aufmerksamkeit erregt wie »Uns Sproch es Heimat«. In einem Interview über diesen Volltreffer stellte sich heraus, dass Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn sich längst in einen brillanten Linguisten verwandelt hat. Losgelegt hat er mit einer Tiefenanalyse des Kölschen Schwadens, wie sie ein Linguistik-Ass vom Rang eines Noam Chomsky nicht besser hätte hinbekommen können.
Kölsch, hat der Präsident theoretisiert, ist eine verbindende, warme, ja umarmende Sprache. Jeder, der sich mit einem anderen Dialekt an den Karnevalstagen nach Köln bewegt, wird das zu spüren bekommen. Der auf Distanz bedachte Schwabe wird seine Distanz schrumpfen lassen, der erdbetonte Bayer wird sich hohe Luftsprünge zutrauen, und den kühlen Hamburger wird die Vollwärmstufe des Kölsch zu einer selten regen Erscheinung machen. An den heiligen Tagen werden an zentralen Plätzen Lilliput-Ausgaben des Wörterbuchs »Kölsch-Hochdeutsch/Hochdeutsch-Kölsch« mit zusätzlichen Begleitkamellen verteilt.
Gesprochen, hat Kuckelkorn weiter ausgeholt, wird dann aber hoffentlich kein Lexikon-Kölsch, sondern das vertraute, aber längst zu selten gewagte Straßenkölsch! Die Kölner sollen sich etwas trauen, angeblich wird alles toleriert, was nach Rheinisch oder Kölsch klingt. Bloß kein akademisches Kölsch, sondern das knubbelige, wie es im Veedel geflüstert wird!
Üben kann man, indem man kölsche Lieder singt, in jeder guten Kölsch-Kneipe läuft kölsche Musik, schon aus Einladungs- und Aufwärmgründen. Auch wenn man kein Wort versteht, sollte man mitsummen und mitmachen, das ist die Hauptsache.
Noch geheim gehalten hat Kuckelkorn, dass Kölsche Literatinnen und Literaten eingeladen werden, auf dem Festkomiteewagen beim Rosenmontagszug mitzufahren. Während des Umzugs werfen sie eigens angefertigte Taschenbuchausgaben von Adam Wredes Meisterwerk »Neuer Kölnischer Sprachschatz« unters jubelnde Volk. Die dreibändige grellrote Ausgabe früherer Tage dagegen erhält jede kölsche Schule zusätzlich als Geschenk.
FEUER MACHEN
Im Dezember haben wir in der Kindheit die ersten Feuer gemacht. Wir haben das trockene, aufgelesene oder geschnittene Holz vom vergangenen Jahr gesammelt und daraus einen kleinen Stapel gebaut. Sobald es dunkelte, zündeten wir einige Hölzer an und wachten darüber, dass die züngelnden Flammen ihren Fraß fanden. Sie breiteten sich aus und schlugen gen Himmel, und wir warteten, bis sie sich nach dieser Streckung rasch wieder senkten. Dann dehnten sie sich von Ast zu Ast und ummäntelten jedes einzelne Holz.
Ein richtiges Feuer loderte bis tief in die Nacht. Manchmal legten wir kleinere Hölzer nach und sahen, wie die erste Asche zerfiel. Eine kompakte Glut wurde genährt und setzte sich fest, wir bekamen den Blick nicht weg von diesem Expressionismus in Rot und wollten gar nicht mehr fort.
Wir waren Meister im Feuermachen, aber wir ahnten nicht, welche noch größeren Meister es gibt. Daniel Hume ist so einer und hat darüber das Buch »Die Kunst, Feuer zu machen«[L1] geschrieben. Wenn man es liest, flammen die Kindheitsbilder wieder auf, und wir haben den alten Rauchgeruch in der Nase, der sich im Winter so wunderbar zwischen den nahen Bäumen verfängt und hält. Sodass wir einen nachdenklichen Blick auf all die Holzstöße werfen, die in unserem Garten momentan noch überwintern.
BEGEGNUNG MIT ROGER WILLEMSEN
Roger Willemsen habe ich kennengelernt, als er noch nicht sehr bekannt war, das war im Herbst 1987. Damals stellte er in den Büroräumen des Münchener Piper Verlags ein Buch mit dem Titel »Figuren der Willkür« vor. Ich saß neben ihm und präsentierte ebenfalls ein neues Buch. Wir kamen rasch ins Gespräch und saßen später noch lange zusammen, als sich die Zuhörer und die Mitarbeiter des Verlages schon längst verlaufen oder zurückgezogen hatten.
Später habe ich ihn immer wieder durch Zufall getroffen. Oft in Köln, in Restaurants, die uns beiden gefielen, einmal auch im Bordrestaurant eines Zuges, wo wir einander plötzlich gegenübersaßen. Während einer Fahrt in den Norden unterhielten wir uns fast ausschließlich über Musik. Mein Terrain war die Klassik, er aber sprach über Jazz, wo er sich viel besser auskannte als ich.
Ich habe diese Fahrt gut in Erinnerung: die Begeisterung, mit der er auf mich einredete, seine Vehemenz, das Sprudeln der aus dem Stegreif entstehenden überraschenden Einfälle, seine Freundlichkeit. Als ich aussteigen musste, verabschiedeten wir uns fast wie zwei Musiker, die gerade ein Duo gespielt hatten, er ton- und melodienangebend, ich eher begleitend und lauschend. Auf dem Bahnsteig blieb ich noch eine Weile stehen, nachdem er mir zum Abschied durch das Zugfenster lachend zugewinkt hatte.
Insa Wilke hat nun viele seiner Texte über Musik in dem Buch »Musik! Über ein Lebensgefühl«[L2] versammelt. Die meisten sind Aufforderungen zum Hören bestimmter Stücke, in deren Klangcharakter er einführt und die er in einer Sprache auslegt, die nie bildungsbeflissen oder theoretisierend wirkt. Roger Willemsen ließ sich von bestimmten Kompositionen mitreißen und fesseln, und wenn er über solche Trips schrieb, dann so, dass man dieses Miterleben hautnah mitbekam.
»Musik!« ist ein ideales Buch für das Erweitern eigenen Hörens. Gleich einer langen Reise kann man Roger Willemsen durch seine musikalischen Kontinente folgen, lesen, wie er seine Jazz-Favoriten vorstellt, Klassik mit Jazz konfrontiert oder Szenen außereuropäischer Musik porträtiert. Und da alle Stücke leicht im Netz abrufbar sind, kann man alle paar Tage eine Willemsen-Session einlegen und der Vorstellung erliegen, man lauschte ihm weiter und weiter und hörte seine eindringliche, nicht nachlassende Stimme.
EIN WEIHNACHTSLIED
Die Christmette war zu Ende, die Kirchenbesucher standen auf, leicht übermüdet und erschöpft. Dann aber holte die Orgel noch einmal aus, und die Trompeten stimmten das Weihnachtslied an, das ich so liebe: »Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem!«[M2]
»Herbei, o ihr Gläubigen« – oder auch: »Nun freut euch, ihr Christen« lautet die erste Zeile der deutschen Übersetzung. Das aber ist nicht dasselbe, denn im lateinischen Text ist das Vokabular kräftiger, frischer, ja, eine geradezu mitreißende Aufforderung! Und wozu? Dazu, das Lamentieren, Reflektieren und Sinnieren wenigstens für einen einzigen starken Moment aufzugeben und sich einem nicht zu leugnenden Glücksgefühl gemeinschaftlicher Freude hinzugeben. Gleichgültig, ob man so etwas als Gläubiger oder Nichtgläubiger erlebt, es fällt schwer, beim Mitsingen dieses Liedes gefasst zu bleiben. Ich erinnere mich an eine Aufnahme mit Luciano Pavarotti aus der Basilika Notre-Dame in Montreal, als der große Tenor das »Adeste fideles« mit einem Schwung und einer Strahlkraft anstimmte, dass ihn der Überschwang selbst davontrug. Nach etwa zwei Minuten begleiteten ihn mehrere Chöre, da gab er für Sekunden auf und kämpfte mit den eigenen Emotionen.
Sie rühren daher, dass es sich um ein Glückslied ohne Wenn und Aber handelt und damit um einen Gesang, der keine verhaltenen Empfindungen mehr duldet, sondern die schlummernden bündelt und herausschreit: Hier bin ich, es hat mich gepackt, jetzt mache ich mich auf den Weg, kommt bitte mit! Das spezielle Übermaß dieses plötzlichen, unbedingten Aufbruchs ist wohl auch der Grund dafür, dass es von so vielen Sängerinnen und Sängern interpretiert wurde (wie etwa Bob Dylan, Mahalia Jackson, Elvis Presley).
Es gibt Weichspüler-Fassungen, diese aber verfälschen den Gestus des Jubels, der diesem Lied so elementar innewohnt und den wir sonst kaum noch kennen. Mir erscheint Pavarottis Version am stärksten: Er singt, als höbe er gleich ab, hinauf zu den knapp unter dem Kirchendach vermuteten, begeistert herumflatternden Engeln.
DIE KLAUSUR
Ich bin eingeschneit. Das kleine Gartenhaus steckt unter schweren Mänteln und Krägen von Schnee. Von außen betrachtet ergibt das ein trügerisch harmloses Bild: ein Haus wie aus einem Märchen der Brüder Grimm, man möchte sofort anklopfen, mit den Bewohnern eine warme Suppe essen und später zusammen Volkslieder singen.
Von wegen harmlos oder idyllisch: Die Lage ist ernst. Schaue ich frühmorgens aus dem Fenster, blicke ich auf ein unaufhörlich schneiendes Grau. Schneeflocken in dieser maßlosen Art machen nicht glücklich, sondern Angst. Ich komme zu Fuß gerade noch bis zum Zaun, könnte aber am Mittag selbst das nicht mehr schaffen.
Haben wir überhaupt noch etwas zu essen? Im Keller liegen zum Glück noch Berge von Winteräpfeln, und klares Wasser fließt auch noch aus der Leitung. Ach, es hilft alles nichts: Ich werde in die Stadt gehen müssen! Mit dem großen Jägerrucksack und schweren Stiefeln sowie dem alten Lodenumhang werde ich dort stumme und bemitleidende Blicke ernten: Wo kommt dieser Verrückte denn her? Aus dem nächsten Laientheater?
Rasch werde ich aufbrechen müssen, bevor es zu spät ist und ich den Weg zurück nicht mehr schaffe. Das Nötigste nur, ein paar Lebensmittel für die nächsten Tage! Wenn das gelingt, ist ein Zustand komplett, den ich nur zu gut aus anderen Anlässen kenne: Die Klausur! Sich in Klausur zu begeben, bedeutet: den kleinen Raum des Nachdenkens nicht zu verlassen, keine langen Mahlzeiten, keine Ablenkung!
IN BILDERN VERSCHWINDEN
Seit frühmorgens fällt Schnee, und es ist der bisher schönste des jungen Jahres. Keine schweren Flocken, sondern feiner Kristallstaub, ein Rieseln von winzigen weißen Insekten, denen man beim Schweben und Fallen zuschauen kann. Da sie pausen- und schwerelos fallen, deute ich sie als Anspielung auf meine Klausur: So sollten meine Buchstaben das Weiß der leeren Seiten bedecken, so arm an Geräuschen und so unermüdlich. Die Winterszene erscheint wie ein sphärischer Zustand, der Film vor den Fenstern tränkt den eigenen Blick, und der Blick schweift zurück, zur Winterurszenerie des Bruegel-Bildes »Die Jäger im Schnee«.
Dazu passt eine Entdeckung: Geht man auf die Homepage des Kunsthistorischen Museums Wien, trifft man auf das Angebot »Inside Bruegel«. Dort werden die »Wiener Gemälde« Bruegels gezeigt, darunter auch »Die Jäger im Schnee«. Mithilfe von »Inside Bruegel« kann man nun als Betrachter in das Bild schlüpfen, indem man es Schritt für Schritt langsam vergrößert (eine »Info« berät).
Dann ist jedes Detail beinahe hautnah zu sehen: der brennende Kamin einer Scheune, an dessen Dach gerade Leitern zum Löschen des Brandes angelegt werden. Die vereisten Verzweigungen der Flusslandschaften, mit ihren tief in den Wassern versunkenen Bäumen. Die zu munteren Spazierstockformen gerollten Schwänze der Hundemeute im Vordergrund.
So versinkt man im Bildganzen und taucht ab, um immer neue kleine Szenen im Bild zu finden. Sie sind die Flocken und der rieselnde Schnee, die von den vielen Pinselstrichen ausgelegt und zusammengetragen wurden zu einem täuschenden Teppich aus unendlich vielen sich überlagernden Farben.
KLAVIERSTUNDE
Wer in einen pianistischen Konzertabend geht, erlebt ihn vor allem als Zuhörer. Die Wahrnehmung ortet den Klangcharakter, den damit verbundenen jeweiligen Ausdruck der einzelnen Phrasen und die sich im Klangverlauf entwickelnde Folge geweckter Emotionen.
Die wenigsten Zuhörer aber sehen einen Pianisten spielen. Wer das tut, nimmt die Physis des Spielens wahr, die körperliche Aktion, die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Kräfte, die ein akzentuiertes Spiel erst ermöglichen.
Deshalb lade ich zu einer kurzen Klavierstunde ein, indem ich Vladimir Horowitz dabei beobachte, wie er während seines Wiener Klavierabends im Jahr 1987 das »Impromptu Nr.3 in Ges-Dur«[M3] von Franz Schubert spielt (auf Youtube leicht zu finden).
Erstaunlicherweise liegen beide Hände nebeneinander sehr flach auf den Tasten, die Finger nicht gekrümmt, sondern so weit wie möglich gestreckt. Der Anschlag erfolgt über den vordersten Teil der Fingerspitzen, die so wenig Aufwand wie möglich betreiben. Sie touchieren die Tasten und bewegen sich fast unmerklich in ihre Ausgangsstellung zurück. Die Unterarme auf gleicher Höhe wie die Hände und Finger – diese ergeben eine Linie der Reduktion.
Das aufrechte Sitzen des Rumpfs folgt dieser Bewegungslosigkeit. Er rührt sich in keinem Moment, selbst das Mienenspiel des Gesichts ist fast nicht vorhanden. Schuberts »Impromptu« wird auf diese Weise nicht inszeniert oder vorgetragen, vielmehr erscheint die Musik Takt für Takt wie von selbst, als spielte der Flügel und habe den Spielenden verhext oder in Trance versetzt.
Kein anderer Pianist hat je so medial dieses Impromptu von Schubert gespielt und dadurch erkennen lassen, welche Musik Schubert da eigentlich komponiert hat: die eines Abwesenden, Einsamen, der nichts so scheut wie die direkte Berührung, den Eifer, die Teilhabe an den lauten Liedern der Welt. Entzug könnte man die Physis dieser Jahrhunderteinspielung nennen. Eine fast körperlose Statuarik begleitet eine Psychologie des Alleinseins.
SALINGERS NACHLASS
Wie oft habe ich bisher Salingers Roman »Der Fänger im Roggen«[L3] gelesen? Er ist in meinem Geburtsjahr (1951) erschienen, doch er ist noch immer vollkommen frisch und gegenwärtig.
Außer diesem Roman kenne ich auch alle weiteren Veröffentlichungen Salingers recht gut. Ich war süchtig nach seinen Figuren und nach der merkwürdigen Feierlichkeit, mit der sie aus kleinen Alltagsmomenten starke Augenblicke machten. Die letzte von Salinger veröffentlichte Erzählung erschien 1965, danach zog er sich zurück.
Von Salingers Sohn Matt ist nun zu erfahren, dass sein Vater bis zu seinem Tod im Jahr 2010 kontinuierlich weitergeschrieben habe. Es gab also ein fast vierzigjähriges Schreiben, das der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, durchaus aber für einen späteren Druck bestimmt war.
Vergleichbares kenne ich nicht. Die Isolation hatte in Salingers Fall wohl den Sinn, das Schreiben gegenüber allen möglichen Einmischungen pur und ungestört zu erhalten. Von außen sollte nichts in den geschlossenen Kosmos des Hauses eingreifen, in dem Salinger, abgeschottet von der Umwelt, seine letzten Jahrzehnte verbrachte. Jede Teilhabe an seinen Texten (etwa durch Kommentar und Kritik) war daher ausgeschlossen. Das Schreiben blieb ganz bei sich, reiner Impuls des Selbst.
Von heute aus betrachtet erscheint eine solche Entscheidung wie eine Provokation. Angesagt ist zurzeit, dass Autorinnen und Autoren unendlich viele Stimmen und Reaktionen zu ihrem entstehenden Text einholen. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass solche Vorlektorate zu Selbstblockaden der Schreibenden führen. Genau das wollte Salinger vermeiden. Er schrieb und schrieb in seinen letzten fast vierzig Jahren ohne Gutachter, um einer späteren Leserschaft jene Texte anvertrauen zu können, denen er alle Kommentare zu Lebzeiten erspart hatte.
Matt kümmert sich nun zusammen mit Salingers Witwe um die Veröffentlichung des gesamten Nachlasses. Bald sollen die ersten Texte erscheinen …
DIE ENTDECKUNG DER MODE
Damals, in den späten Fünfzigerjahren, kümmerte sich keiner von uns Jungs um seine Kleidung. Wir zogen frühmorgens eine schlottrige Hose und ein zerknittertes Hemd an, und an den Nachmittagen tauchten wir in abgelegene Kletterzonen ab, aus denen wir am Abend angerußt und verdreckt nach Hause zurückkamen.
Während der hohen Karnevalstage jedoch war alles anders. Jeder von uns lag den Eltern mit einem Kostümvorschlag in den Ohren, und da fertige Kostüme teuer waren, baten wir unsere Mütter, ein Kostüm nach unseren Wünschen zu schneidern. So hat der Karneval uns damals mit den Themen der Mode vertraut gemacht. Plötzlich begriffen wir am eigenen Leib, was das war und was es bedeutete, sich ihren Gesetzen zu unterwerfen.
Das begann mit zeichnerischen Entwürfen und ließ uns zu ersten Anproben erscheinen: War der Ärmel zu kurz, waren die Knöpfe zu groß, passten die Schuhe?! Und wie stand es mit den Farben?!
Ich selbst hatte mir in den Kopf gesetzt, als Kaplan aufzutreten. Mein modisches Vorbild war mein eigener Onkel, der in Essen eine katholische Pfarrei betreute und den ich bei meinen Besuchen oft in einer schwarzen Soutane gesehen hatte. So ein Kleidungsstück empfand ich ungemein fein: vom Kopf bis zum Boden durchgehend, mit dreiunddreißig violetten Knöpfen, eng anliegenden Ärmeln und – tailliert! Hose und Hemd konnte ich endlich vergessen, denn eine Soutane hatte mit dem Alltag nichts mehr zu tun und verlieh einem ein würdevolles Äußeres.
Als ich sie zum ersten Mal trug, schritt ich plötzlich aufrecht und mit durchgedrücktem Oberkörper. Ich stellte das Laufen und Zappeln ein und trug als Höhepunkt meiner feierlichen Präsentation ein ebenfalls schwarzes Birett. Den halben Tag redete ich frei erfundenes Latein und segnete sogar all die, die gar nicht gesegnet werden wollten. Die Mode hatte aus mir eine Gestalt gemacht, zum ersten Mal spürte ich, was das war. Es war ein Mensch, der sich um jedes Detail seines Äußeren gekümmert hatte und selbst noch den Namen des feinen Stoffs hätte nennen können, in den man ihn gewandet hatte. In meinem Fall war es Baumwolle, mollis bombacio …
IM FRISEURSALON
Alle zwei Monate lässt Justus sich die Haare schneiden. Aus Gewohnheit geht er immer in denselben Friseursalon, wo ihn Dimitri erwartet. »Vorne kurz, hinten länger, wie letztes Mal«, sagt Justus leise und kommt sich etwas altmodisch vor. Zu beiden Seiten studieren viel jüngere Kunden mithilfe von Tablets die gegoogelten »Frisuren männlich«. Sie werden von Stylisten umkreist, die eine intensive Typberatung betreiben. Modisch angesagt sind längere Haare, auch dramatische Locken, die aber »undone« getragen werden, »raspelkurze Seiten« dagegen sind momentan das Letzte.
Nach der Typberatung werden die neusten Zeitschriften verteilt. Die meisten Kunden lesen »GQ« oder »Men’s Health«, die mutigeren pflücken Modetrends auch aus den Frauenzeitschriften. Lektüren verlaufen laut, Bruchstücke werden in den Raum geschleudert und ziehen Gelächter oder kurze Kommentare nach sich.
Vor dem Schnitt müssen alle unters Wasser, Haare waschen, inklusive einer speziellen Kur. Das kann man auf einem Massagestuhl erleben, dessen röhrende Stangen sich massiv an den Rückenmuskeln entlangbewegen. Kurzes Atemholen, ein Gläschen Prosecco oder auch nur etwas Wasser. Justus mag nicht massiert werden, auch die Kopf- oder Handmassagen von wortarmen Azubis mit ausdrucksloser Mimik ignoriert er. Mit hochgezogenen Schultern versinkt er unter seinem weiten Poncho und blickt stur auf die Tageszeitung.
Die Gespräche kreisen um Neueröffnungen von Restaurants oder Bars, angesagte Drinks, Sport und Mode. Gesprochen wird im Stil des Karlism und damit in jenem unnachahmlichen Idiom, das Karl Lagerfeld kreiert hat (»I like everything to be washable, myself included.«). Knappe Pointen, gedämpfter Humor, alles soll leicht und selbstbewusst wirken, als berührte einen die Welt nicht besonders. Zwei Stunden verbringt Justus im Lagerfeld-Country, zahlt, schüttelt sich, verlässt den Salon und traut niemandem mehr über den Weg.
KREATIVE VERORTUNG
Wie nähert man sich den kreativen Potenzen von Karl Lagerfeld? Berichtet man über sie? Oder befragt man andere dazu? Der französische Regisseur Loïc Prigent hatte eine fabelhafte Idee: Er besuchte Lagerfeld in seinem Studio und drehte ausschließlich an seinem Schreibtisch. Nirgendwo hält sich der Meister lieber auf, und nirgendwo kann man ihn besser dabei beobachten, wie er Ideen entwickelt.
Und wie macht man das? Ganz einfach, man lässt ihn nach einem Zeichenblock greifen. Und dann gibt man kurze Stichworte vor – und bittet ihn, gleichzeitig zeichnend und erzählend zu antworten: Wie sehen Sie aus, wenn Sie frühmorgens aufstehen? – und schon geht es los. Der Stift fliegt über das Papier, zeichnet die Haare, die Frisur, die Kleidung, während der lockere, elegante Ton des Sprechens und Redens jedem gezeichneten Detail zu Hilfe eilt.
Diese Technik ermöglicht eine klassische, gelungene kreative Verortung: Man redet nicht über Kreativität, sondern zeigt sie in den Momenten ihres Entstehens. Sie sind eng verbunden mit dem kreativen Raum, auf den sie angewiesen sind und an dem sie ausschließlich hervorgebracht werden. Im Falle Lagerfelds ist es der mit Zeichenmaterial und Stiften aller Art überfüllte Tisch und ein Zeichenblock im Hochformat, der eine Skizze nach der andern hervorlockt. Während die eilige, sichere Hand Blatt für Blatt entwirft, fixiert das fortlaufende Erzählen die Bewusstwerdung der Details im Kopf des Zeichners: Die Geste des Zeichnens wird ornamentiert durch die Geste des Sprechens.
Loïc Prigent arbeitet in seiner Dokumentation »Lebens-Skizzen« ausschließlich mit diesem Ausschnitt: dem Schreibtisch, den Materialien, der impulsiven Gestik. Keine Fotos, keine ablenkenden Interviews mit Zeitgenossen – und vor allem: keinerlei Kommentar! Die Sache selbst – verortete Kreativität – wird gezeigt –, und genau diese Methode macht den Film von Prigent selbst wieder genial.
BEGEGNUNG MIT EINEM KIND
Der amerikanische Schriftsteller John Updike (1932–2009) ist erst neun Jahre alt, als ihn seine Mutter auf den Stufen der Veranda des Großelternhauses in Shillington/Pennsylvania fotografiert. Er sitzt draußen in der Sonne und hält ein Buch in den Händen. Die Schuhe sind geschnürt, die kurze Hose und eine Jacke lassen den Jungen aussehen wie einen kleinen Gelehrten in der Sommerfrische. Die Haare fein gekämmt, eine mächtige Strähne ziert die Stirn.
John war ein Einzelkind, und man sieht der Fotografie an, wie viel Liebe dem Jungen entgegengebracht wird. Anscheinend hat er die Mutter bereits auf irgendeine Weise beeindruckt, sonst würde sie ihm nicht diese Aufmerksamkeit schenken. Eine Aura von frischem Aufbruch und Erwartung umgibt diese Fotografie, sie ist so stark, dass ich mich sofort an ähnliche Kindertage erinnere, als ich für die eigene Mutter ein Motiv oder sogar ein Thema war.
Der alte John Updike hat dieses Foto irgendwann wiederentdeckt und es so ernst genommen, als wäre es die Fotografie einer bedeutenden Fotografin. Er hat es lange betrachtet und dann Detail für Detail beschrieben. Foto und Text markieren einen der Höhepunkte seiner Schriften »Über Kunst«[L4].
Seit einigen Tagen lese ich in diesem Band einen Updike-Text nach dem anderen. Hat ein Schriftsteller je genauer, liebevoller und emphatischer über einzelne Kunstwerke geschrieben? Und hat es je mehr Freude gemacht, vor großen Bildern in Gemeinschaft eines Begleiters zu verweilen, der sie nicht zutextet, sondern sie mithilfe seiner immensen Sehkraft zum Leuchten bringt?
EIN LUNCHKONZERT
In einem Lunchkonzert in der Berliner Philharmonie. Sie öffnet gegen 12Uhr, eine Stunde lang strömen Menschenscharen aller Lebensalter hinein. Sie kommen mal eben vorbei, um etwa fünfzig Minuten an einem mittäglichen Konzert teilzunehmen, und sie halten sich dazu nicht in einem der Konzertsäle auf, sondern im Hauptfoyer.
Für Personen mit Schwerbehindertenausweis ist eine bestimmte Sektion von Plätzen abgesperrt, die anderen Zuhörer verteilen sich im Raum, wo auch immer sie gerade einen Steh- oder Sitzplatz finden. Viele setzen sich auf den Boden oder die Treppen, andere steigen hinauf zur Empore, wo man nur entlang der Geländer einen Blick auf das kleine Podium werfen kann.
Gegen 13Uhr erscheinen die beiden Solisten, eine Pianistin und ein Violinist. Sie spielen eine Violinsonate von Mozart und eine von Beethoven, und sie schließen mit der »Tzigane« von Ravel. Zwischen den einzelnen Sätzen wird begeistert geklatscht, und obwohl das Publikum überall verstreut sitzt, liegt, krabbelt (wie etwa die Kleinsten), wirkt diese Mittagssession hoch konzentriert, heiter, ja, wie ein locker komponiertes Zusammentreffen und Fest.
Wer will, kann sogar (oben auf der Empore) auf und ab gehen, und wer durch eines der Fenster beobachten will, wie sich die Musik von drinnen in der Umgebung draußen verteilt, kann auch das tun: Erstaunlich, wie gelöst und passioniert die Bauarbeiter in den nahen Parkanlagen erscheinen, wenn dazu gerade Musik von Mozart erklingt!
Man öffne vielen Menschen einen großen Raum und lasse sie machen, man greife nicht ein, sondern vertraue ihrer Konzentration und ihrem spontanen Geschick, und man teile mit ihnen die gespannte Begeisterung beim Anhören von Musik, die sich wie hergezaubert in den Räumen verteilt.
Das Lunchkonzert schien beendet, als die begeisterten Zuhörer noch eine Zugabe forderten. Ich war bereits auf dem Weg zum Ausgang, als ich die ersten Töne hörte und stehen blieb. Wenige Takte eines Klaviervorspiels – und dann der Einstieg der Stimme der Violine. Das Klavier tritt in die Begleitung zurück, die Violine singt sich aus, dann ein kurzer Mittelteil, in dem das Klavier durchatmet – und die Rückfindung der Violine zum Gesang.
Das habe ich früher solo auf dem Klavier gespielt, dachte ich. Das ist ein »Lied ohne Worte« von Mendelssohn, das ist das Opus 19/1 in E-Dur[M4], das klingt in der Version mit Klavier und Violine noch viel schöner, dachte ich, das impft einem die Schönheit von Musik in drei Minuten bis in die hintersten Spulen des Hirns, das ist …
Und ich blieb weiter stehen und hörte, wie das Stück ausklang und die Zuhörer einen Ergriffenheitsmoment lang still wurden und sich erhoben und zu klatschen begannen und ich ebenfalls klatschte und mit feuchten Augen hinaus ins Freie eilte, durch die Narzissenlandschaft ringsum.
ZU ZWEIT UND ZU DRITT
Der japanische Philosoph Isaku Yanaihara war sechsunddreißig Jahre alt, als er 1955 dem Bildhauer Alberto Giacometti in Paris begegnete. Yanaihara hatte sich mit französischer Kunst der Gegenwart und der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt, Werke von Albert Camus übersetzt und die intellektuellen Klimaumschwünge in Paris aus der Nähe studiert. Dazu hatte ein Stipendium beigetragen, das ihn für einige Zeit in der französischen Metropole wohnen und arbeiten ließ.
Einen besonderen Impuls erhielt er in dieser Zeit zunächst durch Gespräche, die er mit Giacometti führte. Die beiden müssen sich von Anfang an gut verstanden haben, denn die spontan empfundene Nähe erhielt schon bald eine Struktur: Giacometti begann, den Freund zu porträtieren. Tag für Tag saß er von da an stundenlang in dessen kleinem Studio, aufrecht, oft mit Jacke und Krawatte, das blasse, breite Gesicht den Blicken des Künstlers aussetzend.
Mit der Zeit entstand eine Arbeits- und Lebenssituation, wie es sie in dieser Strenge nur selten gegeben hat. Giacometti hörte nicht auf, Yanaihara zu porträtieren, und Yanaihara geriet dadurch in den Bann einer Werkentstehung, aus der auch er sich nicht zu lösen vermochte. Immer wieder schob er die geplante Rückreise nach Japan auf und ging schließlich sogar eine Liaison mit der dritten Person im Bunde, mit Giacomettis Frau Annette, ein.
In den folgenden Jahren hat Yanaihara zweihundertachtundzwanzig Mal für Giacometti Modell gesessen. Nach den Sitzungen war man oft zu zweit oder zu dritt bis in die Nacht in Paris unterwegs. Hatte man sich getrennt, machte sich Yanaihara Notizen über die Tag- und Nachtgespräche, aus denen später ein Buch entstand. Seit Kurzem liegt dieses Zeugnis einer Lebensgemeinschaft erstmalig in deutscher Übersetzung vor[L5].
Drei Menschen, verstrickt in einen fortlaufenden, sich immer wieder zuspitzenden und neu strukturierenden Werkprozess, die Metropole Paris als Anschauungsbühne für ihre Blicke und Themen, die dadurch ausgelöste Verwandlung der künstlerischen Praxis in eine erotische – das wären die Motive und Themen für einen Film, den ich Bild für Bild vor Augen habe.
NACHRICHTEN VON DEN LEBLOSEN
Paul lädt seine fünf besten Freunde per Facebook mal wieder zu einer Kurzwanderung ein: vier Stunden quer durch die Wälder zum Waldheim. Josef meldet sich nach zwei Minuten: Warum wieder zum Waldheim? Warum nicht zum Stausee? Sechs Minuten später ist Ernie so weit: Warum nur wir Freunde? Warum nicht auch Bekannte, Frauen und Kinder? Das regt Dieter sehr auf: Bisher waren wir Männer ganz unter uns, das soll so bleiben, höchstens Hunde wären als Begleitung noch passend. Was soll das heißen?, fragt Bernd, sind Hunde als Begleitung beliebter als Frauen und Kinder? Um Gottes willen, meldet sich Dieter zurück, so war das doch nicht gemeint! Hat sich aber so angehört, bellt Bernd, worauf Paul wieder eingreift: Leute, was ist denn bloß mit euch los?!
Seit einiger Zeit nerven Social-Media-Konferenzen. Sie beginnen mit einem harmlosen Vorschlag oder einer unscheinbaren Idee und weiten sich in wenigen Minuten zu heißen Debatten über das Weltganze aus. Jeder Satz provoziert eine Antwort, die sich quer stellt und dadurch zu einer neuen Provokation wird. Rasch entwickeln die immer schärfer werdenden Abgrenzungen eine eigene Dynamik. Schließlich redet sich jeder in einer bestimmten Position fest, die eigentlich gar nicht seine Position ist und auch niemals so gedacht war: Josef will nur zum Stausee! Ernie nur mit Großgruppen! Dieter wiederum höchstens mit Hunden!
Nach einer Weile steht der Austausch still, und niemand ist in der Lage, das Knäuel der Meinungen aufzulösen. Dann haben wir es mit Formen von Entscheidungsfindung zu tun, wie sie für Social-Media-Kontakte typisch sind. Der unreflektierte Gebrauch der neuen Medien zerkleinert jedes Thema mikroskopisch bis ins Unendliche und führt schließlich zur Erstarrung. Seit einiger Zeit sind wir die armen Zuschauer dieses Dilemmas und erhalten fast täglich Nachrichten von den Fronten der Leblosen: monatelange Koalitionsverhandlungen, jahrelange Brexit-Umkreisungen – und keinen Tag nur eine Spur von Bewegung.
Was aber könnte helfen? Die Gesprächspartner einsperren und isolieren, magere Kost, wenig Getränke, keine sonstige Unterhaltung nach dem Vorbild eines Konklaves zur Papstwahl, bei dem der weiße Rauch neuerdings in immer kürzeren Abständen aufsteigt. Handybenutzung, Internet – das alles ist den Kardinälen verboten, und so verlieren sie rasch die Lust an der ewigen Streuung der Meinungen und einigen sich schließlich ruckzuck auf einen Gelehrten aus Deutschland oder einen Heiligen vom anderen Ende der Welt.
DIE AUFERSTEHUNG VON NOTRE-DAME
Kurz nach dem Brand von Notre-Dame erlebt man eine verblüffende Auferstehung. Die große Kathedrale war lange Zeit ein beliebtes Objekt des Massentourismus, dessen Scharen sie nichtsahnend durchwanderten wie ein dunkles Bergwerk, in dessen Verstecken man irgendwann auf eine bucklige, zerzauste Gestalt zu treffen hoffte. In der Disney-Version von »Der Glöckner von Notre-Dame« war man ihr einmal im Kino begegnet, ohne zu ahnen, dass der stark sentimentale Bursche eigentlich einem Roman des Schriftstellers Victor Hugo[L6] entstammte.
Victor Hugo?! Ein großer Roman?! Aber ja, nun sind Name und Buch wieder in aller Munde, und die beiden Kapitel des dritten Buches, die von der Geschichte der Kirche erzählen und die berühmte Vogelschau auf Paris präsentieren, werden beinahe wie sakrale Texte gelesen. Nicht anders verhält es sich mit der Musik. Seit dem Brand interessiert sich die Welt wieder für die zum Glück unbeschädigte große Orgel und lauscht neuen und älteren Aufnahmen ihrer legendären Organisten. Welche Kirchenmusik wurde von welchen Komponisten für die Messliturgien von Notre-Dame komponiert? – Auch das ist inzwischen eine Frage, für deren Beantwortung lauter frisch entstandene Webseiten Kataloge mit vielen Hinweisen bereithalten.
Ähnlich verlaufen die Studien der Kunstfreunde, für die »The Public Domain Review« eine ausführliche Bilderstrecke mit Gemälden oder Fotografien angelegt hat, die im Zeitraum von 1460 bis 1921 Notre-Dame abbildeten. David, Matisse, Atget oder Signac – sie alle haben die Kirche porträtiert und uns eine Vorstellung von ihren sich wandelnden Physiognomien vermittelt. Ganz zu schweigen von den Architekten, schon wenige Tage nach dem Brand waren die Diskussionen über den Wiederaufbau in vollem Gang, und sofort war klar, dass er ein europäisches Projekt werden wird, mit Spezialisten und ausgesuchten Handwerkern aus vielen Ländern.
Diese Revitalisierung von Notre-Dame ist erstaunlich. Plötzlich ist sie ein Thema, das von Vertretern aller Künste wie ein großes Zukunftsprojekt behandelt wird, in dessen Verlauf wir unsere Fantasien und Vorstellungen von Vergangenheit neu befragen. Momentan schlägt die Stunde der Fachleute und Enthusiasten, die sich mit Leidenschaft in Details vertiefen und von ihnen so spannend zu berichten wissen, wie es keine Disney-Animation je vermocht hat.
DIE HÖFE UND HÄUSER DES THOMAS BERNHARD
Der Schriftsteller Thomas Bernhard war vierunddreißig Jahre alt, als ihm 1965 für seinen Roman »Frost« der Bremer Literaturpreis zugesprochen wurde. Bernhard war damals wenig bekannt, er stand noch am Anfang eines Werks, das in den Folgejahren rasch immer größere Geltung erlangte und schließlich in den obersten Ruhmesetagen ankam. Mit dem Preisgeld finanzierte er den Kauf eines damals noch ruinösen Vierkanthofs in Ohlsdorf, den er nach und nach aufwendig renovierte und ausstattete.
André Heller hat in seinem Buch »Hab & Gut. Das Refugium des Dichters«[L7] Fotografien von Hertha Hurnaus veröffentlicht, die das Äußere und Innere dieses Hofes einfangen. Verblüffend ist, dass Bernhard die Inneneinrichtung wie ein Bühnenbild komponiert hat. Dabei zitiert er traditionelle Insignien eines Bauernhofs (wie eine hölzerne Eckbank, einen viereckigen Esstisch, Kachelöfen etc.), die er mit modernen Elementen (wie einer Edelstahlküche mit Geschirr und Küchengeräten oder mit Fernsehgeräten sowie Transistorradios) kombinierte. Vollends mysteriös erscheinen schließlich Gegenstände, die auf mögliche Bewohner verweisen: ein Gewehr, vielerlei Schuhe und Stiefel, Hüte, Jacken und Hosen, akkurat in der Ankleide nebeneinander gereiht.
Unübersehbar sind die vielen Schreibtische, an denen Bernhard jedoch angeblich niemals geschrieben hat. In der kompletten Edelstahlküche hat er auch nie gekocht, anscheinend hat er die Räumlichkeiten des gewaltigen Hofes kaum bewohnt. Gäste hat er nur selten empfangen und noch seltener beherbergt. Geschrieben hat er in Gmunden, wo er eine Wohnung besaß, sowie in Wien oder auf Reisen.
Später hat Thomas Bernhard noch zwei weitere große, einsam gelegene Höfe oder Häuser erworben, die er zu Illusionsräumen seiner poetischen Anschauung umgestaltete. Anscheinend hat er alle drei ausschließlich als Fantasiewelten verstanden, die nicht mit dem Schreibprozess in Verbindung gebracht werden sollten. So waren die Häuser Ausstellungen von Werkideen und fiktiven Figuren, die sich in ihnen mit künstlichem Leben vollsaugten, sie dienten als Vampiranstalten für Einfälle, Atmosphären, Geschichten.