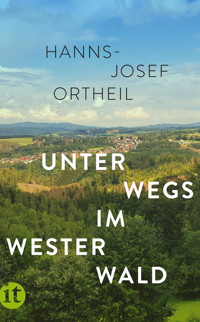3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hanns-Josef Ortheil hat Mozarts Briefe neu gelesen, und sein Essay ist nicht nur eine Studie über Mozarts Sprachkunst, sondern auch eine kunstvolle Erzählung, wie sich dieser unvergleichbare Komponist durchzusetzen lernte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erich Forneberg (1903-1972) zum Gedächtnis
1
MOZART, DAS KIND: Musik schafft die einzige Kulisse, in die sein Bild gehört. Nichts darüber hinaus, an Takten wird seine Kindheit gemessen, an eingeübten Stücken und Proben, an Stunden am Klavier und mit der Violine.
Im Notenbuch der Schwester fixiert Leopold die Leistungen, die Stunden, die erworbenen Fertigkeiten. Das Kind erhält Aufgaben, die es spielend bewältigt. Spielend – das meint: willig, scheinbar ohne Anstrengung, nicht Opfer einer Erziehung, sondern einer Affektion.
Diese breitet sich aus, und ihr Panorama bilden die Reisen, mit denen der Vater schrittweise beginnt. Zuerst, zur Probe, nach München, dann nach Wien, zum Kaiserhof, dann nach Paris.
Auf diesen Reisen entlädt sich die Affektion wie eine Krankheit, eine Seuche. Die Reisen hinterlassen die sichtbarsten Spuren, setzen Menschen, die das Kind spielen hören, in Verzückung. Wolfgang, infiziert von den Tönen und angezogen von den Instrumenten – den Orgeln, Klavieren und Violinen –, plötzlich gestaltend, was die von überallher zusammenlaufenden Menschen erwarten: das Heilige als Schrecken, das Unantastbare als Gewalt, nicht frei von Dämonie.
Der junge Mozart erscheint wie ein Gerufener, wie einer, den alle Orgeln des Landes anhalten, bis er sie gespielt hat, und er kommt durch kaum eine größere Stadt, in der es nicht den obligatorischen Volksauflauf gibt. In Ybbs an der Donau spielt er so, daß die an der Mittagstafel sitzenden Franziskaner aufspringen und in den Kirchenchor laufen. An einer Zollstation packt er Klavier und Violine aus, dadurch lenkt er die Zollbeamten ab, die ihn wiedersehen wollen und sich seine Adresse notieren.
Das Kind erreicht alles durch Musik. Das Auspacken der Instrumente – ein ›Sesam öffne dich!‹, und der Vater vermerkt stolz, wieviel Geld es wieder gebracht hat.
Seine Briefe an den Salzburger Handelsherrn Lorenz Hagenauer sind voll von Verrechnungen: was kommt herein, was gibt man aus? So rechnet er es dem Freund, dem Vermieter und Spezereiwarenhändler, vor. Aber die Briefe sollen noch weiter dringen; sie gehen auch an die befreundete, Leopold nahestehende Welt in Salzburg. Sie dokumentieren den Verlauf einer Reise, sie berichten von der Annäherung der ›höheren Welt‹, an die Kinder, die »übrigens alles in Verwunderung« setzen (I,49).1 In diesem Sinn halten sie der Salzburgischen Welt die Erfolge vor Augen. Der Bub soll als ein anderer zurückkommen, und Salzburg soll sich nach seiner Rückkehr vor ihm auftun. Daher verwendet Leopold einige Sorgfalt auf diese Briefe. Schreibend entwickelt er einen Blick aus Lebensaufsicht und Gewinnmaximierung. Später läßt er sich die Briefe kopieren, Abschriften fertigte er oft schon kurz nach einem Entwurf an. Diese Briefsorgfalt hatte für ihn mehr als nur den einen Sinn, Freunden und Nachbarn zu berichten. Leopold wußte immer, daß die Ereignisse und Gegenstände in mehrere Zusammenhänge gehörten, den der »Verwunderung« zunächst, aus dem sich Erfolg, Geld, am Ende ein Amt schlagen lassen sollten.
So hängen für ihn alle Linien zusammen, und er zieht die Fäden, indem er darauf achtet, daß er alle Ereignisse und Zufälle im Blick und in den Händen behält. Daher erziehen ihn die Briefbotschaften auch in gewissem Sinn zu einem Programm: man achte darauf, wie sich Erfolg und Zukunft miteinander verknüpfen lassen, man gebe sich nie dem Augenblick hin, man bleibe nie länger als notwendig an einem Ort. Solche Appelle gehen nicht zuletzt an ihn selbst. Gleichzeitig aber beweist er dem Geschäftsmann Hagenauer, der für die Finanzierung der Reisen zuständig ist, sein Geschick als geschäftlich denkender, überzeugender Verwalter. Denn er verwaltet die Angelegenheiten des Sohnes, und die Briefe werden dabei zu Abrechnungen.
Was kommt herein, was gibt man aus? Und Wolfgang, Woferl, ist die Maschine, die den Zwischenraum ausfüllt. Es ist etwas Eiliges, Klappriges in Leopolds Briefen. Namen als Signale für Auftritte, Visiten als Finanzierungslücken. Ansonsten kommt gar keine Sprache in ihnen zum Vorschein, keine plötzliche, den Augenblick fixierende Rede, kein Durchqueren oder Aufatmen.
Und die Kinder? Den Kindern gefällt das Reisen. Sie nehmen es als Abwechslung wahr, und sie unterscheiden noch nicht zwischen Heimat und Fremde. Auch später wird dieser Gegensatz für Mozart nicht existieren. Im Gegenteil: Salzburg verwandelt sich während seiner langen Abwesenheiten in eine Stadt, in der es sich nur schwer leben läßt, in der alles Anstrengungen kostet und in der man seinen Namen gegen alle Neider bewahren muß. Salzburg – ein Ort der Langeweile und der Gefahr, seinen Ruf zu verlieren und unterzugehen im Nachbarngetuschel oder im Hohngelächter der Bekannten. Salzburg wird also mit der Zeit immer enger, und diese Enge macht keine Heimat. Mit jedem Tag, den Mozart auf Reisen – in einer beträchtlichen, bestürmenden Unruhe – verbringt, werden die Gassen schmaler für ihn und die Zimmer niedriger im dritten Stock des Hagenauerschen Hauses. Kommt überhaupt noch Licht hinein, ist der Arkadenhof nicht viel zu klein? Mozart entwöhnt sich, später wird er sich auf diese Entwöhnung oft beziehen und sich vor der Vorstellung winden, nach Hause gekommen zu sein. In Salzburg nämlich nimmt das Zirkulierende, das ihm auf den Reisen gefällt, das Ungefähre von Ort und zeitlichem Aufenthalt, das man jederzeit tauschen kann, einen unerträglichen Stillstand an. In Salzburg verfestigt es sich – das Gefühl, der eigenen Bewegung, dem eigenen Vorwärtsdrang treu zu sein.
Doch machen die Reisen aus Mozart keinen Vertriebenen, sie entwickeln in ihm vielmehr ein Empfinden für mühelose Erneuerung, für Zwischenspiele, für ein andauerndes, leicht durchführbares Wechseln zwischen Anstrengung und Vergnügen, Konzentration und Verschwendung. Das hält sich die Waage, geht unmerklich ineinander über. Die Proben, die Auftritte, das Spiel – so wird ein rascher Wandel in Bewegung gehalten, der unterhaltend ist und vorausdrängt. Die Reisen unterminieren das Gefühl für Stabilität, Festigkeit, bürgerliche Ausdauer – sie bezahlen diesen Verlust mit unumschränkter Anerkennung. Auf Reisen wird alles leicht, und Leopold kann bestätigen: »Der Bub ist mit allen Leuten, sonderheits mit den Offizieren so vertraulich, als wenn er sie schon seine Lebenszeit hindurch gekannt hätte.« Und: »Die Kinder sind lustig, und überall so, als wären sie zu Hause.« (I,49)
So verläuft in Leopolds Augen alles nach Plan, und in seinem Hirn kreuzen sich die Strategien, den Knaben aufs Vorteilhafteste in Szene zu setzen. Das ist eine Kunst, eine Kunst des Ankündigens, Wartens, Probierens. Ein Aufenthalt wie der in Wien (1762) kann nur über beinahe drei Monate hinausgezögert werden, weil man fast täglich Konzerte gibt. Wenn Wolfgang krank wird, stockt die Mühle, die Pläne geraten durcheinander. Leopold überschlägt: die Trinkgelder für die Kutscher, die Trinkgelder für die Lakaien – lohnt sich das Bleiben noch? Wolfgang sichert in dieser Zeit der Familie den materiellen Boden. Allein durch sein Auftreten garantiert er für die Dauer des Aufenthalts. Schon dadurch ist der Woferl »Meister«, vollkommen in der Beherrschung der irdischen Materialität, die auf sein Spielen hin in Bewegung gerät. Geschenke und Gelder kommen ins Haus, und der Vater versucht, die Dukaten in sicheren Schuldbriefen anzulegen.
Die Reise aber ist eine Jagd, immer hinter den Gelegenheiten her, die Musik zu Gehör zu bringen, ein Hasten über Stock und Stein, wo ein defektes Rad einen weit zurückwirft, wo die Günstlinge des Hofes einem schon immer voraus sind, wo man die Launen der Fürsten erahnen muß und zuweilen gar gezwungen ist, schnelle Nachtfahrten einzulegen.
Es dreht sich um die Mozartsche Kutsche, die da unterwegs ist, es dreht sich fortwährend dieses Spiel der Launen und Zufälle, der Gelegenheiten und verpaßten oder genutzten Chancen. Die Pläne Leopolds sind Wunder an Voraussicht, in Gedanken tastet er Wege, Verbindungen, Städte, Schlösser, Aufenthaltsorte der Herrscher ab. Es kommt auf alles an, auf die Jahreszeit, eine Heirat, einen Krieg, eine Erbangelegenheit – denn alles könnte einen Plan zunichte machen, und am Ende könnte man vergeblich einen Umweg gemacht haben, einen Umweg von Tagen, die nicht mehr aufzuholen wären. Man muß die passenden Gelegenheiten und Stunden aufspüren, die der Adel sich erlaubt. Es gibt ja keinen Vorrat an Musik, wie für uns heute, es gibt nur die glückliche, die passende Stunde. Eine Kutsche wird vorbeigeschickt, ein Auftritt wird erlaubt, die Musikanten werden entlassen. Ein Fürst kann diesen Ablauf aber auch verschieben, vom Nachmittag auf den Abend, die Nacht, den nächsten Tag. Leopold stellt seine Uhren nach diesem Belieben. Er ordert die Termine – ein Spiel am kaiserlichen Hof sichert Auftritte für die nächsten Wochen. Die Welt erscheint als ein Karussell auf den Empfängen und in den Jagdschlössern, zu denen die Fürsten, wenn es ihnen eben gefällt, noch in der Nacht aufbrechen. Ein Karussell – auf dem man nie sitzt, das einen antreibt, nur für einige Minuten aufzuspringen, um mitmachen zu dürfen, die launigen Melodien des Vergnügens zu fabrizieren, für eine Stunde vielleicht, bei der Kaiserin sogar für drei. Aufspringen und mitmachen – man wird bezahlt, man fliegt, von der Geschwindigkeit getrieben, wieder herunter, und – kein Wunder! – so aus der Ferne betrachtet, ist dieses Karussell dann nur noch eine Maschine, die einen in Atem hält, ein Intrigantengeschöpf, ein Monstrum, das einen treibt, bis man krank wird dabei.
Leopold studiert die Bewegungen dieses Karussells, als ließen sie sich am Ende doch aufschlüsseln. Er will den Anteil des Zufälligen soweit wie möglich beschränken. So verfolgt er mit Ausdauer die Herkunft der Einladungen. Wo ist die Ursache, der Ursprung, der alles entscheidende Anfang? Schrittweise verfolgt er das Geäder des Getuschels. Er bescheidet sich nicht damit, Initiator zu sein, er will auch Empfänger der Wirkungen sein, die er hervorbrachte. Wenn sich alles fügt, wenn seine Inszenierungen umschlagen in Einladungen, dann will er darüber hinaus noch wissen, wie ihm das gelungen ist, welche Räder in der Tat ineinandergegriffen haben. Er denkt es nach, er spielt die Wege durch, er läßt nichts beiseite, alles soll ins Netzwerk eingepaßt werden.
Ein junger Graf hört auf der Durchreise den jungen Mozart in Linz. In Wien angekommen, erzählt er dem Erzherzog Joseph davon, der wiederum der Kaiserin berichtet. Ein Zufall – denn der junge Graf hatte einen Aufenthalt in Linz nicht vorgesehen, nur auf eine Empfehlung hin hatte er sich hineinziehen lassen. Die Kunde, der Blick, die Ausbreitung des Ruhms! Leopold weiß aus solchen Fällen, daß er weit ausstreuen muß, damit sich etwas ereignet. Die Bewegungen ereignen sich an den Peripherien, es arbeitet in der Ferne um ihn herum, und die Früchte der Einladungen sind Ergebnisse einer kaum durchschaubaren, aber dennoch erfolgreichen Mischung aus Gelegenheit und Versuch.
Ein Höhepunkt – wenn man unbeobachteter Zeuge der Verbindungen ist! So in Wien, als Leopold am 10. Oktober 1762 Glucks »Orfeo ed Euridice« hört. Da wird er zum Zeugen des höchsten Getuschels, von Loge zu Loge – er hört es genau, die geheime Botschaft, und die innere Freude steigt in ihm hoch. Da berichtet der Erzherzog Leopold (später Leopold II.) vom Wolfgang, der so vortrefflich Klavier spiele; noch am Abend desselben Tages liegt eine Einladung nach Schönbrunn vor. Aus einer derartigen Zeugenschaft bezieht Leopold Verstärkungen für seine Unternehmungen. Hinhörend, lauschend ist er Teil seiner eigenen Aktionen, ein Genuß, den man sich nicht verlockend genug vorstellen kann. Wien, 16. Oktober 1762: »Nun sind wir schon aller Orten im Ruff.« (I,51)
Auf diese Weise verringert sich die Entfernung zu den Zentren der Macht, den Herrschern, diese zunächst abgewandt erscheinenden Innenhöfe, die umgeben sind von konzentrischen Ringen, auf denen die Trabanten, die Hofleute und Zubringer, kreisen. Man bedarf der Augen und Ohren dieser Trabanten, man muß ihre Bewegungen studieren und vorausahnen – ganz aus der Ferne zuerst. Einer kommt vielleicht in einer Kutsche vorbei, dem anderen geht man unauffällig hinterher. Schon ein Stallmeister vermag etwas, ein »Obriststallmeister« kann die rechte Hand des Fürsten sein, man muß es nur wissen. Die Gerüchte zirkulieren, und man muß sich entsprechend diesem Geflüster bewegen, all tempo oder alla zoppa, auf hinkende Art.
Denn es können auch störende Kreise und Zirkel in diese Bewegungen hineinwirken, sie können verzögern, den gerade erscheinenden Anlauf aufs Zentrum zum Schlingern bringen. Zu diesen störenden Kreisen zählen die Spektakelmeister, die andere Musikanten protegieren, dazu zählen aber auch die Komponisten (wie die des Wiener Hofes), die neidisch sind auf das Treiben, die Gegengifte und Gegengerüchte ausstreuen, um den Weg des Kindes zu stoppen. Dann heißt es, er sei ein Scharlatan (Kehrseite seiner göttlichen Sendung: der Teufel, der Betrüger), und es gehe nicht an, daß so einer das Orchester dirigiere.
Leopold muß sehen, wie er diese Gegengifte unschädlich macht. Er hat keinen direkten Einfluß darauf, er muß den Knaben herumschicken, damit man ihn sieht, antastet, küßt, damit man ihn hört, in diese Musik hineinhört, die der Verzückung dient. Dann muß Wolfgang seine Künste vor einem ausgewählten Publikum demonstrieren, und am Ende kann er froh sein, die Gegengifte unschädlich gemacht zu haben, wenn auch der Erfolg sich nach soviel Intrigen nicht mehr auf den ersten Blick hin einstellt. Jetzt muß er spielen, nicht nur um zu überzeugen, sondern auch, um seine Feinde zu überwinden. Aber auch das fällt ihm leicht, denn auch das macht Spaß, und er mag von den Gefahren, denen er ausgesetzt war, noch wenig geahnt haben, während es um ihn tuschelte. Um so naiver die Grazie des Auftritts und um so siegesgewisser das Spiel! Die Sprache der Musik – ein Wundermittel, das die Welt – die steife, spröde, unsinnliche – aufschließt, und das selbst diesen Menschen, die er mit Blicken überfliegt, solange sie ihm wohlgesonnen sind, Seufzer abnötigt. Wenn sie ihm nur nicht so nahe kämen! Er, Wolfgang, kennt die Gesetze. Benimmt er sich nicht, wie man es von einem Kind kaum erwarten könnte? Lachend, lebendig, charmant, wie einer, der den Zeremonien mit lässiger Geste schon beinahe entflohen ist? Und – ist er am Ende nicht schon über sie hinaus?
Spielt er nicht sich selbst am ehesten zu, der Schwester noch, der er applaudiert? Was wollen sie aber dann von ihm, wenn sie sich ihm so aufdringlich nähern, ihn berühren, ihn küssen? Da wischt er sich das Gesicht, als könne er so ihre Nähe abstreifen. Aber – Gott sei Dank – das bemerken sie nicht, sie verstehen es nicht. Seltener Fall, wenn einer wie Zinzendorf, ein skeptischer, aufmerksamer, weitsichtiger Beobachter daherkommt, um den ganzen Fall in sein Tagebuch zu notieren, wo er freilich besser aufgehoben ist als im öffentlichen Gespräch.
Zinzendorf, am 17. Oktober 1762: »Le pauvre petit joue a merveille, c’est un Enfant Spirituel, vif, charmant, sa Sœur joue en maitre, et il lui applaudit. Mlle de Gudenus qui joue bien du clavecin, lui donna un baiser, il s’essuya le visage.« (Dok 18)2
Zum Teufel mit den Küssen! Können sie nicht aus der Ferne genießen?
Sie können nicht – und das rührt an das Geheimnis der Auftritte des Kindes. Die Musik wurde häufig nicht hoch eingeschätzt, ein Orchester oft nur als ein musikalischer Apparat, abseits von der gesellschaftlichen Sprache aufgebaut, die Leier neben der höfischen Sprache, unaufmerksam gehört. Bereits Leopold jedoch erkennt, daß die Kinder mehr sind.
Sie überschreiten durch ihr Spiel das Weghören, sie durchbrechen gleichsam Schallmauern – und sie zwingen zum Schauen. Das ist das Wichtigste. Die Kinder geben der Musik plötzlich einen kreatürlichen Charakter. Sie sind wie die Töne und Klänge – unauffindbar im Gespräch, aber geeignet zum Anschauen und Staunen, zum Hinterdreinsummen und Nachblicken. Dadurch setzen sie, wie Leopold notiert, alles in Bewegung; sie kehren die Konventionen um, denn sie sind der Mittelpunkt, nicht mehr nur der Hof, obwohl sie ihm zutragen. »Alles gerieth in Erstaunen! Gott giebt uns die Gnade, daß wir, Gott Lob, gesund sind, und aller Orten bewundert werden.« (I,89) So deutet es der Vater, und das ist in doppeltem Sinn notiert: pragmatisch, denn Gesundheit ist Geld, dankbar, denn die Gnade kann nur von dem kommen, der das Geheimnis der Auftritte zuläßt. Die Musik reicht also durchaus bis zu dem, der die Ursache der Zufriedenheit zu sein scheint. Sie entlockt ein Staunen, sie wirkt wie eine Offenbarung, sie entwickelt ein Transzendieren, über die Sphäre des Hofes und am Ende auch über die sichtbare Welt hinaus. Alle sagen es ja, »göttlich!«, eine Einmaligkeit, das Besondere. Dieses Transzendieren muß gereicht haben, damit auch der Knabe etwas davon hatte. Es mag ihn gefreut, befriedigt haben, und es mag ihm den später verhängnisvollen Irrtum eingeredet haben, man brauche nur zu spielen (was für ihn heißt: Spaß treiben, Freude machen, jenen unaufhörlichen Kreislauf gegenseitiger Affektion in Bewegung setzen), man brauche sich nur in diesen abberufenen Stunden zu erhöhen, um leben zu können.
Denn in der Tat lebte die Familie ja von diesen Kunststücken. Die Musik aber und die Kunst, die Instrumente zu beherrschen, könnten dem jungen Mozart vorgegaukelt haben, man brauche es mit der Welt nicht ernst zu nehmen, wenn diese nur ihren Spaß an der Musik habe. Jedenfalls begegnete diese Welt dem Knaben mit Freundlichkeit, mit Bewunderung, mit angedichteter Verehrung, freilich nur, solange er spielte. Er interessierte sprachlos, nur mit der Gewalt der Musik ausgestattet, während der Vater die Sprachen des Hofes und die Sprachen der Macht studierte.
Paradoxität des Empfindens: Wolfgang interessierte, wenn er spielte, und gerade in diesen Stunden, in denen er gefordert wurde und zur Verfügung stand, entspannte er sich, entspannte sich das Gefühl, nur hin- und hergerissen zu werden. Ein Zwiespalt, der sich daraus ergab, daß er gerade dort, wo er am meisten geordert, bestellt, beengt wurde, daß er gerade dort und dann am ehesten er selbst war? Ein Zwiespalt vielleicht – aber mit Sicherheit hat er es noch nicht so empfunden, eher vielleicht als Gelegenheit, ganz ins Musikalische zu geraten, in die Sprache der Musik, um das »Leben«, die Stunden dazwischen, zu den weniger bedeutsamen zu rechnen, aus denen man erst einen Spaß herauszaubern und herausinszenieren mußte. Vielleicht auch die allmählich stärker werdende Empfindung, diese Stunden »dazwischen« seien höchstens noch als Kopien zu ertragen. Kopien wovon? – Davon weiß der junge Mozart noch nichts, und um so deutlicher strafen seine späteren Briefe die Unwissenheit, an die der sonst im Menschenverständnis so geübte Vater ebenfalls nicht dachte, bis er klarer sah, zu einer Zeit, als diese Entdeckung ihm einen Schleier von den Augen riß, alles aber schon zu spät war.
Vorläufig hält auch Leopold die Auftritte des Sohnes für unbegreiflich. Darin weiß er sich mit anderen Beobachtern einig: »und ich habe noch niemanden gehört, der nicht sagt, daß es unbegreiflich seye.« (I,52) Also, vorerst: Mozart, das Wunder! In Mozarts kindlicher Gestalt erhält die Musik einen besonderen Rang, in seinem Transzendieren stellt sie sich als ein solches Wunder vor. Nicht daß die Gestalt nur ihr Werkzeug wäre. Im Gegenteil: erst Mozart bringt die Musik zum Leben, erst in seiner Aktion werden Publikum und Musikant eins in einem Medium, das keiner begreift und von dem doch die begeisterten Rufe und Bravostürme handeln. Die Musik – was ist das, was hat sie aus einem gemacht?
Denn Mozart ist Musik, nicht nur ihr Diener, ihr Geschöpf. Auf ihn projizieren die Zuhörer das Erlebnis der magischen Annäherung. Mozarts Spiel ist so sehr eins mit dem Medium, in dem er allmählich (für den Vater kaum sichtbar) lebt, daß er beginnt, seine Umgebung durch die Optik des musikalischen Vergnügens zu betrachten. Auch die Welt um ihn soll sich in seine Späße finden, sie soll Freude werden für ihn, und erst in diesem Wunsch mag sich seine Hoffnung ausgesprochen haben, die Stunden »dazwischen« könnten etwas von ihrer Langeweile verlieren.
»Bewundrungswerthes Kind!« – so beginnen die Huldigungsgedichte, wie etwa das eines gewissen Pufendorf, das sein Virtuosenlob in die Nähe des Herrscherlobs rückt. Mehr können sie nicht sagen, die Zuhörer und Bewunderer, mehr weiß auch Leopold noch nicht. Was kann man mit solchen Zeilen machen? Sie genauer studieren, versuchen, dahinter zu schauen? Das am wenigsten! Leopold will, daß man Gebrauch von diesen Gedichten macht, man soll sie abschreiben und herumzeigen. Ihm schlagen die Verse sofort in mögliche Wirkungen und Effekte um. Sie könnten weitere Erfolge einläuten! Um eine Vizekapellmeisterstelle in Salzburg bemüht, begreift Leopold ein Gedicht als Hebel, alte Vorbehalte zu lockern, neue Bande zu flechten. Er weiß nie, was dabei herauskommt, es ist nicht abzuwägen, aber man muß derartige Steine in den Fluß werfen, damit sich an den Ufern etwas tut. Diese Unwägbarkeiten machen seinem Übersichtssinn heftig zu schaffen. Er will alles auf den Punkt hin berechnen und konzentrieren, und er sieht mit jedem Schritt, daß nichts sich in dieser Form berechnen läßt. Daraus zieht er einen einzigen Schluß: man muß Signale setzen, unaufhörlich. Aber im stillen graut es ihm vor allem Ungefähren. Salzburg und Wien? – Er darf sie nicht zusammen-, er darf sie nicht gegeneinanderhalten, es käme nichts als Verwirrung heraus, und Verwirrung ist ihm das Unangenehmste. Also lieber: stille, stille – stille, stille – stille, stille!
Auch andere Beobachter kommen nicht hinter das Geheimnis des Kindes. So erscheint in dem »Augsburger Intelligenz-Zettel« vom 19. Mai 1763 eine längere Nachricht über die beiden Kinder, die Ratlosigkeit zugibt. Man deckt die Tastatur mit einem Schnupftuch zu – und Mozart spielt. Man setzt ihn in ein anderes Zimmer – und Mozart nennt die Töne, die man ihm vorspielt. Er hört eine Glocke, eine Uhr, eine Sackuhr – und wieder nennt er den Ton. Man spielt ihm eine Oberstimme vor – und er accompagniert auf der Stelle. Mozart scheint keine Übung zu brauchen, er findet nicht den Weg zur Musik, er lebt in ihr, sie ist das Element, in dem er sich bewegt und mit dem er sich verständigt. Die Töne sind die Namen seiner ersten Sprache. So kann Leopold später nur erstaunt berichten, daß er dem Kind das Pedalspiel an der Orgel erklärt und Wolfgang ohne weitere Übung sofort mit dem Spiel begonnen habe. Die Musik hat ihm das Recht gegeben, sie zu besitzen. So fragt der Berichterstatter im Intelligenzblättchen, als er die Nachricht erhält, der Knabe beherrsche nicht nur den Violinschlüssel, sondern auch den Sopran-, den Baßschlüssel: »Muß er diss also seit dem Neuenjahre gelernet haben?« (Dok 23) Nein, wir beobachten Mozart nicht (wie der Berichterstatter) als Lernenden. Er übersetzt nicht Anweisungen in Übungen, er ist nicht einmal außerhalb der Musik. Wenn man ihm etwas erklärt, ist es nur so, als sagte man ihm, was er schon immer gewußt hat. Ohne Verzögerung übt er es aus. Mozart lernt nicht, er herrscht.
So skizziert ihn ein Ölbild aus dem Jahr 1763. Neben einem Klavier, im Galakleid, das der Wiener Hof ihm geschenkt hat und das eigentlich für den Prinzen Maximilian bestimmt war. Mit Hut und Degen, der junge Herrscher – nicht über das Volk, sondern über das Instrument. Breite Goldborten, das Tuch in lila.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!