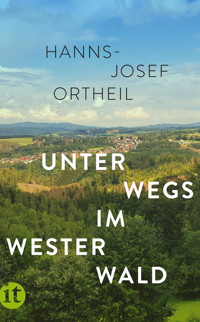2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Luft voller Aromen, ein Duft von Orangen, Zitronen und Kräutern.
Benjamin Merz, Ethnologe und jüngstes Kind einer Familie mit fünf Söhnen, überwindet seine Hemmungen und entwickelt ungewohnte Fähigkeiten darin, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Während einer Forschungsreise auf Sizilien beginnen die Frauen des Städtchens Mandlica diese Fähigkeit zu entdecken und zu schätzen. Nach dem Roman »Die große Liebe« und »Die Erfindung des Lebens« hat Hanns-Josef Ortheil einen weiteren hellen und lichten Roman über das Leben im Süden Italiens und die Nähe, die dieser magische Raum zwischen Menschen ermöglicht, geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Isole che ho abitatoVerdi su mari immobili.
Inseln, die ich bewohnt habe, grün über reglosen Meeren.
I
Der Morgen
Ma forse qualcuno risponde?Aber antwortet jemand?
1
AN EINEM sonnigen Aprilmorgen komme ich mit dem Flugzeug in Catania an. Wie schon so oft bin ich der letzte Fluggast, der das Flugzeug verlässt. Ich habe beim Anflug auf die Stadt in der Ferne den Ätna entdeckt, und das Bild des breit hingelagerten Vulkans mit seinen deutlich erkennbaren Rauchspuren und dem kegelförmigen Schneegipfel fesselt mich so, dass ich ihn von meinem Fensterplatz aus fotografiere. Zwei Stewardessen sind schließlich bei mir und bitten mich, das Flugzeug zu verlassen, sie sind freundlich und höflich, aber ich merke ihnen an, dass sie über meine Langsamkeit leicht verstimmt sind.
Ich nicke nur, obwohl mir die Frage auf der Zunge liegt, warum denn eine solche Eile geboten ist. Schließlich ist jedem Fluggast doch klar, dass man in einer scheußlichen Wartehalle lange auf die Koffer und das Gepäck warten wird. Warum kann ich dann aber nicht noch einen kleinen Moment im Flugzeug verweilen und die Schönheit des Ätna bewundern, anstatt ein rotierendes Laufband anzustarren?
Das sind einfache Fragen, die vielleicht sogar zu jenen seltenen Fragen gehören, über die man länger nachdenken könnte. Ich stelle diese Fragen jedoch nicht, ich habe Hemmungen. Auch als ich mein Handgepäck geordnet und den Weg zum Ausgang gefunden habe, frage ich nicht nach, obwohl mir lauter Fragen zu dem Thema, was die beiden Stewardessen mit dem weiteren Tag anstellen werden, auf der Zunge liegen: Zurück nach Deutschland fliegen? In Catania übernachten? Dort irgendwo (aber wo und vor allem mit wem?) einen schönen Abend verbringen?
Ich mag Stewardessen, ich sehe in ihnen weniger attraktive als mütterliche Gestalten, die den still und steif dasitzenden Fluggästen etwas Nahrung in die geöffneten Vogelmünder träufeln und stopfen, ich sehe sie als große, langbeinige Vögel, die sich über die Vogelnester zu beiden Seiten des schmalen Laufstegs hermachen und sie laufend beäugen. Gerne wäre ich mit einer von ihnen einmal einen Abend zusammen und würde sie alles fragen, was ich mir in meinen Flugjahren an Fragen für sie notiert habe. Doch leider – ich schweige, meine Hemmungen sind zu stark, und so nicke ich nur blöde auf ihren Abschiedsgruß hin und greife schweigend nach einer der sizilianischen Begrüßungsorangen, die sie den Fluggästen beim Verlassen des Flugzeugs in einem Korb hinhalten.
Als ich die Orange zu fassen bekomme, bemerke ich sofort, dass sie aus Marzipan ist, ich habe zu stark zugegriffen und dadurch das Marzipan etwas gedrückt und gequetscht. Und so lege ich die aus der Form geratene Süßigkeit wieder in den Korb zurück und nicke den beiden etwas angewidert dreinblickenden Stewardessen erneut zu. Es ist eine Szene wie in einem Loriot-Sketch, sie werden dich jetzt für einen Verrückten halten, der Loriot-Sketche im richtigen Leben nachspielt, denke ich noch und werde bei diesem Gedanken so verlegen, dass ich, um meine Verlegenheit wegzulächeln, laut Arrivederci! sage. Auf Wiedersehen!, antworten die beiden Stewardessen da beinahe unisono, und die dezidiert deutschsprachige Antwort macht mich noch unsicherer, so dass ich zum dritten Mal nicke und dann mit meinem verzerrten Lächeln die Gangway hinabtrotte.
An den Fingern meiner rechten Hand klebt aber noch etwas Marzipan, ich versuche, es unauffällig am Geländer abzustreifen, da sehe ich, dass mir eine der beiden Stewardessen hinterherläuft und mir eine Serviette reicht. Wir stehen dicht nebeneinander auf einer mittleren Stufe der Gangway und sorgen uns gemeinsam um meine verklebten Finger, es muss ein seltsames, irritierendes Bild sein, jedenfalls starren uns die anderen Fluggäste aus dem Innern des wartenden Busses so entsetzt an, als wäre gerade ein großes Unglück passiert. Um der Sache ein Ende zu machen, nehme ich die Serviette in die rechte Hand und schlinge sie dann geschickt wie einen Verband um meine Finger, die Stewardess schaut mir etwas besorgt hinterher, doch ich schaffe es dann wirklich, den Boden Siziliens ohne weitere Komplikationen zu betreten.
Jetzt erst spüre ich die angenehme Wärme, die weiche Frühlingswärme Siziliens, dichte, niemals schwüle, sondern vom Meerwind gesiebt wirkende Luft, eine Luft voller Aromen, ein Duft von Orangen, Zitronen und Kräutern. Ich kenne diesen Geruch schon von meinen früheren Aufenthalten her, doch ich bin sofort wieder überrascht und gebannt. Kein mir bekanntes Land verströmt einen solchen Duft, er ist einzigartig, und er erinnert mich an die Bilder der südlich des Ätna gelegenen großen Orangenhaine, in denen ich einmal eine Nacht im Freien verbracht habe, um den Düften der Früchte ganz nahe zu sein. Ich bleibe also stehen und atme diese herrliche Luft ein, als die auf der Gangway stehende Stewardess mir erneut hinterherkommt. Anscheinend nimmt sie an, dass es mir nicht gut geht oder dass sonst irgendetwas mit mir nicht stimmt, jedenfalls fragt sie mich genau das: ob es mir nicht gut gehe und ob sie mir helfen könne. Da weiß ich sofort, dass es mir nun aus dem Stand heraus gelingen wird, endlich eine Frage zu platzieren, es ist eine richtige Erlösung, denn schließlich habe ich schon die ganze Zeit etwas fragen wollen und es doch nicht geschafft. Riechen Sie auch diese herrliche Luft? frage ich also und bin etwas stolz auf diese sich direkt aus der Situation ergebende Frage.
Es kommt jedoch nicht zu einer Antwort, denn die Stewardess wendet sich sofort, als machte ich nur einen Scherz, von mir ab und trippelt die Gangway so auffallend schnell wieder nach oben, als wollte sie mir ihre Verstimmung nun deutlich zeigen. Ich schaue ihr nach, als der Busfahrer hupt, und so betrete ich mit einer nicht beantworteten Frage den Bus, wo ich meine Frage gleich der nächstbesten Mitreisenden erneut stelle: Riechen Sie auch diese herrliche Luft? Anstatt auf diese Frage einzugehen und sie endlich mit einer Antwort zu würdigen, antwortet die Mitreisende aber nur Haben Sie sich die Finger verbrannt oder was?, was mich sofort wieder schweigen lässt, worauf die Mitreisende sagt: Sie sollten die Finger mit Wasser kühlen. Was soll ich? Wovon ist denn überhaupt die Rede? Ich presse die Finger in der Serviette zusammen und verstumme, ich muss schlucken, es geht mir nun wirklich nicht gut, meine gut platzierte Frage wird von aller Welt ignoriert, was mir zeigt, dass diese Frage eben doch nicht so gut platziert ist, wie ich gedacht habe. Der Bus fährt los, ich lasse meine rechte Hand sinken und die Serviette zwischen den dicht gedrängt stehenden Mitreisenden auf den Boden fallen. Dann aber trete ich unauffällig darauf und zerstampfe sie mit beiden Füßen, bis ich sie – weiter vollkommen unauffällig und heimlich – in kleinste Teile zerrupft und vernichtet habe.
Im Innern des Flughafengebäudes stehen wir dann alle, genau wie ich befürchtet habe, um das unsäglich langsam rotierende Laufband herum und warten auf unsere Koffer und das Gepäck. Ich setze mich an den Rand der weiträumigen Halle, hole meinen Notizblock hervor und notiere: Riechen Sie auch diese herrliche Luft? – Ja, Sie haben recht, jetzt rieche ich sie auch. – Orangen? Zitronen? Was meinen Sie? – Ja, Orangen, Zitronen und vielleicht etwas Minze oder Melisse, jedenfalls etwas Grünes, Kühles.
In guten Dialogen reiht sich ganz selbstverständlich und weiterführend Frage an Frage, und die Antworten fordern immer neue Fragen heraus und verwandeln sich selbst wieder in Fragen. Das Fragen und Antworten ist in guten Dialogen eine Lust und ein Fest, doch man muss von dieser Kunst etwas verstehen, um sie als Lust und Fest zu erleben. Ich glaube davon viel zu verstehen, ich bin eine Art Fachmann für diese Kunst, und es ist mir gelungen, daraus sogar meinen Beruf zu machen.
Von Beruf bin ich nämlich Ethnologe, ich befrage Menschen fremder Kulturen und ziehe aus diesen Fragen meine Schlüsse. Nun bin ich auf Sizilien gelandet, um einer solchen Forschungsarbeit nachzugehen. Ich werde ein paar Monate auf der Insel bleiben, um nichts anderes zu tun, als Fragen zu stellen und Antworten in Fragen zu verwandeln. Wenn das gelingt, beginnt eine vorher noch weitgehend stumme oder verschwiegene Menschengegend mit einem Mal zu reden. So etwas ist wie ein Zauber. Alte und junge Menschen, Menschen jeder Herkunft und jedes Geschlechts, antworten und fragen selbst etwas und sprechen und reden und beginnen vielleicht sogar zu erzählen. Einige Male ist mir das bereits ansatzweise gelungen, ja, es ist mir gelungen, das Schweigen in Reden zu verwandeln, und ich habe Bücher über die Erzählungen aus der Fremde geschrieben, erfolgreiche und nicht nur von meinen Fachkollegen, sondern weit über eine so begrenzte Leserschaft hinaus gelesene Bücher.
Die Stadt der Dolci soll mein nächstes Buch heißen, ich habe diesen Titel im Kopf, halte ihn aber noch geheim. Der Titel spielt auf den sizilianischen Ort an, in dem ich meine Forschungsarbeiten durchführen will. Es ist ein Ort, der in der Welt der Süßigkeiten und Desserts, für die es im Italienischen den schönen, klingenden Namen Dolci gibt, sehr bekannt und berühmt ist. Fast alle Familien dieses Ortes sind nämlich in irgendeiner Weise mit der Herstellung solcher Dolci beschäftigt, mit Schokolade und Marzipan, mit Eis und Gebäck, mit Kuchen, Bonbons und dunkelfarbigem Fruchtsirup, den man über zerstoßenes Eis gießt. Um gute Fragen zu stellen, habe ich über diese geheim gehaltenen Künste viel gelesen, doch geht es mir nicht in erster Linie darum, über diese von Generation zu Generation vererbten Geheimnisse mehr zu erfahren. Mein eigentliches Ziel ist es vielmehr, die Einwohner dieses Ortes so zum Sprechen zu bringen, dass ich von den noch tiefer liegenden Geheimnissen des Ortes etwas erfahre. Diese Geheimnisse betreffen das innerste Leben und Fühlen der Menschen und die Art und Weise, wie sie auf den Tiefenschichten dieser Geheimnisse ihr Leben und ihre Welt eingerichtet haben. Stufe für Stufe will ich fragend bis zu diesen Schichten hin vordringen, und beginnen werde ich diese Tiefenbohrungen mit ein paar wenigen, sehr einfachen Fragen: Leben Sie gerne hier? Wo halten Sie sich am liebsten auf? Warum hier, im kleineren Café auf der Piazza – und nicht drüben, im größeren?
2
ALS ICH meinen Koffer und das weitere Gepäck endlich von den Laufbändern gefischt habe, gehe ich damit nach draußen, vor das Flughafengebäude, wo bereits eine Unmenge von Taxen und Bussen auf die Fluggäste wartet. Ich bleibe stehen und genieße die Wärme, nirgendwo in Europa ist es jetzt, im April, so angenehm warm, und nirgendwo blüht jetzt bereits so wie hier das ganze Land, bunt und farbensatt, als hätte ein leicht überdrehter Maler in der Tradition eines Spätexpressionismus die Farben mit einem breiten Pinsel auf eine erdockerfarbene Leinwand aufgetragen.
Einige Taxifahrer wollen mich in ihren Wagen locken, sie kommen zu mir und fragen mich nach meinem Ziel und machen einladende Bewegungen. Ich mag dieses Fragen, ich mag es schon aus beruflichen Gründen, denn es ist meist sehr interessant, wie und mit welchem Vokabular Menschen etwas fragen – aber ich bin vom Flug und seinen Begleiterscheinungen noch so befangen, dass ich nur stumm den Kopf schüttele. Nach einer Weile schiebe ich den kleinen Wagen mit meinem Gepäck hinüber zu den Mietwagenzentralen, wo sich bereits lange Schlangen von Wartenden gebildet haben. Am Ende einer dieser Schlangen stelle ich mich an und höre zu, wie die meist deutschen Reisenden rekapitulieren, was sie die Angestellten der Mietwagenbüros gleich fragen werden. Viele befürchten, auf irgendeine Weise betrogen zu werden, deshalb gehen sie noch einmal rasch die Verträge durch, die sie bereits in Deutschland per Internet geschlossen haben: Autofabrikat, PS-Zahl, Kilometerstand, Zustand des Wagens, Reifen- und Ölkontrolle, auf alles wollen sie achten.
Als ich selbst an der Reihe bin, lege ich ebenfalls den Vertrag vor, den ich bereits in Deutschland geschlossen habe. Der Angestellte schaut mich kurz an und beginnt auf Englisch zu sprechen, ich sage ihm aber sofort, dass er Italienisch mit mir sprechen könne. Er schaut mich etwas länger an und lächelt, dann stellt er, wie ich erwartet habe, erst gar keine Fragen und liest mir nur knapp und prägnant die Daten meines Wagens vor, der draußen auf dem Parkplatz auf mich wartet: Autofabrikat, PS-Zahl, Kilometerstand.
Das Italienisch-Sprechen erweist sich in diesem Fall sofort als eine Basis für ein Vertrauensverhältnis, es gibt nichts mehr zu fragen oder zu antworten, wir sind beide sozusagen auf ein und derselben Ebene oder auf Augenhöhe. Außerdem erleichtert es unser Gespräch, dass ich nicht wie die meisten anderen deutschen Reisenden ein Fabrikat aus Deutschland (VW, Opel, Mercedes), sondern dezidiert einen Fiat für meine Fahrten durch Sizilien bestellt habe. Sie haben einen Fiat bestellt, sagt der Angestellte und nickt, und ich sehe ihm an, dass ich mich seiner italienischen Seele mit dieser Bestellung noch mehr genähert habe.
Natürlich kann er nicht ahnen, dass mich keineswegs eine besondere Liebe zu italienischen Automarken zu dieser Bestellung veranlasst hat, sondern vielmehr ein bestimmtes Gesetz meines Berufes als Ethnologe, das mir vorschreibt, mich während meiner Forschungen den Gegebenheiten der Fremde ganz und gar anzupassen. Die kurze Formel für dieses Gesetz lautet Teilnehmende Beobachtung, und sie besagt, dass ein forschender Ethnologe sich den Sitten und Gebräuchen der Untersuchungsregion beinahe bis zur Aufgabe seiner eigenen Identität hin anpassen soll. Konkret bedeutet das, dass man sich als Ethnologe in Sizilien mit einem italienischen Wagen fortbewegen, möglichst gut Italienisch sprechen, sich ausschließlich von italienischer Küche ernähren und in erster Linie mit Sizilianern oder zumindest Italienern verkehren soll. Ein Ethnologe auf Forschungsreise unterscheidet sich durch solche Vorgaben sehr von einem Touristen. Er besucht die Fremde nicht kurz und beobachtet nicht nur oberflächlich ein paar kulturelle Highlights an den Wegrändern, sondern er hält sich vielmehr für längere Zeit an ein und demselben Ort auf, um möglichst tief in das Leben der Einheimischen einzutauchen.
Unter uns Ethnologen gehören die Debatten, ob ein solches Eintauchen in die Fremde überhaupt möglich ist oder ob auch der Ethnologe trotz aller Bemühungen letztlich doch immer ein Fremder bleibt, zu den beliebtesten Themen. Ich will diese Debatten hier keineswegs im Einzelnen aufgreifen, möchte aber doch erwähnen, dass es einigen meiner deswegen zu großer Berühmtheit gelangten Kollegen durchaus gelungen ist, so mit der Fremde und ihren jeweils eigenen Lebensverhältnissen eins zu werden, dass sie am Ende ihrer Forschungen beinahe schon für Einheimische gehalten wurden. Einige dieser Kollegen sind nach derartigen Erfolgen konsequenterweise auch gar nicht mehr aus der Fremde nach Hause zurückgekehrt, sondern haben ihr Leben ausschließlich in der Fremde weitergeführt. Das führt gar nicht selten zu der letzten Konsequenz, dass sie nämlich ihren Beruf aufgeben und in der Fremde einer anderen Tätigkeit nachgehen. Die meisten von ihnen heiraten außerdem und gründen Familien, die sich später durch besonders zahlreichen Nachwuchs auszeichnen, als wären viele Kinder der letzte und triumphale Beweis dafür, dass es ihnen gelungen ist, mit der Fremde ganz und gar zu verschmelzen.
Teilnehmende Beobachtung gibt es also in verschiedenen Graden. Die meisten Kollegen mischen sich, so gut es eben geht, unter die Einheimischen und versuchen, deren Lebenstempi und Lebensgewohnheiten anzunehmen. Manche scheitern dabei und ziehen sich rasch wieder in ihre heimatlichen Basisländer zurück, andere haben mäßigen Erfolg und kommen mit ein paar meist stark frisierten Forschungsergebnissen nach Hause. Die großen Meister unseres Faches aber tauchen so tief in das fremde Leben ein, dass sie am Ende von Einheimischen kaum noch zu unterscheiden sind.
Draußen auf dem Parkplatz drückt mir der Angestellte der Mietwagenfirma die Autoschlüssel in die Hand und überreicht mir betont lässig die Papiere. Ich sehe, wie die anderen deutschen Reisenden, die doch lange vor mir an der Reihe gewesen waren, noch immer damit beschäftigt sind, ihre Mietwagen zu begutachten und zu umkreisen. Als der Angestellte zu mir nur knapp Sie wissen ja Bescheid, das ist Ihr Wagen sagt, öffne ich sofort das Heck meines Fiat, verstaue mit ein paar wenigen Handgriffen mein Gepäck, setze mich an das Steuer, lasse das Fenster auf meiner Seite herunter, winke kurz und fahre auf der Stelle los.
Sie wissen ja Bescheid, das hört sich für mich nicht nur gut, sondern geradezu euphorisierend an. Es ist eine Formulierung, die mir bestätigt, dass ich nicht für einen Touristen, sondern für einen Reisenden gehalten werde, der den Einheimischen nahe ist. Eine erste Hürde auf dem Weg zur Teilnehmenden Beobachtung habe ich so bereits souverän genommen. Ich fahre in einem Fiat Richtung Süden, und ich brauche weder eine Landkarte noch andere Hilfsmittel, um mein Ziel, den kleinen Ort Mandlica an der südlichen Küste der Insel, problemlos zu erreichen.
3
EIN WENIG kenne ich Mandlica schon, denn ich war in den letzten Jahren schon zweimal jeweils eine Woche dort. Ich habe es als neugieriger Tourist besucht, um vor Ort zu erleben, ob die Herstellung der verschiedensten Dolci die Stadt wirklich zu jenem Süßspeisen-Paradies gemacht hat, von dem in beinahe jedem Reiseführer in den höchsten Lobestönen die Rede ist. Dann aber hat mich neben der tatsächlich verschwenderischen und hinreißenden Art, wie der Ort seine Dolci in angeblich genau fünfzig Cafés und unzähligen Pasticcerien präsentiert, vor allem die besondere geographische Lage der Stadt angezogen.
Mandlica besteht nämlich aus einer Unter-, einer Mittel-und einer Oberstadt und erhebt sich in diesen drei sehr unterschiedlichen Zonen von der Meeresküste bis hinauf zur Hügelregion, die auf ihrer obersten Kuppe von einem mächtigen Kastell gekrönt wird. In der Oberstadt leben die meisten Einwohner. In kleinen, steil hinauf bis zur Höhe hin ansteigenden, sehr schmalen und labyrinthisch angelegten Gassen, in denen man sich fast nur zu Fuß bewegt und sich als Fremder leicht verirrt, haben sie ihr Zuhause. In der Mittelstadt führt die breite Hauptstraße mit ihren Läden, Cafés, Pasticcerien und Restaurants um die große Piazza mit dem barocken Dom herum und bildet so das eigentliche Zentrum, während die Unterstadt aus einer Hafenregion mit kleinen Hotels und bis in die tiefe Nacht frequentierten Fischlokalen besteht.
Eine ähnlich vielfältige und interessante Topographie gibt es in Sizilien nur selten. In Mandlica kann man in der Stille der Oberstadt wohnen, sich im lebhaften Trubel der Mittelstadt tagsüber mit den Einheimischen unterhalten und in der Hafenstadt den Abend und die Nacht bei gutem Essen und noch besserem sizilianischen Wein ausklingen lassen. Genau diese Art Leben habe ich während meiner beiden ersten Aufenthalte auch zu führen versucht, bin damals allerdings noch an meiner Unfähigkeit, Kontakte zu knüpfen, gescheitert. So kam ich über ein einsames Leben in der Oberstadt, einsame Spaziergänge ohne Begegnungen mit den Einheimischen in der Mittelstadt und einsame Nächte am Meer in überfüllten Fischlokalen der Unterstadt, unterhalten lediglich von ein paar Zeitungen und Büchern, nicht hinaus.
Wenn ich nicht als Ethnologe im Einsatz und dadurch geradezu gezwungen bin, mich mit den Menschen meiner Umgebung zu unterhalten, verharre ich nämlich leider Gottes nicht selten in einem mir selbst verhassten Einzelgängertum, dessen ruhige Zurückhaltung ich in solchen Daseinsmomenten mir selbst gegenüber fälschlicherweise als einen besonderen Genuss deklariere und preise. Ich mache mir dann nur zu gerne vor, dass ein allein eingenommenes Abendessen mir besser gefällt und erheblich mehr zusagt als ein verschwatztes und mit zehn unruhigen und meist sehr abgelenkten Personen geteiltes. Und ich sitze kurz vor Mitternacht nicht selten, scheinbar übertrieben glücklich summend, am letzten noch besetzten Tisch des Lokals und tue so, als hätte ich in der Begleitung meiner Bücher und Zeitungen einen fantastischen, unterhaltsamen Abend erlebt.
Bin ich aber mit meinen ethnologischen Studien beschäftigt, so sind die Unterhaltungen mit den Einheimischen, die mir sonst sehr schwerfallen und fast immer eine Last für mich sind, gut vorbereitet. Ich habe mir die Fragen, die ich stellen werde, genau überlegt, und ich gerate mit jeder Frage und jeder auch nur halbwegs interessanten Antwort weiter in Form und in Schwung. Unangenehm ist es nur, wenn ich in solchen Situationen dann selbst etwas gefragt werde. Eine solche Gegenfrage verstößt gegen die Regeln des ethnologischen Forschungsgesprächs und sorgt dann meist für ein peinliches Schweigen von meiner Seite oder sogar für den gänzlichen Abbruch des Gesprächs. Ich gerate ins Schwitzen, denn ich möchte keineswegs als Privatmensch, sondern ausschließlich als Forscher betrachtet und auch behandelt werden.
Als Forscher frage und erkundige ich mich leidenschaftlich, als ginge es um mein Leben. Mein eigenes Leben dagegen darf nicht zum Thema werden, denn es soll höchstens für mich, nicht aber für die Befragten von Interesse sein. So jedenfalls schreibt es der ethnologische Kodex vor, der ausdrücklich festlegt, dass ein guter und zurückhaltender Ethnologe sich selbst unbedingt aus dem Spiel des Fragens und Antwortens herauszunehmen hat. Sein Leben und Dasein ist nicht von Belang, um der exakten Forschung willen ist er lediglich Übersetzer, Verstärker und Interpret all der Texte, die ihm von außen angeboten werden.
Während der Anfahrt auf Mandlica erinnere ich mich an meine verpatzten ersten beiden Aufenthalte, summe aber dennoch leise vor mich hin, als sei ich sicher, wegen meiner diesmal monatelangen, intensiven Vorbereitungen auf die Gespräche in dieser Stadt erheblich mehr Erfolg zu haben. Als ich von der Küstenstraße abbiege und schließlich auf Mandlica zufahre, gerate ich sogar in eine regelrecht euphorische Stimmung. Ich habe eine CD mit den Canti della Sicilia der großen sizilianischen Sängerin Rosa Balistreri eingelegt, ich lasse alle Fenster meines durchgeschüttelten Fiats herunter und höre zu, wie Rosas raues und tiefes Schluchzen sich wie eine majestätische Tonflut nach außen, in die schon leicht verbrannte Graslandschaft, ergießt.
An der nächsten Kreuzung will ich dem Hinweisschild Mandlica folgen und die restlichen drei Kilometer bis hinauf zur Oberstadt besonders langsam fahren, als ich das Handy klingeln höre. Ohne auf das Display zu schauen, weiß ich, dass mein ältester Bruder mich anruft. Ich könnte hohe Wetten darauf abschließen, dass genau er es ist, der mich in diesem Moment meines euphorischen Abhebens stört und aus dem Glücksrhythmus der sizilianischen Lieder bringt. Ich lasse es eine Weile klingeln und fahre dann noch langsamer, um nun wirklich einen Blick auf das Display des Handys werfen zu können. Richtig, Georg, mein ältester Bruder, ruft an, und ich ahne auch bereits, was er von mir will.
Georg ist Anwalt und führt im Kölner Stadtteil Lindenthal eine große Kanzlei in einer beeindruckenden Villa, in der er mit seiner Familie auch wohnt. Neben Georg habe ich noch drei ältere Brüder, Martin, Josef und Andreas, die ebenfalls alle in Köln mit ihren Familien leben. Martin arbeitet als Arzt an den Universitätskliniken, Josef hat eine Apotheke und Andreas ist Studiendirektor für Griechisch und Latein an einem Kölner Gymnasium.
Alle vier sind erheblich älter als ich, eigentlich war meine Existenz wohl auch gar nicht mehr vorgesehen, dann aber kam ich doch noch acht Jahre nach dem vierten Sohn meiner Eltern als fünftes und letztes Kind auf die Welt. Meine Eltern nannten mich Benjamin, und ein echter Benjamin wurde dann auch aus mir. Während der Familienmahlzeiten saß ich zwischen Mutter und Vater und gab den schweigenden Nachkömmling, der den oft lauten Debatten am Tisch nicht folgen konnte. Meine vier älteren Brüder dagegen legten sich bei solchen Gelegenheiten ins Zeug, sie redeten und redeten, sie stritten und gaben den Ton an, während die Eltern sich auf einige Nachfragen oder ein knappes und manchmal ironisches Kommentieren der Tischgespräche beschränkten. Vor allem mein Vater war ein Meister der ironischen Bemerkung, die das Debattieren bei Tisch sogar dann und wann zum Erliegen brachte. Ich bemerkte oft, wie sehr auch ihm die Art meiner Brüder, sich in Szene zu setzen, auf die Nerven ging, doch er sagte niemals etwas offen und direkt gegen diese Unsitte, sondern unterlief das Gespräch höchstens auf feine, diskrete Art mit ein paar trockenen, ironischen Hinweisen und Sätzen.
Von Beruf war er Ingenieur, während meine Mutter als Bibliothekarin im Historischen Institut der Universität Köln arbeitete. Beide sind vor etwa einem Jahrzehnt kurz hintereinander gestorben und haben uns Brüdern das große Wohnhaus in Köln-Nippes hinterlassen, in dem wir – zusammen mit vielen Mietern, verteilt auf vier Stockwerke – unsere Kindheit verbracht haben. Es ist ein sehr schönes, noch zu Lebzeiten der Eltern renoviertes Haus, das an einem weiten, ovalen Platz mit hohen Pappeln und vielen Rosenbeeten liegt. Im ersten Stock dieses Hauses haben wir fünf Kinder mit den Eltern gewohnt, heute lebe ich als einziger Nachkomme noch immer in unserem Elternhaus.
Ich wohne sehr bescheiden unter dem Dach, in drei kleinen Zimmern mit schrägen Wänden, aber ich wohne genau dort, wo ich unbedingt wohnen möchte. Ich habe nie woanders als in diesem Haus gelebt, ich habe ihm und meiner Familie die Treue gehalten. Selbst während meines Studiums kam es für mich zu keinem Zeitpunkt in Frage, dieses Haus zu verlassen, damals habe ich die kleinen Zimmer unter dem Dach bezogen, und manchmal kam mein guter Vater die Treppen zu mir hinauf und setzte sich in meine Küche, um mit mir ein Kölsch zu trinken und sich nur mit mir allein zu unterhalten.
Natürlich zahle ich meinen Brüdern keine Miete, sie lassen mich mietfrei wohnen und unterstützen mich sogar mit der Hälfte der monatlichen Mieteinnahmen aus dem gesamten Haus, die meinen eigentlichen Lebensunterhalt bilden. Ich bin zwar Privatdozent an der Kölner Universität, erhalte aber kein nennenswertes Gehalt, so dass ich auf diese finanzielle Hilfe angewiesen bin.
Ich gebe zu, dass es mir peinlich ist, mich nicht selbständig ernähren und von einem gescheiten Gehalt leben zu können. Aber es ist mir – schon allein wegen meiner Scheu und meines extrem zurückhaltenden Wesens – nicht gelungen, in der Wissenschaft Karriere zu machen. Ich habe zwar mit der Bestnote summa cum laude promoviert und mich dann mit einer in Fachkreisen sehr anerkannten ethnologischen Studie über Kölner Mietverhältnisse in den fünfziger Jahren unter besonderer Berücksichtigung des Stadtteils Köln-Nippes habilitiert, danach aber keine Professoren-Stelle erhalten. Viermal wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch an eine andere Hochschule eingeladen, und viermal landete ich nur auf einem zweiten oder dritten Platz der üblichen Berufungslisten.
Ehrlich gesagt, war ich nach diesen gescheiterten Berufungsverfahren jedoch meist erleichtert, meine Heimatstadt Köln nicht verlassen zu müssen. Ich sagte das in dieser deutlichen Form aber weder meinen Eltern noch meinen Brüdern, sondern tat immer, als wäre ich tieftraurig über das Scheitern meiner Bemühungen, als ordentlicher Professor für Ethnologie zum Beispiel auf einem Lehrstuhl in Heidelberg zu landen. Selbstverständlich habe ich nichts gegen Heidelberg, ich mag diese Stadt und habe sie auch bereits mehrmals besucht. Bei dem Gedanken aber, in Heidelberg zu wohnen und vielleicht von einem schönen Wohnhaus in Hanglage auf den Neckar zu blicken, fühle ich mich nicht wohl. Die ganze Hanglage ballt sich gleichsam in meinem Magen zusammen und führt dort zu einer spiegelbildlichen Innenhanglage, ein leichter Schwindel überfällt mich, und es kann nichts anderes helfen als die rasche Rückfahrt nach Köln, wo ich in meiner Dachwohnung ein Fenster öffne und hinab auf den großen ovalen Platz mit seinen hohen Pappeln schaue.
Ich habe über diese seltsamen Verhaltensweisen nie mit einem Menschen gesprochen, ja, ich habe über sehr vieles, was in mir so vorgeht und mich sehr beschäftigt, nie gesprochen. Ich muss zugeben, dass mich diese Zurückhaltung und dieses Schweigen sehr bedrücken, andererseits möchte ich aber auch ausdrücklich betonen, dass ich kein unzufriedener oder nörglerischer Mensch bin. Im Grunde bin ich mit meiner Situation unter dem Dach meines Elternhauses nämlich zufrieden, manchmal bin ich dort sogar ausgesprochen glücklich, und wenn ich Zeit und eine Möglichkeit finde, meinen Studien dann sogar noch im Ausland nachzugehen, kann ich mich erst recht nicht beschweren.
Als irritierend empfinde ich es nur, dass ich gleichsam noch immer unter der Aufsicht und Kontrolle meiner Brüder lebe. Meine vier Brüder haben es nämlich geschafft, sie verdienen sehr gut bis ordentlich, sie haben Familie, und sie sind Vorsitzende von Vereinen und Organisationen, deren Zusammenkünfte ich nicht einmal aufsuchen würde. Dafür, dass sie mich finanziell unterstützen, verlangen sie von mir Rechenschaft über meine Arbeit und manchmal sogar ein Stück Unterhaltung.
Georg nennt mich einen frei schwebenden Geist und findet eine solche Klassifizierung auch noch komisch, und Josef kommt bei jeder kleinen Erkrankung bei mir vorbei, um mir eigenhändig die richtigen Medikamente zu bringen (deren Einnahme ich ihm dann noch telefonisch bestätigen muss). Im Grunde behandeln sie mich so, als wären sie an die Stelle meiner Eltern getreten und müssten weiter auf den Kleinen aufpassen, der im Leben nicht zurechtkommt. Das alles ärgert mich sehr, obwohl ich doch eigentlich anerkennen sollte, dass sie sich nur wohlmeinend um mich kümmern. Das Sich-Kümmern hat aber auch sehr unangenehme und beengende Seiten, von denen meine Brüder nicht einmal etwas ahnen. Manchmal kommt es mir so vor, als führten sie mich an ihren Leinen, und gar nicht so selten verfluche ich ihre scheinbare Hilfsbereitschaft und sehne mich danach, weit von ihnen entfernt in einem einsamen, dunklen Waldgelände in einer Blockhütte zu leben.
Ich habe noch nie in einer solchen Blockhütte gelebt, ich lebe, wie gesagt, in einer Drei-Zimmer-Wohnung unter dem Dach meines Elternhauses. Alle paar Tage bekomme ich von einem meiner Brüder einen Anruf, angeblich, damit der Kontakt mit mir nicht abreißt. Ich gehe darauf ein, ich bin höflich und freundlich, manchmal mache ich darüber sogar einen Scherz. Doch nicht selten überfällt mich nach einem derartigen Telefonat eine solche Wut, dass ich am liebsten laut aufschreien würde. Ich schreie aber niemals laut auf, sondern ich lege in solchen Momenten zum Beispiel die Canti della Sicilia von Rosa Balistreri auf.
Rosa und ich – wir verstehen uns. Rosa schreit heraus, was ich fühle, eine Zeitlang war Rosa Balistreri sogar einmal meine Braut.
4
ICH PARKE meinen Wagen am Straßenrand und warte, bis das Klingeln des Handys aufhört. In kaum fünf Minuten wird Georg erneut anrufen, in der Zwischenzeit trinke ich einen Schluck Mineralwasser. Plötzlich erinnere ich mich daran, dass einer der Brüder mir während unserer familiären Mahlzeiten oft Wasser nachgeschenkt hat, während die Brüder Cola, Fanta oder später sogar Kölsch trinken durften. Mir aber gönnte man nur Leitungswasser, das eigens für mich in einer gläsernen Karaffe an meinem Platz stand. Ich mochte dieses Wasser nicht, doch wenn meine Mutter mich aufforderte, es zu trinken, trank ich es, weil eine Weigerung meiner guten Mutter überhaupt nicht gefallen hätte. War mein Glas dann aber irgendwann leer, schenkte ich mir nicht nach. Als ein Zeichen meiner stummen, inneren Vorwürfe ließ ich es vielmehr leer stehen, bis einer meiner Brüder es mit einer pathetischen Geste und einem dummen Kommentar (Dat Wasser vun Kölle es jot … ) bis zum Rand erneut füllte …
Ich nehme einen Schluck San Pellegrino und schaue hinauf zur Oberstadt von Mandlica, die ich von meinem Parkplatz jetzt bereits sehe. Da klingelt das Handy ein zweites Mal.
– Benjamin?! ruft mein Bruder Georg.
– Ja, antworte ich, ich bin’s, es ist alles in Ordnung.
– Alles in Ordnung, Benjamin?!
– Ja natürlich, alles in Ordnung, Georg.
– Wo bist Du, Kleiner?
– Auf Sizilien, kurz vor Mandlica.
– Ist das Dein Forschungsnest, heißt es so?
– Ja, so heißt es.
– Kommst Du mit Deinem Mietwagen zurecht?
– Ja natürlich.
– Du fährst einen Mercedes?
– Nein, ich fahre einen Fiat.
– Wieso das denn? Bist Du verrückt?!
– Der Fiat gehört mit zum Forschungsprogramm.
– Soll das ein Witz sein?
– Nein, der Fiat steht im Dienst der Forschungen.
– Du forschst über Fiat?
– Nein, es ist komplizierter.
– Komplizierter! Natürlich, mein Kleiner, bei Dir ist es immer komplizierter als bei unsereinem.
– Ja, das stimmt.
– Kann ich was für Dich tun?
– Nein, es ist alles in Ordnung, mach Dir keine Sorgen.
– Ruf mich an, wenn ich etwas für Dich tun kann.
– Mache ich.
– Dann drücke ich Dir jetzt die Daumen für Deine Forschungen.
– Danke, ja, das ist nett von Dir.
– Und noch eins, mein Kleiner. Lass die Frauen in Ruhe, hörst Du?
– Wie bitte? Wovon redest Du denn? Wie kommst Du denn jetzt auf so ein Thema?
– Ich meine ja nur. Auf Sizilien sollte man die Frauen in Ruhe lassen, das weiß sogar ich, und ich bin kein Ethnologe. Die Männer haben dort ein sehr wachsames Auge auf die Frauen, und wenn dann so ein Fremder daherkommt und ihre Frauen beschnuppert, verpassen sie ihm eins, verstehst Du?
– Ich verstehe, was Du meinst. Ich bin aber kein Fremder.
– Bist Du nicht?
– Nein, ich werde schon bald kein Fremder mehr sein.
– Mein Gott, Kleiner, mach mir bloß keine Angst.
– Ich möchte Dir keine Angst machen, ich werde es Dir später einmal genauer erklären. Wir Ethnologen setzen alles daran, während unserer Forschungen nicht als Fremde aufzutreten.
– Lass die Frauen trotzdem in Ruhe! Versprichst Du es mir?
– Ich werde die Frauen in Ruhe lassen, das verspreche ich Dir.
– Bis bald, mein Kleiner.
– Bis bald, mein Dicker.
Ich beende das Gespräch rasch, bevor Georg noch etwas sagen kann. Am Ende unserer Telefongespräche bringe ich meist eine kleine Boshaftigkeit unter, an der er dann etwas zu knabbern hat. Ich sage mein Dicker oder mein Alter oder mein Großväterchen (Georg hat bereits zwei Enkel). Ich sehe ihn dann vor mir, wie er den Kopf über mich schüttelt und einmal tief durchatmet. Ich kann ihm so etwas nicht ersparen, ich brauche diese kleinen Spitzen, um mich zumindest noch etwas zu wehren und damit zu beweisen, dass ich nicht bereit bin, mich immer und ewig unterzuordnen.
Ich stelle die Canti della Sicilia von Rosa Balistreri wieder lauter und fahre dann in langsamen Kurven die steile Straße zur Oberstadt von Mandlica hinauf. Den großen Parkplatz ganz oben neben dem Kastell finde ich sofort. Ich parke und lasse all mein Gepäck bis auf eine Tasche mit den wichtigsten Wertsachen im Auto. Dann mache ich mich auf die Suche nach meiner Pension, die ich nach langen Recherchen als ersten, vorläufigen Aufenthalts-und Arbeitsort ausgewählt habe. Natürlich frage ich niemanden auf der Straße nach der Adresse, ich tue vielmehr so, als wüsste ich genau, wo ich mich gerade befinde.
Nach kaum zehn Minuten habe ich die Pension dann auch gefunden und betrete den kleinen Innenhof hinter dem großen, braunen Empfangstor, das ich schon von den Fotografien im Internet her kenne. Ich gehe zur Rezeption und drücke auf die kleine Klingel, die auf dem Rezeptionstisch befestigt ist.
Die Frau, die auf das Geräusch der Klingel hin erscheint, ist beinahe so groß wie ich. Sie ist blond und, wie ich schätze, etwa in meinem Alter. Sie schaut mich von oben bis unten an und lächelt, als amüsierte sie sich über irgendwelche Details meines Aussehens oder meiner Kleidung. Was gibt es denn zu lächeln? Ich trage ein weißes, offenes Hemd mit langen Armen und eine beige Leinenhose, dazu ein Paar hellblaue Schuhe aus Segeltuch, natürlich ohne Strümpfe. Ich würde sie gerne fragen, warum sie lächelt, doch es geht nicht, ich habe wieder meinen kleinen Anfall von Scheu und Zurückhaltung. Nicht einmal ein paar erste freundliche Worte bringe ich heraus, ich grüße nur kurz.
Die Blonde aber grüßt zurück und wechselt aus dem Italienischen dann sofort ins Deutsche. Ich bin so erstaunt, dass mir nur eine kleinlaute Erwiderung gelingt, das stört sie aber keineswegs, vielmehr erzählt sie sofort, dass sie seit beinahe fünfzehn Jahren in Mandlica lebe und aus dem tiefsten Bayern hierhergekommen sei. Ich sollte nun fragen, was sie aus dem tiefsten Bayern nach Mandlica verschlagen habe, doch ich bin einfach zu durcheinander. Zu keinem Zeitpunkt meiner Vorbereitungen auf diese Reise habe ich damit gerechnet, dass die Besitzerin dieser Pension eine Deutsche sein könnte. (Hat sie etwa einen Sizilianer geheiratet? Lebt sie deshalb hier? Und wenn ja – haben die beiden etwa auch Kinder?)
Ich stehe etwas hilflos da und halte die Tasche mit den wichtigsten Wertsachen in meiner Rechten. Die Blonde aber macht einfach weiter und beginnt ein kurzes Frage-und Antwort-Spiel.
– Wo haben Sie Ihren Wagen geparkt?
– Oben auf dem großen Parkplatz.
– Sehr gut, das ist der beste Platz zum Parken. Und Ihr Gepäck?
– Ist noch im Auto.
– Und Ihre Frau?
– Ich bin allein unterwegs.
– Sie sind nicht verheiratet?
– Ich bin allein unterwegs.
– Aber Sie haben doch ein Doppelzimmer gebucht, oder etwa nicht?
– Doch, ja, ich brauche Platz für meine Arbeit.
– Sie wollen hier arbeiten?
– Ja, das werde ich.
– Sind Sie ein Journalist?
– Nein, ich bin Ethnologe.
– Aha, Ethnologe.
Sie ist anscheinend nicht gerade begeistert von meinen knappen Antworten, das ist klar, aber ich kann ihr in diesen ersten Momenten unseres Kennenlernens nicht weiter entgegenkommen. Eine unerklärliche Befangenheit lässt mich in solchen Szenen immer kleinlauter werden, weil ich ein so zielstrebiges Fragen als ein Ausfragen empfinde. Während eines solchen Ausfragens habe ich nicht die geringste Chance, etwas zurückzufragen, so dass das Gespräch nicht ebenbürtig verläuft. Stattdessen gebe ich in solchen Gesprächen lauter matte und meist hirnlose Antworten und gebe dabei auch noch oft etwas Persönliches von mir preis, was ich eigentlich gar nicht preisgeben möchte.
So ist etwa die Frage, ob ich verheiratet bin, eine Frage, die ich nicht gerne beantworte. Manchmal habe ich sie bereits mit ja, in anderen Fällen aber auch mit nein beantwortet. Diese Frage fällt dreist und direkt über mich her und lässt mich die merkwürdigsten Lebenskonstellationen erfinden: Ich bin verheiratet, lebe aber getrennt. Ich bin nicht mehr verheiratet, lebe aber noch mit meiner Frau zusammen. Ich bin nicht verheiratet, war aber einmal verheiratet. Einige Stunden nach solchen Auskünften habe ich dann oft vergessen, was ich auf die Frage nach meinem Verheiratetsein kurz zuvor noch geantwortet habe. Kommt das Gespräch dann aber zufällig wieder auf das Thema Heirat, gerät alles durcheinander, es sei denn, es gelingt mir, von diesem Thema abzulenken und zu einem anderen zu wechseln.
Die blonde Besitzerin der Pension führt mich dann eine schmale Wendeltreppe hinauf, die vom schattigen Innenhof in den obersten Stock führt. Sie öffnet eine Zimmertür und zeigt mir mein Zimmer, sie macht einen Rundgang mit mir durch den hellen und freundlich erscheinenden Raum, durch dessen Fenster man auf die Dächer der Oberstadt blickt. Dann schaut sie mich an, sie wartet darauf, dass ich endlich etwas sage. Ich räuspere mich und tue ihr endlich den Gefallen.
– Das Zimmer gefällt mir.
– Oh, das freut mich.
– Noch ein wenig mehr Platz wäre allerdings nicht schlecht.
– Noch mehr Platz? Das Zimmer ist beinahe zwanzig Quadratmeter groß.
– Ja, es ist in Ordnung und für den Normalfall auch groß genug.
– Sie sind kein Normalfall?
– Nein, ich bin nicht der Normalfall eines Touristen, ich bin hier als Ethnologe, und ich werde viel zu tun haben.
– Gut, wenn das so ist, müssen wir uns etwas anderes ausdenken.
Sie verlässt das Zimmer und geht wieder hinaus auf den Flur, dort schließt sie eine andere Tür auf. Ein zweiter Rundgang folgt, und diesmal verläuft er durch zwei große Zimmer, zu denen noch eine kleine Küche und ein Bad gehören.
– Hier wohnen sonst keine Pensionsgäste, sagt die Blonde.
– Hier wohnen wohl die Verwandten aus Bayern, wenn sie mal vorbeikommen, antworte ich.
– Stimmt. Aber woher wissen Sie das?
– Ich bin Ethnologe, ich habe für so was ein Gespür.
– Ist ja interessant.
– Ja, das ist interessant. Aber ich will mich nicht damit hervortun, es beruht auf viel Übung und Menschenkenntnis. Gute Ethnologen haben meist etwas Menschenkenntnis.
– Und Sie sind ein guter Ethnologe?
– Vielleicht, es wird sich noch herausstellen.
Sie schaut mich wieder so an, als überlegte sie sich gerade ein paar Fragen zu meiner Person, dann aber erklärt sie nur, dass ich die kleine Wohnung bekommen könne, ohne Aufpreis, für den Preis des Doppelzimmers, das ich reserviert habe. Ich wage nicht zu fragen, warum sie so großzügig ist, stattdessen gehe ich mit ihr wieder hinunter in den Innenhof, wo ich ihr meine Papiere aushändige.
Als wir an der Rezeption stehen, kommt eine zweite, schwarzhaarige Frau an uns vorbei. Sie grüßt kurz und verschwindet dann hinter einem Vorhang.
– Das ist meine ältere Schwester, sagt die Blonde.
Ich antworte nichts, ich nicke, immer wenn ich sehr überrascht, verlegen oder durcheinander bin, nicke ich blöde und stumpf, als wäre bereits alles gesagt. Dabei schießen mir die Fragen und Antworten längst wie Pfeile durch den Kopf. Auf dem Weg zurück zu meinem Wagen rasen sie sogar so rasch durch mein Hirn, dass ich mich auf einen Mauervorsprung setzen muss, um sie gleich zu notieren: Sind Sie zusammen mit Ihrer Schwester nach Sizilien gekommen? – Ja, wir sind zusammen hierher gereist, als junge Mädchen, die auf Sizilien etwas erleben wollten. – Und dann haben Sie beide hier geheiratet? – Nein, nur ich habe geheiratet, meine Schwester aber nicht, meine Schwester hat hier eine tiefe Enttäuschung erlebt. – Sie war verlobt, und der Verlobte hat sich davongemacht? – Sie glaubte, sie sei verlobt, aber der angebliche Verlobte hatte längst eine andere. – Und in Ihrem Fall hat es besser geklappt mit den Sizilianern? Sie haben einen treuen Mann gefunden? – Ich habe einen Mann gefunden, mehr sage ich nicht. – Aber Sie sind geblieben, hier auf Sizilien, Sie sind trotz aller Enttäuschungen geblieben! – Ja, wir sind geblieben, wir wohnen seit langem zusammen hier …
5
ES DAUERT einige Zeit, bis ich all mein Gepäck in die Zimmer der Pension gebracht habe. Ich beginne gleich damit, sämtliche Koffer und Taschen auszupacken, und ich richte mir die Zimmer so ein, wie es für meine Arbeit am sinnvollsten ist. Den Schreibtisch rücke ich vor das große Fenster, durch das man über die Dächer der Stadt hinweg bis zum Meer blickt, die beiden Schränke postiere ich dicht nebeneinander in der hintersten Ecke des Schlafzimmers, dann gehe ich in Küche und Bad und verstaue dort all die Utensilien, die ich für den reibungslosen Ablauf meiner Arbeit unbedingt brauche.
Zu ihnen gehören kleine Flaschen mit sizilianischem Fruchtsirup, die ich unterwegs, während der Anfahrt auf Mandlica, gekauft habe. Nirgendwo auf der Welt gibt es einen vergleichbaren Orangen- und Zitronensirup, bereits kleinste Mengen der bittersüßen Essenzen entfalten auf der Zunge einen derart intensiven Geschmack, dass man glaubt, die Zunge bade in einem Meer feinsten Öls aus hochreifen Früchten.
Zum Abschluss meines Auspackens setze ich mich in die Küche, schütte mir ein Glas Leitungswasser ein und gebe einen kleinen Schuss Zitronensirup hinzu. Ich nehme einen ersten Schluck, es ist ein Begrüßungsschluck, ich begrüße den Fruchtkörper Siziliens, ich nehme Kontakt auf zu seinen Aromen und Düften.
Beim Kosten erinnere ich mich plötzlich an meine Kölner Wohnung unter dem Dach meines Elternhauses. Ihre Küche ist beinahe genauso groß wie diese hier, und auch sonst gibt es starke Ähnlichkeiten zwischen den Kölner Zimmern und den Zimmern in dieser Pension. In Köln trinke ich das Leitungswasser immer mit einem Schluck Sirup von Früchten aus Leichlingen, ich hasse es, pures Wasser zu trinken, kein Getränk erscheint mir fader, reizloser und in seiner wichtigtuerischen Schlichtheit penetranter als Wasser. Wahrscheinlich kommt diese starke Abneigung daher, dass ich in der Kindheit immer mit diesem Getränk aufgezogen und abgespeist worden bin. Man hat die interessanteren Getränke den Brüdern gegönnt, mir aber nicht, noch als Oberschüler wurde ich mit Leitungswasser traktiert, während meine Brüder im Verlauf ihrer Schulorgien nächtelang die schärfsten Sachen in sich hineingekippt haben. Eine Zeitlang haben sie damit angegeben und immer neue Getränke aufgefahren, ich aber habe mich dieser stumpfen Trinkerei verweigert und nach den seltenen, feineren Trinkgenüssen gefahndet. Heimlich, ohne je davon zu erzählen, habe ich diese Genüsse erforscht, niemand, selbst die liebe Mutter nicht, hat etwas davon geahnt. Und so sitze ich hier, im südlichen Sizilien, als ein erfahrener Koster rarer Getränke, ich trinke das verdammte Wasser in unendlich verfeinerter Form, und ich habe das Gefühl, ein wenig von meinem vertrauten Zuhause in die Fremde Siziliens hinübergerettet zu haben.
Während ich langsam weiter an meinem Glas nippe, klopft es an der Tür, und ich höre an der sich halblaut meldenden Stimme sofort, dass es meine bayrische Wirtin ist. Ich öffne und lasse sie eintreten, sie hält einen Meldebogen in der rechten Hand, anscheinend hat sie ihn gerade eigenhändig ausgefüllt, anstatt die Daten aus meinen Papieren sofort in den Computer einzutragen. Mit Hilfe dieses Meldebogens sucht sie das Gespräch, das ahne ich sofort, und ich ahne auch, dass ich mich nun auf weitere Fragen zu meiner Person und den Umständen meines Aufenthalts einzustellen habe.
Zum Glück beginnt sie damit aber nicht, sondern bleibt beim Eintreten erstaunt stehen. Sie ist überrascht, wie
© 2012 Luchterhand Literaturverlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Alle Rechte vorbehalten.
eISBN 978-3-641-104733-3
www.randomhouse.de
Leseprobe